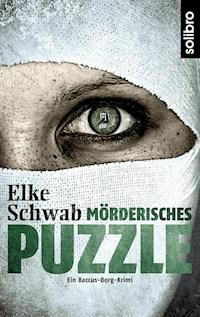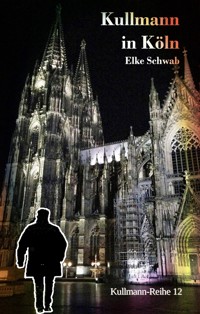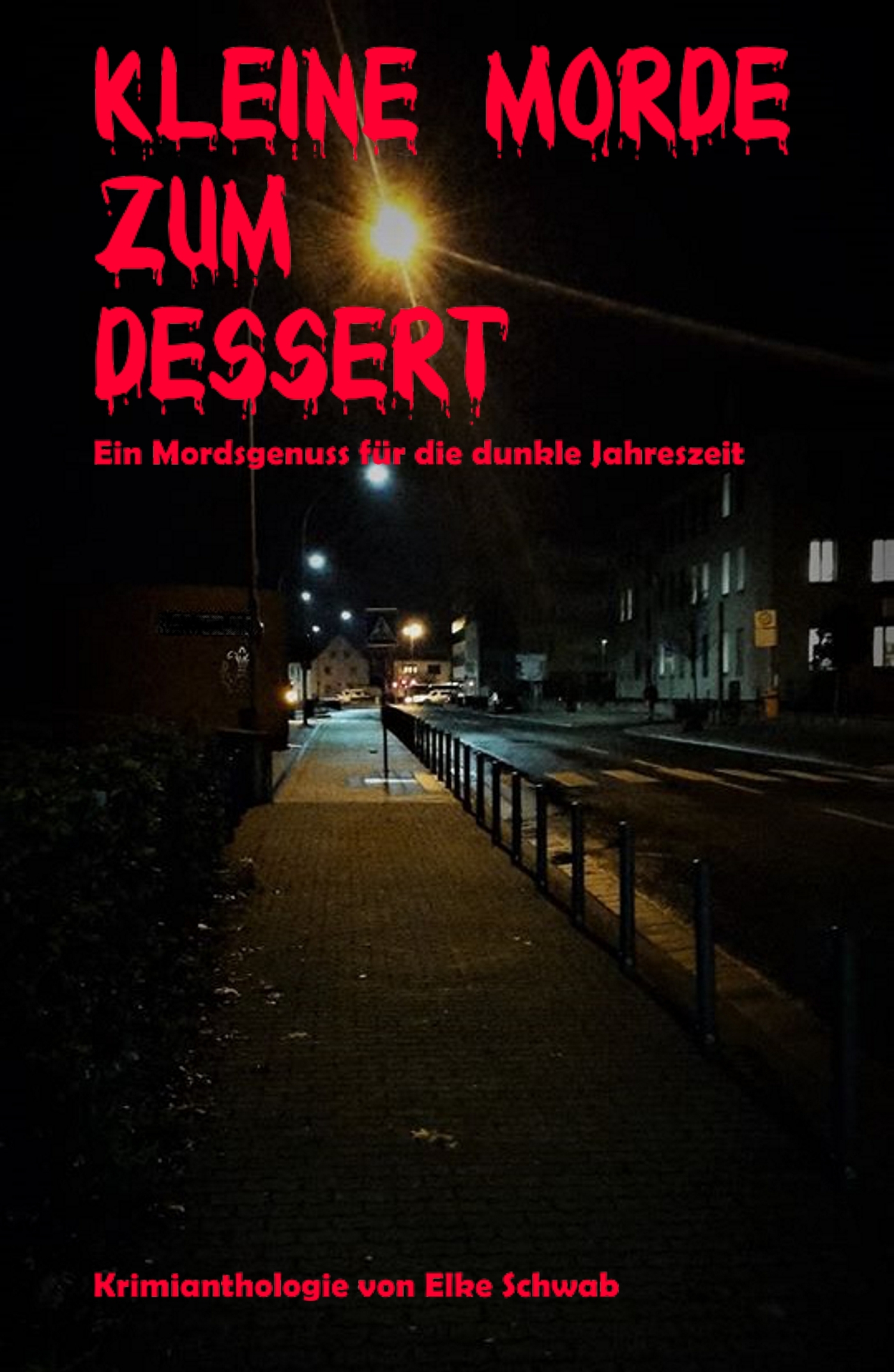4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hybrid Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Jenny, groß, blond und ständig abgebrannt, fliegt aus der Wohnung in Saarbrücken und zieht bei Oma Käthe in Saarlouis ein. Schon gleich nach der Ankunft geht sie mit Käpt'n Ahab, ihrem Hund, im Stadtpark Gassi und stößt unter einer Hecke auf eine Tasche voller Banknoten. Jenny nimmt das Geld mit, ohne nachzudenken - und ohne zu wissen, dass es sich um Lösegeld aus einer Entführung handelt. Damit macht sie merkwürdige Gestalten auf sich aufmerksam. Ebenso die Kriminalpolizei und einen Privatschnüffler, der unter anderen Umständen genau in ihr Beuteschema passen würde. Zu spät erkennt sie, wer auf welcher Seite steht und bringt sich und ihre Oma damit in Lebensgefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Pleiten, Geld und Geiseln
ISBN 978-3-96741-037-2
Hybrid Verlag
© by Hybrid Verlag,
Westring 1
66424 Homburg
www.hybridverlag.de
www.hybridverlagshop.de
1. Ebook-Auflage 2020
Autor: Elke Schwab
Umschlaggestaltung: © 2020 by Creativ Work Design
Lektorat: Matthias Schlicke
Korrektorat: Birgit van Troyen
Buchsatz: Sylvia Kaml
Autorenfoto: Manfred Rother
Coverbild ›Pleiten, Pech und Leichen‹
© by Creativ Work Design, Homburg
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Elke Schwab
Pleiten, Geld und Geiseln
Kriminalkomödie
Dieses Buch widme ich meiner Oma,
die im wirklichen Leben ein
echter Knaller war.
Inhaltsverzeichnis
15
212
320
434
544
655
763
878
989
10102
11114
12122
13129
14136
Danksagung144
Weitere Bücher der Autorin im Hybrid Verlag:145
DIE AUTORIN146
1
Hier stehe ich vor Omas Haus in Saarlouis – mit einem notdürftig gepackten Rucksack auf dem Rücken, meinem dreibeinigen Hund Ahab im Arm, den mit Habseligkeiten vollgestopften Leichenwagen vor dem Gartentörchen und tausend Mordfantasien gegen meine ehemalige Vermieterin im Kopf.
Käpt’n Ahab verhält sich erstaunlich ruhig. Er spürt, dass etwas im Busch ist und dass er mich gerade jetzt besser nicht nervt. Ich streichele ihm durch das struppige Fell, während ich darauf warte, dass meine Oma endlich auf mein Klingeln reagiert.
Dabei weiß ich nicht, wen ich mit den Streicheleinheiten mehr beruhige: den Hund oder mich?
Ich hatte immer gedacht, dass mich die völlig paranoide Vermieterin Silvia Probst irgendwann mal wegen Käpt’n Ahab aus der Wohnung wirft. Aber dass meine Haare der Auslöser sein könnten … darauf wäre ich nie gekommen.
Mein Versuch, Naturblond in Schwarz zu verwandeln, endete mit Giftgrün. Ich gebe zu, dass ich beim ersten Blick in den Spiegel selbst erschrocken war. Doch irgendwann gewöhnt man sich auch an diese Farbe. Außerdem wächst sie wieder raus. Also kein Grund, jemandem fristlos den Mietvertrag zu kündigen.
Doch bei Silvia Probst ist alles anders. Ihr Verfolgungswahn wird von Tag zu Tag schlimmer. Lange Zeit war ich für sie so etwas wie eine Stütze in ihrem Haus. In dieser Zeit konnte ich mir eine tolle Wohnung in einer belebten Straße in Saarbrücken leisten. Und das, obwohl ich wenig bis nichts verdiene.
Bis mir das Missgeschick mit den Haaren passiert ist …
Jetzt stehe ich vor Omas Häuschen in der Robert-Koch-Straße 32a in Saarlouis, bin frustriert und ratlos. Keine guten Aussichten. Oma ist meine einzige Verwandte – also liegt es nahe, dass ich zu ihr gehe. Doch jetzt öffnet sie nicht.
Während ich in Selbstmitleid versinke, höre ich Geräusche aus dem Innern des Hauses. Also ist sie da.
Jetzt klingele ich Sturm.
»Ja, ist ja schon gut«, höre ich sie murren. »Eine alte Frau ist kein D-Zug.«
Ihr Standardspruch, wenn sie keine Lust hat. Ich muss schmunzeln. Wenn sie einen guten Einfall hat – zum Beispiel, wie sie Geld auftreiben kann – dann sieht man nichts mehr von der sogenannten alten Frau. Dann ist sie flink wie ein Wiesel.
Geld ist ohnehin unser gemeinsamer Nenner – oder besser gesagt unser gemeinsames Defizit. Wir haben beide noch nicht herausgefunden, wie man wirklich zu Geld kommt. Aber Not macht bekanntlich erfinderisch. Genau da sind wir uns verdammt ähnlich. Neben irgendeiner Arbeit – meist als Hilfskraft, weil ich keine Berufsausbildung abgeschlossen habe – finde ich immer Möglichkeiten, mir etwas dazuzuverdienen. Und Oma bessert gelegentlich ihre klägliche Witwenrente auf.
Also was steht meiner Zukunft im Weg? Oma und ich finden für alles Lösungen – ob legal oder nicht, das interessiert uns dabei wenig.
Die Tür geht auf.
Da steht sie mit einem Handy am Ohr vor mir.
Ich muss lachen. Normalerweise stehen junge Leute so vor einem. Doch nicht eine Dame von 75 Jahren.
Oma Käthe ist halt ein Fall für die Wissenschaft. Bei dieser Frau blickt niemand durch. Nur ich ... manchmal … gelegentlich … ab und zu …
Ihre Haare stecken in Lockenwicklern. Ihre rundliche Gestalt in einer Kittelschürze, wie sie vor 50 Jahren vielleicht mal modern war. Aber der Eindruck täuscht. Ich ahne, dass sie darunter ein feines Kostüm trägt, das sie mit dieser Schürze einfach nur schützen will.
»Was hast du vor?«, frage ich anstelle einer Erklärung, warum ich mit Hund und Gepäck und voll beladenem Auto vor ihrer Haustür stehe.
Seit Kurt Frenzen – ihr sehr kurzzeitiger Lebensgefährte – verstorben ist, habe ich den Überblick über Käthes Leben verloren. Ich weiß nicht, was gerade ihr neuestes Geschäftsmodell ist. Es scheint offenbar zu funktionieren. Also ist Oma einen Schritt weiter als ich. Ich muss nämlich erst noch herausfinden, womit ich mir in Zukunft etwas Geld verdienen kann. Mein letzter Arbeitgeber hat mich fristlos gefeuert. Und von dem bisschen Arbeitslosengeld kann ich nicht leben.
Doch Oma Käthes Anblick sagt mir, dass es immer einen Ausweg gibt.
Ich heiße Jennifer Klein – von meinen Freunden Jenny genannt – bin mit meinen fünfunddreißig Jahren immer noch nicht erwachsen, meine ganze Verwandtschaft beschränkt sich auf Oma Käthe, was ich als gesegnetes Familienglück empfinde, und weiche dank meiner absonderlichen Lebensphilosophie keinem Unheil aus. Ich nehme es gar nicht wahr, ehe ich bis zum Hals in Schwierigkeiten stecke.
Bisher hatte ich nicht nur verdammt viel Glück im Unglück, ich bin auch schon über Leichen gestolpert. Meine Unverbesserlichkeit steht mir ständig selbst im Weg – dazuzulernen gehört nicht zu meinen Talenten.
An ernsten rechtlichen Folgen immer knapp vorbeigeschrammt, gehe ich davon aus, dass sich an meinem Leichtsinn in nächster Zeit auch nichts ändern wird. Vielleicht, weil ich das Leben am Rande der Legalität liebe. Oder den Nervenkitzel? Denn davon gibt es bisher genug – oder soll ich sagen: Davon bekomme ich nie genug?
Doch jetzt habe ich einen Punkt erreicht, der meinen Optimismus ins Wanken bringt. Der Rauswurf meiner Vermieterin aus der schnuckeligen Wohnung in Saarbrücken trifft mich härter als geahnt. Zu gut erinnere ich mich noch an die Zeit davor.
Nur meiner Freundin Anna Marquard, deren Familie ein Bestattungsinstitut betreibt, verdankte ich damals, dass ich nicht auf der Straße gelandet bin. Meine vorrübergehende Behausung bestand lediglich aus einem ausrangierten Leichenwagen. Nicht meine erste Wahl. Aber ein Dach über dem Kopf. Ein blechernes. Eine verdammt miese Zeit.
Das schreit nicht nach Wiederholung.
Also stehe ich vor meiner Oma in Saarlouis und bitte sie um Einlass. Nicht wirklich das, was ich mir von meinem Leben wünsche. Ein bisschen autark sein hätte mir schon gereicht. Auch ist Saarlouis nicht meine erste Wahl, denn Anna wohnt in Saarbrücken. Der Weg dorthin ist vielleicht nicht gerade weit, aber saublöd zu fahren. Ständig herrscht Stau auf der einzig möglichen Autobahn.
»Ich frage wohl besser dich, was du vorhast«, sagt Oma gerade und lässt das Handy in der Tasche ihrer Kittelschürze verschwinden.
Verdutzt schaue ich sie an.
Wovon redet sie da?
»Du stehst hier vor meiner Tür – mit deinem Flohpinscher im Arm – und fragst mich, was ich vorhabe«, erklärt Oma.
»Das ist kein Flohpinscher«, verteidige ich meinen Hund und erinnere mich wieder. Meine Gedanken laufen gerade Karussell. Da kann ich mir selbst nicht immer folgen.
»Doch, ist er.«
Meine Oma hasst Hunde – und Käpt’n Ahab ganz besonders. Darin sehe ich mein größtes Problem, wenn ich bei ihr unterkommen will. Aber da muss ich jetzt durch. Also vertiefe ich die Unterhaltung über meinen Hund lieber nicht weiter, sondern komme gleich zum Thema. »Silvia hat mich aus der Wohnung rausgeschmissen. Jetzt brauche ich eine Bleibe.«
»Das ist ja schrecklich. Setz den Hund bitte ab, damit ich dich drücken kann.«
Ich gehorche. Ahab knurrt. Dafür knuffe ich ihn leicht in die Seite, damit er einmal in seinem Leben im richtigen Augenblick die Klappe hält.
Der kleine, struppige Dreibeiner versteht.
Oma und ich fallen uns in die Arme. Sie drückt mich an ihren weichen Körper, ein Gefühl, das ich schon von Kind an liebe und von dem ich nicht genug bekommen kann.
»Diese Silvia tickt sowieso nicht richtig«, lautet Omas Kommentar.
Erleichtert darüber, dass meine Oma mich so herzlich empfängt, betrete ich das Haus, das sie erst vor kurzem komplett hat umbauen lassen. Alles altengerecht – extra für Kurt Frenzen, der kurz nach seinem Einzug plötzlich verstorben ist.
Geradeaus führt der Weg direkt ins Wohnzimmer, in dem jetzt Zwischenwände fehlen, was alles geräumiger erscheinen lässt. Eine antike Drehorgel dient als Raumteiler zur Küche, die überwiegend in Weiß gehalten ist.
»Wo dein Zimmer ist, weißt du bestimmt noch«, meint Oma. »Daran habe ich nichts verändert – als hätte ich geahnt, dass du bald wieder nach Hause kommst.«
Ich fühle mich tatsächlich willkommen. Das ist schön. Damit nimmt mir meine Oma die Angst, nicht mehr zu wissen, wo ich hingehöre. Doch ich komme noch nicht dazu, mich in meinem Kinderzimmer einzurichten. Käpt’n Ahab erobert mit seinen drei Beinen das Haus im Sturm. Dabei stößt er gegen die Drehorgel, deren hölzernes Wägelchen ins Rollen gerät.
Der Leierkasten prallt gegen die Küchenzeile und gibt einen entsetzlich lauten Ton von sich. Ahab jault vor Schreck noch lauter als dieses alte Ding und Oma kreischt hinter mir: »Aber der Hund kommt ins Tierheim.«
»Kommt er nicht. Er bleibt bei mir.«
»Ich kann mich nicht um diesen Flohpinscher kümmern. Er macht mir hier alles dreckig und kaputt.« Oma stellt die Drehorgel an ihren gewohnten Platz zurück und drückt solange auf verschiedene Knöpfe, bis sie verstummt.
»Ahab ist ein sauberer Hund. Und kaputt macht er auch nichts«, stelle ich mürrisch klar. Ein Pfeifen bleibt hartnäckig in meinen Ohren zurück.
»In Saarbrücken hattest du eine Hundeklappe, durch die er immer rein- und rauskonnte. Wie soll er hier in den Garten gelangen, wenn er mal muss?«
»Dann sagt er mir oder dir Bescheid und wir lassen ihn raus«, antworte ich.
»Oder er pinkelt auf meine teuren Sachen.«
»Auf deine Drehorgel pinkelt er schon nicht mehr. Vor diesem lauten Ton hat er sich so erschrocken, dass er das niemals mehr vergessen wird«, meine ich schlau. »Wo hast du das Ding überhaupt her?«
Oma wirkt gequält. Mit einem Murren auf den Lippen antwortet sie: »Das war Kurts Macke. Er liebte Drehorgeln. Sein Vater hat früher in Berlin damit sein Geld verdient.«
»Wo bekommt man sowas heute noch her?«
»Hat Kurt im Internet bestellt. War sauteuer – trotz Ebay! Soll von einem Orgelbauer aus Berlin sein.«
Plötzlich reißt Oma die Augen weit auf, stürmt auf die Küchenzeile zu und stößt einen derart lauten Schrei aus, dass ich in die nächste Schockstarre gerate.
Ich ahne, dass Ahab schon wieder was angestellt hat.
»Das war mein Mittagessen!«
Jetzt wird es eng für Ahab und mich.
Der Dreibeiner hat es tatsächlich geschafft, auf die marmorierte Küchenanrichte zu springen und sich an dem Auflauf zu bedienen, der dort steht, fix und fertig für den Backofen vorbereitet. Ich packe ihn und stelle ihn auf den Boden zurück. Aber zu spät. Das Mittagessen ist ruiniert.
»Am besten gehst du jetzt mit deinem Flohpinscher raus und spazierst ein bisschen mit ihm«, schlägt Oma mit hochrotem Gesicht vor. »Ich richte dir inzwischen dein Zimmer her. Wenn du zurückkommst, lädst du mich zum Essen ein. So viel Entschädigung muss sein.«
»Dann gehe ich jetzt am besten eine Bank überfallen, denn ich bin gerade nicht flüssig«, murre ich.
»Mir egal, wie du es machst. Ich muss mittags was Warmes essen.«
»So wie deine Inneneinrichtung aussieht, bist du irgendwie zu Geld gekommen«, entgegne ich und lasse meine Blicke weiter durch die hellen, offenen Räume wandern. Weiße Möbel mit schwarzen Elementen zieren den Raum. In der Ecke, die wohl das Esszimmer sein soll, steht ein schwarzer Tisch umrundet von Chromstühlen mit weißen Lederüberzügen. Das sieht nicht nur klasse, sondern auch teuer aus. Ein Sideboard in kolonialem Stil aus dunklem Massivholz mit Metallapplikationen an der Front und aufwändigen Schnitzereien bildet einen angenehmen Kontrast zu den modernen Möbeln. Darauf steht eine auffallend schöne Schatulle – könnte Barock sein. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus.
Eine Schale voller Chips ziert den modernen Tisch.
Bei dem Anblick spüre ich selbst großen Hunger aufkommen. Mein Magen knurrt schon. Ich greife danach und stopfe mehrere gleichzeitig in den Mund. Erst dann merke ich, dass diese Dinger steinhart sind. Um ein Haar hätte ich mir die Zähne daran ausgebissen. Erschrocken spucke ich alles wieder aus.
»Wenn die schmecken würden, wäre die Schale schon lange leer, Kindchen«, merkt Oma dazu an.
Mit Ahab an der Leine gehe ich an der Wallerfanger Straße entlang, passiere einen kleinen Autohändler, der nur äußerst fragwürdige Rostlauben zum Verkauf anbietet. ›Ivan Horvat‹ steht auf einem großen Schild und dazu die Ansage, dass es hier was für Bastler gibt. Ein Mann mit schwarzen Haaren, hagerem Gesicht und Pockennarben kommt aus einem kleinen Verschlag, der wohl das Büro sein soll. Sein unfreundlicher Gesichtsausdruck gibt mir das Gefühl, schleunigst weiterzugehen. Das tue ich, weil Ahab zu meinem Entsetzen anfängt zu knurren. Eigentlich hatte ich mir irgendwann mal geschworen, den kleinen Unhold nie wieder an der Leine Gassi zu führen. Aber hier gibt es keine andere Möglichkeit. Also besteht jetzt und hier meine Hauptaufgabe darin, größeres Übel durch den kleinen Kerl zu vermeiden.
Und das Beste daraus zu machen.
Ich biege in die Vaubanstraße ein.
Von hier sind es nur noch wenige Meter und ich tauche in ein Meer aus Grün ein. Der Weg führt am Altarm der Saar entlang, dann über die kleine Vauban-Insel, auf der Ahab an jeder Ecke etwas zum Schnüffeln findet. Es macht Laune, hier zu spazieren. Die Freude meines Hundes überträgt sich auf mich.
Verkehrslärm dringt bis hierher. Ich versuche ihn auszublenden, doch genau in dem Moment knallt es laut. Ein Auspuff? Ich überhöre die lästigen Geräusche einfach, richte meine Aufmerksamkeit auf die Schönheit dieses Fleckchens. Das fällt mir zum Glück nicht schwer.
Mein Blick schweift über den Saaraltarm, der gesäumt wird von den Bastionen aus der Zeit Ludwigs des Vierzehnten. Festungsbaumeister Vauban, dessen Baustil große Teile von Saarlouis beherrscht, hat auch diese Mauern erbaut.
Der Saarlouiser Inselgarten prangt inmitten der kleinen Insel. Die ursprünglichen Katakomben werden heute für Veranstaltungen aller Art genutzt, wie ich an den Plakaten erkennen kann.
Wirklich schön hier. Ich habe wohl vergessen, was diese kleine Stadt alles zu bieten hat.
Nicht mehr weit und ich gelange ans Ende der Insel. Dort überquere ich eine kleine Brücke und schon lande ich im Saarlouiser Stadtpark.
Auch dort ist es schön. Die Vögel zwitschern in den Bäumen und Sträuchern um die Wette. Alles grünt und blüht, Insekten schwirren um die Hecken und erfüllen die Luft mit ihrem Summen. Ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr hier war. Eigentlich schade, denn hier gibt es noch verdammt viel Natur – so viel, wie ich schon ewig nicht mehr an einem Platz gesehen habe. Doch vermute ich mal, dass mich genau das nicht wirklich weiterbringen kann. Wenn ich eine Lösung für mein derzeitiges Problem – besser gesagt meine Probleme – finden will, muss ich in die Stadt.
In der Natur kann ich kein Geld verdienen.
Aber abschalten.
Käpt’n Ahab wirkt immer noch ausgelassen. Ihm gefällt hier alles. Er schnuppert überall, zieht mich von rechts nach links in einem Tempo, dass mir schwindelig wird und bellt jeden anderen Hund an, der es wagt, hier ebenfalls zu spazieren.
Ich lasse ihn gewähren. Viel zu sehr bin ich damit beschäftigt, mich mit meiner neuen Lebenssituation abzufinden. Oma und ich werden klarkommen – das steht außer Frage. Doch ist damit nicht des Rätsels Lösung gefunden. Die Lösung, wie ich zu Geld kommen soll, um mir wieder ein eigenständiges Leben aufzubauen.
Mein Hirn fängt an zu rauchen, so viele Ideen sammeln sich an, die ich schnell wieder verwerfe.
Bei Oma Käthe sieht alles nach Erfolg aus. Die Einrichtung der Küche allein hat mich schon in Staunen versetzt. Gleich werde ich den Rest des Hauses bewundern können. Kurt Frenzen hat ihr nicht nur menschlich gutgetan, sondern auch finanziell. Aber der gute Mann ist seit einigen Wochen tot. Also muss es etwas anderes geben, womit sie diesen hohen Lebensstandard halten kann. Und ich werde herausfinden, was. Vielleicht kann ich ja bei ihr einsteigen.
Meine Güte. Wie tief bin ich gesunken? Solche Gedanken wären mir vor kurzem noch nicht gekommen, als ich mir mit ›An- und Verkauf‹ bei Ebay etwas nebenbei dazuverdienen konnte.
Doch das ist jetzt Geschichte.
Aber … wenn ich es mir genau überlege, war dieses Geschäftsmodell auch nicht das Gelbe vom Ei. Der Ärger, der daraus entstanden ist, steckt mir heute noch in den Knochen. Besser gesagt in den Haaren. Daraus resultieren im weitesten Sinne meine grünen Haare und somit auch der Rausschmiss aus der Saarbrücker Wohnung.
Also muss ich ab sofort nach vorne schauen, mich nach neuen Chancen umsehen. Wie singt Marius Müller-Westernhagen so schön: »Geld findet man bekanntlich im Dreck und Straßen sind aus Dreck gebaut.«
Mit neuem Mut marschiere ich weiter.
Während Käpt’n Ahab von einer Entdeckung zur nächsten wuselt, spüre ich, wie meine Wut auf meine Vermieterin langsam verfliegt. Sagt meine Oma nicht auch immer »Nichts ist so schlecht, dass es nicht auch für etwas gut sein kann«?
Wer weiß?
Vielleicht entdecke ich Saarlouis für mich ganz neu. Immerhin bin ich hier aufgewachsen.
Gerade passiere ich einen ausgehöhlten Baum.
Ups, weg ist Ahab.
Sofort ziehe ich ihn da raus.
Vor uns zeigt sich ein kleines Gebäude, das übervoll mit Graffiti besprüht ist. Dazu noch mit Plakaten beklebt, die in dem bunten Wirrwarr fast nicht zu erkennen sind.
Das sieht für mich nach einem Stromhäuschen aus. Ich erinnere mich, dass es hier mal einen Campingplatz gab. Vermutlich gibt es ihn noch und das bunte Steingebilde gehört dazu. Ich gehe weiter.
Ein Platschen dringt an mein Ohr. Wasser? Wo?
Suchend setzen wir unseren Weg fort. Ich entdecke das Schild ›Betreten der Eisfläche verboten‹, bevor ich Wasser sehe. Ich muss lachen. Es ist Sommer – bestimmt 30 Grad im Schatten. Da empfinde ich dieses Schild als äußerst unpassend.
Vor mir in einiger Entfernung sehe ich einen Mann mit Rucksack und kurzen Hosen am Ufer stehen. Er schaut auf das Wasser. Als ich mich nähere, wirft er mir einen Blick zu, dreht sich um und eilt davon.
Das soll mir recht sein.
Ich genieße das Alleinsein mit meinem Hund, was in diesem Park nur bedingt möglich ist.
Wir umrunden den kleinen Teich und kehren langsam wieder zurück in Richtung Vauban-Insel. Ich nähere mich der Stelle, an der sich vor vielen Jahren mal ein kleines Freibad befand. Es war direkt an einen alten Wall angebaut. Oberhalb steht das ›Gymnasium Am Stadtgarten‹, das hoch über den Stadtpark ragt. In diesem Schwimmbad war ich oft an heißen Sommertagen. Schade, dass es geschlossen wurde. Gerade dieser Sommer verspricht, verdammt heiß zu werden. Da würde ich mich bestimmt gerne wieder dort tummeln. Von Omas Häuschen aus ist es nicht weit bis hierher.
Heute entdecke ich an dieser Stelle lediglich eine Absperrung, die niemanden aufhalten kann, und einen kleinen Tümpel, in den Ahab am liebsten hineinspringen würde. Zum Glück behalte ich ihn an der Leine. Er hat niemals gelernt, auf mein Kommando zu hören. Also muss er auf Freilauf verzichten. Das Risiko, den kleinen Drei- beiner zu verlieren, ist viel zu groß.
Ahab kam aus dem Nichts in mein Leben – besser gesagt unter mein Auto. Seitdem habe ich ihn ins Herz geschlossen. Vielleicht spielte seine Verletzung dabei eine wichtige Rolle. Denn beim Rückwärtsfahren habe ich ihn nicht gesehen, dafür gehört. Aber da war es schon zu spät. Der Tierarzt hat sein rechtes Vorderbein nicht mehr retten können.
Das tut dem struppigen Kerlchen allerdings keinen Abbruch. Er rennt mindestens genauso schnell wie jeder vierbeinige Hund. Gerade jetzt zerrt er mich auf eine große Hecke zu. Ich kenne mich mit dem Grünzeug nicht aus – ich ahne nur, dass er sich dort Zecken einfangen kann. Also ziehe ich ihn weg. Aber damit ist für Ahab das Problem noch lange nicht gelöst. Er stößt Töne aus, als ginge es um sein Leben, wenn er nicht sofort in diese Hecke kriechen darf.
Die Blicke, die mich von den wenigen Passanten vor Ort treffen, reichen mir, um Ahabs Wunsch nachzugeben. Schwups verschwindet er.
Dieser Hund ist wirklich anstrengend.
Ein junges Pärchen, das vor lauter Schmusen kaum vom Fleck kommt, verschwindet zum Glück gerade um die nächste Ecke. Ein älterer Mann, der mit einem Handy Fotos macht, lässt sich besonders viel Zeit, meinen Standpunkt zu passieren.
Aber ich harre aus, bis auch der weg ist.
Urplötzlich taucht eine korpulente Frau auf und wirft mir provokante Blicke zu. Was soll das? Ahabs Jaulen klingt bis zum Schotterweg. Ich tue so, als sei das ganz normal.
Diese Frau macht mich nervös. Lässig spielt sie an ihren langen, blonden Haaren, ohne mich dabei aus den Augen zu lassen. Als es mir zu bunt wird, sage ich: »Mein Hund kackt. Ich denke, da hat er ein bisschen Privatsphäre verdient.«
Daraufhin beschleunigt sie endlich ihre Schritte – aber nicht, ohne mir einen bösen Blick zuzuwerfen. Dann verschwindet sie aus meinem Blickfeld.
Ich warte trotzdem noch ein Weilchen.
Bei dem, was ich gerade zu tun gedenke, brauche ich keine Zeugen. Ahab kommt nämlich immer noch nicht von allein aus dieser vermaledeiten Hecke heraus. Seine Töne klingen immer absonderlicher. An der Leine ziehen will ich nicht, sonst breche ich ihm das Genick. Ich muss ihm also in das Gestrüpp folgen.
Ich schaue mich um: Niemand da.
Auf allen vieren tauche ich hinein in das undurchschaubare Gewirr aus Grünzeug. Das wird mühsamer als gedacht. Dünne Äste wischen durch mein Gesicht und pieken mich an allen möglichen Stellen.
Mich schaudert’s. Was da wohl alles krabbelt?
Ganz so naturverbunden fühle ich mich plötzlich nicht mehr. Prompt wünsche ich mich in meine Saarbrücker Stadtwohnung zurück. Dort musste ich nicht mit Ahab Gassi gehen. Dort hatte er eine Katzenklappe, durch die er nach Herzenslust in den Garten laufen konnte.
Endlich komme ich dem Frechdachs näher. Ihn interessiert dabei wenig, welche Mühe es mich kostet, ihm zu folgen. Er beschnuppert und beschlabbert etwas auf dem Boden, das total spannend sein muss.
Dieses Etwas sieht braun und undefinierbar aus.
Hoffentlich kein totes Tier.
Ich muss jetzt schon würgen, ohne zu wissen, was er da gefunden hat. Aber ich beherrsche mich und krieche weiter.
Dann erkenne ich etwas.
Es ist absolut nichts Ekeliges, sondern vielmehr etwas hochgradig Verdächtiges. Etwas, das ganz bestimmt nicht hierhergehört. Etwas, das diese große Begeisterung meines Hundes auf keinen Fall erklärt.
Was vor mir liegt, ist braun und nass. In der dunklen Hecke erkenne ich es nicht richtig. Außerdem verfängt sich gerade wieder ein Ast in meinem Shirt.
Ich strampele mich frei, ziehe den Hund weg und packe das Ding jetzt beherzt an, das Ahab so in Ekstase versetzt.
Ich glaube es nicht.
Es ist eine Tasche. Zu allem Überfluss eine schwere Tasche.
Ich ziehe sie zu mir heran. Sie besteht aus braunem Leder, das fleckig aussieht. Mühsam drehe ich sie um. Erst jetzt sehe ich die Schnallen, womit man sie öffnen kann. Mit einem leichten Klack, Klack gehen sie auf. Also kann die Tasche noch nicht lange hier liegen. Die Schlösser sind weder verdreckt noch eingerostet.
Vorsichtig hebe ich die Klappe an. Ich befürchte, dass ein Tier darin eingeschlossen sein könnte – ein weiteres Tier, das ich in meiner großherzigen Art und mit meinem ständig leeren Geldbeutel aufnehmen und durchfüttern werde.
Doch es kommt anders.
Ich bekomme ganz große Augen.
2
Ich sehe Geldscheine.
Nur Geldscheine.
Eine ganze Menge Geldscheine.
Verwirrt reibe ich über meine Augen und schaue wieder hin: Tatsächlich! Geldscheine.
Sie liegen komplett durcheinander. Die Tasche ist halbvoll. Vorsichtig fahre ich mit einer Hand hinein und rühre darin wie in einer Suppe.
Es sind ausnahmslos Geldscheine. Nichts anderes. Keine Papierschnipsel oder so. Alles echtes Geld.
Ich ziehe ein paar Scheine heraus. Es sind Fünfziger, Hunderter und Zweihunderter. Solche Scheine habe ich noch nie gesehen. Außerdem sehen sie benutzt aus, verknittert und schmutzig.
Ahab hechelt neben mir ganz aufgeregt. Fast hätte ich vergessen, wo ich mich befinde – nämlich versteckt in einer Hecke zusammen mit meinem Hund.
Was soll ich jetzt tun?
Das ist doch die Chance meines Lebens.
An der Seite der Tasche befindet sich ein Riemen. Den kann ich mir über die Schulter werfen. Dann sieht es so aus, als sei es meine Tasche.
Ein bisschen groß ist sie – und schmuddelig – und schwer. Ich reibe darüber und habe sofort etwas Braunes an meinen Fingern kleben.
Mist! Das brauche ich nicht.
Vorsichtig krieche ich aus der Hecke heraus. Nur mein Kopf ragt ins Freie. Ich schaue nach rechts und nach links: alles menschenleer.
Hurtig kraxle ich hinaus, schwinge die Tasche über die Schulter, wobei ich fast umfalle, nehme Ahab an die kurze Leine, damit er endlich aufhört, ständig seinen Fund anspringen zu wollen, und trete mit zügigen Schritten den Heimweg zu Omas Häuschen an.
Die Tasche wird von Schritt zu Schritt schwerer. Die Blicke der Menschen, die an mir vorbeigehen, machen mich nervös. Jeder starrt auf das schmutzige Lederbündel, das an meiner Schulter hängt, als könnten sie durch das Leder hindurchschauen.
Ahab hört einfach nicht auf zu bellen. Er bellt mein schweres Anhängsel an, als sei ein Ungeheuer darin versteckt. Damit habe ich keine Chance, unauffällig zu sein.
Nervös drehe ich mich um.
Eine Gestalt verschwindet hinter einer Mauerecke. Leide ich an Verfolgungswahn oder hat sich wirklich jemand vor meinen Blicken versteckt?
Ich bleibe eine Weile stehen, um abzuwarten, ob diese Gestalt wieder auftaucht. Aber nichts dergleichen passiert. Also habe ich mir das nur eingebildet.
Ich zucke mit den Schultern und gehe weiter. Ahab kläfft immer noch ohne Unterlass. Nicht gerade förderlich für meine angegriffenen Nerven.
Dass es nicht richtig ist, so einen Fund einfach mit nach Hause zu nehmen, ist mir klar. Aber in meiner bescheidenen Situation betrachte ich mein Handeln als entschuldigt. Ich bin die Finderin – also bin ich auch die Besitzerin.
Trotzdem werfe ich erneut einen Blick hinter mich: Tatsächlich! Wieder sehe ich einen Mann – in einer seltsamen Haltung. Seitlich gebeugt steht er da. Automatisch muss ich bei seinem Anblick an Quasimodo denken. Mich schaudert’s. Was hat das zu bedeuten?
Er regt sich nicht. Tut nichts. Als sei er erstarrt.
Ich setze meinen Heimweg fort. Meine Beine sind inzwischen wackelig. So ganz sicher fühle ich mich nicht mehr. Der Fund wiegt immer schwerer auf meiner Schulter. Aber ich gehe weiter, überquere die Wallerfanger Straße und biege in die Robert-Koch-Straße ab.
Ich drehe mich um: Von dem seltsamen Mann ist nichts mehr zu sehen.
Hastig beschleunige ich meine Schritte, damit niemand sehen kann, in welchem Haus ich verschwinde. Meine Oma in Schwierigkeiten zu bringen ist das Letzte, das ich erreichen will.
Endlich kommt ihr kleines Häuschen in Sicht.
Die rundliche Dame steht am Gartentörchen und erwartet mich bereits. Mir wird schlecht.
Ist in der Zwischenzeit etwas bei ihr zuhause vorgefallen? Habe ich mit dieser Tasche eine juristische Lawine ins Rollen gebracht? Polizei, Staatsanwaltschaft, Gefängniswärter? Warten sie alle schon auf mich?
Doch nichts dergleichen kann ich entdecken. Die schmale Straße liegt ruhig da. Nur Omas Präsenz ist nicht zu übersehen und nicht zu überhören: »Deinen Flohpinscher hört man meilenweit kläffen.«
Ich schlucke meinen Ärger herunter. Auf der Straße will ich nicht mit ihr streiten. Jetzt bloß keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Ich steuere die Haustür an, die ich von meinem Standpunkt nicht sehen kann. Sie liegt etwas zurückgesetzt unter einem kleinen Vordach. Oma stellt sich mir und Ahab in den Weg. Bestimmend sagt sie: »Das dreckige Bündel an deiner Schulter kommt nicht mit ins Haus. Und der Hund auch nicht. Ich habe alles sauber gemacht.«
»Wenn du erst mal weißt, was sich in dem dreckigen Bündel befindet und was genau passiert ist, siehst du die Dinge in einem anderen Licht«, flöte ich, dränge mich an Oma vorbei und trete ein.
»Dein Hund hat eine Tasche voller Geld gefunden?« Oma kann es nicht fassen. Ihre Augen leuchten. Liebevoll streichelt sie über Ahabs struppiges Fell, der sich das gern gefallen lässt.
Wir sitzen auf dem Boden – inmitten der vielen Geldscheine. Bei dieser unübersichtlichen Menge haben weder Oma noch ich eine Vorstellung davon, wie viel es sein könnte.
Ahab beschäftigt sich derweil unentwegt mit der Tasche.
»Was sind da für braune Flecken drauf?«, fragt Oma.
»Keine Ahnung. Ich will auch nicht so genau wissen, was das ist.«
»Ich ahne, dass dein Hund sich nur deshalb für die Tasche interessiert hat.«
»Wie das?«
»Das sind menschliche Ausscheidungen.«
»Igitt! Du meinst, dass jemand …« Ich spreche den Satz nicht aus.
»Wir sollten lieber das Geld zählen«, lenkt Oma ab. »Die Tasche braucht uns nicht zu kümmern.«
Gesagt – getan.
Nach stundenlangem Zählen wissen wir es ganz genau: Es sind 875.000 Euro – fast eine Million! Vor meinen Augen flimmern nur noch Banknoten. Ein Zustand, den ich immer herbeigesehnt habe. Jetzt ist er da! Ich kann mein Glück gar nicht fassen.
»Das Geld hat jemand dort versteckt, dem es selbst nicht gehört«, meint Oma.
»Warum sagst du das?«
»Weil es mit Sicherheit Leute gibt, die das Geld wiederhaben wollen.«
Ich spüre, dass meine Freude einen Dämpfer bekommt. Der merkwürdige Mann fällt mir wieder ein. Also hat er mich wirklich verfolgt – ich habe es mir nicht eingebildet.
»Was ist? Du guckst gerade, als hättest du einen Geist gesehen.«
Oma merkt auch alles.
Ich zögere, bis ich zugebe: »Da war plötzlich ein Mann hinter mir, als ich mit dem schweren Teil abgezogen bin. Er sah so komisch aus.«
»Komisch?«
»Ja! So wie Quasimodo … du weißt schon, der Glöckner von Notre Dame.«
»Du machst mir Angst.«
Ich springe auf und gehe nervös hin und her, während ich den Mann zu beschreiben versuche: »Er hielt sich irgendwie seitlich gebückt, was ich noch nie an einem Mann gesehen habe. Außerdem war er total dünn – schon fast knochig. Sein Kopf wirkte viel zu groß. Vielleicht habe ich mir ja auch nur eingebildet, dass er mir gefolgt ist. Der hatte vermutlich ganz andere Sorgen.«
»Und vorher ist er dir nicht aufgefallen?«
»Nein! Als ich Ahab in die Hecke gefolgt bin, habe ich mich nach allen Seiten umgeschaut. Da war niemand.«
»Dann hat er sich schon irgendwo in der Nähe aufgehalten und dich beobachtet.«
»Scheiße!«
»Nicht so negativ, Kindchen. Wenn er das Geld versteckt hat, gehört es ihm auch nicht. Denn sonst hätte er keinen Grund gehabt, es zu verstecken. Also kann er keine Ansprüche auf etwas stellen, was ihm nicht gehört.«
»Ach Oma! Du bist einfach nur genial. Wie gut, dass ich gerade jetzt nicht allein bin.«
»Ich habe dein Zimmer aufgeräumt«, meint Oma daraufhin geschäftig, als habe sie mein Kompliment verlegen gemacht. »Aber zuerst gehen wir etwas essen. Ich komme um vor Hunger. Anschließend richtest du dich ein.«
Ich gehe durch den Flur, der durch die Umbaumaßnahmen breiter geworden ist, und betrete mein ehemaliges Kinderzimmer. Beim Anblick des einfachen Bettes wird mir schwummrig. Wie soll ich darin schlafen können? Ich schaue mich um. Es hat sich nichts verändert. Am Kleiderschrank kleben immer noch die vielen Bildchen von Schauspielern, die mir damals gefallen haben. Keanu Reeves, der Actionheld, von dem ich nächtelang geträumt habe. Kevin Costner, der mit dem Wolf tanzte. Ein Typ, den ich nicht von der Bettkante gestoßen hätte. Oder Johnny Depp mit seinen Scherenhänden. Sie sind inzwischen verblasst, haben ihre Wirkung verloren. Oder bin ich älter geworden?
Ich drehe mich nach allen Seiten, lasse meinen Blick über die Wände und die Decke wandern. Da sehe ich das übergroße Poster, das genau über meinem Kinderbett hängt. Es zeigt Alf – einfach nur Alf. Der Außerirdische, der mit seiner Serie alle Kinder, die ich kannte, verzaubert hat. Jetzt muss ich bei dem Anblick dieses großen Bildes lachen. Direkt neben dem Bett hängt Kermit, der Frosch. Neben ihm Miss Piggy – ebenfalls ein Muss. Auch Balu, der Bär, darf nicht fehlen. Wenn ich mal über alle Maßen angespannt war, hat mich sein Anblick wieder zur Ruhe bringen können.
Ich stelle die Reisetasche ab, die ich bereits aus dem Auto mit ins Haus gebracht habe und kehre in die Küche zurück.
»Wie gefällt es dir?«, fragt Oma doch tatsächlich.
»Sieht aus wie vor zwanzig Jahren.«
»Das ist Nostalgie, Kindchen. Wenn du länger bleibst, kannst du dich ja neu einrichten.«
Da klingelt es an der Tür.
Oma und ich schauen uns erschrocken an.
Ahab kläfft wie ein Verrückter. So tun, als sei niemand im Haus, ist dadurch nicht mehr möglich.
»Und jetzt?«, frage ich.
»Jetzt gucken wir erst mal, wer dort steht. Vielleicht ist es nur meine Nachbarin, die Zucker für ihren Kuchen braucht.«
»Das glaubst du selbst nicht. Nicht an einem Dienstag, vierzehn Uhr und mitten in einer Stadt voller Geschäfte.«
Oma winkt ab und steuert das Gäste-WC an. Ich folge ihr. Ein kleines, schmales Fenster zeigt direkt auf den Platz vor der Haustür. Was wir sehen, macht es nicht besser: Dort steht der Mann, der mich verfolgt hat. Wie konnte er herausfinden, in welches Haus ich gegangen bin? Ich habe mich doch so beeilt.
Ohne Worte schiebt mich Oma wieder zurück in den Flur und flüstert: »Wir müssen jetzt geduldig sein. Irgendwann geht er von allein.«
»Und der Hund?«
»Er kann doch allein im Haus sein.« Oma schaut mich verschwörerisch an.
Ich nicke. Wohl fühle ich mich dabei allerdings nicht.
Auf leisen Sohlen kehren wir ins Wohnzimmer zurück, wo das Geld in kleinen Stapeln auf dem Boden liegt. Bei dem Anblick wird mir inzwischen mulmig. Dass das Glück von so kurzer Dauer sein könnte, wäre mir nicht in den Sinn gekommen. Doof, dass mich dieser krumme Mann mit der Tasche gesehen hat. Welche Rolle er wohl bei dem Ganzen spielt? Bestimmt keine gute – zumindest nicht für mich, denn jetzt steht er vor Omas Haustür und will rein.
Ich strenge mich ganz besonders an, kein Geräusch zu machen. Dabei übersehe ich die Drehorgel.
Mit voller Breitseite stoße ich dagegen. Das alte Ding auf dem albernen Wägelchen rollt einige Zentimeter, kippt um und dudelt in ohrenbetäubender Lautstärke Tulpen aus Amsterdam.
Dazu jault Ahab, als ginge es um sein Leben.
Oma verdreht die Augen. Sie dreht sich im Kreis, bis sie einen Entschluss gefasst hat. Tatkräftig versucht sie, die Drehorgel zum Schweigen zu bringen. Aber das Ding dudelt unaufhaltsam weiter.
»Jetzt weiß die ganze Nachbarschaft, dass jemand zuhause ist«, stellt sie mit hochrotem Kopf fest.
Wo sie recht hat, hat sie recht.
An der Tür ertönt ein Hämmern und Rufen. Der Mann vor der Tür wird aufmüpfig.
»Jetzt wird es richtig eng.« Oma beginnt, die Drehorgel hochzuheben und schnauft dabei wie ein Walross. Ich eile ihr zu Hilfe. Zu zweit gelingt es uns.
Kaum steht das Ding, hört die Musik auf.
Die Stille, die uns plötzlich umgibt, verursacht mir ein Pfeifen in den Ohren. Ich kann nichts mehr hören. Dafür sehen! Und zwar, wie Oma in Richtung Haustür geht. Ich will sie aufhalten, doch es ist zu spät.
Mit Schwung reißt Oma die Tür auf.
Niemand da.
Ich glaube es nicht. Meine Augen werden ganz groß. Der Platz vor der Tür ist leer.
Die kleine, rundliche Frau dreht sich zu mir um und meint amüsiert: »Manche Probleme lösen sich von ganz allein. Man muss nur lange genug warten.«
Diese Logik gefällt mir. Ich muss lachen.
»Das Geld lassen wir allerdings nicht mehr hier liegen. Wie es aussieht, kommen die Probleme, die damit verbunden sind, schneller als gedacht.«
Wir gehen hinunter in den Keller.
Ich weiß noch aus Kindertagen von einem Raum, der nicht nur wie ein Bunker aussieht, sondern tatsächlich ein Überbleibsel der Westwalllinie ist. Westwall nannte man ein militärisches Verteidigungssystem, entlang der westlichen Grenze Deutschlands. Das Befestigungssystem bestand aus über 18.000 Bunkern, Stollen, Panzersperren, Gräben. Nach dem II. Weltkrieg sollten sämtliche Bauwerke, die als Zeitzeugen einer schlimmen Epoche galten, komplett von der Bildfläche verschwinden. Einige konnten sich als Museum behaupten, andere wurden in die Luft gesprengt. Und wieder andere, die in Wohngebieten lagen, sozusagen in die Keller der Wohnhäuser integriert.
Meine Großeltern hatten damals ein Grundstück erstanden, unter dem genau ein solcher Bunker versteckt lag. Bei den Ausgrabungen für die Kellerräume wurde er entdeckt. Er sollte im Krieg als Unterstand dienen, in dem sich die Menschen vor Bombenangriffen schützen konnten.
Heute hat er die Funktion, Omas geheime Schätze aufzubewahren. Diesen Raum findet man nur, wenn man davon weiß. Die Tarnung funktioniert auch heute noch perfekt. Sie besteht aus einem metallenen Regal, in dem Marmeladengläser, Obstgläser, Körbe und leere Schüsseln lagern. Dieses Regal schwingt sie zur Seite, als sei es federleicht. Erst dahinter erkennt man die Tür zum Bunker.
Oma nimmt einen übergroßen, rostigen Schlüssel aus dem Regal und sperrt die eiserne Bunkertür auf. Vor unseren Augen offenbart sich ein kleiner, viereckiger Raum, der links von einer Schrankwand aus Kirschbaumholz dominiert wird. Sonst gibt es dort nichts zu sehen.
Wir verstecken die Geldscheine zusammen mit der schmutzigen Tasche in diesem Schrank.
Anschließend sperrt Oma den Raum ab, geht vor mir die Treppe nach oben und steuert im Wohnzimmer das Sideboard an. Darauf prangt die barocke Schatulle aus Eisen, die verdammt schwer aussieht. Die Form ist rechteckig mit abgeschrägten Kanten. Sie hat vergoldete, aufgesetzte Verzierungen mit eisernen Haltegriffen rechts und links. Jede Menge gusseiserne Schnörkel umrahmen ein Schloss auf der Vorderseite. Ein vergoldeter Schlüssel im Rokokostil steckt darin. Lediglich der geschwungene Kopf des Schlüssels ragt heraus. Oma dreht den Schlüssel einmal herum. Mit einem leichten Klack lässt sich das Behältnis öffnen. Innen ist alles mit rotem Samt ausgelegt.
Dort legt sie den alten Bunkerschlüssel hinein.
»Was ist das?«, frage ich erstaunt.
»Das ist eine Geldkassette aus dem 18. Jahrhundert …«
»Wie bitte? Das Ding allein ist doch schon ein Vermögen wert.« Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus.
»Leider nicht. Würdest du mich ausreden lassen, könnte ich dir erklären, dass diese Geldkassette eine Nachbildung ist. Kurt hat sich für sowas interessiert. Das Original konnte er sich nicht leisten, also hat er sich dieses Ding einfach nachbauen lassen.«
»Dann ist das Ding immer noch wertvoll«, beharre ich. »Ich erkundige mich mal, wie viel es dafür bei Ebay gibt.«
»Nichts wirst du tun. Das Ding bleibt hier stehen und dient mir als meine persönliche Geldkassette. Es erinnert mich an Kurt.«
»Das ist aber nicht das Einzige, was du von Kurt hier herumstehen hast.«
»Ja und?«, kreischt Oma plötzlich los. »Wir hatten keine Gelegenheit mehr zu heiraten. Der Depp ist vorher gestorben. Seine Schmarotzerfamilie hat alles geerbt und ich bin leer ausgegangen. Also behalte ich zumindest das Wenige, das er hier zurückgelassen hat.«
»Ist ja schon gut.«
»Hier drin bewahren wir den Schlüssel zu unserem Geheimversteck auf.« Sie sperrt das edle Behältnis ab und lässt es auf der Kommode stehen. Den vergoldeten Schlüssel wirft sie in die Schale mit den künstlichen Chips auf dem Esszimmertisch.
»Auffälliger geht es nicht mehr«, stelle ich fest.
»Warum? Das ist meine Schatulle.«
»Klar. Aber wenn jemand in deinem Haus nach dem Geld sucht, guckt er doch zuerst dort nach. Und was findet er? Einen Schlüssel, der mehr als verdächtig aussieht.«
»Blödsinn! Je auffälliger, desto unauffälliger«, meint Oma schlau dazu. »Glaub’ mir, niemand schenkt dieser Schatulle Beachtung, weil sie unübersehbar auf der Kommode steht.«
Wir verlassen das Haus. Mein Leichenwagen steht in der prallen Sonne. Der Inhalt – mein gesamtes Hab und Gut – schmort hinter den Glasscheiben. Ich werfe einen prüfenden Blick hinein und sage zu Oma: »Wenn wir zurückkommen, räume ich meine Sachen aus. Im Auto herrschen bestimmt fünfzig Grad. Ich weiß nicht, ob das dem Zeug so guttut.«
»Bei dem Krempel kann nichts mehr kaputtgehen.«
»Sehr witzig. Anscheinend bist du inzwischen unter die Wohlhabenden gegangen. Erzähl mir doch, womit du das viele Geld verdienst.«
»Das ist nichts für dich.«
»Wer sagt das?«
»Ich!«
»So einfach kommst du mir nicht davon.«
Wir gehen los. Saarlouis ist ein kleines, überschaubares Städtchen, in dem Gastronomie an allen Ecken angeboten wird. Nur ausgerechnet in der Robert-Koch-Straße gibt es nichts. Also müssen wir ein gutes Stück laufen, was mir gerade jetzt nicht behagt. Wer weiß, wo sich Quasimodo versteckt hält. Lauert er uns womöglich auf?
Doch Oma ist nicht zu bremsen. »Wir gehen in den Schwarzbachhof. Das ist eine einfache Gaststätte mit gutem Essen und nicht so teuer.«
»Aber jetzt können wir uns doch etwas Besseres leisten.«
»Willst du schon gleich am ersten Tag auffallen, indem du mit Geld um dich wirfst?«
Oma hat recht. Wie immer.
»Außerdem dürfen wir dort einen Hund mitbringen«, fügt Oma mit einem Blick auf den kleinen Dreibeiner an, »und du willst unseren kleinen Goldgräber doch bestimmt nicht allein lassen.«
Ich muss schmunzeln. Innerhalb kurzer Zeit ist Käpt’n Ahab vom Flohpinscher zum Goldgräber aufgestiegen.
Es ist nicht weit, schnell erreichen wir den Schwarzbachhof. Das Lokal ist klein und wird von einer großen Theke beherrscht. Im hinteren Raum finden wir einen Tisch, unter dem genug Platz für Ahab ist.
Quasimodo hat auf überraschende Überfälle in einsamen Ecken verzichtet – eine Tatsache, die mich trotzdem nicht beruhigt.