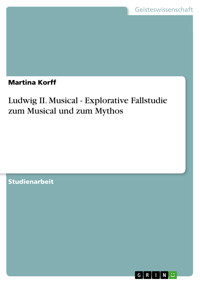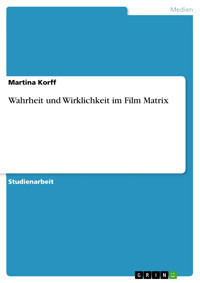Praktische Berufsvorbereitung im Rahmen eines wissenschaftlichen Studiengangs - Band 1 E-Book
Martina Korff
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Magisterarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Sonstiges, Note: 1,7, Ludwig-Maximilians-Universität München (Institut für Kommunikationswissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: „Kommunikationswissenschaft?! Was macht man denn damit?“ – wie oft musste ich in den letzten fünf Jahren diese Frage beantworten. Inhalt und Nachdruck meiner Antwort haben sich über die Jahre verändert: Am Anfang war es eher ein unbeholfenes „Alles, was mit Kommunikation zu tun hat.“ Das „Glaube ich“ habe ich mir dazu gedacht. Nach dem dritten Semester, die Zeit meiner Zwischenprüfung, stellte ich mir die Sinnfrage: „Nichts!“, „Bücher lesen und dumme Theorien lernen!“ oder „Bald gar nichts mehr!“ war in diesem Moment der Verlorenheit zwischen Erwartung und Realität aus meinem Mund zu hören. Ich nutzte ein Auslandspraktikum, um mir darüber klar zu werden, ob ich überhaupt weiter studieren werde, ob ich nicht lieber eine Ausbildung machen sollte, endlich die Ärmel hochkrempeln und richtig was tun. Wie man sieht, habe ich weitergemacht – und auch eine neue Antwort parat: „Professionell kommunizieren, was denn sonst!?“. Die Frage, was man mit dem gewählten Studium später einmal anfangen möchte oder kann, muss jeder Student irgendwann beantworten. Tatsache ist, dass ein Studium eine Station auf dem Weg in die Berufstätigkeit ist – die konkrete Stellung allerdings, die es dabei einnimmt, hängt sowohl von dem persönlichen Weg, als auch von (hochschul-) politischen, gesellschaftlichen und arbeitsmarktbezogenen Faktoren ab. So hat sich gerade im 19. und 20. Jahrhundert die Funktion der Hochschule einschneidend verändert: von einer geistigen Bildungsinstitution für soziale Eliten hat sie sich mittlerweile zu einem multifunktionalen Dienstleistungsunternehmen entwickelt.1 Weitgehende Akademisierung der Berufswelt und die gleichzeitige Vergesellschaftung der Wissenschaft machen eine immer stärkere Verzahnung von Berufspraxis und Wissenschaft unumgänglich. Eine Folge davon ist, dass berufsorientierte, wissenschaftlich basierte Ausbildung mittlerweile eine zentrale Aufgabe der Hochschule beschreibt. Historie und gegenwärtige Konzeption vor allem wissenschaftlicher Studiengänge stehen diesem Anspruch jedoch derzeit noch entgegen. Gleichzeitig werden Stimmen laut, die sich deutlich gegen eine Koppelung wissenschaftlicher Ausbildung an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes wenden. Vor diesem Hintergrund, der im Laufe meiner Arbeit eingehend beleuchtet wird, stellt sich die Frage, welche Rolle berufs- oder praxisorientierte Aspekte im Rahmen eines wissenschaftlichen Studiengangs spielen und welche Erwartungen damit verbunden sind.[...] 1Vgl.Schneekloth,Ulrich,Hochschulen,1990.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 1
Praktische Berufsvorbereitung im Rahmen eines wissenschaftlichen Studiengangs -Erwartungen von KW-Studenten und Akzeptanz des Praxisreferats am Institut für Kommunikationswissenschaft (ZW)
Page 4
Darstellungsverzeichnis
Darstellung 1 - Beruflicher und persönlicher Nutzen von Studienstrategien ................................... 19 Darstellung 2 - Verteilungen in der Stichprobe ............................................................................... 78 Darstellung 3 - Relative Verteilung des Alters in der Stichprobe..................................................... 86 Darstellung 4 - Verteilung der Geschlechter nach Hauptfächern .................................................... 86 Darstellung 5 - Schwerpunkt im Magisterstudium Kommunikationswissenschaft ........................... 87 Darstellung 6 - Einkommenquellen im Vergleich: IfKW - Deutschlandweit ..................................... 88 Darstellung 7 - Indizes aus den Faktoren zur Studiumsentscheidung ............................................ 92 Darstellung 8 - Nutzen des Studiums - nach Geschlecht................................................................ 94 Darstellung 9 - Nutzen des Studiums - nach beruflicher Vorgeschichte ......................................... 95 Darstellung 10 - Nutzen des Studiums - nach Studiumsfortschritt .................................................. 96 Darstellung 11 - Studiumsintensität .............................................................................................. 100 Darstellung 12 - Gründe für Berufstätigkeit nach Teilgruppen ...................................................... 101 Darstellung 13 - Nützlichkeit und Umsetzungsstatus von Studienstrategien für den beruflichen
Erfolg.................................................................................................................................... 103 Darstellung 14 - Berufliche Qualifikation durch den Studiengang KW .......................................... 105 Darstellung 15 - Wahrnehmung des Praxisreferats ...................................................................... 112 Darstellung 16 - Qualifikationsprofile für die häufigsten Tätigkeitsbereiche.................................. 117 Darstellung 17 - Nachfrage und Angebot von Tätigkeitsarten....................................................... 118 Darstellung 18 - Nachfrage und Angebot von Tätigkeitsbereichen ............................................... 119 Darstellung 19 - Berufliche Wertorientierungen ............................................................................ 121 Darstellung 20 - Dimensionen von Praxisbezug im Urteil der Befragten ...................................... 128 Darstellung 21 - Verteilung von KW-Studenten auf die Studienperspektiven ............................... 131 Darstellung 22 - Eigenschaftsräume der Studienperspektiven ..................................................... 133
Page 5
Vorbemerkung
Ziel dieser Arbeit ist es nicht nur, einen Abschluss in Kommunikationswissenschaft vorzubereiten, sondern vor allem auch dem Leser ein kurzweiliges und aufschlussreiches Lesevergnügen zu bereiten.
Das Institut für Kommunikationswissenschaft (Zeitungswissenschaft) wird wegen der zu erwartenden häufigen Nennung im Rahmen dieser Arbeit mit „IfKW“ abgekürzt. Damit ist immer das Münchner Institut gemeint, auch der Zusatz „(Zeitungswissenschaft)“ ist - zumindest gedanklich - darin enthalten. Ähnlich wird mit der Fachbezeichnung Kommunikationswissenschaft verfahren, die durch die Abkürzung „KW“ ersetzt werden kann. „LMU“ steht für die Ludwig-Maximilians-Universität München.
Um auch im Schriftbild der Gleichberechtigung von Mann und Frau Rechnung zu tragen, tauchen in Veröffentlichungen immer wieder abenteuerlich veränderte, gleichzeitig Mann und Frau bezeichnende Substantive auf, die nicht nur das Lesen, sondern auch die formal richtige wie grammatikalisch sinnvolle Darstellung erschweren. In dieser Arbeit wird auf derartige Experimente verzichtet. Der männliche Plural „Studenten“ bezeichnet gleichermaßen Mann und Frau. Der Anteil von fast 73% Frauen, die derzeit am IfKW der LMU eingeschrieben sind, wird verstehen, dass ich mich gegen die, den Gesetzen der Mehrheit folgende, Bezeichnung „Studentinnen“ entschieden habe.
Martina Korff
München, September 2002
Page 6
Einleitung
„Kommunikationswissenschaft?! Was macht man denn damit?“ - wie oft musste ich in den letzten fünf Jahren diese Frage beantworten. Inhalt und Nachdruck meiner Antwort haben sich über die Jahre verändert: Am Anfang war es eher ein unbeholfenes „Alles, was mit Kommunikation zu tun hat.“ Das „Glaube ich“ habe ich mir dazu gedacht. Nach dem dritten Semester, die Zeit meiner Zwischenprüfung, stellte ich mir die Sinnfrage: „Nichts!“, „Bücher lesen und dumme Theorien lernen!“ oder „Bald gar nichts mehr!“ war in diesem Moment der Ver-lorenheit zwischen Erwartung und Realität aus meinem Mund zu hören. Ich nutzte ein Auslandspraktikum, um mir darüber klar zu werden, ob ich überhaupt weiter studieren werde, ob ich nicht lieber eine Ausbildung machen sollte, endlich die Ärmel hochkrempeln und richtig was tun. Wie man sieht, habe ich weitergemacht - und auch eine neue Antwort parat: „Professionell kommunizieren, was denn sonst!?“.
Die Frage, was man mit dem gewählten Studium später einmal anfangen möchte oder kann, muss jeder Student irgendwann beantworten. Tatsache ist, dass ein Studium eine Station auf dem Weg in die Berufstätigkeit ist - die konkrete Stellung allerdings, die es dabei einnimmt, hängt sowohl von dem persönlichen Weg, als auch von (hochschul-) politischen, gesellschaftlichen und arbeitsmarktbezogenen Faktoren ab.
So hat sich gerade im 19. und 20. Jahrhundert die Funktion der Hochschule einschneidend verändert: von einer geistigen Bildungsinstitution für soziale Eliten hat sie sich mittlerweile zu einem multifunktionalen Dienstleistungsunternehmen entwickelt.1Weitgehende Akademisierung der Berufswelt und die gleichzeitige Vergesellschaftung der Wissenschaft machen eine immer stärkere Verzahnung von Berufspraxis und Wissenschaft unumgänglich. Eine Folge davon ist, dass berufsorientierte, wissenschaftlich basierte Ausbildung mittlerweile eine zentrale Aufgabe der Hochschule beschreibt. Historie und gegenwärtige Konzeption vor allem wissenschaftlicher Studiengänge stehen diesem Anspruch jedoch derzeit noch entgegen. Gleichzeitig werden Stimmen laut, die sich deutlich gegen
1Vgl. Schneekloth, Ulrich, Hochschulen, 1990.
Page 7
eine Koppelung wissenschaftlicher Ausbildung an die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes wenden.
Vor diesem Hintergrund, der im Laufe meiner Arbeit eingehend beleuchtet wird, stellt sich die Frage, welche Rolle berufs- oder praxisorientierte Aspekte im Rahmen eines wissenschaftlichen Studiengangs spielen und welche Erwartungen damit verbunden sind. Dies beschreibt den ersten Aspekt meiner in drei Teile geteilten Leitfrage.
Teil eins dieser Arbeit widmet sich dementsprechend dem Verhältnis von Wissenschaft und Praxis. Dabei geht es zunächst darum, die Funktion der Universität vor dem Hintergrund der Arbeitsmarktentwicklungen des letzten Jahrhunderts bis heute zu betrachten (Kap. 1.1). Die Öffnung der Universitäten und die steigende Akademikerarbeitslosigkeit haben in den 70er Jahren zu einer verstärken Diskussion des Praxisbezugs wissenschaftlicher Studiengänge geführt. Allerdings lässt sich bis heute kein einheitliches Konzept oder Verständnis von Praxisbezug und dessen Umsetzung vorlegen, so dass zuerst Potentiale und Her-ausforderungen von Praxisbezug geschildert werden müssen, bevor - auf Grundlage vereinzelter Definitionen - allgemeine Wesenszüge abgeleitet werden können (Kap. 1.2). Abschließend werden Strategien betrachtet, die dazu geeignet sind, Praxisbezug - in der definierten Art und Weise - im Rahmen eines Studiums tatsächlich umzusetzen (Kap. 1.3).
Kooperationen mit externen Unternehmen und studiumsbezogene Praktika beschreiben eine derartige Strategie, der im zweiten Teil verstärkt Aufmerksamkeit geschenkt wird: 1982 wurde das Praxisreferat des Instituts für Kommunikationswissenschaft gegründet, dessen Aufgabe es ist, den Studenten des IfKW Praktika zu vermitteln und gleichzeitig die Beziehungen zwischen Institut und beruflicher Praxis zu intensivieren. Die letzten zwanzig Jahre haben eine Vielzahl vermittelter Studenten, langjährigen, intensiven Kontakt zwischen Wissenschaft und Berufspraxis und einige Herausforderungen mit sich gebracht, die in Kap. 2 dargestellt und aufgearbeitet werden.
Zentrale Frage zum Praxisreferat - und damit der zweite Teil meiner Leitfrageist, welche Rolle das Praxisreferat in der praktischen Berufsvorbereitung spielt und wo sich unter Umständen Verbesserungen aufzeigen lassen.
Damit sind - wie in zahlreichen Arbeiten zu diesem Thema - theoretische Über- legungen und mögliche Umsetzungen von Praxisbezug auf Hochschulseite skiz-
Page 8
ziert. Bisher noch nicht dazu in Beziehung gesetzt wurden die Erwartungen und Vorstellungen der letztendlich „Leidtragenden“ - der Studenten. Dies soll im Rahmen dieser Arbeit geschehen. Reinhard Gawatz hat 1991 fünf Studienperspektiven veröffentlicht, die sich konkret auf das Verhältnis von Studium und Beruf beziehen und mir damit die Möglichkeit geben, in einer explorativen Analyse, Übereinstimmungen und mögliche Missverständnisse zwischen theoretischer Konzeption und studentischem Verständnis zu identifizieren (Kap. 3).2Der letzte Teil meiner Leitfrage bezieht sich auf die Erwartungen, die Studenten an praktische Berufsvorbereitung im Rahmen eines Studiums stellen.
Dazu habe ich eine standardisierte, schriftliche Befragung unter 222 Studenten der Kommunikationswissenschaft durchgeführt, aus der sich nicht nur die Studienperspektiven ableiten lassen, sondern die gleichzeitig auch Einblicke in das Verhältnis von Studium und Beruf erlaubt und Einstellungen zum Praxisreferat offenbart (Kap. 4 und 5). Die Darstellung des Praxisreferats wird ergänzt durch eine Inhaltsanalyse aller dort veröffentlichten Stellenangebote in den Jahren 2000 bis 2002. Damit ist die Möglichkeit gegeben, abgefragte Praktikumswünsche und Berufsvorstellungen der Studenten mit dem tatsächlichen Angebot zu vergleichen.
Die Literatur zum Funktionswandel der Hochschule ebenso wie die meisten Praxisbezugskonzeptionen beschäftigen sich hauptsächlich mit geistes- und sozialwissenschaftlichen Studiengängen, ohne eine weitere Differenzierung nach Disziplinen vorzunehmen. Der erste Teil meiner Arbeit ist daher, ohne Einschränkung auf ein bestimmtes Fach, allgemein gehalten, da ich der Meinung bin, dass alle Erkenntnisse auch auf das Studium der Kommunikationswissenschaft übertragen werden können.3Ansätze, die aus dem kommunikationswissenschaftlichen Bereich stammen, zeichnen sich durch eine zu starke Konzentration auf das Berufsziel Journalismus aus, so dass sie sich nicht als alleinige Grundlage für diese Analyse eignen.4
2Vgl. Gawatz, Reinhard, Studienperspektiven, 1991.
3Katrin Hammerer hat in ihrer Magisterarbeit konkret die Entwicklungen im Medienbereich nachgezeichnet: Hammerer, Katrin, KW, 1999, S. 5ff.
4Spezifika der Journalismusausbildung ergeben sich vor allem durch die Begabungsideologie, den offenen Berufszugang und die gleichzeitigen Professionalisierungsbemühungen des Berufsfeldes. Literatur dazu findet sich in Fußnote 158.
Page 9
Vorteile ergeben sich jedoch daraus, dass gerade das kommunikationswissenschaftliche Studium Station auf dem Weg in ein breit angelegtes Berufsfeld ist. Studenten und Hochschule stehen hier verstärkt vor der Herausforderung diverse Tätigkeitsprofile und verschiedene wissenschaftliche Schwerpunkte in eine umfassende, qualifizierende Ausbildung zu integrieren.
Die Analyse wird zeigen, dass häufig Missverständnisse oder falsche Erwartungen der Grund dafür sind, warum Studenten - ebenso wie ich - an ihrer Studiumsentscheidung für ein „praxisfernes“, wissenschaftlich orientiertes Fach zweifeln oder sogar bis zu ihrer Abschlussarbeit theoretische Inhalte meiden.5Gleichzeitig wird deutlich, dass auch ohne langwierige Studiumsreformen, neue Abschlüsse oder abenteuerliche Schwerpunkte im Rahmen eines wissenschaftlichen Studiengangs viel für die praktische Berufsvorbereitung der Studenten getan werden kann.
5Die Ergebnisse, zu denen Katrin Hammerer in ihrer Analyse kommt, bestätigen sich damit. Vgl. Hammerer, Katrin, KW, 1999, S. 105.
Page 10
1 Mehr Praxisbezug! Das Verhältnis von Wissenschaft und Praxis
1.761.000 Studierende gibt es im Wintersemester 2000 in Deutschland.61.334.000 davon studieren an Universitäten, der Rest verteilt sich auf Fachhochschulen, Technische Universitäten und andere Hochschularten. 49% beträgt der Anteil der weiblichen Studenten und hat sich damit seit 1975 um 13% fast auf „Gleichstand“ erhöht. Die Verteilung auf die einzelnen Fächergruppen zeigt vor allem eins:„ein massives Wachstum der gesellschaftswissenschaftlichen, einen ebenso massiven Rückgang der Lehramtsstudiengänge, einen eher durchschnittlichen Anstieg von Mathematik/Naturwissenschaften und eine Stagnation der Ingenieurwissenschaften“.7
Die Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften stellen mit knapp 360.000 im Wintersemester 2002 die größte Gruppe aller Universitätsstudenten. Interessanterweise entfallen auf diesen Fachbereich auch jeweils 30% aller männlichen und weiblichen Studierenden.8
Jeder einzelne Student dieser Statistik steht für eine berufliche Zukunft, ein persönliches Ziel und individuelle Ansprüche und Erwartungen an seine Ausbildung. Dem gegenüber stehen - nicht immer positiv und kooperierend - der Arbeitsmarkt, die Hochschule und vielleicht auch die eigenen Eltern oder Freunde.
Zu studieren bedeutet im Jahre 2002 nicht mehr zwingend, einer privilegierten gesellschaftlichen Schicht anzugehören, Wissenschaftler zu werden oder einen seit Jahrhunderten existierenden, anerkannten Beruf ergreifen zu wollen. Es ist vielmehr notwendiger Meilenstein des eigenen Werdegangs geworden, will man eines Tages einen ebenso anspruchvollen wie anspruchserfüllenden Beruf und einen - mehr oder weniger - sicheren Arbeitsplatz sein eigen nennen. Folglich zielen Erwartungen an wissenschaftliche Ausbildung in vielen Fällen auf eine praktische Berufstätigkeit, und das individuelle Streben nach Wissen ist strukturiert und gelenkt von dessen beruflicher Anwendungsrelevanz.
6Heine, Christoph, HIS, 2002, S. 132f. Bis zum Jahr 2015 werden es 1.805.000 sein, erst danach ist eine abnehmende Zahl von Studierenden in Deutschland prognostiziert. Vgl. BMBF, Daten, 2001, S. 160.7Heine, Christoph, HIS, 2002, S. 135, auch Grafik S. 134.
8Heine, Christoph, HIS, 2002, S. 138.
Page 11
Das Zusammenspiel wissenschaftlicher Theoriearbeit und beruflicher Praxis gestaltet sich in Abhängigkeit von Historie und Entwicklungsstand des Faches: Ulrich Schneekloth identifiziert drei Entwicklungsstufen: explorative, paradigmatische und finalisierte Phase.9Damit ist der Weg gekennzeichnet von dem „kognitiv ungesteuerten [Forschungsprozess] von Einzelwissenschaftlern“ über die „[kognitive] Strukturierung“ und „zu erreichende Abschließbarkeit von The-orien“ bis hin zur extern gesteuerten Wissenschaft, die „ohne Anwendungsbezug nicht mehr produktiv wissenschaftsimmanent entfaltbar“ ist.10Geistes- und Sozialwissenschaften sind analog zu diesem Konzept meist in der explorativen oder paradigmatischen Phase anzusiedeln: Wissenschaft findet häufig losgelöst oder auch bereits ansatzweise mit Blick auf mögliche Anwendungsszenarien statt. Zu einer starken Verschränkung und gegenseitiger Einflussnahme und Strukturierung zwischen Theorie und Anwendung ist es bisher in den meisten Fällen nicht gekommen. Die Praxis greift hier zwar im Idealfall je nach Bedarfssituation auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse zurück, Berufsstrukturen und -prozesse sind jedoch nicht vollständig in die wissenschaftliche Struktur und Orientierung übernommen.
Es scheint jedoch als seien vor allem die Geistes- und Sozialwissenschaften eifrig bestrebt, das Verhältnis von Wissenschaft und beruflicher Praxis nachhaltig zu verändern: Praxisbezug, Praxisnähe und Berufsvorbereitung sind jetzt Eigenschaften, die von Studenten und Arbeitsmärkten mit einem geistes- oder sozialwissenschaftlichen Studium assoziiert werden sollen. Wenn auch hier besonders auffällig, so ist diese Tendenz doch allgemeiner Natur: die Funktion eines wissenschaftlichen Studiums allgemein, ebenso wie das Verhältnis von Studium und Beruf im Speziellen befindet sich seit Jahren im Umbruch.
Vorab gilt es jedoch einen Schritt zurückzutreten und zu betrachten, vor welchem Hintergrund diese Diskussion geführt wird. Dazu zählt zum einen die Eigenschaft der Universität als ‚Ort des Wissens’ und zum anderen gesellschafts-und arbeitsmarktpolitische Entwicklungen der letzten Jahre.
9Zum Finalisierungskonzept siehe Böhme, G. / van den Daele, W. / Krohn, W., Finalisierung, 1974.
10Schneekloth, Ulrich, Hochschulen, 1990, S. 36f.
Page 12
1.1 Funktionswandel der Hochschulen
„Im Mittelpunkt [der Funktionsbestimmung; MK] steht heute die Orientierung an einer differenzierten Multifunktionalität [Hervorhebungen im Original; MK] einer Universität als Dienstleistungsinstitution: - integrierte Hochleistungsforschung, - Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, - „berufsqualifizierende“ Erstausbildung, - Weiterbildung sowie - regionaler Dienstleistungsbezug. Qualitativ neu gewichtet wird die Notwendigkeit, Orientierungswissen und kulturelle Identität zu vermitteln.“11
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts veröffentlicht Wilhelm von Humboldt seine Denkschrift „Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten zu Berlin“ und legt damit den Grundstein für ein geschlossenes Verständnis von Wissenschaft und Universität, in dessen Mittelpunkt der humanistische Bildungsauftrag steht.12
„Knapp zusammengefaßt [sic!] bedeutet HUMBOLDTs Modell der Universität jene Institution, in der sich Lehrende und Lernende als gleichberechtigte Forscher in Einheit von Forschung und Lehre, um in Einsamkeit und Freiheit der reinen Wissenschaft nachzuspüren und durch diesen Prozeß [sic!] sittliche und geistige Vervollkommnung zu erfahren [Hervorhebungen im Original kursiv; MK].“13
Die Philosophie ist in diesem Konzept die alles vereinende Wissenschaft, die losgelöst von Politik und Wirtschaft betrieben wird.
Finalisierungsprozesse und Vergesellschaftung, also die Öffnung der Wissenschaft gegenüber Belangen und Zwecken der außeruniversitären Umwelt, führen universitätsintern verstärkt zu Differenzierung und Spezialisierung der bestehenden Disziplinen. Der Wissenschaftsraum wird beschrieben von einer Vielzahl von Einzelwissenschaften, mit je eigenem Gegenstand und Material. Vertreter dieser Einzeldisziplinen sind hochspezialisierte Experten, die in immer weniger Bereichen, für die sie sich zuständig fühlen, über immer mehr Wissen verfügen. Universitätsextern wandelt sich Wissenschaft zur zweckgebundenen Produktivkraft, die - „industrieller Prozessoptimierung“ entsprechend - arbeitsteilig organisiert ist.14Helmut Spinner hat für die Entwicklung der Wissenschaft vier auf-einander folgende Phasen definiert, in deren Verlauf die Außenorientierung und
11Schneekloth, Ulrich, Hochschulen, 1990, S. 8.
12Vgl. Kopetz, Hedwig, Universität, 2002, S. 40.13Kopetz, Hedwig, Universität, 2002, S. 41.
14Vgl. Schneekloth, Ulrich, Hochschulen, 1990, S. 40f, 63ff. In der Folge etablieren sich vermehrt technisch- naturwissenschaftliche Studiengänge - im Gegensatz zu den philosophischen Disziplinen.
Page 13
-bestimmung der Wissenschaft zunimmt: Theorie, Praxis, Technik und Industrie.15
Eng verknüpft mit der Vergesellschaftung der Wissenschaft ist die Verwissenschaftlichung der Berufswelt: immer mehr Berufe, die früher reine Lernberufe waren, verlangen heute nach einer akademischen Ausbildung. Die zunehmende Komplexität gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Vorgänge erfordert wissenschaftliche Fähigkeiten und Strategien für Informationsbeschaffung, -verständnis und -verarbeitung.
Vor diesem Hintergrund war ein einschneidender Funktionswandel der Universität unausweichlich: weg von einer persönlichkeitsbildenden Institution, hin zu einem wissenschaftlichen Dienstleistungsunternehmen und einer Vermittlungsstätte „wissenschaftlich fundierter Berufsqualifikation“16.
1.1.1 Historische Aspekte zum Praxisbezug
Die Praxisferne des, auf eine Beamtenlaufbahn in der Forschung ausgelegten Studiums wird vor diesem Hintergrund zum zentralen Kritikpunkt.17„Im Kern handelte es sich bei der ab Ende der 60iger Jahre einsetzenden sozialdemokratischen Hochschulreform aus der Perspektive der strukturell gesellschaftlichen Anforderungen, um eine durch ein spezifisch reformiertes gesellschaftliches Kräfteverhältnis geprägte Vergesellschaftungsvariante. Neben der notwendigen Expansion im Hochschulzugang orientierte die Reformphase auf: ...
- die Studienreform in Bezug auf die Ausbildungsabschlüsse, Praxis- und Berufsfeldbezug sowie modernerer Wissensvermittlung durch forschendes Lernen.“18
Die Studiumsreformen stehen dabei vor der Herausforderung, stetig wachsendes Wissen in Studienpläne zu fassen, hoch spezialisierte Einzeldisziplinen und arbeitsteilig organisiertes Wissen sinnvoll in einem Ausbildungskatalog zusammenzufassen und uralte Konflikte und Missverständnisse zwischen Wissenschaft und Praxis, wenn schon nicht zu lösen, so doch wenigstens zu umgehen.19Ihren vorläufigen Höhepunkt findet die Diskussion über den Praxis- und Anwendungsbezug des Studiums in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts,
15Ein tabellarische Übersicht dieser Wissenschaftsformen und ihrer Begleittransformationen findet sich in Anhang 1.1, Band 2. Vgl. Spinner, Helmut, Wissenschaft, 1997.
16Schneekloth, Ulrich, Hochschulen, 1990, S. 43.
17Zu Konzeption und Problematik der Ordinarienuniversität vgl. Schneekloth, Ulrich, Hochschulen, 1990, S. 58ff.
18Schneekloth, Ulrich, Hochschulen, 1990, S. 74.
19Vgl. ausführlich Schneekloth, Ulrich, Hochschulen, 1990, S. 143ff.
Page 14
wenn die Berufsvorbereitung im Rahmen eines Studiums so offiziell wird, dass sie 1976 im §7 des Hochschulgesetzes festgeschrieben wird.20
Bereits davor, Ende der sechziger Jahre, entfachen Studenten eine Diskussion über „den Zerfall der deutschen Wissenschaft zwischen ‚Elfenbeinturm’ einerseits und adaptiver Instrumentalisierung für unreflektierte Zwecke andererseits“.21Dies soll jedoch erst später konkret auf die Praxisorientierung übertragen werden.
Berufsspezifischer Praxisbezug - im Gegensatz zu allgemeiner Annäherung von Wissenschaft und Praxis22- wird dann im Kontext steigender Akademikerarbeitslosigkeit erneut zum zentralen Thema. Es zeichnet sich ab, dass die Sicherheit, nur auf Grund des Studiums eine akademische Position erhalten zu können, nicht mehr für alle Studenten garantiert werden kann. Bei steigenden Studentenzahlen und sinkendem Lehrerbedarf - dem traditionellen Beschäftigungsgebiet der Geistes- und Sozialwissenschaften - rücken Fragen nach Sinnhaftigkeit und Legitimation dieser Fächer in den Vordergrund.
„Dies forderte die Hochschulen und für das Bildungssystem verantwortliche Politiker heraus, deutlich zu machen, daß die Absolventen wertvolle Beiträge für bisher vernachlässigte Aufgaben in der Gesellschaft leisten können und daß in vielen Berufen, die bisher typischerweise nicht von Hochschulabsolventen besetzt waren, Hochschulabsolventen sinnvoll eingesetzt werden können.“23
In der Folge setzt die vertikale Ausweitung der Akademikerbeschäftigung ein: immer mehr Absolventen übernehmen Berufe, die ehemals reine Ausbildungsberufe waren. Die Vermittlung berufspraktischer Fähigkeiten, die natürlich Teil einer Berufsausbildung sind, wird nun ebenfalls auf die Universitäten übertragen. Dies hat weitreichende Folgen für Studiumsorganisation und -inhalte. Denn es steht in Konkurrenz zu der Konzeption von Forschung und Lehre, wie sie einst Wilhelm Humboldt formulierte: „Der Vorrang der Forschung, der ständigen Suche, befreit die Universität wiederum von dem Zwang zur unmittelbar praktischen Ausrichtung.“24
20Inhaltlich entspricht diesem Paragraphen der Artikel 71 des Bayerischen Hochschulgesetzes von 2002. Vgl. Fußnote 26.
21Kluge, Norbert / Teichler, Ulrich, Praxisorientierung, 1988, S. 213.
22Schlagwort für diese allgemeine Annäherung ist das „Studium generale“, „mit [dem] die auf Fachdisziplinen beruhende spezielle Ausbildung für einen Berufseintritt gewissermaßen überhöht und zugleich fundiert werden [sollte].“ Oehler, Christoph, Hochschulwesen, 1988, S. 298.23Kluge, Norbert / Teichler, Ulrich, Praxisorientierung, 1988, S. 213.
24Kopetz, Hedwig, Universität, 2002, S. 46. Wissenschaftliche Tätigkeit zielt in diesem Verständnis in erster Linie auf Persönlichkeitsbildung.
Page 15
1.1.2 Vorgaben des Hochschulgesetzes
Diese Entwicklung findet sich im Hochschulgesetz abgebildet. Als Beispiel soll hier ein Ausschnitt aus dem Bayerischen Hochschulgesetz dienen:„Die Hochschulen bereiten auf eine berufliche Tätigkeit vor, welche die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden … fordert.“25
„Lehre und Studium sollen den Studenten auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und ihm die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen Studiengang entsprechend so vermitteln, so daß er zu wissenschaftlicher … Arbeit und zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat befähigt wird.“26
„Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, … Studieninhalte und Studienreformen, Studiengänge und Hochschulprüfungsordnungen im Hinblick auf die Entwicklungen in Wissenschaft und Kunst, die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die notwendigen Veränderungen in der Berufswelt zu überprüfen und weiter zu entwickeln. … Die Studienreform soll gewährleisten, daß … die Studieninhalte im Hinblick auf Veränderungen in der Berufswelt den Studenten breite berufliche Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen.“27
Die drei Ausschnitte aus dem Bayerischen Hochschulgesetz beschreiben die Soll-Funktionen der wissenschaftlichen Ausbildung: Berufsvorbereitung an erster Stelle, Persönlichkeitsbildung und Vermittlung von sozialem und politischem Verantwortungsbewusstsein gleich an zweiter. Die Berufsvorbereitung darf dabei nicht von einem nach innen gekehrten, rein wissenschaftsorientierten Blick gelenkt werden. Berufliche Zukunftschancen sollen geschaffen werden, eine Orientierung an der Berufswelt, ihren Gesetzen, ihren Bedürfnissen und ihren Strukturen ist dafür unabdingbar. Die Weiterentwicklung der Studieninhalte und -formen, der Prüfungsordnungen und Studienabschlüsse wird damit direkt an Veränderungen in der Berufswelt gekoppelt.
Es scheint also, als wäre „Praxisbezug“ quasi vom Hochschulgesetz verordnet. Doch es werden keine konkreten Aussagen darüber getroffen, wie dies tatsächlich umgesetzt werden kann. Von „Hinblick“ und „Weiterentwicklung“ ist die Rede und von „Kenntnisse vermitteln“. Art. 71, Abs. (2), Ziff. 3 führt zusätzlich an, dass praktische Tätigkeiten, mit dem Studium abzustimmen „und nach Möglichkeit in den Studiengang einzuordnen“ sind.28
25Bayerisches Hochschulgesetz, 2002, Art. 2 Aufgaben, Abs. (1), Ziff. 2.
26Bayerisches Hochschulgesetz, 2002, Art. 71 Studienziel, Studiengang, Abs. (1), Ziff. 1 und 2.27Bayerisches Hochschulgesetz, 2002, Art. 76 Studienreform, Abs. (1).
28Bayerisches Hochschulgesetz, 2002.
Page 16
Hammerer widerspricht der konkreten Berufsvorbereitung durch ein Studium und folgert aus dem Hochschulgesetz, „daß die Aufgabe der Universitäten nicht darin besteht, die Studierenden für einen konkreten Beruf zu qualifizieren, sondern sie auf ein Berufsfeldvorzubereiten[Hervorhebung im Original; MK].“29
1.2 „Praxisbezug“
Bei jeder Befragungsrunde, die ich für meine Magisterarbeit durchgeführt habe wiederholte sich dasselbe Spiel. Ich betrat den Seminarraum, bewaffnet mit einem dicken Stapel Fragebögen und der Ausstrahlung nie enden wollender Motivation. Die Studenten, denen nicht schnell genug eine gute Ausrede einfiel, überließen sich teils mit gequälter, teils mit wissender Mine den neugierigen Bögen. Ein Kreuz folgte dem anderen, angestrengte Mimik wechselte sich mit nachdenklicher oder überraschter ab. Gegen Ende wurde es spannend. Der Schlusssatz meines Fragebogens lautet: „Keine Kreuzchen mehr: Bitte nutze doch die Rückseite des Fragebogens, um kurz mit eigenen Worten zu beschreiben, wie Du für Dich ‚Praxisbezug’ definierst.“30Die Atmosphäre wurde ab diesem Punkt deutlich geschäftiger. Fast jeder konnte und wollte etwas zu diesem Thema sagen.31Damit hat sich nur ein weiteres Mal bewiesen, was seit jeher problematisch ist: jeder kennt den Begriff, alle benutzen ihn - aber niemand fragt, was der andere damit meint.32Machen wir uns also auf den Weg:
29Hammerer, Katrin, KW, 1999, S. 27.
30Anhang 6.3, Band 2, S. 85.
31Die Ergebnisse finden sich in Kapitel 5.6, Praxisbezug.
32Folgende Zitate zeigen, mit welcher Selbstverständlichkeit das Wort „Praxisbezug“ benutzt wird: “Praxisbezug ist keine Entfernung aus der Wissenschaft.“ - Was dann? Wie ist Wissenschaft definiert? “Lehre und Praxisforschung an den Hochschulen müssen stärker an den Realitäten der Lebens- und Arbeitswelt orientiert sein, einfach näher am Puls des Lebens sein.“ - Wie ist das mit Wissenschaft - im obigen Sinne - vereinbar?
“In der Praxis beruflichen Handelns kommt es auf eine gelungene Kombination und - soweit möglichauf synergetische Wirkungen zwischen generellem Wissen und speziellem Praxiskönnen an; ... Studenten müssen Generalisten und Spezialisten zugleich sein und dies bereits während ihres Studiums erlernen können.“ - Was müssen sie also lernen, wodurch zeichnet sich Praxiswissen im Unterschied zum wissenschaftlichen Wissen aus?
“Somit kann Praxisbezug während des Studiums dem Praxisschock vorbeugen und der späteren Reputation dienen.“ - Ersetzt Wissen somit Erfahrung?
Die Antwort auf die Frage, wie dieser Praxisbezug hergestellt werden kann, findet sich hier: “Erforderlich sind stabile, finanziell verlässliche und gute organisatorische sowie flexible Rahmenbedingungen und Voraussetzungen!“ - Das Urteil über diese Aussage möchte ich dem Leser überlassen. Alle Zitate: Bassarak, Herbert, Praxisforschung, 1997, S. 9.
Page 17
1.2.1 Motive für Praxisbezug
Unabhängig vom konkreten Verständnis von Praxisbezug, das in Kap. 1.2.3 eingehender analysiert wird, existieren unterschiedliche, keinesfalls trennscharfe und sicher auch nur schwer vollständig zu erfassende Motivkomplexe für die Einführung, Betonung oder Negierung von Praxisbezug. Ihnen übergeordnet ist sind die beiden Motive, die Arbeitsmarktchancen für Akademiker zu verbessern und - mit dem Ziel beiderseitig von den Synergien zu profitieren - eine Annäherung von Wissenschaft und Praxis herzustellen.
1.2.1. 1 Legitimation
„Die Philologien [und ebenso andere wissenschaftliche Disziplinen; MK] reagieren damit auf die Beschäftigungskrise in den Akademikerberufen (insbesondere auf die Kluft zwischen akademischer Ausbildung und beruflichen Anforderungen in den Magisterstudiengängen) sowie auf den gesellschaftlichen Legitimationsdruck, unter dem die Geisteswissenschaften stehen.“33
Praxisorientierte Studiengänge, hier in dem Sinne, dass sie berufspraktische Elemente integrieren und auf einen Beruf hin ausbilden, entsprechen den Vorstellungen der Berufswelt. Sie garantieren, dass der außeruniversitären Umwelt Experten zur Verfügung stehen, die gleichzeitig über hochspezialisiertes Wissen und allgemeine berufliche Fähigkeiten, wie analytisches Denken, Informationsbewusstsein und wissenschaftliche Methoden, verfügen. Wo sonst als in den Geistes- und Sozialwissenschaften findet man Mitarbeiter, die sich eingehend mit dem „[volkstümlichen] Liedgut der Tuareg im Raum östliche Sahara“ oder ähnlichen Kuriositäten beschäftigen?34Und genau darin zeigt sich ein offensichtlicher Widerspruch: würden sich alle wissenschaftlichen Disziplinen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes organisieren - also Verwertung und Bedarf von Wissen vor Erkenntnisstreben stellen35- gäbe es genau diese Experten bald nicht mehr. Die Seltenheit ihrer Einsatzmöglichkeiten ließe den Studiengang unrentabel werden und die wissenschaftlichen Bemühungen würden eingestellt. Damit wäre genau das Gegenteil dessen erreicht, was der Arbeitsmarkt fordert. Praxisbezug darf folglich nicht bedeuten, sich am Ist-Zustand der Berufswelt zu orientieren und darauf hin Arbeitskräfte auszubilden. Gerade in der Unabhängigkeit von beruflichen Profilen deutet sich hier die Existenzberechtigung der
33Jäger, Georg / Schönert, Jörg, Wissenschaft, 1997, S. 9. Vgl. auch Steinwachs, Burkhart, Praxis, 1997.
34Stellenanzeige der Langenscheidt Verlagsgruppe, Anhang 1.2, Band 2.
35Auch konkret berufspraktisches, handwerkliches Wissen anstelle von wissenschaftlicher Arbeit.
Page 18
Geistes- und Sozialwissenschaften an. Aufgabe des Praxisbezugs einer wissenschaftlichen Ausbildung kann in diesem Kontext daher maximal bedeuten, Schlüsselqualifikationen und berufliches Grundwissen, zu vermitteln und zu fördern. Vorteilhaft dabei ist, dass gerade Disziplinen, die wegen Ihrer „Praxisferne“ gerne an den Pranger gestellt werden, von ihren Studenten meist mehr Organisationssinn, Fachverständnis und Engagement in der zielstrebigen Durchführung verlangen, als dies bei den „verschulten Praxisdisziplinen“ der Fall ist, die demgegenüber häufig als Vorzeigebeispiel benutzt werden. „Praxisbezug“ stellt damit nicht nur die wissenschaftlichen Disziplinen vor die Aufgabe, die Potentiale, über die sie bereits verfügen, bewusst zu nutzen, sondern ist auch eine Herausforderung an den Arbeitsmarkt. Dieser muss sich im klaren darüber werden, welche Konsequenzen die industrielle Organisation von Wissenschaft für das zukünftige Arbeitskräfteprofil nach sich zieht. Legitimationsstrategien, die darauf ausgerichtet sind, die Existenzberechtigung wissenschaftlicher Disziplinen an deren genannten Praxisgehalt zu messen, erweisen sich damit nicht nur als sinnlos, sondern im Gegenteil sogar als kontraproduktiv. Überspitzt gesagt, legitimiert sich die berufsvorbereitende Funktion wissenschaftlicher Ausbildung gerade darin, dass sie sich nicht, oder zumindest nicht diktatorisch, an den Bedürfnissen der Berufswelt orientiert.36Auf Grund mangelnder Vereinheitlichung praxisorientierter Elemente kann bis jetzt auch noch nicht verlässlich auf das positive Veränderungspotential praxis-orientierter Reformen geschlossen werden. Zu groß ist hier der Einfluss lokaler Faktoren wie Wirtschaftslage, Konkurrenz der Ausbildungslandschaft (so z.B. Fachhochschulen, Akademien, etc.) und Verfügbarkeit von Fachkräften.
1.2.1. 2 Weg in die Profession
Professionen37sind Produkte des Professionalisierungsprozesses, der den„Übergang von einer traditionalen sozialen Ordnung zu einer sozialen Ordnung [markiert; MK], in welcher der Status des einzelnen von den Aufgaben abhängt, die er erfüllt, und wo die Aufgaben nach „rationalen“ Kriterien (Kompetenz und Spezialisierung) verteilt werden.“38
36Vgl. Schindler, Beufsfähigkeit, 1993, S. 80.
37Mit inhaltlichen Interpretationen und Wortbedeutungen - und vor allem der Abgrenzung zum englischen „professions“ - hat sich eingehend Hans Albrecht Hesse beschäftigt. Vgl. Hesse, Hans Albrecht, Professionalisierung, 1968.
38So Max Webers Verständnis von Professionalisierung. Dargestellt in Boudon, Raymond / Bourricaud, François, Stichworte, 1992, S. 402.