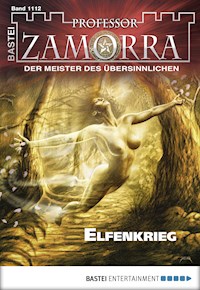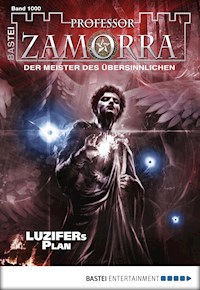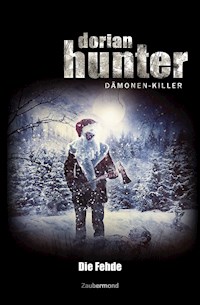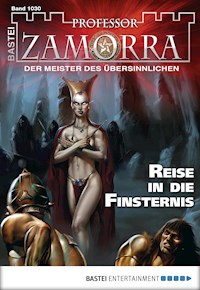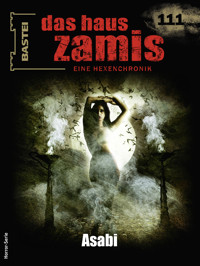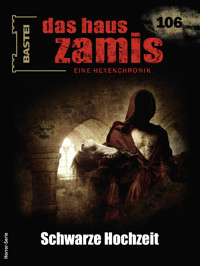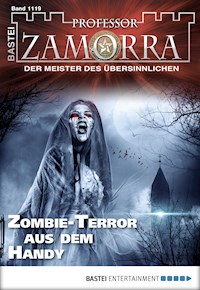
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Paul Vianney, der bekannte Geschäftsmann, wurde Opfer eines Raubmords. So glaubt man in der Gegend - doch irgendetwas ist an seinem Tod seltsam. Hat er wirklich nur einen Einbrecher überrascht? Oder steckt etwas ganz anderes hinter der ganzen Sache?
Der knappe Anruf Monsieur Landrus, des Leiters der deBlaussec-Stiftung bei Nicole, lässt letzteres vermuten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Zombie-Terror aus dem Handy
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Arndt Drechsler
Datenkonvertierung E-Book: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-4631-2
www.bastei-entertainment.de
Zombie-Terror aus dem Handy
Von Christian Schwarz
Schweißgebadet fuhr Paul Vianney aus einem dieser fürchterlichen Albträume hoch. Seit drei Wochen plagten sie ihn so gut wie jede Nacht.
Das Schema war jedes Mal das Gleiche, nur die Szenerie wechselte ständig: Ein Untoter verfolgte ihn, während er bei der Flucht Höllenängste ausstand. Vianney starrte in das Grau des Schlafzimmers. Und zuckte zusammen. Vor dem Kleiderschrank bewegte sich etwas!
Er erahnte die Bewegung mehr, als dass er sie sah. Dann öffnete sich auch schon die Schlafzimmertür einen Spalt breit. Etwas huschte hinaus.
Vianney unterdrückte einen Schrei.
Er wusste plötzlich, dass der Augenblick der Entscheidung gekommen war …
Dardilly, Frankreich, Gegenwart
Paul Vianney lauschte. Es dauerte einige Momente, bis er über sein laut pochendes Herz hinweg den regelmäßigen Atem seiner Frau wahrnahm. Madeleine schlief tief und fest. Gut so. Seine psychischen Aussetzer der letzten Wochen gingen langsam auch über ihre Kräfte. Wie oft war sie ebenfalls aufgewacht, wenn er stöhnend oder gar brüllend aus dem Schlaf hochfuhr. Und wie er selber hatte sie danach zumeist nicht mehr einschlafen können. Dieser permanente Schlafmangel forderte irgendwann seinen Tribut, ganz klar.
So leise wie möglich schlug Vianney die Bettdecke zurück. Natürlich hatte er Angst. So schreckliche Angst wie noch nie in seinem Leben. Denn was ihn da heimsuchte, schien sich nicht nur auf Albträume zu beschränken. Es hatte auch etwas sehr Reales an sich. Bisher hatte er das immer nur geahnt. Jetzt war die Ahnung Wirklichkeit geworden. Die Befürchtung, dass er plötzlich vollkommen verrückt geworden war und sich nicht existierende Dinge einbildete, hatte er spätestens in dem Moment beerdigt, als die Schlafzimmertür aufgegangen war. Mochte der huschende Schatten vielleicht noch als Einbildung durchgehen, die geöffnete Zimmertür tat es ganz sicher nicht. Zum ersten Mal präsentierte sich sein geheimnisvoller Gegner nun real. Und wurde somit angreifbar.
Vianney hoffte, dass er es nun zu Ende bringen konnte. Indem der Fremde in ihr Haus eindrang, musste Vianney nun auch seine Frau als direkt gefährdet betrachten. Das würde er nicht zulassen. Niemals. Und deswegen mit aller Härte reagieren. Madeleine war ohnehin schon zu stark in dieses fürchterliche Spiel involviert.
Spiel?
Psychoterror war kein Spiel. Irgendjemand jagte ihn und trieb sich jetzt in seinem Haus herum. Wie auch immer der Unbekannte sich Zugang verschafft hatte – so nahe war er Vianney noch nie gekommen.
Zu Vianneys Charakter gehörte wilde Entschlossenheit. Sie hatte ihn dorthin gebracht, wo er heute war. Er blickte kurz zu den schweren Vorhängen, die das Licht des Vollmonds weitgehend aussperrten und nur ein ganz klein wenig davon ins Zimmer ließen. Sonst hätte er die Bewegung vielleicht gar nicht bemerkt. Und die Bewegung der Tür. Vianney verzichtete darauf, Licht zu machen und in seine Kleider zu schlüpfen, denn das hätte Madeleine wecken können. Und wenn sie ihn zurückhielt, würde er es vielleicht doch nicht durchziehen.
So schlich er zur Tür, trat in den großen, offenen Raum, den er sich als Bibliothek eingerichtet hatte, hinaus und schloss sie leise. Unwillkürlich erwartete er, angegriffen zu werden. Nichts passierte. Erst jetzt machte er Licht. Für einen Moment blendete ihn die Helligkeit, er kniff die Augen zusammen. Als er sie öffnete, glaubte er nun hinter dem mittig stehenden Bücherregal eine Bewegung wahrzunehmen. Er sah nach. Aber da war nichts.
Also doch Einbildung?
Die Unsicherheit überfiel ihn erneut. Schwer atmend ging Vianney zu der alten, hölzernen Truhe, in der er sein Jagdgewehr aufbewahrte. Er nahm es heraus und lud es mit Schrotposten. Jetzt fühlte er sich etwas sicherer. Er ging zum Treppenabsatz. Das nach unten flutende Licht tauchte die Diele in Halbdämmer. Vianney erstarrte für einen Moment. Eiseskälte durchflutete seinen Körper, er musste ein Zittern unterdrücken.
Ein Schatten!
Er bewegte sich durch die Diele, öffnete die Haustür und ging hinaus.
Er will mich nach draußen locken, dachte Vianney. Gut so, dann bringen wir es dort zu Ende …
Seine Angst wich wilder Wut. Er ging die Treppe hinab, machte unwillkürlich einen Bogen um sein Handy, das auf einer Kommode lag und schlüpfte in Mantel und Schuhe, die an der Garderobe im Eingangsbereich hingen beziehungsweise standen. Vianney wollte die Haustür aufziehen, stellte aber zu seinem Erstaunen fest, dass sie verschlossen war. Erneut kroch es ihm eiskalt über den Rücken. Er hatte doch gerade gesehen, wie der Kerl die Tür geöffnet hatte! Und der Schlüssel steckte innen. Das war doch nicht möglich.
Bin ich vielleicht doch verrückt?
Nein, Vianney weigerte sich, das zu glauben und machte diesen Glauben an der offenen Schlafzimmertür fest. Er schloss die Haustür auf und trat in die helle Vollmondnacht hinaus. Vor ihm erstreckte sich der große, baum- und buschbestandene Park, der das Anwesen umgab. Groß und rund hing der leuchtende Erdtrabant am nahezu wolkenlosen samtblauen Nachthimmel und tauchte den Park in geheimnisvoll glitzerndes Dämmerlicht. Mit zusammengekniffenen Augen starrte Vianney zwischen die Bäume, das Gewehr locker im Anschlag. Aber da war nichts. Oder?
Doch, da!
Auf dem schmalen Kiesweg, der durch eine Baumgruppe zum Schuppen führte, sah er den Schatten erneut. Kein Zweifel möglich. Und er bewegte sich zum Schuppen hin. Paul Vianney ging mit großen Schritten los, die Nachtkühle spürte er nicht. Trotz seines mächtigen Bauchs entwickelte er ein beachtliches Tempo. Als er die Baumgruppe erreichte, verhielt er kurz. Dahinter sah er den Schuppen schimmern. Und davor bewegte sich der geheimnisvolle Schatten!
Vianney ging durch die Baumgruppe hindurch. »He, bleib stehen und stell dich endlich!«, rief er. »Oder ich knall dich ab wie einen Hund. Ich will endlich wissen, wer oder was du bist!«
Der Schatten verharrte und schien zu ihm herüber zu starren. Dann löste er sich urplötzlich auf. Verwirrt starrte Vianney auf die Stelle, an der er sich eben noch befunden hatte. In diesem Moment hörte er ein Knacken hinter sich.
Der Mann fuhr herum. In namenlosem Entsetzen riss er die Augen auf. »Was …«, stammelte er.
»Ich bin hier, um dich zu töten«, hörte er eine tiefe, unartikulierte Stimme.
Paul Vianney drückte ab. Der Knall brach sich an den Bäumen und machte ihn fast taub.
Dann fuhr etwas heran.
Und riss ihm die Kehle auf.
***
Vassagos Welt, Tage zuvor
Der uralte Erzdämon stand auf einem mächtigen Felsen und schaute nachdenklich über die weite, steinige, sandfarbene Ödnis hinweg. Er identifizierte einen mächtigen Schädelknochen, weit mehr als zur Hälfte im Boden verborgen. Der bleiche Knochen erinnerte an den Kopf eines riesigen Stieres, denn eine Art Horn ragte schräg in den Himmel hoch. In die leere Augenhöhle, die ihn anklagend anzustarren schien, hätte sogar sein eigener Kopf hineingepasst. Einige schleimige Kreaturen wanden sich darin. Vassagos Blicke wanderten weiter. Die gesamte Ebene war von Knochen aller Größen und Formen bedeckt. Auch halbe, übel zugerichtete Kadaver, die unerträglich stanken, befanden sich gelegentlich dazwischen. Vassago blickte über ein gigantisches Totenfeld.
Doch nicht alles, was hier tot erschien, war es wirklich. Nicht weit von ihm erhob sich langsam und lautlos einer der Kadaver. Fleisch fiel in Fetzen von den Knochen, als er sich schüttelte, das linke Auge hing ein Stück weit heraus, nur noch von einem schmalen Nervenstrang gehalten. Die Kreatur fasste es mit der Rechten und schob es zurück.
Eine zweite gespenstische Gestalt kam auf die Füße. Das Monstrum bückte sich, packte seine Hand, die abgetrennt neben ihm gelegen hatte, und drückte sie an den Armstumpf. Es gab ein schmatzendes Geräusch, als sich die Glieder wieder vereinigten. Eine dritte, eine vierte Gestalt regte sich. Sie alle ordneten ihre Glieder. Dann staksten sie mit ausgestreckten Armen auf Vassago zu.
Mit einem Blitz vernichtete Vassago das untote Leben. Das hier war seine Welt, gewiss, die er nach seinen ureigenen Vorstellungen geformt hatte. Und er hatte sie geliebt.
Jetzt nicht mehr.
Denn Vassago wusste nun, dass er nicht einfach nur ein Dämon, wenn auch ein mächtiger, war.
Ich bin mehr, viel mehr. Ich stehe so unendlich weit über diesem Gewürm, dass es mich graust, wenn ich es nur ansehen muss. Selbst Asmodis steht noch sehr weit unter mir …
Vassago war einst, im Abgrund der Zeiten, JABOTH gewesen, das Wesen, in dem sich LUZIFER alle hunderttausend Jahre hatte erneuern müssen, um zu überleben. Kein Wesen, das je JABOTH gewesen war, hatte diese Prozedur überlebt, bis auf eines.
ICH, ICH habe es überlebt. LUZIFER ist in mir aufgegangen, ich war er selbst. Und ich bin bis heute ein Teil von ihm, auch wenn er mich wieder in die Selbstständigkeit entlassen hat!
Vassago seufzte so schwer, dass die Ebene vor ihm zu beben begann. Ein gezackter Spalt entstand, riss auf und spuckte glühendrote Lava aus. Fontänenartig stieg sie in den Himmel.
Viel zu lange hatte dieses Wissen um seinen wahren Adel verborgen in Vassago geschlummert. Mit LUZIFERs endgültiger Befreiung aus seiner Pein und dem damit einhergehenden Untergang der Hölle war es zutage getreten. Jetzt wusste er diesen seltsamen Drang, im Licht erlöst zu werden, endlich richtig einzuschätzen. Es war nichts anderes als LUZIFERs Sehnsucht, in die Gemeinschaft der Siebenheit zurückkehren zu dürfen, die ihn einst wegen seines Verrats in die Tiefe verstoßen hatte. Daher mochte auch Vassagos Fähigkeit zur Weissage rühren, denn wer, wenn nicht LUZIFER, konnte in die Zukunft sehen? Und hatte nicht LUZIFER Menschen und Dämonen gleichermaßen geschaffen? Also war es richtig, wenn Menschen und Dämonen Vassago um Rat anrufen konnten, unter einem weiß- und einem schwarzmagischen Siegel, denn es war nur recht und billig, dass LUZIFER jedem seiner Kinder beistand.
LUZIFER. Er selbst – Vassago.
Zuerst traute Vassago diesem neuen Wissen nicht. Dann, als er es akzeptiert hatte, wusste er eine Weile nicht, was er damit anfangen sollte. Schließlich leitete er daraus ab, dass es nur ihm zustand, Ministerpräsident der neuen Hölle zu werden, LUZIFERs verlängerter Arm auf Avalon. Mit der Seelenstadt hatte er sich dort positionieren wollen. Es war schiefgegangen, nicht zuletzt deswegen, weil er dieses Vorhaben nicht mehr mit letzter Konsequenz verfolgt hatte.
Denn in seinem Schädel hatte längst ein ganz anderer Plan Gestalt angenommen. Einer, der so kühn war, dass er zunächst davor erschauert war. Das war nun nicht mehr so. Die goldene Elfe, die so plötzlich und überraschend aufgetaucht war, sah er als Zeichen. Und sie würde ihm noch nützlich sein.
Vassago ging es an. Er wusste nun, was er zu tun hatte. Die Aufgabe schien ihm plötzlich nicht mehr ganz so groß und erdrückend zu sein.
***
Kneipe »Zum Teufel«, Zamorras Dorf Gegenwart
»Gut so, dass sie den Drecksack gleich erschossen haben«, sagte Posthalter Jean-Claude Trenet und wischte mit einer großspurigen Geste über das Foto, das einen toten Terroristen ausgestreckt neben seiner Kalaschnikow auf dem Boden zeigte. Es nahm eine halbe Seite der gestrigen Ausgabe des Le Progrès ein. Die Tageszeitung lag aufgeschlagen vor Trenet auf dem Tisch.
»Genau«, stimmte ihm der ewig unrasierte Malteser-Joe zu und schlug so stark mit der Faust auf den Tisch, dass einige der Wein- und Schnapsgläser ein kleines Tänzchen veranstalteten. »In der Fremdenlegion haben wir auch immer kurzen Prozess mit Terroristen und Verrätern gemacht. Kopfschuss, weg, und Ruhe war.«
»He, Leute, haltet mal den Ball flach, ja?«, mischte sich nun Professor Zamorra ein. »Das sind doch Stammtisch-Parolen.«
Nicole Duval lächelte ihren Liebsten, dem sie genau gegenübersaß, wölfisch an. »Was glaubst du, wo wir hier sind, chéri? In Pater Ralphs Kirche? Oder beim Jahrestreffen der politisch Korrekten?«
Der gesamte Stammtisch begann brüllend zu lachen, Pater Ralph am lautesten.
»Schön, wenn ich euch erheitern konnte«, erwiderte der Meister des Übersinnlichen mit säuerlichem Grinsen, als das Gelächter abebbte.
»Müssen wir jetzt unsere Getränke selber bezahlen?«, fragte Justine Rameau mit unschuldigem Lächeln.
»Natürlich nicht«, sagte Nicole und legte ihre Hand auf die der fitten Mittsechzigerin, die direkt neben ihr saß. »Sollte Monsieur Zamorra nicht bezahlen, weil er ja, wie ihr wisst, hin und wieder das Gemüt einer leberkranken Vogelspinne zur Schau stellt, werde ich es eben tun. Und wenn dabei mein ganzes Monatsgehalt draufgeht.«
»So ist’s richtig, Mademoiselle Duval hat das Herz auf dem richtigen Fleck«, sagte André Goadec, Zamorras größter Weinbergpächter und begann laut zu applaudieren. Der ganze Tisch stimmte mit ein. Vereinzelte »Bravo«-Rufe wurden laut.
»Von wegen: leberkranke Vogelspinne. Eine Runde Calvados für alle!«, rief Zamorra grinsend in Richtung Pierre Mostache, der hinter der Theke stand, ein paar Gläser putzte und sich gerade mit dem Putztuch die Tränen aus den Augen wischte.
»Ich wusste es immer schon, du bist der beste chéri der Welt«, sagte Nicole und warf Zamorra eine Kusshand zu.
»Aber ist doch wahr, was Jean-Claude gesagt hat«, nahm Dorfschmied Charles den Faden wieder auf. »Jeder Terrorist im Knast kostet den Steuerzahler zehntausend Euro im Monat. Hab ich erst neulich gelesen. Ich hab auf jeden Fall keine Lust, für so einen Massenmörder zu bezahlen. Deswegen bin ich für die Todesstrafe für alle Terroristen. Entweder gleich erschießen oder ohne Prozess aufhängen, hochziehen und zur Abschreckung hängen lassen, so wie sie’s irgendwo im Nahen Osten auch machen.«
»Jetzt redest du aber wirklich Blödsinn, mein Lieber«, mischte sich Pater Ralph ein. »Wir sind doch keine Barbaren.« Er zog die Zeitung zu sich her und blätterte zwei Mal um. »Da, schau, der Artikel hier. In Dardilly haben sie vorgestern Paul Vianney in seinem eigenen Garten um die Ecke gebracht …«
»War der nicht Bauunternehmer?«, fragte Nicole.
»Genau.« Pater Ralph nickte. »Ein brutaler Raubüberfall. Vianney hat laut Aussage seiner Frau den Einbrecher aus dem Fenster gesehen und ist mit seinem Gewehr raus in den Garten. Er hat noch auf den Gangster geschossen, aber ihn wohl nicht getroffen. Der Dreckskerl muss ihn dann kompromisslos angegriffen haben. Vianney war übel zugerichtet, mit einem Messer oder etwas ähnlich Scharfem aufgeschlitzt. Was würdest du mit so einem Mörder tun, Charles? Auch ohne Prozess aufhängen?«
»Der ist immerhin kein Terrorist«, murmelte der Angesprochene.
»Macht das den Mord weniger schlimm?«
»Ich weiß nicht …«
»Aber ich.« Pater Ralphs Augen funkelten. »Mord ist Mord. Das Opfer kann nicht mehr nach der Motivation des Mörders fragen, verstehst du? Und die dürfte ihm auch herzlich egal sein, dem Opfer. Macht es für dich tatsächlich einen Unterschied, ob du von einem Terroristen oder einem Raubmörder umgebracht wirst? Und was würdest du sagen, wenn sie dich irrtümlich für einen Mord verantwortlich machen und sofort aufknüpfen? Ohne dass du eine Chance hattest, dich zu verteidigen?«
»Äh, nun, ich …«
»Ich jedenfalls bin froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben«, fuhr Pater Ralph leidenschaftlich fort. »Davon mal abgesehen, dass jeder die wirkliche Rechenschaft über sein Leben erst beim Jüngsten Gericht ablegen muss.«
»Rechtsstaat oder nicht, darüber könnten wir aber so was von diskutieren. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich auf dem Land in so einem elenden kleinen Kaff lebe«, warf Malteser-Joe ein, der den bürgerlichen Namen Gerard Fronton im Pass stehen hatte, seit über einem Jahrzehnt aber nicht mehr wusste, wo dieser Pass überhaupt war. Er brauchte ihn auch nicht. »Hier wird wohl kaum jemals ein Terrorist zuschlagen.«
»Dafür hast du allerbeste Chancen, dass dich hier der Teufel holt«, kommentierte Mostache, der gerade mit einem Tablett voller Calvados-Gläschen an den Tisch trat. »Wer wüsste das besser als ich. Schließlich war Monsieur Asmodis hier bei mir mal Stammgast. Man wählt den Namen seiner Lokalität ja schließlich nicht einfach so.«
Goadec kicherte, während die anderen breit grinsten. »Genau. Monsieur Zamorra kann schließlich nicht überall sein. Und bei unserer hohen Geistlichkeit bin ich mir nicht ganz so sicher, ob sie im Zweifelsfall tatsächlich auf unserer Seite steht.«
»Was soll das heißen?«, brauste Pater Ralph auf und schob das Kinn kampflustig vor.
Goadec tat es ihm gleich. »Na ja, ich meine gehört zu haben, dass es sich beim Handy-Klingelton unseres Herrn Pfarrers nicht gerade um sonntägliches Glockengeläut handelt.«
Nicole lehnte sich zurück und tauschte ein Lächeln mit Zamorra. Sie wusste genau, worauf der Weinbergpächter anspielte. Pater Ralph leistete sich mit dem ihm eigenen Humor Highway to Hell als Klingelton.
»Ach ja? Das meinen der Herr Weinbergpächter gehört zu haben?«, erwiderte Pater Ralph und ließ sich wieder zurücksinken. Er grinste verkniffen. »Dann wollen wir doch mal prüfen, ob der Herr Weinbergpächter richtig liegt. Vielleicht haben der Herr Weinbergpächter die Güte, seinen Seelenhirten, dessen Handynummer er ja gespeichert hat, mal kurz auf dessen Gerät anzurufen?«
»Nichts lieber als das.« Goadec zog sein Handy hervor und wählte Pater Ralphs Nummer. Alle schauten gespannt.
Gleich darauf ertönte festliches Glockengeläut unter Pater Ralphs Soutane hervor. Das provozierte erneute Lachanfälle.
Er holte sein Handy hervor und drückte den Klingelton weg. »So, was sagst du jetzt, André, hm? Da könnte ich doch jetzt wohl eine Entschuldigung erwarten. Ich wäre auch schon mit einer klitzekleinen zufrieden.«
»Von wegen«, brummte Goadec. »Neulich hat sich dein Handy noch ganz anders bei dir gemeldet, das weiß ich aus todsicherer Quelle. Ab in die Hölle oder wie das Lied hieß.«
»Ich kenne diese todsichere Quelle genau. Hin und wieder beichtet sie nämlich bei mir. Und sie arbeitet im Château.«
»Was es alles gibt«, erwiderte Zamorra grinsend.