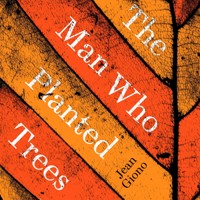Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer die Provence bereits kennt, der findet in diesem Buch, was er braucht, um sie neu zu entdecken. Und wer sie nicht kennt, wird sie durch den heimlichen Klassiker Jean Giono lieben lernen. Im Hinterland, dort wo die Provence schroff und spröde wird, und die Schafe seit Jahrhunderten auf die Sommerweiden getrieben werden, hat er seine von lebendigen Naturbeschreibungen satten Betrachtungen über die Landschaft, ihre Pflanzen, Tiere und Menschen verfasst. Jenseits aller Schablonen und vorgefertigter Bilder einer der schönsten Landstriche Europas gelang Giono mit diesem Buch eine sinnliche literarische Einladung zu einer Reise in eine der meistgeliebten, der rätselhaftesten und interessantesten Landschaften Europas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 478
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean Giono
PROVENCE
Aus dem Französischen vonSiglind Schüle-Ehrenthal,Herausgegeben von Henri Godard
Jean Giono, am 30. März 1895 in Manosque, Basses-Alpes geboren und am 8. Oktober 1970 dort gestorben, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern Frankreichs. Der überzeugte Pazifist war ein Verfechter des einfachen Lebens und lebte zurückgezogen in der Provence. Er veröffentlichte zahlreiche Romane, Gedichte und Theaterstücke. Zu seinen berühmtesten Büchern gehört der auch mehrfach verfilmte Roman »Der Husar auf dem Dach«.
INHALT
Vorwort von Henri Godard
I. Gesamtansichten
1. »Wie ein zerfließender Ölfleck …«
2. »Es ist vergeblich, vereinen zu wollen …«
3. »Kommt man von Norden und hat Valence hinter sich gelassen«
4. Frühling in der Haute-Provence
5. Brief über die provenzalischen Landschaften
II. Von Pan zu Shakespeare
6. »Ich kenne die Provence nicht …«
7. »Das, was ich über die Provence schreiben will …«
8. Arcadie! Arcadie!
9. »Auch wenn ich in diesem Land geboren bin …«
10. »Nie ist das Kennenlernen zu Ende …«
III. Bildausschnitte und Reiserouten
11. »Über eine Schulgeografie der Basses-Alpes …«
12. Basses-Alpes
13. 04
14. Manosque
15. bis Manosque
16. Reiseroute von Nyons nach Manosque
17. Reiseroute von Manosque nach Bargemon
18. Liebreiz von Gréoulx
19. Revest-du-Bion
20. Das Lure-Gebirge
21. Die Erhebungen des Vaucluse. Gordes
22. Die Schluchten des Verdon
23. Die Crau
24. Das Mittelmeer
IV. Tradition und Wandel
25. Legenden von der Haute-Provence
26. Die Santons
27. Über die toten Olivenbäume (I)
28. Über die toten Olivenbäume (II)
29. Der Lavendel
30. Die Bauernhöfe halten mit dem Jahrhundert nicht Schritt
31. Häuser in der Provence
32. Eine Landschaft, in der man glücklich ist
33. Protest gegen die Anlage eines Nuklearzentrums in Cadarache
34. »Das ganze 19. Jahrhundert hindurch …«
Index der Ortsnamen
VORWORT
Jean Giono ist kein provenzalischer Schriftsteller; er ist ein französischer Schriftsteller, der in der Provence geboren ist. Das sagt er selbst, und zu Beginn dieses Bandes muss das wiederholt werden. Ebenfalls sagt er, und auch da muss man ihm Aufmerksamkeit schenken: »Es gibt keine Provence. Wer sie liebt, liebt die Welt, oder er liebt nichts.« Immer in Opposition zu den nichtssagenden Redensarten, findet er noch im Jahr 1954 diese andere Formulierung: »Der Schriftsteller, der die Provence am besten beschrieben hat, ist Shakespeare.«
Man versteht ihn. Es hat ihn viel Zeit gekostet, um das Etikett des Regionalschriftstellers loszuwerden, und über die Provence schreiben heißt, jedes Mal Gefahr laufen, wiederum so gedeutet zu werden. Seit Ende des letzten Jahrhunderts haben ein paar Schriftsteller die Provence zu ihrem Spezialgebiet gemacht, von denen er sich schließlich unterscheiden muss, noch dazu da das Land selbst mittlerweile durch den erstarkten Tourismus an mehr als einem Ort einen Postkartenaspekt annahm.
Allein, Giono mag noch so sehr auf Distanz gehen, ja immer wieder betonen, dass er nur durch Zufall in der Provence geboren sei, Tatsache bleibt nichtsdestoweniger, dass es ihm die Augen geöffnet hat, dass es ihn geprägt hat und dass er dort fast sein gesamtes Leben verbracht hat. Für ihn selbst, der immer unterstrich, das Reisen nicht zu mögen, war das nicht reisen, sondern eher, diese Basses-Alpes, inzwischen Alpes-de-Haute-Provence, in jeder Hinsicht zu durchstreifen, und das hat er sich nicht entgehen lassen. Die vielen Stunden, die er mitten durch diese Landschaften zog und seine natürliche Fähigkeit schulte, Sinneseindrücke und Freude aus der Welt zu ziehen, konnten gar nicht anders sein, als danach auch mit Lust darüber zu schreiben. Auf diesem Gebiet hat er alle Eigenschaften, um mit seinen Vorgängern rivalisieren zu können, und sei es sogar mit Shakespeare.
In gewisser Weise hat er nie aufgehört, über die Provence zu schreiben, auch wenn sich das Territorium seiner Romanwelt selbst nicht mit ihr vermischt. Weder die Anzahl noch die Bedeutsamkeit der Romane, deren Handlung im südlichen Teil des Dauphiné stattfindet, können verhindern, dass in unserer Erinnerung die Provence nicht doch der dominante Rahmen dieser Welt bliebe. Geografische Namen und beschreibende Details vermischen sich in diesem Gesamteindruck. Was immer das Trièves-Gebiet in Gionos Imagination für eine Bedeutung haben mag, nur über die Provence hat sich Gionos Werk eröffnet, und nur über sie wird es sich auch wieder schließen. Es waren, und zwar aus gutem Grund, ganz provenzalische Landschaften, die er unter dem Deckmantel griechischer Namen in seinem ersten Roman »La Naissance de l’Odyssée« heraufbeschwor. Die folgenden aber geben sich freimütig als provenzalisch aus, denn hier wird vermehrt Manosque erwähnt, die Durance, das Lure-Gebirge und viele andere Orte, die mit Leichtigkeit erkennbar sind. Im Jahr 1935 hat Giono dann in der illustrierten Ausgabe der »Vraies Richesses« Landschaftsfotos der Region mit Zitaten kommentieren lassen, die seinen Romanen entnommen waren, als ob er dadurch deren Echtheit beglaubigen wolle. Auch nach dem Krieg zieht Angelus immer noch durch die Provence, in den ersten drei Bänden des Zyklus vom Husaren von Montgenèvre nach Manosque und von Manosque nach Théus, und dann nach Marseille, wo Pauline sterben wird. In »L’Iris de Suse«, seinem letzten Roman, gönnt Giono sich das Vergnügen, in der Fantasie noch einmal seine heimatliche Provence, diesmal von Süden nach Norden, zu durchlaufen, indem er Tringlot und seiner Herde beim Auftrieb folgt.
Diese scheinbar so offenkundige Lokalisierung ist dennoch immer doppelsinnig gewesen. Wo Giono authentische Namen nennt, achtet er sorgfältig darauf, die Orte im Verhältnis zueinander zu verschieben und die Fährten noch mal zu verwischen, indem er fiktive Namen einstreut. Auch wenn er sich bisweilen damit amüsiert, selbst den Weg seiner Helden in die Wanderkarten einzuzeichnen: er lässt es sich nicht nehmen, zu variieren. Es mag so aussehen, als ob die geografische Realität den Rahmen geliefert hätte, sie selber war jedoch auch raffiniert in die Fiktion mit einbezogen. Selbst wenn die Namen von Städten, Dörfern, Flüssen, Hügeln oder Gipfeln noch zahlreicher vertreten wären, die Provence wäre auch da immer präsent, wo sie gar nicht vorhanden ist. Durch die Namen nimmt Giono zweifelsohne mehr Bezug auf die Provence als Faulkner auf den Mississippi; aber er nimmt genau wie dieser in Anspruch, einen imaginären Süden zu schaffen.
Es war also, je nachdem, wie die Romane einen zur Aufmerksamkeit zwangen, ganz natürlich, dass der Wunsch entstand, zu erfahren, was Giono über die Provence selbst zu sagen hatte. Einladungen und Anfragen ließen nicht auf sich warten. Manches davon führte zu beträchtlichem Umfang, so beispielsweise die zwei Extreme im Werk, Manosque-des-Plateaux ab 1930, und das Ensemble kurzer Texte, die die Fotografien kommentierten, welche 1967 unter dem bezeichnenden Titel Provence perdue publiziert wurden. Andere Projekte waren mehr oder weniger eine direkte Gelegenheit für ihn, über die Provence zu reden, wie das Szenario des Films L’Eau vive, der es Giono entsprechend dem Verlauf seines Helden erlaubte, die Achse und gleichsam das Rückgrat der Provence freizulegen, oder der »Essay sur le charactère des Personnages«, der den Notizen zur Affäre Dominici hinzugefügt war. Doch neben diesen Essays von einigem Umfang hatte er auf die gleiche Art Anfrage genauso in zahlreichen, viel kürzeren Texten geantwortet, in Einleitungen, Artikeln, veröffentlichten Briefen und sogar in aufgenommenen Vorträgen. Diese Texte sind in dieser Sammlung enthalten. Ausgenommen zwei Texte, waren sie bis heute verstreut in Zeitschriften oder Broschüren erschienen, sowie in Büchern, wo sie als Vorwort dienten. Viele, insbesondere die Einleitungen, waren ohne Titel oder waren nur überschrieben mit »Provence«. Hier sind sie durch dem Text selbst entlehnte Formulierungen kenntlich gemacht, oft mit den ersten Worten des Textes. Die zwei einzigen Texte, die in die Sammlung nochmal aufgenommen werden mussten, sind der von 1939, hier betitelt mit »Ce que je veux écrire sur la Provence …«, der in den Band L’Eau vive eingefügt worden war, und »Arcadie! Arcadie!«, der in der posthumen Sammlung Le Déserteur eine Rolle spielt. Ein anderer Text war geschrieben worden, um einer teilweisen Umstellung von vier früheren Essays, mit demselben Titel Provence, als Vorwort zu dienen. Giono ist, wenn er seine Texte schreibt, nicht mehr Erzähler, sondern Zeuge. Insofern spricht er als in Manosque Gebürtiger und im Namen einer lebenslangen Vertrautheit mit der Provence. Seine schriftstellerischen Fähigkeiten stehen hier im Dienste dieser Zeugenschaft. Dank ihrer kann er die Provence zum Leben erwecken und ihre Formgebung variieren. Da, wo von etwas gesprochen wird, das sich eigentlich gleich bleibt, hat er keine Schwierigkeiten, dieses Motiv neu erscheinen zu lassen, indem er im ganzen Umkreis Wegrouten und Rundblicke, von einem höher gelegenen Punkt aus betrachtet, aufeinander folgen lässt – manchmal während er dem Vorrücken der Sonne folgt, wenn sie sich allmählich über der Region erhebt und ab einer bestimmten Höhe gleichzeitig weit auseinanderliegende Punkte im Raum berührt, mitunter ist es eine Strecke von der Straße, oder die Marschroute eines Wanderers, manchmal ein Fremder, manchmal er selbst, und in diesem Fall wird die Gegenwart Schritt für Schritt belebt, bald leibhaftig in erlebter Erzählung, bald in erzählter Erinnerung. Eins nach dem anderen bieten sich ihm Bilder an, die er hier vor allem als Mittel einsetzt, um die Wirklichkeit besser erfahrbar zu machen. Zu der Zeit, als er die meisten seiner Texte schreibt, hat Giono eine Meisterlichkeit in der Schreibkunst erlangt, die ununterbrochen von vollendeter Sensibilität geprägt ist.
Doch man darf bei Giono nicht erwarten, dass er sich selbst da, wo er in Essay- oder Zeugnisform davon spricht, was sein Land ausmacht, zu eng an diese Realität hielte. Wahr ist, dass er tatsächlich alle Wanderwege, die er darstellt, abgelaufen ist. Schreibt er aber, so breitet er oft auf seinem Tisch die Karten aus, die ihm an sich schon eine Quelle des Vergnügens sind, und behält sie ständig im Blick. Das, was er schreibt, stammt ebenso aus der Vision wie aus dem, was die Karten ihm eigentlich nur aus seiner Erinnerung anbieten. Wenn er irgendein winziges Detail der Landschaft präzisiert oder umgekehrt wiederum alle weit weg liegenden Ebenen und Anhaltspunkte, vom selben Blickpunkt aus gesehen, einzeln ausführt, so stellt er keineswegs immer Nachforschungen an über den gegenwärtigen oder vergangenen Zustand von diesem Detail, oder fragt sich, in welcher Jahreszeit oder unter welchen zeitlichen Umständen diese Markierungen denn alle auf einmal sichtbar wären. Man könnte sich nicht an Giono wenden, wenn man einen Touristenführer suchte. Aber jeder, der angesichts einer Landschaft jemals von Männern und Frauen träumte, die zu ihr passen könnten, fände Spaß daran, zu lesen, was Giono diesbezüglich über die Provence zu sagen hat. Obwohl sein Wissen über dieses Land eine erworbene Sache ist und es hierbei selbstverständlich sein Ziel ist, andere an seinem Wissen teilhaben zu lassen, bleibt festzustellen, dass jenseits der Realität, die jeder beschreiben kann, das Interesse von der Vision ausgeht, die zur Wahrnehmung noch hinzukommt. Bei Giono tendiert die Grenze zwischen beschreibendem Essay und Roman unmerklich zu verwischen, wozu sich der Leser nur beglückwünschen kann. Der Text von Ennemonde ist zuerst unter dem Titel Le Haut Pays publiziert worden, und sein ganzer erster Teil könnte tatsächlich in einer solchen Textsammlung wie dieser hier platziert werden, genauso wie eine gewisse Anzahl von Seiten aus »Camargue« nur dazu da waren, mit dem einen oder anderen Text die Figuren entstehen zu lassen. Die Provence von Giono bleibt auf diese Weise ununterbrochen ein Land, das von den Schatten der Personen bewohnt ist, die an jeder Wegbiegung solche Landschaften, wie er sie beschreibt, hervorgerufen haben oder hervorrufen könnten.
Wenn es sich auch immer um die gleichen Landschaften handelt, so sind doch der Blick auf sie und mehr noch das Imaginäre, in das sie sich fügen, immer wieder etwas, das sich verändert. Geschrieben in Abständen über einen Zeitraum von mehr als dreißig Jahren, ermöglichen diese hier vereinten Texte mit einem einzigen Blick, die Entwicklung von Vision und Stil zu erfassen, die Giono charakterisiert, wobei Konstanten und Brüche miteinander vermischt sind. Die Provence war seit dem Beginn des Werks ganz selbstverständlich die Welt des Pan und die der Einheit des Menschen mit der Welt, in lyrischer Tonart gesungen. In den fünfziger Jahren ist sie zu einem Land geworden, in dem mehr als woanders noch starke Leidenschaften zu finden sind, die ein Kenner der Seelen wie ein Feinschmecker analysiert. Ein Text wie »Je ne connais pas la Provence …« (ich kenne nicht die Provence), der aus dem Jahr 1936 stammt, ist ganz durchdrungen von der Inspiration der Vraies Richesses. Aber drei Jahre später, in »Ce que je veux écrire sur la Provence …« (was ich über die Provence schreiben will), war Giono schon einen Schritt weitergekommen. Eine erste Publikation als Broschüre, dann die Einfügung, immer unter dem anfänglichen Titel »Provence«, in die sehr verschiedenartige Sammlung von L’Éau vive haben sicherlich nicht zugelassen, diesen langen Essay richtig einzuschätzen.Er ist in Wirklichkeit einer der Schlüsseltexte, in denen der »frühe« Giono, der seine ganze Aufmerksamkeit auf die natürliche Welt richtete, sich erweitert und mit neuen Interessen anreichert. Der Akzent liegt sicherlich immer noch weiter auf einem staunenden, fast religiösen Gefühl für die Gleichzeitigkeit von all dem, was im Wandel der Zeiten und Formen der Erde, Pflanzen, Tiere und menschlichen Wesen miteinander in der Welt in einem gegebenen Augenblick existiert. Aber er kündigt in mehr als einer Hinsicht auch das Schaffen der Nachkriegszeit an. Das Auftauchen großer, leerer Wohnstätten mitten in verlassenen Parks, welche später das Dekor von mehr als einer Szene sein werden, das wäre allerdings ein bisschen wenig, oder diese Buggys, Tilburys und anderen Wagen aus vergangenen Zeiten, die sich nun vermehren sollten, oder selbst das plötzliche Auftauchen dieser umschweifigen Rede von der »mit Gold beschlagenen Säbeltasche eines Husaren«. Doch man erkennt hier seit 1939 in gewissen Passagen schon die Skizze jener romanhaften Psychologie, die das Merkmal des kommenden Werkes sein wird.
Als Giono 1953 in die Provence um ihrer selbst willen zurückkehrt, hat er endgültig den Wendepunkt erreicht. Viel fehlte nicht mehr und Virgil ist vergessen; als es jetzt darum geht, im Land einen Bezugspunkt zur Literatur der Vergangenheit zu finden, stößt er auf Stendhal, dann auf Shakespeare. »Arcadie! Arcadie!« ist mit dem Schwung der Voyage en Italie geschrieben. Giono vergnügt sich hier damit, die Gegend, die ihm am vertrautesten ist, in das Licht einer Psychologie zu tauchen, die von nun an in vollem Maße entfaltet wird, die ihm dazu dient, einen ganz persönlichen Blick auf Brescia, Florenz und auf Venedig zu werfen. Der Titel scheint tatsächlich wieder an den alten Geist anzuknüpfen, doch das Ausrufezeichen steht abschließend mit all seinem Doppelsinn da, um zu suggerieren, dass es hier eher um ein Augenzwinkern geht, selbst wenn die Beschwörung des Tals der Asse abschnittweise die alte ländliche Utopie wiederauftauchen lässt (gleichwohl durch eine Metapher angezeigt, die nichts Virgilisches mehr hat, noch irgendetwas Antikes: »Tahitis der betörten Menschen«). Alles Übrige ist nicht mehr im lyrischen Ton gehalten, auch nicht mehr feierlich, sondern im Gegenteil mit leichter Hand und humorvoller Feder geschrieben. Die Distanz lässt sich voll und ganz in der langen Ausführung, die der Olivenernte gewidmet wird, wahrnehmen. Weit entfernt ist man hier vom »Poème de l’olive« von 1930, und andererseits so nahe an der Passage aus Noé über die Olivenerntezeit, die dort aber nur wie eine an den Rand jener Seiten geschriebene Variation steht. Giono ist hier jedoch eher noch geprägt vom Zyklus des Husaren. »Arcadie! Arcadie!« ist wie eine Verschnaufpause, die er sich leistet, bevor er an die lange Bearbeitung des Bonheur fou geht. Man ist daher nicht erstaunt, dort etwas von diesen Wendungen wieder anzutreffen, die sich wie Signaturen eines Stendhalismus lesen, mit dem er den ganzen Romanzyklus hindurch spielt. Diese Provence von 1953 hat gründlich mit dem Paganismus gebrochen, sie ist von nun an ein Gebiet, ganz dazu geeignet, »die Seele lauter Wonnetaumel« auskosten zu lassen (oder aber »die zarteste Melancholie«), sie ist ein Land der »empfindsamen Seelen«, die wissen, dass hier lauter »Höhepunkte des Glücks« zu finden sind.
Kaum sind einige Monate verstrichen, nachdem Giono diesen Text für seinen Freund Lucien Jacques geschrieben hat, als er aufs Neue gebeten wird, einige Seiten über die Provence zu schreiben, diesmal als Einleitung für ein Album des Guides Bleus. Um seine Schreibweise zu ändern, verzichtet er hier auf folgerichtige Wanderrouten, auf denen man die Provence lang und breit durchlaufen könnte, und ebenso auf künstliche Erweiterungen der Art, wie er sie in »Arcadie! Arcadie!« den Öl- und Weinbauern gewidmet hatte. Er entscheidet sich, nicht nur die Einheit, sondern auch die Vielseitigkeit des Landes zur Geltung zu bringen, eine unerschöpfliche Vielseitigkeit, die jede Gesamtdarstellung ausschließt, insbesondere eine vollständige Kenntnis, wovor er bereits vom ersten Satz an warnt: »Und wenn ich auch in diesem Land geboren bin und fast sechzig Jahre darin gewohnt habe: ich kenne es nicht.« Ganz logisch entscheidet er sich also für eine Folge von Teilansichten, die kontrastierend oder durch natürliche Verknüpfung von Gedanken aneinandergefügt sind. Allerhöchstens gönnt er sich eine Panoramaaufnahme, so wie er sie liebt, aufgenommen von der Höhe einer seiner zu dieser Zeit bevorzugten Aussichtspunkte aus, dem hoch oben hingekauerten Dorf Saint-Julienle-Montagnier, von wo aus er in langsamer Drehung nach und nach um sich herum all die Gipfel sehen kann, die die Region gliedern oder festlegen. An anderen Stellen geht er ganz freizügig von einem Punkt des Landes zum anderen, indem er es nicht nur mit den Augen vollständig abtastet, sondern auch mit dem Gedanken an all seine Unterschiede; und immer wieder, ohne dies genau anzugeben, kehrt sein Denken periodisch heim zu dieser Stadt Manosque, die nie aufgehört hat, die Quelle seines Schauens und der Anfang für alle seine Erkundungszüge zu sein.
Diese neue Provence ist von den ersten Seiten an eine solche der romanischen Chroniken. Mehrere Ortsnamen, beispielsweise die der Gehöfte Silence oder Scambuc knüpfen hier an, mehr aber noch dieser Wahn des Spiels, sehr nahe an dem, was im »Monolog« von Faust im Dorf heraufbeschworen wurde, obwohl es hier eine sonderbare Form und die neue Bezeichnung des »Arrêt« beansprucht. Es ist tatsächlich immer das gleiche Vergnügen, unverzichtbar in dieser Welt der Einsamkeit und Langeweile, das einzige, das ein ausreichendes Unmaß erlaubt, um der Welt, die einen umgibt, den Kampf anzusagen. Von der Jagd nach dem Glück in »Arcadie! Arcadie!« ist man zu den tragischen Leidenschaften übergegangen: von Stendhal zu Shakespeare. Denn gerade in diesem Text geht Giono dazu über, den Autor des Macbeth und des König Lear als den Schriftsteller auszugeben, der die Provence am besten beschrieben habe.
Doch im Jahr 1954 ist die Serie der Chroniken fast schon beendet. Unter den neuen Arbeiten, die Giono vorschweben, ist eine, die er im Endeffekt nicht schreibt, aber Anlass zu Skizzen gibt, die in einem Vorwort aus dem Jahr 1958 zu Colline und zu den Coeurs, passions, caractères von 1960–1961 publiziert wird. Die Texte über die Provence, die in diesen Jahren geschrieben wurden, versäumen nicht, diesem neuen Interesse für einen gewissen Charaktertypus Platz zu machen. Vorwegnahmen dieses Typus findet man in jener Arbeit von 1954, in der Geschichte von dem ehemaligen Besitzer des Hauses von Saint-Julien. Die darauffolgende Arbeit von 1957 ist dann geradezu vollständig dem Vorhaben gewidmet, zum ersten Mal die Geschichte von einer gewissen Marie M. zu erzählen, von der Giono in den folgenden Jahren nicht weniger als ein Dutzend Versionen schreiben wird. Der Entwurf führt dann 1965 zu dem »Charakter« im Stil der Ennemonde, und im selben Jahr wird die Person auch in einer Passage des letzten Textes dieser Sammlung angeführt, gewissermaßen für den Platz, der zwischen den alten Dorfbewohnern und denen, die ihn möglicherweise wieder besetzen wollen, welcher Marie M. als Rast einmal zugesichert werden wird. Und so verfolgt sie auf ihre Weise in einer ganzen Reihe solcher Texte den Weg des Werks. Bei allen Vorsichtsmaßnahmen, die Giono ergreifen kann, um nicht mit der Provence gleichgestellt oder in sie eingesperrt zu werden, berührt ihn das Land trotz allem so nahe, dass, wo er sich verändert, er es sich mit ihm verändern lässt.
Aber die Provence ihrerseits verändert sich ebenso. Zur Zeit von Gionos Jugend mochte sie wohl für ihn die gleiche wie zu Virgils Zeiten geblieben sein. Seither hat sie nicht nur Naturkatastrophen über sich ergehen lassen, was schließlich zum Lauf der Dinge gehört, sondern auch mancherlei von Menschen verursachte Schädigungen. Einer allgemeinen Beschleunigung des technischen Fortschritts haben sich einige besondere Eingriffe beigefügt, die sie allmählich unkenntlich machen. Die Welt passt sich gezwungenermaßen letztendlich immer den Katastrophen an. Nach dem außergewöhnlichen Frost von 1956 musste Giono der Gedanke an eine Provence, die ihrer Oliven beraubt sein würde, zunächst erst einmal erschrecken. Zwei Jahre später finden seine Augen an den stehen gebliebenen toten Baumstümpfen bereits eine Schönheit, oberhalb des Wurzeltriebs, der wieder sprießt. Doch, was tun mit diesen Straßen, die immer größer werden, immer geradliniger, die, wie Rasierklingen ins lebendige Fleisch, dieses Land zerschneiden? Bis in die fünfziger Jahre hatte sich Giono nur mit der Route Nationale angelegt. Während er indes einige weitere Texte dieser Sammlung schreibt, befinden sich ein erster, dann ein zweiter Streckenabschnitt der Autobahn in Bau, die ab nun rücksichtslos rauf wie runter die Provence durchquert. »Die Autobahnen geißeln mit ihrer trägen, wellenförmigen Bewegung all die jungfräulichen Landschaften.« Die Zeit des TGV hat er nicht erlebt, aber er kannte eine gewisse Anzahl entsprechender Projekte – die Anlage des Nuklearzentrums in Cadarache, die Schaffung von Militärzonen wie die der Ebene von Canjuers, später dann die des Plateau d’ Albion – und er hat versucht, gegen diese Projekte anzukämpfen. Ohne Zweifel ist die Provence mehr als andere Gebiete ein bedrohtes Land. Viel mehr als nur bedroht, wie Giono 1967 in einem Titel, Provence perdue, formuliert.
Es ist im Übrigen nicht gesagt, dass das Vergängliche an der Provence nicht etwas wäre, das er teilweise auch an ihr liebte. Schon in »Colline« beschwört er diese abgestorbenen Dörfer des Lure-Gebirges herauf, deren Häuser nur noch lauter Steinhaufen sind, von Efeu und Brombeergesträuch überwuchert. Er kommt darauf ein weiteres Mal 1954 zurück, in den letzten Zeilen von »J’ai beau être né dans ce pays …«. Von jeher bestand der Blick, den er auf die Provence warf, nicht allein aus Schärfe, aus der feinsinnigen Beobachtung seines Reichtums oder aus der Präzision seiner Farbgebung. Dieser Blick wurde ununterbrochen belebt durch die Erinnerung und die Einbildungskraft, und desgleichen durch den Sinn für das Tragische und für die menschlichen Leidenschaften, was parallel dazu auch die Kraft der Romane ausmacht. Von all dem war reichlich viel nötig, um dieses Land aus den Klischees oder der Folklore herauszuholen, was seit langem bereits bedrohliche Formen angenommen hat. Giono, der nicht als provenzalisch gelten wollte, hat wahrlich viel dafür getan, dass wir eine andere Provence sehen können, erweitert durch ein ganz neuartiges Spiel von Schlagschatten, welche diese Provence, ganz anwesend in ihren Schatten, im Lichte eines Werkes wirft.
Henri Godard
I
GESAMTANSICHTEN
1.
»Wie ein zerfließender Ölfleck …«
Wie ein zerfließender Ölfleck, so läuft die Provence über ihre historischen Grenzen. Im Westen wird sie fest zusammengehalten von der Rhône und im Süden eindeutig begrenzt vom Meer, den Norden aber kennzeichnen diese Bergthymianbüschel, die über die Berggipfel des Lus-la-Croix-Haute ihren Duft verströmen, und der Osten hat diesen klaren Himmel, der sich über dem Briançonnais öffnet. Die Bresche, die die Durance bei Sisteron in die Voralpen reißt, gleicht einer Pforte an der Chinesischen Mauer. Man stellt sich vor, die Ländereien da drüben wären ganz anders. Sie sind in der Tat ganz anders durch ihre hohe Vegetation. Die Ritterschar der Bäume führt bebänderte Lanzen von Eschen und Linden mit sich, statt Rundschild und Federbusch von Olivenbaum und Platane; doch das Fußvolk dieser Sonnenarmee besetzt das ganze Land. Pfefferkraut überklettert die Böschungen, Lavendel verströmt sich im Heidegestrüpp, spanischer Flieder lugt über all die Felsen und Ruinen. Das Dachgestühl ist zugespitzt, die Häuser buckeln den Rücken, hier und da schaut ein Stoppelfeld hervor. Man trifft seine Vorbereitungen gegen Schnee und eiskalte Winterstürme, doch der Mauerputz hier ist wie in Arles aus dem gleichen Kalk, und die Mischung von Sonne und Putz ergibt die gleichen Farben. Jenseits von Sisteron, auf die Alpen zu, jenseits des Lure-Gebirges in Richtung des Vercors, da schweift ein Geruch, es ist der gleiche, den man in der Hügellandschaft des Var, auf den Anhöhen der Rhône, in der Wildnis der Crau-Ebene und im Tal der Durance einatmen kann. In Nizza ist die Luft mit Cassis durchwürzt, von Arles nach Salon hin hat sie einen Nachgeschmack von Gips, von Avignon bis Embrun riecht sie nach Vogel, und in Briançon, Lus-la-Croix-Haute und Die berührt sie ganz sachte ein Hauch von Eis. Aber eigentlich ist sie – weit und breit in der ganzen Gegend, die diese Städte und Marktflecken umschließt – aus dem Trampeln der Sonne über die duftreichen Kräuter entstanden: Sie ist der Saft aus dieser Rebenernte. Auch nachts von ihr zu kosten, macht keinerlei Unterschied, es sei denn, man wäre ein Spezialist. Man kann ihre Herkunft nur bestimmen, wenn eine langjährige Kenntnis der Gegend einem erlaubt, die Feinheiten zu riechen, die lokale Delikatesse aus dem Atem eines Tannenwaldes, das Quartier riesiger Herden, die Trockenheit eines Teiches, die brütende Hitze auf einer weiten Ebene voller Geröll, das Meer, den Gletscher oder wie beispielsweise Richtung Saint-Julien-le-Montagnier das verworrene Dickicht der Steineichen voller Wildschweinsuhlen.
Man sollte sich jedoch keinerlei Gleichförmigkeit vorstellen. Ich sagte zwar, man könne sich täuschen, wenn man des Nachts von dieser bedufteten Luft kostet, sobald aber der Tag anhebt, verbreitet sich unter der Sonne eine Vielseitigkeit höchst außergewöhnlicher Art. Da entfaltet die im Piemont aufsteigende Morgendämmerung ihr italienisches Szenenspiel in den Wäldern des Briançonnais, über den Gletschern des Pelvoux, auf den Weiden des Isère, auf den Sägezähnen des Vercors. Weiter runter springt sie auf den Gipfel des Ventoux, den des Lure-Gebirges, noch weiter herab auf die Sainte-Victoire und auf die Sainte-Baume. Und dann, ganz weit draußen, berührt sie das Meer. Nahe der Küste, von Marseille bis Nizza, oder noch genauer, von Carry-le-Rouet bis zur Mündung des Var, liegt alles noch im Dunkeln. Man wird lange warten müssen, bis die ersten Lichtstreifen des Tages in die düsteren Täler der Drôme gedrungen sind, in die schwarzen Schluchten des Diois, bevor man sieht, wie im Licht der Saum des Schaums aufflammt, der gegen die roten Felsen des Trayas brodelt. Von den Wäldern hin zu den Gletschern, von den Weiden zu den Felsen fließt das Licht auf die kleinen Täler zu und deckt die goldbraunen Berge des Nyonsais auf, den dunklen Schiefer von Gap, die romantischen Hügel des Var, die Einöden des Lure und des Canjuers; es betupft rotgolden die Zipfel der Dörfer, die in den Tälern an der Drôme hocken, an der Durance, Encrême, Asse, dem Buëch und am Verdon. Es schlüpft zur gleichen Zeit mit dem Briefträger auf seinem Fahrrad in den umfriedeten Hof der Bauernhäuser, hoch oben auf dem Plateau Albion; es lässt sich schließlich nieder auf der weiten Crau-Ebene, auf dem marmornen Kieselgestein und bringt dies lange Gras, so durchscheinend hell wie Glas, schaumig perlend zum Glitzern. Und jetzt funkelt das Meer wie der Schild des Achill: Die Segelboote flammen an den Anlegern von Cannes in ihrem Flaggenschmuck auf; der Kaffee dampft vor den Köhlerhütten in der Einöde des Var; die Zöllner fahren nach Montgenèvre die Zeitung holen; die rosigen Flamingos schwingen sich im Vaccarès in die Luft; der Regenpfeifer lässt seinen blauen Federstrich durch das Schilf der Rhône tanzen; die Drossel ruft auf den Hängen des Ventoux, in der Wildnis des Lure kehrt der Dachs in seinen Bau zurück; die Gemüsehändler debattieren auf den Terrassen der Cafés von Cavaillon; die Fischer von Cassis starten ihre erste Runde Boule; Marseille hat alle Busse in die Straßen losgelassen; Grenoble zählt seine Kletterhaken und Seile; Valence erwacht mit dem Dröhnen seiner Lastkähne; der Geruch von frischem Brot durchzieht Hunderte von Ortschaften, Tausende von Dörfern. Die in den Wäldern liegenden Schulen verschlingen die kleinen kugelköpfigen Kinder; die Lerche zirpt in der Crau, der Rabe krächzt im Alpenland, der Adler kreist über Lure, die Herden lassen die Wege rings in den Alpen aufqualmen. Die Tanker brüllen, rot angestrichen, an der Brücke von Caronte. Der Étang de Berre betört Saint-Chamas. Der gesamte Süden fängt zu leben an.
(1958)
2.
»Es ist vergeblich, vereinen zu wollen …«
Es ist vergeblich, vereinen zu wollen, was Gott getrennt hat. Es gibt zwei voneinander sehr unterschiedliche Provence-Gebiete: Die Basse-Provence verläuft flach an der linken Uferseite der Rhône, vom Ausgang des Mondragon-Durchbruchs bis zum Meer; und am Mittelmeer entlang vom Rhône-Delta bis zum Estérel. Das Flachland vom Comtat gehört genauso dazu wie die Ebenen des Var. Das ist die Provence aus der Zeit von 1840; das ist Tartarin, das ist Mireille, das ist die Provence, die der Tourist zu kennen glaubt, weil er sie vom Fenster seines Autos aus betrachtet hat, und weil er bisweilen die traditionelle Literatur gelesen hat. Es ist eine Provence, die an einigen Orten schließlich das wurde, was man sich von ihr erzählte. Zu Beginn des Jahrhunderts wäre es ebenso schwierig gewesen, am Ufer der Rhône einen Boule-Spieler anzutreffen, wie einen Schmetterlingsjäger; heute, das ist nicht zu verhehlen, gibt es beide.
Die Haute-Provence rollt ihre Hügelbastionen an einer Grenze entlang, die von Carpentras bis zur Auberge des Adrets reicht und dabei Vaison durchläuft, Nyons, Sault, Apt, Mirabeau, Aix-en-Provence, Ollioules, Pourrières, Seillons-Source-d’Argens, Carcès und die Abtei von Thoronet. In dieses Land sind die Alpen eingefallen. Die mittelhohen Hügelketten, die drei Viertel davon bedecken, zeugen in Spuren noch von einer geologisch-alpinen Umwälzung. Die Wildbäche, die sie durchlaufen, besamen das Land mit den Grundarten der Alpenpflanzen. Es gibt genauso viele Birken wie Olivenbäume. Die Hügelketten erheben sich allmählich zu den Plateaus, die aus der Eiszeit stammen, und wachsen dann zu richtigen Gebirgen an: Der Ventoux ist 1987 Meter hoch, das Lure, bis auf wenige Meter ebenso viel, das Sainte-Baume Massiv und das Sainte-Victoire Gebirge sind mehr als 1000 Meter hoch, und in den äußersten Grenzgegenden des Landes an schlecht ausgewiesenen Stellen, wo sich Piemont und Dauphiné mischen, da kommen die Berggipfel an 3000 Meter heran. Der Tourismus ist sehr wenig in diese Region eingedrungen. Der größte Teil der Menschen »auf vier Rädern« ist gezwungen, den Tälern zu folgen, und in den Tälern, so schön sie auch sind, findet man die Pracht und Ursprünglichkeit der Bergwelt nicht. Es ist also ein geheimnisvolles Land.
Doch gerade das, was bekannt, überbekannt ist, und von oben nach unten auf der Route Nationale 7 bereist wird, das wollen wir trotzdem im Einzelnen betrachten. Sobald man zwischen dem Wasser und den Felsen des Donzère-Mondragon durchgeschlüpft ist, öffnet sich die Basse-Provence. Man mag noch so oft sagen, dass sie bei Valence beginnt; Valence ist nur wie schlecht geschnittenes Brot; im Himmel hängen hier und da noch Spuren von Lyon. Sicher, für den Grönländer, den Holländer, den Belgier ist das der Süden, aber der Süden ist nicht die Provence. Das Grau hat noch nicht seine aristokratische Qualität. Andererseits glaubt man, südlich der Gebirgsenge eine Fülle von Farben zu sehen, und gerade da findet man das Grau, wahrhaftiges Grau von edelster Qualität. Glaubt nicht dem Maler, der gerade auf diese Landschaften ein Blutrot pfropft, ein Gelb von Gold, ein Essiggrün. Alles ist grau. Mit diesem Grau nämlich spielen im Winter das Weiß und die rosenfarbigen Mandelblüten; an dieses Grau wird sich das Blau des Sonnenhimmels schmiegen, und gerade aus diesem Grau werden die herbstlichen Flammen ausbrechen, ganz flüchtig zitronengelb gefärbt. Ein Grau, das alles Grau des Winters vereint und in weiter Ferne nur ein bisschen ins Violett eines Bischofs in partibus stößt. Ich spreche wohlverstanden nicht von den Zufahrten zur Route Nationale 7, wo die Farben (wir sollten es in heutigem Jargon sagen) »funktional« sind. Sie funktionieren im Handel nach dem Gesetz von Angebot und Nachfrage sowie dem Kurs auf dem Markt: da ist das Bonbonrosa von Pfirsichgärtnern, das Senfgelb von Senf, da ist das Grünblau des amerikanischen Weizens, das Kupferblau von Wein, der durch die Schwefelspritze geflossen ist, die künstliche Farbe von all dem, was auf den Märkten verkauft und demzufolge kultiviert wird. Aber sobald man die Obstgärten und das Ackerland verlassen hat, sobald man sich von der langen Allee der Tankstellen und Touristenattrappen entfernt, die zum Meer herabziehen, da umhüllt euch dieses Grau, ein eigenartiges Grau, aus intensivem Licht und zerriebenen Farben. Vor der Unterjochung der Rhône, die von nun an Leuchtreklamen mit Neonlicht versieht und Fabriken, die das Proletariat fabrizieren, mit Energie versorgt, hatte der Fluss an seiner Uferseite noch Wälder und Quellen sprudeln lassen. Samenkörner und losgerissene Wurzeln versahen das Wassergetümmel mit Bäumen, Blattwerk, Quellgemurmel und Schatten. Die Höhenzüge am rechten Flussufer ragten kaum über die Wipfel der Zitterpappeln, Birken, Erlen, und Tannen hinaus. Heute sind diese Rhône-Ufer begradigt, instand gesetzt, gerade ausgerichtet. Bulldozer haben alles entwurzelt und eingeebnet. Die zarte Romantik der Landschaft, die man durch die Stämme nackter Birken zwischen Charnève und den Margeries-Inseln sah, ist verschwunden. So bleiben nur noch die gebirgigen Weiten in Richtung des Tricastin, bedeckt mit dem bronzefarbenen Haar seiner Steineichen, bis hin zu den fernen Höhen des Roche-Saint-Secret, über den hinaus sich kronprinzlich Hügel nach Valouse und Estellon hinabziehen. Im Süden lässt sich bereits der Ventoux erahnen und richten sich von Anhöhen durchsetzte Ebenen ein, die das Tal noch bis nach Orange hin verstopfen: die Ranjarde, der Wald von Uchaux und an der äußersten Spitze der Buchtung, wo das Comtat sich ansiedelt, die Dentelles de Montmirail.
Wenn ich mich ein bisschen zu lange an ihrer Eingangspforte aufgehalten habe, so deshalb, weil die Provence an diesem Ort halb Nieder- halb Hochprovence ist und weil sich von hier aus die Trennung vollzieht. Die Hügel und selbst schon die Berge weichen bis hinter Nyons und Carpentras zurück, das Tal dehnt sich ins Flachland aus. Am Ende des letzten Jahrhunderts, nach dem Bau des Kanals von Carpentras, dort, im Dreieck Jonquières-Pernes-Carpentras und in all den Gebieten im Osten dieser Stadt, gegen Mazan, Malemort, Venasque zu, da war das flache Land von großen Ländereien mit Wiesen, Sykomore-Hochwäldern und großartigen Quellen überzogen, auf denen Rassepferde gezüchtet wurden, und eine ausnehmend feine, elegante Gesellschaft lebte. Die Pferdehändler der Hochebenen kamen, um sich aus diesen Gestüten einzudecken, und die herrschaftlichen Pferdezüchter hatten auf den Märkten berühmte Namen. Die Töchter dieser Herren brachten eine Nachkommenschaft von ausnehmend schönen Männern und Frauen hervor, der noch heute in der ganzen Gegend des Comtat kaum eine an Naturwüchsigkeit und oft auch an Reichtum das Wasser reichen kann. Die Söhne dieser Herrschaften, von hohen freiheitlichen Grundsätzen durchdrungen, was sich wohl ausschließlich im frischen Schatten von Sykomoren und großartigen Quellen entwickelt, sind alle unverheiratet geblieben. Mit Quasten, Kokarden und Ordensbändern sind sie durch die schönen Abenteuer des 19. Jahrhunderts gezogen, und fast alle sind um 1914–1918 herum ganz prächtig gestorben. So blieben also nur noch einige große, edle, einsame Häuser übrig in dem schönen, weiß bezäunten Wiesenland bei Monteux, am Ufer des Anzon oder entlang des Grande Levade. Schon lange züchtet man dort keine Pferde mehr. Hier schläft man, verbringt hier »die Weekends«. Die anderen Landgüter sind verschwunden, ersetzt durch ganze Baumschulen von Hochspannungsmasten. Die Hauptstadt dieser Zentauren im Gehrock war Carpentras. Seit deren Verschwinden lebt die Stadt vor allem in ihren Vororten, abgekehrt von den generösen Landschaften, um sich voll den politischen Geschäften zu widmen. In gewisser Entfernung morgens in der Frühdämmerung des Hochsommers, wenn der Verkehr noch schläft, erscheint die Satdt ganz typisch spanisch: Man riecht dort den Dampf der San-Bénitos-Suppe.
Übrigens, man muss es sich immer wieder klarmachen, sind alle Götter der Welt (inbegriffen selbstverständlich auch die aus Griechenland, die aus Israel und auch die des Augustus) hierhergekommen, um in diesem Land zu sterben, das vom Vorgebirge der Dentelles de Montmirail bis hin zu den südlichsten Ufern des Rhône-Deltas reicht. Man braucht nur ein bisschen in den Ackerböden von Bédarrides scharren, in den Gärten von Sorgues, im Lavendel von Blauvac, in den Spargelfeldern von Althen-des-Paluds, um daraus eine gefiederte Schlange hervorschnellen zu sehen, eine Nase von der Osterinsel, eine Steinfratze, einen Gott aus Arizona, ein tibetanisches Banner, einen archaischen Pansexualismus, einen universellen corpus christi. Aber so wie tote Städte, die im Sand der Wüsten nur vom Flugzeug aus sichtbar sind, so sind auch diese göttlichen Spuren nicht mehr wahrnehmbar, es sei denn, im Dämmerlicht des Morgens. Man muss zu einer Zeit auf den Beinen sein, zu der die Tank-Laster an den Rändern der Routes Nationales noch träumen, zu der die Vierradfahrer, ganz Riviera-krank, mit versoffener Nase vom Châteauneuf-du-Pape in den rosigen Laken sämtlicher Hotels »Zum Prinzen«, »Zum Universum« und des »Crillon« schlafen. Dann lässt der Triumphbogen von Orange seine Gefangenen Luft schnappen, und der Hügel von Saint-Eutrope befreit einen beachtlichen Tempel von seinen hohen Nebelwänden. Es ist die Stunde, in der der Arbeiter im Blaumann, dem es obliegt, die Sirene der Fabrik in Gang zu setzen, noch dabei ist, das Tomatenomelette, die Lyoner Wurst und die Sardinen aus Tunis in seinen Korb zu legen. Die Kneipen haben ihre Tischchen noch nicht hinausgestellt. Der Fuhrbetrieb mit Hérault-Weinen, mit Benzin aus Berre und Lafarge-Zement tröpfelt nur so dahin und zwischendurch hört man Schwalbenschreie und den Wind durch die Platanen streichen. Man kann in den Gässchen rings um den Frère-Mounet-Platz auch schon mal das raschelnde Dahingleiten einer Toga erwischen oder eine dieser schwarzgekleideten Frauen, alt wie Narwal-Knochen in zeitgenössischer Tracht, geschneidert von den Alakaloufs, die in kleinen Schritten zur Frühmesse von Saint-Florent laufen. Später gibt es überall die Hauptstraßen rauf wie runter nur noch die vielfarbigen Auslagen der eingeborenen Korbflechter, die ihre Körbe, alle von tschechischen Gefangenen geflochten, aufstellen.
Doch in derselben Morgendämmerung, in Avignon, auf dem Platz Saint-Didier, da verlässt Notre-Dame-du-Spasme ihre Altarwand, und erfrischt ihre nackten Füße auf dem Kieselsteinpflaster, das einem Stendhal die Gicht zum Schreien brachte. Zum Platz des Palastes hin muss man die Rue de la Bonneterie überqueren, den Stalingrad-Platz und die Rue Carnot. Alte Häuser, die sich seit Jahrhunderten nicht mehr die Zähne geputzt haben und obendrein auch noch schwerwiegende Rohrleitungsprobleme haben, hauchen ihren beißenden Odem auf eure Hacken. Das ist der heilige Johannes, der in der Wüste wehklagt. Man steht schier im goldenen Rachen der Propheten, die ein großes Maul haben und rohen Porree fressen. Der Fluss – den man weit über die Dächer hin brausen hört – spricht trotz seiner Schnelligkeit von Jordanien, vom Toten Meer, von Hirtenkulturen, wohl oder übel bis in alle Ewigkeit von Hammelfett durchduftet. Die helvetische Kühle, die euch hinter den Mauern des Palastes anspringt, verwundert, ohne zu entzücken. Die Luft kann noch so viel durchduftet sein von diesem Zimtgeruch der ausgiebig besprengten Bäume, der orientalische Muff der kleinen Straßen vertrüge sich besser mit den großen vertikalen Linien der halb ernsthaft, halb spöttelnden Fassade der Papstfestung, die sich gegen das bleierne Blau eines Himmels lehnt, den die Sonne noch nicht verschleißt. Dort kann man je nach Jahreszeit zwischen Münzhaus und Palaststufen wohl gut eine viertel bis dreiviertel Stunde lang Italienflair genießen, solange die Stadt sich nicht rührt. Sobald sie sich aber regt, ist’s vorbei, oder genauer, ist alles anders: Operette ist angesagt, Opera buffa, fast schon Così fan tutte, wenn man dem Treiben all derer folgt, die ihren Kaffee oder ihren Pastis trinken oder die frische Luft auf dem Georges-Clemenceau-Platz genießen. All diese wunderschönen Eindrücke ergeben sich übrigens wie einer aus dem anderen, ergänzen sich, bereichern sich, streichen sich gegenseitig heraus; und mancher Grünkramhändler im Unterhemd, manch Rentner in Basin-Weste mit Uhrkette und kreiselnder Gangart, manch kleines Mädchen mit Blumenkranz und gestärktem Röckchen: sie alle würden viel an Drolligkeit einbüßen, wenn man sie nicht mit der Gotik des 14. Jahrhunderts konfrontieren könnte und mit dem raubtierhaften Lufthauch der Gässchen. Es gibt übrigens rund um die Stadt sehr schöne Schutzmauern, denen es zwar an Höhe fehlt – wie alle meinen –, die aber durchaus noch in der Lage sind, Grundschüler zu Krüppeln zu machen. Avignon hat sein eigenes Loch-Ness-Monster: das ist der Mistral. Hier weht er mit außergewöhnlicher Heftigkeit, und die Altstadt verliert innerhalb von fünf bis sechs Minuten ihren Geruch. Aber den bodenständigen Poeten (ich will sagen: dem Schlachter, dem Tuchhändler, dem Krämer und ganz allgemein all denjenigen, die das Heft in der Hand haben und den Ladentisch dazu) sind Mistral und Rhône gute Freunde; jahrein, jahraus verschluckt er mehrere Dutzend Autofahrzeuge (Ladung inbegriffen) mithilfe des Flusses, in dessen Schlund er sie stößt. Die bescheidenen Leute oder diejenigen, die nordisch erzogen sind, behaupten, dass es sich dabei eigentlich nur um 2 CV’s handelt, andere sprechen von Lastern mit Planenabdeckung. Es ist tatsächlich so, bei Nordweststurm (oder Nordoststurm), da heult die Stadt wie Troja in der Nacht ihres Untergangs. Die Vehemenz in den Bäumen, der Fluss, der seine Schuppen gegen den Strich bürstet, die Gemäuer, die zittern, das Horn, das durch alle Flure tönt, der Staub, der von allen Seiten hochfegt, der weiße Himmel, die kranke Sonne, das alles erbaut eine Szenerie von außerordentlicher Erhabenheit. Avignon ist wahrlich eine Stadt, die mit keiner anderen zu vergleichen ist. Sie reißt sich von der Jetztzeit los, um die schwimmende Stadt des Gulliver zu werden.
Hat man die Brücke von Bonpas hinter sich gelassen, so betritt man auf der anderen Seite der Durance die Elysenfelder. Bis zu den Alpilles ist die Ebene von Zypressen überzogen. Es ist ein gewaltiger Trauergarten à la Louis XIV, ein Küchengarten für Euridike, die Gärtnerin. Von den Eygalières-Hügeln aus, den sogenannten Mas-de-Montfort-Stätten, blickt man über diesen Gemüse-Hades; man sieht darin all die Straßen sich kreuzen, auseinandergehen und wieder zusammentreffen. Vor der Erfindung der motorisierten Gärtnermaschinen war hier ein friedvolles Schattenland, der dahinwandernde Spaziergänger entdeckte ganze Barrieren natürlicher Zypressengrenzen, eine nach der anderen, sah vier oder fünf schwarze Frauen hingekauert den Boden um die Tomatenpflanzen aufkratzen oder je nach Jahreszeit einen kleinen roten Teufel, der seinen Spaten singend in die seidige, aschfarbene Erde fahren ließ; heute ist aus dem Gebiet die reinste Domäne klappriger Töfftöffs geworden und juck mich, kratz mich, laus mich, schüttel mich durch, ändern tut sich doch nichts am Kern der Sachlage und ihrer Dramatik; der ganze Lärm all dieser mannigfaltigen Vehikel verursacht von weit her das Geräusch eines gewaltig brodelnden Kessels, und der Staub, den die Autos aufwirbeln, wird ohne große Fantasieanstrengung zum Qualm, der infernalen Küchen entweicht.
Auf der Nordseite der Alpilles schindet sich Saint-Rémy bis aufs römische, ja, gallo-griechische Blut. Jansenistische Fingernägel verwendet er dazu. Gegenüber von Saint-Rémy, auf der Südseite der Alpilles, lässt Les Baux die Touristenbusse ihre Runden um eine Sekretion der Königin Johanna und um ein Gasthaus mit drei Sternen drehen.
Wenn man das hier hinter sich hat, dann steht man an der Schwelle zu einer außergewöhnlichen Landschaft. Wir sind weit entfernt von Gasthausmahlzeiten und durchschnittlicher Stundengeschwindigkeit. Von den letzten Gipfeln der Alpilles aus, oberhalb von Eyguières, von Espigoulier oder jenseits der Entreconque-Felsen, überschaut man eine weit ausgedehnte, wüstenartige Fläche, deren äußerster Rand im Meer verebbt. Das ist die Crau. Im Hochsommer, wenn die Grasquecke so weiß ist wie Schnee, werden diese Einöden von Fata-Morgana-Dünsten heimgesucht. Nach Entressen hin sieht man die Segel der Großen Armada aufziehen, Palmen von Vathek oder fantastische Landschaften eines Straßenmalers à la Gustave Doré, der hier mit flammender Kreide arbeiten würde. Nur zu Fuß kann man sich in diesen weiten Flächen von Kieselsteingeröll und hartem Gras ergehen. Nach stundenlangem Marsch trifft man bisweilen einen sardischen Hirten oder einen Menschen, ganz aus der Zeit geraten, umringt von seinen rund hundert Schafen mit gesenkten Köpfen. Fern im Osten blinkt wie blanker Stahl das Trévaresse-Massiv, an dessen Seite sich die Stadt Salon ihr Nest gesucht hat; jenseits des Massivs fließt die Durance, und in einer ihrer Talmulden befindet sich Aix-en-Provence. Im Westen und im Süden wird die Crau nur noch von einer dicken Mauer aus zähflüssiger Luft umrandet, in der die Hitze förmlich flimmert. Der einsame Reisende folgt Wegen, auf denen sich Spuren von lauter imaginären Monstern kreuzen. Ein simpler Marienfaden scheidet hier die Jetztzeit von prähistorischen Welten. Wenn es einen Ort aufrichtigen Nachdenkens zur Überprüfung moderner Maßstäbe gibt, dann ist es hier. Nichts von pittoresker Gefälligkeit noch irgendwie geartetem Komfort: man muss seiner selbst sicher sein, um diesen Landstrich zu mögen; die Straßen umgehen ihn, außer derjenigen, die schnurgerade wie ein 40 Kilometer langer Eibenbaum von Salon nach Arles führt. An diesem Dammweg entlang, der die Crau zu einem Drittel vom Norden abtrennt, was gut von den Alpilles aus zu sehen ist, halten einige Bauerngehöfte die Wacht; dunkel wie verbranntes Brot, und weitläufig wie Abteien oder Souks, umgeben von Zypressen und Mandelbäumen. Einige stehen leer, und der Wind lässt sie sausen wie Edgar Allan Poes Bienenkörbe. An diesem Abschnitt der Straße, die vom Kreuzpunkt von Samatane nach Salon führt, befinden sich alle Landschaften des Nostradamus. Nostradamus ist der größte Poet der Basse-Provence (und vielleicht sogar auch der Haute-Provence). Es ist falsch, ihm unterschieben zu wollen, er würde die Zukunft deuten. Er deutet sie nicht mehr oder weniger als Clément Marot, Maurice Scève, Jodelle, La Boëtie, Jean de Sponde etc. Manche seiner Verse gehören zu dem Schönsten, was ein Mensch je gedacht hat, je einbehalten könnte, um sein spanisches Gasthaus zu versorgen:*
Der Hafen Phocen von Koggen und Segeln bedeckt
netzt aus der Welle Limbus wie Fuß
Tod im Gipfeltrichter des heimgesuchten Himmels.
Oh Troja-Blut, Tod im Aufsteigen des Pfeils
Das Leben bleibt als bewegender Grund; der König weicht.
Vereinsamt wirst du dich finden, von Mauern umschlossen
Der Baum, der lange tot, vertrocknet war,
in einer einzigen Nacht wird wieder grünen
Die Mondgöttin in tiefster Nacht über dem hohen Berg
Herrin der Abwesenheit und ihr großer Feldherr
werden vom Statthalter um Liebe angefleht
Aus dem Umkreis, aus der Lilie
wird ein gewaltiger Prinz geboren
Sechshundert und sechs, sechshundert und neun,
Ein Kanzler stark wie ein Ochs,
Alt wie der Phönix der Welt,
der nicht mehr leuchten wird auf dieser Erde,
und das Schiff des Vergessens wird vorüberziehen, wird kreisen in den auserwählten Gefilden.
Sobald man die Quellen und das schattige Laub von Salon in Richtung Arles verlässt, um sich auf diese lange Gerade zu begeben, die auf die Sonne zustürzt, verwandelt sich alles, was man berührt, in Gold. In vergängliches Gold, in mythologisches Gold, in Gold, das einem im Nacken lastet, in ein Gold, das einem den Speichel eintrocknet, den Blick trübt, die Lunge verstopft, das einen in vergoldete Mumien verwandelt, während Nebelbilder die Felswände des eigenen Grabes mit grauen Fresken verzieren.
Es ist offensichtlich, dass das Automobil solche Transmutationen verwehrt. Hunderte von Leuten kutschieren jeden Tag mit »Bleifuß« von Salon nach Arles und von Arles nach Salon, ohne zu ahnen, dass sie die nicht greifbaren Ränder der Landschaft des Jenseits streifen. Das sind dieselben Leute, die davon träumen, den Fuß auf den Mond zu setzen, ja selbst im Kosmos herumzureisen.
Arles war zu Beginn des Jahrhunderts trotz Saint-Trophime, trotz der Arena, dem antiken Theater und der gallo-romanischen Grabsteinwege eine von diesen Städten mit offenen Straßen, die ins Leere laufen, so wie im Western. Etwas davon hat sie behalten trotz des Urbanismus und der Modernität, die in der kunstvollen Anlage vorherrscht. Manch eine ihrer Nächte wird erschüttert von einem Gestöhn, das ebenso aus der Rhône wie vom Minotaurus stammen könnte. Arles ist das Tor zur Camargue. Die Camargue ist ein Dreieck voller Vögel und Rinder.
Am Kreuzpunkt von Samatane, von dem ich im Zusammenhang mit der Entgrenzung nostradamischer Landschaften schon gesprochen habe, überquert die Straße, die von Saint-Rémy, Les Baux und Monries kommt, leicht schräg-winkelig die Straße von Arles nach Salon und dringt tief in die Kleine Crau-Ebene ein. Sie führt zum Étand de l’Oivier, an dessen Ufer Istres liegt, dann weiter abwärts am Ufer des Étang de Berre entlang bis zur Bucht von Ranquet und schließlich bis nach Martigues, wobei ich Fos dem Ort Martigues vorziehe.
Fos liegt am Meer, am Rand des Golfs mit gleichem Namen und am Ende einer anderen Straße, die durch die Große Crau geht und am Rande melancholischer Sümpfe verläuft. Fos ist ein kleiner Teil von Ville d’Ys. Noch dazu ist es der einzige Ort, wo das weiße Licht mit dem Tamarisken Laubwerk übereinstimmt, das der Wind zerzaust, einig mit dem Meeresschaum und dem Sandstaub aus den Wüsten. Die Melancholie der Sümpfe schläfert jegliche Lebensform ein. Dort ist man allein. Dort hört man die großen Stimmen: den Wind, das Meer, das Echo aus den Schluchten. Man befindet sich auf einer kleinen abgeflachten Landzunge zwischen Himmel und Wasser. Thunfische und jene bizarren Wesen, die einst den Schrecken des Odysseus hervorriefen, die Seekühe, kommen zum Spielen an den Strand. Ein staubiger Wüstenwind quirlt den Sand auf. Hier tanzt man nicht des Sonntags. Hier badet man nicht, aus Gründen nichtiger Gefahren, die dennoch als böse und furchtbar gelten. Man ist mitten im silbrigen Staub, und nichts geschieht, als eben in dieser Art silbrigem Nichts zu sein.
Martigues wird das »Venedig der Provence« genannt; es hat mit seiner ruhmreichen Taufpatin eigentlich nur gemein, dass man hier das Erdöl wie auf dem Quai des Esclavons riecht, wenn der Wind von Mestre her weht.
Von Martigues aus kommt man über eine Straße nach Marseille, die an der nördlichen Seite der Bergkette von Estaque entlangführt. Diese Straße lehrt einen nichts. Andererseits, wenn man sich nach Carro begibt, erfährt man viele Dinge, und natürlich sollte man sich in diesen Kreidebergen, die das Kap Couronne beherrschen, die Lektüre von Homer vornehmen. Man wird ständig lauter interessante Erfahrungen machen, wenn man langsam in Richtung Val-de-Ricard, Laure, Le Douard, Le Rove wandert. Von Rove aus hat man beim Verlassen des Tunnels übrigens, den schönsten Blick auf Marseille, einen wirklich beachtlichen Blick, aber noch wichtiger ist, dass man hier wahrlich gut platziert ist, um diese Stadt zu erfassen, die unter so viel dümmlichen Legenden und elementaren Missverständnissen leidet.
Die Marseiller sind keine Seefahrer; sie sind »Navigatoren«. Denn mit ihnen werden die Passagierschiffe bemannt. Selten wagen sie sich auf kleine Schiffe: Sie gehen auf Frachtschiffe, aber nicht auf Fischerboote. Trotz der Mittelmeerstürme, die ebenso wild wie die Stürme des Ozeans sind, kann man von Perpignan bis Livourne auf Friedhöfen noch so viel suchen, aber »im Meer Ertrunkene« findet man dort nicht. Nebenbei gesagt: eintausend (von 800.000) Marseiller gehen zum Vergnügen ans Meer, der Rest ist entschieden für die Berge. Sobald der Marseiller freie Zeit hat, nimmt er sein Auto und begibt sich in die Alpen, im Winter, um Ski zu fahren; im Sommer, um zu picknicken. Daher diese Menge von Vereinen in Marseille, alle erdgebunden, erdverbunden bis zur Fußgebundenheit: die Marseiller Exkursionisten, die Saint-Henri Wanderer, die Alpinisten der Barasse etc., etc. Einige Leute gehen tatsächlich fischen, allerdings eher mit Wurfangeln auf die Felsen der Corniche oder auf die von Les Goudes; einige wagen sich auf Nachen bis zum Seegebiet um das Schloss If vor, das sind die Tollkühnsten; der Knochenmann zieht eine grausige Ernte daraus, selbst bei schönem Wetter. Der normale Marseiller ertrinkt nicht: er wird auf dem Weg nach Venelles im Auto zerquetscht. Der Marseiller träumt nicht von Ozeanien oder von der Südsee, er träumt nur von Festungen oder von den Alpes-d’Huez. Alles andere ist einfacher (und schmeichelhafter für ihn) als sich einen Marseiller vorzustellen, der empfänglich für den Gesang der Sirenen wäre. Handelt es sich allerdings um ihn selbst, ist er so empfindlich, dass er sich mühelos irgendwoher diesen Gesang einbildet, um flugs den Weg in die Berge einzuschlagen.
Vielmehr als ein Hafen ist Marseille ein Handelshaus: hier spielt man nicht mit dem Meer, man treibt Handel. Prächtige Besitzungen der Schiffseigner aus der Zeit um 1900 auf den Septèmes-Hügeln, auf den Höhenzügen der Viste und den Bergkuppen von Saint-Barthélemy, sind von der Eisenbahnstrecke aus den Alpen aufgerissen worden und heute mit der Nord-Autobahn ganz verschwunden; es gab dort zwischen den Pinien bewundernswerte und auch weniger bewundernswerte Häuser, die mit ihren Quadersteinen all den Dünkel, den Hochmut, die Eitelkeit ihrer Besitzer widerspiegelten, samt ihrem Bedürfnis, sich zu zeigen. Die wirklich bewundernswerten Häuser aber hatten jene zwingende Schönheit, die sich an den Ufern dieses Meeres gerne niederlässt. All die Häuser, mit »schöner Aussicht« gebaut, bisweilen auch im Schatten des Nordhangs, hatten Türmchen mit Fernrohren, von denen aus sie die Weite und den Zeichenträger ausspähten, um korrespondieren zu können. Zu jener Zeit ohne Radio und Telefon (ich spreche von vor 50 Jahren) konnte man mit Armbewegungen, die ein Kreuz signalisierten, auf der Stelle Preisanstieg oder -nachlass, aller möglichen importierten Ware anzeigen. Mithilfe dieser Fernrohre und dieser Semaphore ließ man die Schiffe an der Reede warten, oder beschleunigte ihre Bewegung, danach stieg man hinunter in die Börse, um von dem provozierten Preis zu profitieren. Geschäfte sind schon immer das Wesentliche von Marseille, der »Kraftstoff«, der ihr Herz in Schwung bringt. Sie haben nur ganz einfach die Romantik vom Beginn des Jahrhunderts verloren: die Hügel am Golf geben keine Meerzeichen mehr, die Reeder stürzen nicht mehr in Droschken mit schnellen Trabern zur Börse, die »Geldsäcke« promenieren nicht mehr über die Canebière oder den Cours Belsunce, umschlungen mit Spitzen aus Malines und bestäubt mit Patchouli-Parfüm; die kleinen Aufgelder bringen keine Diamantenhalsbänder mehr ein, und so ein »Schubiak«, der in der Straße Zum-Grünen-Teppich einen Teppich sein eigen nennt, der legt den lieber auf die hohe Kante und treibt sein Geschäft in schmutzigen Laken vom Bett aus, mit Telefon zur Seite, statt den Gepflogenheiten aus einstmals großen Familien nachzugehen, die ihre Frachter nach der Tante »Hélène« benannten.
Bleibt also von dieser Epoche nur noch der Habitus gut gewichster Schuhe zurück (auch wenn sich das seit dem letzten Krieg und vor allem seit der Wildledermode nach und nach verliert). Es gab früher mehr Schuhputzerbuden und kleine Stiefelwichser mit Kasten als Bäckerläden. Der Marseiller hätte eher auf Brot als auf blitzblanke Schuhe verzichtet. Marseille ist die einzige Stadt auf der Welt, wo die Schuhputzer ein Spezialpuder benutzten, um die Schuhe »knarzen« zu lassen. Diese Erfindung ist seither leider verschwunden. Auf dem Cours (dem italienischen Corso) zu promenieren, bestand darin, Schuhe zu tragen, die blankgewichst wie Firnis waren und knarzen mussten. Seit Wildleder und Mokkassins in Mode sind, haben sich diese Gewohnheiten verflüchtigt (der Existenzialismus trägt dazu nichts bei, ein Marseiller Existenzialist lässt sich die Schuhe polieren, falls sie nicht aus Wildleder sind.) Die Schuhputzerbuden sind weniger zahlreich; sie haben sich alle eine wie die andere unter dem Boden verkrochen; kurzum, sie sind nicht mehr diese »Salons des gepflegten Gesprächs«, diese »Hohen Schulen« der Philosophie, südländisch, wie sie nun mal waren. Eher haben sie – sagt man – etwas von Polizei an sich. Das hatten sie auch in alten Zeiten gehabt, aber mit tropischer Grandezza; seit sie Meinungsdelikten nachgehen, sind sie nordisch und stumpfsinnig geworden. Trotzdem ist eine Revolution in Marseille nur möglich mit Unterstützung der Schuhputzer.
Es gibt hier viel orientalische Luft und es ist unbestreitbar, dass der Schatten eines Harun al Raschid mit fürchterlichen Schlägen in der bürgerlichen Holzvertäfelung rumort; diese okkulten Manifestationen können einen an die Anwesenheit eines schlagenden Herzens denken lassen; jene, die sich davon vereinnahmen lassen, bezahlen es teuer. Die Stadt ist weitläufig, generös (in ihren Formen und ihrem Licht); sie hat die Schönheit von Perlmutt und den Klang von hohlen Muscheln. Sie ist zum Seewind hin offen durch die Canebière, eine Nord-Süd-Furche, in der man noch immer ein bisschen spazieren kann; leicht lässt sich unter den Passanten der alte vom jungen Beau unterscheiden: Mit halb kreisenden Tanzschritten stolzieren sie selbst da, wo’s nichts zu stolzieren gibt; sie sind von oben bis unten gepflegt, das heißt, zu den polierten Schuhen kommt noch das pomadisierte Haar, das Gesicht, selbstverständlich behandelt nach Art der »heißen Dampftüchlein«, ist eine Sache für sich, das übrige zeugt von recht lateinamerikanischer Eleganz. Die alte Schöne wie auch die junge gibt’s dort ebenso im Überfluss. Erstere verblüfft mit ihrer Korsage, ihrem Louis xv. Körper und segelt wie eine Fregatte; die zweite ist wie eine kleine Nuss, dunkelhaarig und frech; man muss wahrlich ohne jede Fantasie sein, wenn man dabei an das »Kreuz ihrer Mutter« dächte. Von Ost bis West, verlängert durch den Cours Saint Louis und die Rue de Rome, ging der Cours Belsunce; von dem sind nur ein paar Trümmer übriggeblieben. Seit man die Viertel hinter der Börse abgerissen hat und vor allem, seit man sie rekonstruierte, hat der Cours Belsunce seine einzigartige Besonderheit eingebüßt. Zur Zeit meiner Jugend war das selbst in der größten Hitze ein Hafen voller Kühle und »feiner Lebensart«; dort kam unter dem Sonnenschirm der Seidenrips mit kleinen Schrittchen knisternd ins Rascheln; dort gab es die steifen Melonenhüte, die großen Begrüßungszeremonien und die gesamte Komödie der sonnigen Länder.
Der Prado von Marseille war eine schöne Prachtstraße, ohne je den aristokratischen Anflug des Prado von Madrid zu haben. Er wird heute vom Autoverkehr verschlungen, bis auf den Arm, der zum Meer führt, wo er das geblieben ist, was er ursprünglich einmal war: eine Residenz voll Blattwerk und Vögel. Auf diesem Abschnitt wird die Allee noch von Wohnhäusern eskortiert, hübsch die einen, die anderen in reichlich ergreifendem Stil des neunzehnten Jahrhunderts, aber alle sind umgeben von schönen Bäumen und Rasenplätzen, bisweilen sogar von Buschwald. Sie führt in schönster Tradition der Abenteuer-Alleen hin zum Meer.
Von hier aus kommt man nach Les Goudes und zur Steiluferstraße mit ihren weißen Felsen, die noch vor Cassis enden. Doch im Hinterland von diesem Prado, auf Aubagne zu, öffnet sich wiederum eins der fruchtbarsten und opulentesten Täler der Provence. Davon sieht man hier und da nur noch Überbleibsel, mitten im grausigen Wirrwarr der Süd-Autobahn, die hier entsteht. Trotz dieses schrecklichen Opfers der Moderne an den Gott der Geschwindigkeit, sieht man mitten zwischen den stumpf niedergeschlagenen Hochwäldern, den umgestürzten Weiden, dem zerstückelten Wiesenland, noch wunderschöne Inseln voll Schatten und Frieden unter Ulmen, Hainbuchenhecken, Holunder- und Fliederbüschen, wo wohl noch für ein Weilchen die Kunst zu leben fortbesteht, diese Kunst, wie sie in der Belle Epoque im Tal der Huveaune existierte.
Manche Viertel der Stadt, wie das Camas, der Cours Gouffé, die Rue de la Turbine, die Avenue du Domaine-Flotte, haben viel Charme bewahrt. Einige Häuser im Stil kleiner Klöster, bisweilen übrigens von winzigen religiösen Bruderschaften bewohnt, besitzen noch romantische Gärten. Dort braucht man nur einen Baum, etwas Efeu, einige Glyzinienranken und ein bisschen Glaubenseifer, auf dass all die metaphysischen Konstruktionen der modernen Zivilisation in hallende Tiefen niedersinken. Die Straßen, oder genauer, die Gässchen dieser Viertel sind noch ganz empfindsam und ergriffen vom Schritt des Spaziergängers.