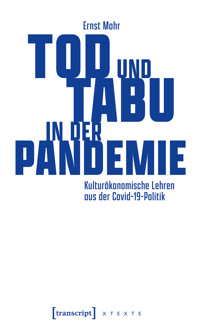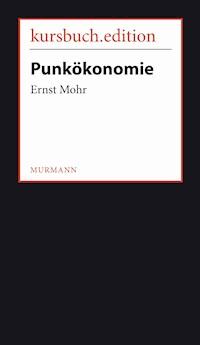
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kursbuch
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Hipster, Punks und der "große Klau" Am gesellschaftlichen Rand versammeln sich Subkulturen und Jugendkulturen. Ökonomisch gesehen stellt er also Risikogebiet dar: häufig niedriger Bildungsstand, verbreitet Arbeitslosigkeit, dafür hohe Sozialkosten – kurz: reiner Kostenfaktor in der Gesamtbilanz. So die eine Sicht. Eine andere erkennt, dass der innovationswirksame Wandel des Zeitgeistes vom Rand her befeuert wird, kaum von der "tragenden" Mitte der Gesellschaft. Habitus, Lebensstil, Mode als Rebellion – das funktioniert so lange, bis der Mainstream zugreift, Versatzstücke der Gegenkultur übernimmt und sich als neuen Trend einverleibt. Damit ist der Lauf der Kommerzialisierung eröffnet und der Rand gezwungen, Neues zu produzieren. Sonst funktionieren seine gegenkulturellen Botschaften nicht mehr. Also doch nicht nur Kostenfaktor? Welches wirtschaftliche Zusammenspiel zwischen Rand und Mainstream hier am Werk ist, dieser Frage geht Ernst Mohr in brillanter Weise nach. Und zeigt, warum und wie dieses Spiel zwischen dem produktiven Konsumenten als neuem Wirtschaftssubjekt und der Geschmacksindustrie als dessen Ausbeuter so gut funktioniert. "Der Rand produziert (Stil), der Mainstream konsumiert (ihn auch) und der Markt dazwischen ist auch noch für irgendetwas da."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ernst Mohr
Punkökonomie
Stilistische Ausbeutung des gesellschaftlichen Randes
Inhalt
kursbuch.edition
Vorwort
Teil I STILISTISCHE INNOVATION
1. Der produktive Rand der offenen Gesellschaft
Stil und Postmoderne
Hipster
Skinhead und Punk
Aus dem schwarzen Gettostil: Beat, Hipster, Rock ’n’ Roll, Teddy Boy, Mod
Jugendkulturen
Camp
Auf dem Weg zur Stilökonomik
2. Der stilistische Innovationskreislauf
Kundschaftung und Besitznahme
Ko-XY
Das Perpetuum mobile
Die verlängerte Werkbank
3. Appropriation der Res nullius
In der ewigen Jäger- und Sammlerökonomie
Die große Linie
Res nullius Stil
Zur neomarxistischen Kritik der verlängerten Werkbank
4. Der »gute« Geschmack
Kontraproduktive Objektivität
Selbst erhöhen wir uns
Womit wir so erfolgreich sind
Wie jeder auf seine Weise durchkommt
5. Das Tabu der unfertigen Identität
Tabu und das Soziale
Der Zusammenhang zwischen Tabu und Stil
Tabubrecher Camp
6. Die Genius-Ideologie
Wo sie sich heute zeigt
Auf keinen Fall im namenlosen Künstler
Das Aschenbrödel kollektiver Genius
7. Die (Kant’sche) Uninteressiertheit
Immanuel Kants überraschende Anhängerschaft
Alternativlos uninteressierte Rhetorik
Die große Absetzbewegung
Zur Unterscheidung von Mainstream und Rand der Gesellschaft
8. Nichtgoutieren und De-facto-Tolerieren
Nichtgoutieren
De-facto-Tolerieren
9. Die stilistische Superinstitution der offenen Gesellschaft
Der »gute« Geschmack und das Tabu der unfertigen Identität
Die Genius-Ideologie und die (Kant’sche) Uninteressiertheit
Nichtgoutieren mit De-facto-Tolerieren
Der komparative Vorteil des Westens
Der gesellschaftliche Diskurs über den Stil
Stilwirtschaft ohne Mainstream?
Teil II DIE KRITIK DES PRODUKTIVEN KONSUMENTEN
10. Paradigmenwechsel
Grundlagen
Anwendungen
Eigentümerschaft, Eigentum und Property-Rights-Theorie
Geschenkökonomie und Geschenk»ökonomie«
Der generalisierte produktive Konsument
11. Das Kartenhaus
Angebot und Nachfrage
Konsumieren
Konsumentensouveränität
Produktion
Konsumtheorie
Der Wirtschaftskreislauf
Die Trennbarkeit von Allokation und Distribution
Private und öffentliche Güter
Die unsichtbare Hand
Staat und Leviathan
Eigentumstheorie
Ideologie
Zum Entweder-oder der angebots- und nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik
Fazit
Nachwort: Lob der ökonomischen Zeitdiagnostik
Literatur
Über den Autor
Impressum
»Es ist uns bloß angelegen, das Wort Stil in den höchsten Ehren zu halten, damit uns ein Ausdruck übrigbleibe, um den höchsten Grad zu bezeichnen, welchen die Kunst je erreicht hat und je erreichen kann.«
Johann Wolfgang von Goethe1
1 Zitiert nach Martini, Müller-Seidel 1962, Band 20, S. 171.
Vorwort
Punk hat als Stil seine Fußspuren in der Konsumwelt hinterlassen. Punkökonomie ist eine Wirtschaft, in der Stil zum Wirtschaftsgut geworden ist. Stilökonomik ist die Ökonomik des Wirtschaftsgutes Stil. Es geht ihr aber nicht, wie Goethe, um den Stil in der kleinen, gleichwohl paradigmatischen Welt der Kunst, sondern um ihn in der viel größeren Welt unseres Alltags – und auch um das Allerweltlichste: die Wettbewerbsfähigkeit! Nicht um die einzelner Unternehmen, sondern um die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft als Ganzes, soweit und in dem Ausmaß sie von der stilistischen Innovationskraft beeinflusst wird. Es geht ihr um das innovationswirksame und damit wirtschaftliche Zusammenspiel zwischen Mainstream und Rand der Gesellschaft.
Der mit und in der Stilökonomik neu entwickelte Denkansatz, der nach den kulturellen und gesellschaftlichen Faktoren fragt, die die stilistische Innovationskraft einer Volkswirtschaft beeinflussen, kann in unversöhnlicher Konkurrenz zum traditionellen ökonomischen Denken gesehen werden. Er kann aber auch als zeitdiagnostischer Beitrag zum besseren Verständnis dessen verstanden werden, was das Charakteristische am Neuen einer Wirtschaft der postmodernen Gesellschaft ist. Nennen wir es die Punkökonomie. Als spezifisch europäische Seite kann in diesem Zusammenhang die Sorge um Europas wirtschaftliche und kulturelle Zukunft aufgefasst werden. Auf die Frage, wie das alte (reife) Europa in einer immer dynamischeren Welt bestehen kann, ohne auf dem Altar ihrer Volkswirtschaft seine Kultur zu opfern, gibt die Stilökonomik die Antwort: Indem Europa sich auf seine Kultur besinnt! Denn sie ist das Schwungrad seiner stilistischen Innovationskraft, sein wahrscheinlich letzter strategischer, weil schwer imitierbarer komparativer Vorteil im globalen Wettbewerb.
Teil I STILISTISCHE INNOVATION
Innovation stellt man sich in den Wirtschaftswissenschaften so vor: Jemand wagt um seines geldwerten Vorteils willen etwas Neues, macht zum Beispiel eine Erfindung. Dieser »Jemand« ist ein Unternehmen oder ein (künftiger) Unternehmer, das oder der mit dem Neuen einen Vorteil gegenüber der (künftigen) Konkurrenz anstrebt. Das Neue gerät so in Wettbewerb mit dem Alten, und wenn es sich durchsetzt, gehört es zum Fortschritt. Dem Fortschritt zuliebe muss dafür gesorgt werden, dass möglichst viele etwas Neues wagen. Dafür sind günstige Rahmenbedingungen wie das Patentrecht und andere Rechte zum Schutz des geistigen Eigentums zu schaffen, weil sie erst sicherstellen, dass Dritte nicht einfach das nachahmen dürfen, was »jemand« um seines geldwerten Vorteils willen wagt. Damit rentiert es sich, Neues zu wagen, wird Innovation stimuliert und der Fortschritt gemacht. Nach diesem Muster ablaufend stellt man sich in den Wirtschaftswissenschaften den Innovationsprozess vor.
Auch Stile werden »erfunden« und gehören dann, wenn sie sich durchsetzen, zum Neuen. Läuft aber stilistische Innovation zum Beispiel in Mode, Einrichtung, Lebensart nach eben diesem wirtschaftswissenschaftlich konstruierten Muster ab? Im Folgenden wird sich zeigen, dass hier ganz andere Akteure mit ganz anderen Zielsetzungen das Neue schaffen und ganz andere Rahmenbedingungen auf die stilistische Innovationskraft der Wirtschaft Einfluss nehmen als in den Wirtschaftswissenschaften bisher gedacht.
1. Der produktive Rand der offenen Gesellschaft
»It’s terrible to say, very often the most exciting outfits are from the poorest people.«
Christian Lacroix2
»In mancher armen Hütte wohnt der Geschmack angenehmer als im überladnen Palast; in einer anständigen Kleidung kann er sich edler zeigen als im buntesten Flitterstaat; an einer einfachen Tafel reizender als beim Krönungsfest des römischen Kaisers.«
Johann Gottfried Herder3
»Nicht vom Zentrum aus geschieht die Entwicklung, die Ränder brechen herein.«
Ludwig Hohl4
Stil und Postmoderne
Was einem Modeschöpfer unserer Tage, Christian Lacroix, wert ist, festgehalten zu werden – dass innovativer Stil besonders am sozialen Rand einer Gesellschaft gedeiht –, war bereits dem Philosophen Johann Gottfried Herder vertraut: Stilistische Qualität findet weniger im wirtschaftlichen Zentrum der Gesellschaft statt – ob nun mit dem Adel aus Herders Zeit oder dem heutigen Mainstream besetzt – als außerhalb davon. Der Philosoph Ludwig Hohl gibt Herders und Lacroix’ Feststellung eine verallgemeinernde Wendung: Sie gilt nicht nur für Reich und Arm, sondern ganz allgemein für Mainstream und Rand der Gesellschaft. Nicht der Mainstream, sondern der Rand ist die Quelle von Veränderung, die aus ihm heraus in den Mainstream hineinfließt.
Dabei bricht der Rand – entgegen Hohls Aussage – weniger in den Mainstream herein, sondern wird als Inspirationsquelle vom Mainstream systematisch genutzt. Anstatt selbst Neues zu schaffen, begibt sich eben zum Beispiel der Modeschöpfer aktiv auf die Suche nach stilistischen Anregungen, um sie dem Mainstream später anzudienen. Dieser Prozess, das Hereinholen der am Rand der Gesellschaft aufkommenden stilistischen Innovation in den Mainstream, ist der Gegenstand der Stilökonomik und das Charakteristische der Punkökonomie. In ihr wird er konkret mit der Hypothese untersucht, dass soziale Normen, Konventionen und Tabus das menschliche Verhalten ebenso beeinflussen wie staatliche Ge- und Verbote oder Steuern und finanzielle Anreize. Die Stilökonomik erweist sich so als Teilgebiet der Institutionenökonomik an den Schnittstellen zur Soziologie und Konsumanthropologie. Sie versucht den Prozess der stilistischen Innovation zu verstehen, indem sie dem Sinn nachgeht, den Menschen am Rand der Gesellschaft ihrem stilistischen Handeln geben. Die Stilökonomik sucht mithin wie die ökonomische Neoklassik nach dem rationalen Kern menschlichen Verhaltens – aber nicht im Sinne eines theoretischen Konstrukts, sondern in dem von den Menschen ihrem Handeln gegebenen Sinn. Die Modelladäquanz der ökonomischen Neoklassik wird in der Stilökonomik also ersetzt durch Sinnadäquanz.
Der Rand der Gesellschaft besteht aus Subkulturen, die sich durch eine quasi natürliche Zugehörigkeit beispielsweise zu einer ethnischen oder religiösen Gruppe auszeichnen, Neostämmen, die für eine Art freiwilliger Wahlverwandtschaft wie zum Beispiel beim Hipster stehen, und aus Jugendkulturen, die durch eine natürliche Temporalität der Zugehörigkeit charakterisiert sind. Wichtig daran ist der Umstand, dass sie alle in einer mehr oder weniger starken Opposition zum gesellschaftlichen Mainstream stehen. Es wird sich in den nachfolgenden Überlegungen zeigen, dass gerade diese Opposition eine katalytische Wirkung auf die stilistische Innovation hat. Denn in dem Moment, in dem ein Stil vom gesellschaftlichen Rand in den Mainstream »hereinbricht«, verliert er am Rand als Mittel zur Abgrenzung an Bedeutung. Und je mehr die Geschmacksindustrie den Rand als Quelle stilistischer Innovation nutzt, umso mehr muss diese sprudeln, um immer neue Mittel zur Differenzierung vom Mainstream zu erschaffen. Stile kommen und gehen und mit ihnen die Gruppen, die sich an ihrem Stil erkennen lassen. Was bleibt, ist die Opposition gegenüber dem Mainstream, die sich in immer neuen Formationen zeigt.
Stile, wie sie zum Beispiel aus dem Hipstertum, dem Punk, Beat, Rock, den Teddy Boys, Mods, Skinheads und aus den Boarder-Kulturen herausgewachsen sind, wurden alle von Unternehmen der Geschmacksindustrie als Quellen für neue stilistische Angebote an den Mainstream entdeckt. Das Trendscouting der Geschmacksindustrie sucht gezielt nach ihnen, und Funde werden planvoll domestiziert, um sie in goutierbarer Form dem Mainstream anzudienen. Da Stilökonomik auch die Ökonomik der offenen, postmodernen Gesellschaft ist, in der die gesellschaftliche Position des Einzelnen weniger vorgespurt als frei gesucht und gefunden ist, stehen mehr oder weniger ausgeprägte Wahlverwandtschaften außerhalb des Mainstreams – Neostämme und Jungendkulturen – im Fokus der Stilökonomik und finden geschlossene (wie zum Beispiel religiöse) Subkulturen weniger Berücksichtigung.
Wo die Wahl die Verwandtschaft macht, ist das Kommen und Gehen nicht deren Substanz. Eine Wahlverwandtschaft braucht etwas, was sie – für die Zeit ihrer (vielleicht flüchtigen) Existenz – als Gemeinsames nach außen anzeigt, was aber zugleich auch als Zeichen der Zusammengehörigkeit wirkt. Dieses Etwas muss nach innen als Kitt genauso wirken wie nach außen als Trennmittel.
»Das Spezifische eines postmodernen Stamms ist ganz klar seine Ästhetik«, stellt der französische Neostammexperte Michel Maffesoli fest.5 Viel mehr als ihre Ästhetik steht einer solchen Wahlverwandtschaft in einer im Fluss befindlichen Gesellschaft auch nicht zur Verfügung. Mit Blick auf den identitätsspezifischen, der Ästhetik vorangehenden Geschmack formuliert es der deutsche Soziologe Hans-Peter Müller so: »In dem Maße, in dem verbindliche religiöse und moralische Wertsysteme als Orientierungsinstanzen ausfallen, ist der Einzelne auf seinen Geschmack, dieses intuitive, spontane und ›quasi-instinktive‹, praktische Urteilsvermögen, verwiesen.«6 Das Wiederfinden ihres konstituierenden Stils im Mainstream zwingt die Mitglieder einer Wahlverwandtschaft also zu einer Reaktion, ohne die ihre Identität in Gefahr geriete.
Eine sinnadäquate stilistische Theorie braucht keine ausgefeilte ästhetische Theorie als Grundlage, denn die Mitglieder von Wahlverwandtschaften haben und brauchen auch keine. Ihnen geht es lediglich ums selektive Dazugehören und darum, es lernend und praktizierend sich selbst und anderen zu demonstrieren. Die sinnadäquate Theorie muss demzufolge ebenfalls um Kernbegriffe wie Ein- und Abgrenzung, Lernen und Praktizieren kreisen. Die ökonomischen Grundkonzepte für Produkteigenschaften – die Komplementarität und die Substitution – sowie die Grundidee der Konvention als handlungsleitende Restriktion reichen dafür aus.
Stiltechnisch gehört zu einem Stil die Gesamtheit aller Dinge, mit denen sich eine Wahlverwandtschaft umgibt, und aller Verhaltensweisen, die er zeigt. Dabei kann eine solche Ansammlung von Dingen und Verhaltensweisen nur durch Wiederholung der Mitglieder zu einer Gesamtheit und als solche verstanden werden. Denn nur durch (auch von außen beobachtbare) Wiederholung ist es sowohl den Mitgliedern einer Wahlverwandtschaft wie auch Dritten möglich, den Dingen und den Verhaltensweisen als Ganzes einen Sinn zu geben. Sinn geben heißt konkret, die Elemente einer solchen Gesamtheit als Komplementaritäten zu verstehen, als etwas, was zusammengehört und ein Ganzes ergibt. Ein Stil ist somit eine einzelne Struktur von Komplementaritäten in der viel größeren Welt aller wiederholt gezeigten Dinge und Verhaltensweisen. Er baut auf ein durch Wiederholung entstandenes, eine spezifische Wahlverwandtschaft anzeigendes Wissen und zeigt alles, was eine Wahlverwandtschaft als solche erst erkennbar macht. Durch Wiederholung werden Hipster, Punker, Rocker und Skinheads an ihrem spezifischen Stil erkennbar.
Weil durch Wiederholung entstanden, ist ein Stil eine Konvention.7 Konventionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie genauso gut anders lauten könnten. Es ist egal, was genau als Konvention wiederholt wird, solange es nur wiederholt wird und jeder, der dazugehört, sich daran hält. Am Ende kommt eine Struktur von Komplementaritäten heraus, die erkannt wird, allein weil sie oft genug wiederholt worden ist. So stand eine Zeit lang die Sicherheitsnadel im Ohr für den Punker, weil sie mit anderen, immer denselben Zeichen immer wieder zusammen gezeigt wurde.
Jeder Stil weist einen Grad an Beliebigkeit auf. Auch die Queen bliebe die Queen, zeigte sie nur hartnäckig genug ihre Sicherheitsnadel im Ohr. Auch der Punker bliebe der Punker, zeigte er sich hartnäckig genug immer mit pastellfarbenem Hut und Handschuhen. Queen und Punker dürfen nur nicht beide dasselbe zeigen, sie müssen sich an die jeweilige Konvention halten. »Daran halten« heißt, die Ordnung, wie sie die Konvention unmerklich zustande bringt, einzuhalten. Stil schafft Ordnung, so beliebig er auch ist.
Stil existiert also nicht absolut, sondern immer nur relativ zu mindestens einem anderen Stil. Hipster kann Hipster nur relativ zu Punk, Skinhead oder Mainstream sein. Sein Stil steht in einem Spannungsverhältnis zu einem anderen Stil: Während die Dinge und Verhaltensweisen eines Stils als Struktur von Komplementaritäten verstanden werden, stehen verschiedene Stile einander als Substitute gegenüber. Das »Das gehört auch dazu!« innerhalb eines Stils kontrastiert immer mit dem »Entweder-oder!« im Vergleich der Stile miteinander. Komplementarität innerhalb eines Stils und Substitution zwischen den Stilen fügen die Stile einer Gesellschaft zu einem ganzen Stilsystem zusammen. Punker, Hipster, Hip-Hopper, Nerds, Emos, Skinheads, Rastafaris, Surfer usw. bilden zusammen mit dem Mainstream dieses soziale System von Stilen, dessen Entstehung durch Wiederholung und Verankerung als Konventionen nur im sozialen Prozess möglich ist.
Die praktische Zweckmäßigkeit eines Stils liegt darin, dass er dem Einzelnen bei der Selbsterhöhungsarbeit helfen kann. Mit einem gemeinsamen Stil (auf Zeit) finden Menschen sich in Gruppen (auf Zeit) zusammen und konstruieren durch Wiederholung ihren Stil als Repräsentanz ihrer selbst. Sie selbst und die anderen Gruppen, von denen sie sich allein durch ihn unterscheiden, interpretieren ihn als eben diese Repräsentanz. Eine ästhetische Theorie braucht es in dieser stilistischen Praxis nicht. Das Streben nach Selbsterhöhung, die Bauernschläue, sich dabei von anderen helfen zu lassen, und das Mittel des wiederholten Zeigens immer derselben Dinge und Verhaltensweisen reichen vollkommen aus, um Stile in der Praxis entstehen zu lassen und sie als solche erkennbar zu machen. Die sinnadäquate Bedeutung von Stil ist demnach, das Mittel zur gruppenspezifischen Differenzierung von anderen Gruppen zu sein.
Ein Stil enthält erstens Bestandteile, die man, wie die Irokesenfrisur des Punkers, in keinem anderen Stil findet. Man findet zweitens aber auch immer Bestandteile, die ein Stil mit anderen Stilen teilt. So zeigte sich der Mod, der britische Büroarbeiter-Dandy der 1960er-Jahre, stets mit Schlips, genauso wie der Londoner Mainstream-Banker. Ein Stil kann deshalb in seinen Kern und seine Peripherie eingeteilt werden. In seiner Peripherie sind Komplemente, die zugleich Komplemente in anderen Stilen sind. Es gibt allein schon aus dem praktischen Grund der Differenzierungseffizienz keinen Stil ohne eine solche Peripherie. Seinen Kern jedoch bilden Komplemente, die sonst in keinem anderen Stil zu finden sind.
Weil der Kern am sichersten Differenzierung schafft, werden seine Bestandteile auch immer differenzierter. Nicht der Schlips und der Schuh gehören zum Kern, sondern der Schlips und der Schuh. Was passiert, wenn der Mainstream ein Element aus dem Kern eines randständigen Stils übernimmt? Das Element wandert vom Kern in die Peripherie. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn der Banker die Irokesenfrisur des Punks übernähme. Der Kern würde kleiner und (vorläufig) an Potenzial zur Differenzierung einbüßen. Der Stil würde an Wert für die Gruppe verlieren, die sich durch ihn konstituiert (hat). Keine Gruppe kann solchen Übernahmen auf Dauer tatenlos zusehen, ohne ihre Identität zu gefährden. Sie könnte sich in diesem Fall erstens auflösen und sich auf andere Gruppen aufteilen. Dies wäre eine Reaktion ohne Impulsgebung für die stilistische Innovation. Oder sie könnte zweitens in einem neu beginnenden Prozess der Wiederholung als neu zu konstituierende Wahlverwandtschaft eine ganz neue Struktur von komplementären Dingen und Verhaltensweisen zu einem ganz neuen Stil werden lassen. Dies wäre ein Impuls für radikale stilistische Innovation. Drittens könnte sie in einem inkrementellen Prozess ihren stilistischen Kern in dem Maße wieder ergänzen, wie er vom Mainstream ausgenommen wurde. Statt stilistischer Häutung also stilistische Zellregeneration. Und viertens könnte sie in einem gezielten Wettrennen mit dem Mainstream um wahre Kennerschaft ihr Ensemble von Komplementen ständig ändern und so den Mainstream als hoffnungslos inkompetent und rückständig an der Nase herumführen. Die ersten drei Mittel sind reaktiv, das vierte ist prophylaktisch.
Stilistische Strukturbildung oder -regeneration muss nicht notwendigerweise durch das gezielte Ergänzen des Kerns oder der Peripherie mit neuen Elementen erfolgen. Ein Stil kann sich auch ganz von jenem Element trennen, das von seinem Kern in seine Peripherie gewandert ist. Wenn der Punker die Irokesenfrisur niemals mehr zeigt, die der Banker nun zeigt, bleibt die Differenzierungsfunktion des Punk als Stil gewahrt. Denn das Mittel der Entleerung der stilistischen Peripherie erfüllt seinen differenzierenden Zweck genauso gut wie das Befüllen seines Kerns. Erkennt man doch einen durch Wiederholung entstandenen Stil ebenso an dem, was ganz gewiss nicht zu ihm gehört, wie an dem, was ganz gewiss dazugehören muss. Auch persistentes Weglassen immer derselben Elemente lassen den Betrachter die Struktur eines Stils erkennen. Das Bauhaus zum Beispiel ist als minimalistischer Stil durch persistentes Weglassen, durch das systematische Entfernen von Elementen aus seiner Peripherie entstanden.
Die Übernahme stilistischer Elemente vom Rand der Gesellschaft durch den Mainstream löst also dort stiltechnisch keinesfalls zwingend stilistische Innovation aus. Aber stilistische Innovation, radikale oder inkrementelle, ist ein geeignetes Mittel, um die für die menschliche Selbsterhöhung notwendige Differenzierung wiederherzustellen. Stilistische Innovation ist immer eine kollektive Bewirtschaftung eines stilistischen Kerns und seiner Peripherie durch eine Gruppe von Menschen, die sich durch diesen Prozess als solche konstituiert und rekonstituiert und sich so (sichtbar) erhält.
Dieses Verständnis stilistischer Innovation passt zum Grundgedanken einer offenen postmodernen Gesellschaft. Wo in der Moderne die Beziehung zwischen den gesellschaftlichen Gruppen eine statische, vertikale, hierarchische war, ist sie heute eine (viel stärker) dynamische, nicht hierarchische, horizontale geworden. Der Prozess der Differenzierung ersetzt in der Postmoderne den für die Moderne charakteristischen Prozess der Distinktion: das sich stilistisch nach oben Anbiedern (Veblen8) und das stilistisch durch Unnahbarkeit nach unten Treten (Bourdieu9) um den dafür von der Gesellschaft bereitgehaltenen Lohn (Weber10).
Es ist nicht mehr das Bild des Vertikalität und Hierarchie repräsentierenden Baumes, das den für die Postmoderne charakteristischen Prozess der stilistischen Innovation am besten verdeutlicht. Der Baum entsteht, je nach Definition des Anfangs, von oben nach unten oder von unten nach oben: Aus seiner Frucht entsteht eine neue Wurzel (Top-down-Innovation) und aus seiner Wurzel ein neuer Stamm (Bottom-up-Innovation). Wo Klassengrenzen aber zunehmend verschwinden, fehlt es dem Baum an der ordnenden Kraft der Gravitation. Die Nuss weiß nicht, wohin sie stürzen muss, und der Keim nicht, wo oben ist. Nicht der Baum, sondern das Rhizom versinnbildlicht das Charakteristische der stilistischen Innovation in der Postmoderne. Ein Rhizom ist eine horizontal in beliebige Richtung kriechende, meist unterirdische Sprossachse, die oberirdische Triebe ausbildet. Die Echte Zaunwinde (Calystegia sepium) ist ein Beispiel. Das Rhizom steht für eine stilistische Innovation nicht mit einer Zeitdimension (vorher – nachher), sondern mit einer räumlichen Dimension (unterschiedlicher Gruppen in der Gesellschaft). Es steht für stilistische Innovation ohne identifizierbaren Schöpfer (Designer, Unternehmen, Marken); für einen demokratischeren Prozess, in dem jedes Mitglied der Gesellschaft potenziell ein Designer und Innovator sein kann; für einen Prozess, in dem es keine natürliche Stilführerschaft einer (hoch)kulturellen oder ökonomischen Elite gibt; für einen Prozess, der von seiner natürlichen Anlage her multidirektional statt unidirektional ist, in dem nie klar ist, wer in der Frage der Stilführerschaft als Sieger herausgeht, in dem das Werden und das Immer-wieder-Werden des Stils wichtiger sind als sein Gewordensein.11
Trotzdem ist in der Postmoderne die rhizomatische Ausbreitung von Stilen nicht beliebig, denn es gibt einen Gärtner: die Geschmacksindustrie, deren Geschäftsmodell darin besteht, die Selbsterhöhungsarbeit der Menschen mit Angeboten aus der Dingwelt und dazu passenden Verhaltensweisen zu unterstützen. Wozu sie sich aller stilistischen Innovationen bedient, derer sie habhaft werden kann und die einem noch lukrativeren, größeren Markt zugeführt werden können. Die Zuführung von Stilen in lukrativere Märkte ist das Kerngeschäft der Geschmacksindustrie. Dies legt die Kultivierungsrichtung der an und für sich richtungslosen rhizomatischen Ausbreitung stilistischer Elemente fest: von klein zu groß, von wirtschaftlich eingeschränkt zu weniger eingeschränkt – vom Rand der Gesellschaft in deren Mainstream. Die soziale Ordnung der Moderne als Richtungsgeber der Diffusion von Stilen ist in der hierarchiearmen Postmoderne durch das Gewinninteresse der Geschmacksindustrie ersetzt. Das hat konkrete Auswirkung auf die stilistischen Innovationen am Rand der Gesellschaft.
Hipster
Das Hipstertum ist ein Stil mit US-amerikanischen Wurzeln, die in die 1940er-Jahre zurückreichen, ein heutzutage als Neo-Boheme zu charakterisierender, urbaner Neostamm. Er ist eine gekünstelte Szene aus Nichtkünstlern, die sich als Künstler verstehen und sich mit Jobs in Künstlerbars und -cafés über Wasser halten. Hipster-Hotspots waren oder sind die New Yorker Lower East Side und später Williamsburg oder Berlin Mitte. Der Amerikanist Mark Greif gibt drei Definitionen des Hipsters. Die erste betrifft den typischen männlichen Objektstil, mit dem sich der Hipster umgibt (die Existenz einer Hipsterin ist bis heute nicht belegt!), die zweite die Hipster-Kultur, die mit Ironie, aber ohne Sarkasmus den Gegensatz zwischen überlegenem Wissen und Reife des Hipsters und der Naivität des Mainstreams thematisiert. Die dritte erfasst den rebellischen Konsumstil des Hipsters, der seine Wahl von Massenkonsumgütern als Kunstwerk versteht, das die Besonderheit derer zeigt, die wissen, wie man im Mainstream genau nicht verschwindet. Für R. Jay Magill Jr., einen anderen Kenner, verkörpert der Hipster in alldem die pure Ernsthaftigkeit (mit leider verloren gegangener Ironie), stemmt sich dadurch, dass er gekonnt authentisch zu sein versucht, als Konsument gegen alles Neue und gelangt durch Ausgraben und Rekombination von immer neuen alten Dingen des vergangenen Massenkonsums zu seinem Stil. Was im Mainstream längst in die Vergangenheit gedrückt worden ist, holt der Hipster in Epochen ignorierender Freizügigkeit als das Authentische in die Gegenwart zurück.12 Zu diesen Wiederentdeckungen gehören unter anderem die Trucker-Kappe, weiße Feinrippunterhemden (»Wife-Beaters«) getragen als Oberbekleidung, Tattoos an Stellen, die bei Vorstellungsgesprächen gut verdeckt werden können, die Nerd-Brille, wie sie Bill Gates auf dem berühmten Garagenfirmafoto zeigt, die Modemarke American Apparel, welche soziale Verantwortung mit Porno-Chic verknüpft.
Hipster ist der Stil, der (fast) nur aus seiner Peripherie besteht. Alles kann dazugehören, was im Mainstream schon in Vergessenheit geraten ist. Hipster ist die jeweils gerade angesagte und allein dem Hipster-Eingeweihten bekannte aktuelle Komposition von Komplementen. Nicht der »Wife-Beater« per se oder die Trucker-Kappe per se sind hip, sondern immer nur in der aktuell angesagten Komposition – die sich ständig ändert. Wodurch der Mainstream, aus dessen Asservatenkammer des Konsumierens sich das Hipstertum bedient, ständig auf Distanz gehalten wird.
Skinhead und Punk
Rund ein Jahrzehnt vor dem Aufkommen des Punk entwickelten sich in Großbritannien die Skinheads – aggressiv und chauvinistisch – zu einer veritablen Subkultur: mit idealisiertem Arbeiterlook, rasiertem Kopf, weiten Jeans und Hosenträgern, Karohemden, Schnürstiefeln als weitere Steigerung des im harten Mod bereits steckenden Proletariertums und alles ablehnend, was im Hübschen, im Bürgerlichen steckt. Die im Mod suggerierte Aufwärtsmobilität wurde durch Abwärtsmobilität hin zum Lumpenproletariat ersetzt, Klassenposition wurde zum Fetisch.
Der dann in den 1970er-Jahren entstehende, ebenfalls innerstädtische Punk brachte uns Schockfrisuren, Nickelpiercing in der Zunge und Sicherheitsnadeln in Ohrläppchen und Augenbrauen, Ganzkörpertätowierung, Selbstverstümmelung und Endzeitklamotten, Irokesen- und ECT-Frisur. Der neue Stil hatte im Gegensatz zum späteren Hipstertum kein kulturell-gestalterisches Ansinnen und kein »Besser leben!« aus Überlegenheit in einer banalen Welt. Der Punker war die Inkarnation des superentfremdeten Humanoiden. Konsequenterweise war der Punk geschlechteroffen und wandte Bertolt Brechts Methode der Entfremdung auf den gesamten Mainstream an: auf den Homo ludens, Homo oeconomicus, Homo conventionalis. An sich selbst zeigten der Punker und die Punkerin, wie breit die biologische Familie, der alle um sie herum angehören, angelegt ist: »Schaut, die einzige Gemeinsamkeit ist das Gehen auf zwei Beinen! Ich und du haben sonst nichts gemein!« Der Blick richtete sich nicht zurück auf die Ursprünglichkeit eines Homo sapiens, er richtete sich nach vorn auf die Endzeitästhetik eines »Homo finalis«.
Seine Höhlen befanden sich zum Beispiel hinter Londoner Hausnummern in der King’s Road, Oxford Street und im Covent Garden. David Bowie wurde zur Ikone des Punk. Der Punk machte die Entfremdung der Jugend aus dem britischen Arbeitermilieu sichtbar. Das Ziel der Reise war die Science-Fiction-Zukunft. Dort erwartete den Punker das Schicksal des Aliens, gefangen in abnormer Sexualität, zugleich aber auch gefangen in einem Großbritannien, das ihm keine Zukunft bot. Eine Welt (und zugleich zwei), die da war(en) und zugleich nicht da war(en). Punk erschloss neue Wege aus Wirklichkeit und Gegenwart. Alle führten wieder zum Ausgangspunkt zurück, einer fiktionalen und zugleich realen Welt. So wurde jede Zukunft hoffnungs- und jede Vergangenheit sinnlos. Der Punk stand auch unter dem Einfluss der schwarzen britischen Subkultur, die mit dem westindischen Musikstil Reggae verbunden war. Das Aufeinandertreffen schwarzer Immigranten und der traditionellen britischen Arbeiterschaft war nach Dick Hebdige, einem der einflussreichsten Stilforscher, der Ursprung des Punk, der sich unter dem Einfluss des Sedativums von Reggae und des Amphetamins von Rock entwickelte: zwischen (schwarzem) Reggae als Repräsentanz einer auf der Reise von der Sklaverei zur Dienstbeflissenheit gegenüber der Bibel sich befindlichen Kultur und (weißem) Rock als Repräsentanz der Reise in eine ferne Zukunft. Punk war dadurch weniger eine Lösung von Widersprüchen als Ausdruck der Erfahrung dieser Widersprüche.13
Aus dem Rock bezog der Punk eine Ästhetik, die in der wachsenden Distanz zwischen Künstler und Fan sichtbar wurde. Auf der einen Seite die Arroganz der Glamour-Rock-Superstars wie David Bowie und Gary Glitter, auf der anderen Seite das Proletariat. Punk wurde so zum proletarischen Anhängsel der Rock-Superstars, deren Extravaganz dem Punker seine Entfremdung nur umso deutlicher vor Augen führte.14 Der Reggae gab nach Dick Hebdige – der die Idee des Stils als Erkennungszeichen von Neostämmen einführte – dieser Entfremdung eine berührbarere Form. Aus ihm bezog der Punk das Image von Rebellion innerhalb des weißen Großbritanniens gegen die britische Kultur, das der weißen Musik (Rock) so offensichtlich fehlte. Der sich zugleich gegen Immigranten richtende Chauvinismus des Punkers änderte nichts an dieser Funktionalität.
Als Stimme Afrikas war Reggae ursprünglich vom weißen Mainstream in den westindischen Kolonien und in Großbritannien als subversiv verstanden worden, als symbolische Bedrohung von Recht und Ordnung, als ungezähmt, als unaussprechlicher fremdartiger Ritus, als Hymne auf die Identität des Schwarzseins. Durch die Hinwendung zur (weißen) Bibel im Reggae nahmen die Unterdrückten sich selbst als Gefahr für den Mainstream die Spitze. Seine dinglichen Spiegelbilder Rastafrisur, Kaki-Outfit und Marihuana wurden so zu einem Gettostil im London der 1960er-Jahre für arbeitslose Jugendliche mit westindischen Wurzeln, deren Hauptproblem darin bestand, die Zeit totzuschlagen, ohne verhaftet zu werden. Schritt für Schritt trimmte sich diese Rasta-Kultur auf Revolte gegen den Mainstream, und je weniger Großbritannien die Hoffnungen der Einwanderer erfüllte, umso mehr löste sich ihre Subkultur von allen religiösen Anflügen und zeigte, dass die Einwanderer innerlich schon wieder ausgewandert waren – diesmal »zurück nach Afrika«.
Die Notting-Hill-Unruhen 1976 zeigten diese Potenz den ebenfalls arbeitslosen Londoner Altersgenossen aus der indigenen britischen Arbeiterschaft. Mit ähnlichen Erfahrungen wie die der Immigrantenjugend und in räumlicher Nähe zu ihr entwickelte die weiße Arbeiterjugend ein Interesse am »Zurück nach Afrika« beim Ausloten ihrer eigenen subkulturellen Optionen. Die Punk-Ästhetik war nach Dick Hebdige ein codierter Dialog zwischen Schwarz und Weiß außerhalb des britischen Mainstreams. Es war und bleibt ein Dialog voller nicht auflösbarer Widersprüche, der auf diese Weise das nirgendwo Angekommensein und das nirgendwo Dazugehören zeigt – wie zum Beispiel im Dialog der verschiedenen Tanzstile: Reggae als Ausdruck der Treue zum Körper und Rock als Ausdruck der Romanze mit der Technik.
Die Flucht in die Entfremdung macht Punk zu einem Stil der permanenten Unangepasstheit. In der internen Hierarchie steht nicht der oben, der Distinktion gegenüber außen am besten zeigt, sondern der, der sich auch nach innen gleichermaßen distanziert. Erst durch diese Innendifferenzierung wird der Punker authentisch, das heißt unangepasst gegenüber allem und jedem, wozu auch die Unangepasstheit gegenüber der eigenen Subkultur gehört. Das Punkerdasein wird so zum Balanceakt, wobei der Absturz im Verlust der Zugehörigkeit zur Subkultur besteht und im Leben als von allen entfremdeter Außenseiter. Zu den Tricks dieses Balancierens gehört unter anderem, niemals T-Shirts oder andere Merchandising-Artikel zum Konzertbesuch der Lieblingsband zu tragen.15
Es geht dem Punker also darum, sichtbar Punker zu sein dadurch, dass er zeigt, keiner zu sein. Punk ist damit der in unendlicher Permutation in Erscheinung tretende Stil des Unangepasstseins. Anhand der Objektwelt beschreibbar ist der Punk deshalb immer nur in einem Augenblick. Die Sicherheitsnadel im Ohr erfüllt ihren Zweck nur zu einem Zeitpunkt. Später, wenn sie zu sehr für den Punk oder gar für den Mainstream steht, muss es etwas anderes sein.
Aus dem schwarzen Gettostil: Beat, Hipster, Rock ’n’ Roll, Teddy Boy, Mod
Der sich in den USA und später in Großbritannien entwickelnde schwarze Gettostil wurde zum Ausgangs- und Referenzpunkt vieler Stile jenseits der schwarzen Minderheit, in der Musik genauso wie bei der Bekleidung. Diese stilistische Innovationskraft außerhalb des Mainstreams – Beat, Hipster, Rock ’n’ Roll, Teddy Boy, Mod – wird von Dick Hebdige am Beispiel einer einzigen Stadt, nämlich London, auf eindrückliche Weise belegt.16 Er zeigt daran, dass urbane, sich gegenüber dem Mainstream absondernde kulturelle Biotope die Hotspots stilistischer Innovation sind; deren Stilinnovationen Zeichen eines Zeichens, nämlich älterer Stile, sind, die wiederum Zeichen noch älterer Zeichen sind usw. und dass der Rand der Gesellschaft dynamisch ist und sich regelmäßig neu erfindet. Damals in London zum Beispiel mit:
• Beat, mit dessen Vorbild des noblen Wilden, erstickt von der Kultur der Städte, voller Sehnsucht nach einem Reservat aus Armut in Würde in der Ferne, in Jeans und Sandalen, erträumt in Soho und Chelsea. • Dem weißen Unterklassen-Dandy-Hipster mit dem blasierten schwarzen Getto-Geck als Referenzpunkt und in Abgrenzung zu allem, was ihn an Rohheit und Impulsivität im Quartier umgibt, immer auf der Suche nach Verfeinerung und immer auf dem Weg nach oben. • Rock ’n’ Roll als Verschmelzung des schwarzen Gospels und Blues mit dem weißen Country- und Western-Stil, mit Popcorn und Hula-Hoop, aufgebrochen in eine ferne, unzugängliche Welt. • Dem proletarischen Teddy Boy, ausgesondert in die Welt der ungelernten Arbeit, als weißes britisches Abziehbild des amerikanischen Gangsters aus einem Fantasie-Amerika voller Luxus und Glanz, in einer Mischung aus schwarzem Rhythmus, Wildlederschuhen, edwardianischem Samtanzug und Schnürsenkelbinder unter geföhnter Frisur, gelebt in Süd- und Ostlondon. • Dem Mod, ebenfalls ein Unterklassen-Dandy, wirtschaftlich aber besser situiert als der Teddy Boy, kleinlich auf alle Details seiner Kleidung bedacht, in maßgeschneiderten Schuhen, kurzhaarig und adrett, auf Französisch getrimmt, subversiv in der absurden Zuspitzung der Embleme des Mainstreams, mit Büroarbeitszeiten, deren Zweck allein darin bestand, das Geld zu beschaffen für die Zeiten dazwischen in einem vom schwarzen Mann inspirierten Untergrund, wo Arbeit irrelevant, Eitelkeit geschätzt und Männlichkeit ambivalenter zelebriert werden konnte. Der ursprüngliche Mod gebar den extravaganten 1960er-Hippie-Look der Carnaby Street und den harten Mod in Springerstiefeln, Jeans und Hosenträgern. Der Skinhead entsprang dem harten Mod.Jugendkulturen
Die ergiebigste Quelle stilistischer Innovation ist die Jugend. Ob in der Musik, beim Sport, in ihrer Kleidung oder Zeiteinteilung, junge Menschen zeigen, dass diesmal – in ihrer Ära – alles anders ist. Jugendkulturen sind weder Subkultur noch Neostamm, sondern ihre eigene Kategorie. Von der Subkultur, zum Beispiel der schwarzen Gettokultur der 1950er-Jahre, fehlt ihnen das Schicksalhafte. Vom Neostamm, zum Beispiel den Wochenendbikern, die Wahlverwandtschaft. Jugendliche sind zur Jugend verdammt, aber nur dazu. Sonst sind sie frei, solange sie alles anders als die Erwachsenen machen. Weil sie aber zur Jugend verdammt sind, sind sie auch nicht miteinander wahlverwandt. Für Jugendkulturen sind die Erwachsenen der Mainstream, und deshalb müssen sie sich von ihnen distanzieren. Deshalb liegen Jugendkulturen außerhalb des Mainstreams, so sehr sie auch in geografischer und institutioneller Nähe zu ihm, zum Beispiel in den Schlafstädten des Mainstreams und in den Familien, gedeihen. In Jugendkulturen wird sichtbar, dass die Zugehörigkeit zum Rand der Gesellschaft keine permanente sein muss. Wer dort seine »Karriere« beginnt, kann später ohne Weiteres im Mainstream landen – oder für immer in einem Neostamm.
Die allermeisten Trendsportarten wurden von Jugendlichen erfunden, die damit allen zeigten, dass die Welt eine andere geworden ist, seit sie in ihr sind: Surfen, Snowboarden, Parkour, BMX-Biking, Basejumping. Mit einer neuen Sportart kommt ein spezifischer Stil daher, denn wer zum Beispiel snowboardet, will es auch sonst dem Skifahrererwachsenendasein zeigen. Jugendkulturen entwickeln so ihren eigenen Stil als Kontrapunkt zur Erwachsenenwelt.
Skateboards zum Beispiel gab es ursprünglich nicht zu kaufen. Sie wurden von jugendlichen Bastlern zusammengebaut für das Gehsteig-Surfen in der Welt der drögen Erwachsenenfortbewegung. Aus der Sicht mancher Kenner der Szene entwickelte sich daraus eine Bewegung mit einem »enormen Einfluss auf die Gesellschaft weltweit. Von der Musik über das Internet bis zur Mode definieren Skateboarder, was angesagt ist.«17 Skateboarding ist jedoch keine eigenständige Jugendkultur, sondern die trockenwarme Ausführung einer Boarder-Gesamtkultur. Zu der gehört das Surfen (Wellenreiten, Windsurfen, Kitesurfen) als deren »nasse« und das Snowboarden als »kalte« Variante. Ohne funktionale Notwendigkeit ähnelt das auf vier Räder montierte Brett dem der Boards, die unmittelbar auf etwas gleiten und deshalb eine besondere Form haben müssen: den in der Horizontalen abgerundeten und vorne und hinten leicht nach oben gebogenen Boards, die auf Wasser beziehungsweise Schnee gleiten. Zahlreiche Manöver und Stunts beim Wellenreiten, Windsurfen und Snowboarden erfordern eine ähnliche Technik wie beim Skateboarding und vermitteln deshalb ein ähnliches Bewegungsgefühl.
Im Wellenreiten finden wir eine Reihe von Aspekten, die typisch für den Interessengegenstand der Stilökonomik sind. Folgende Aussagen aus einem Buch über dessen Geschichte setzen die Agenda:18