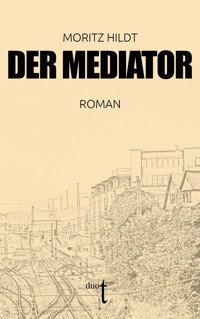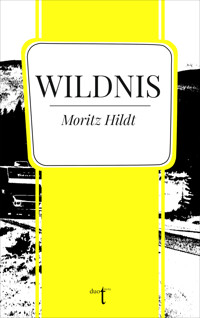
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: duotincta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Im Packeis
- Sprache: Deutsch
"Die blaue Funktionskleidung, die er trug, war dreckig und an vielen Stellen eingerissen. An seiner Schläfe war ein dunkler Fleck, der aussah wie verkrustetes Blut. Er schaute sie nicht an. Sein Blick ging dorthin, wo der Wald begann und sich wucherndes Gestrüpp über den Boden zog, weit hinein bis in die Dunkelheit, die von dort zu kommen schien." Die Wildnis: ein Ort der Gefahr und Sehnsucht. Aber wo beginnt sie? Wie kommen wir ihr nahe? Und was geschieht, wenn nicht nur wir die Wildnis, sondern auch die Wildnis uns in den Blick nimmt? Ein junges Paar aus Deutschland muss sich diesen Fragen stellen, weit draußen in der rauen Natur des Pazifischen Nordwestens. Ein Jugendlicher, der mit seinem Vater in die österreichischen Berge reist, stößt dort auf Verborgenes. Und vor einer Frau und einem Mann, die sich am Rande einer Konferenz in Tübingen in eine Affäre stürzen, tut sich ein Abgrund auf. In seiner atmosphärischen Prosa lotet Moritz Hildt in drei Novellen das Wechselspiel zwischen Vertrautem und Unberechenbarem aus – zwischen dem, was verführt, und dem, was zerstört. "Hildts Beschreibungen des Landes, der Menschen, sind eindringlich. Gegenwart, Vergangenheit, Landschaft und Menschen, ihre Geschichten, ihre Fehler, ihr Suchen verschmelzen." (Reutlinger Generalanzeiger)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wildnis
verlag duotinctaWildnisMoritz HildtSol Duc RoadHundeTraufVerleger, die dieses Buch verlegt haben ...Impressumverlag duotincta
Wildnis
Moritz Hildt Novellen Kurzstrecke #4
Moritz Hildt
Moritz Hildt, geboren 1985 in Schorndorf, ist Schriftsteller und promovierter Philosoph. Er lebt in Passau. 2019 erschien sein Debütroman „Nach der Parade“, 2020 folgte sein zweiter Roman „Alles“. Beide standen auf der Shortlist für den Thaddäus-Troll-Preis.www.moritzhildt.de
Sol Duc Road
1
Es hätte nicht viel gefehlt, und sie hätten die Sol Duc Road verpasst.
Reines Glück, dachte Kevin Dauth, als er das Lenkrad des Wohnmobils einschlug. Das cremefarbene Kunstleder fühlte sich warm an, fast geschmeidig unter seinen Händen, die klebrig waren vom langen Fahren. Träge scherte das massige Gefährt aus und querte die Abbiegespur, die schon fast vorüber war. Der weiße Linkspfeil auf dem aufgerauten Straßenbelag wirkte eigentümlich gedrungen. Als wäre dort, wohin er zeigte, nicht genug Platz.
Im Rückspiegel war kein anderes Auto zu sehen. Auch keiner jener schwer beladenen Holzlaster, die immer wieder und weit über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit über den Highway preschten, oft zwei oder drei dicht hintereinander. Kevin setzte den Blinker. Dabei umfasste er den Hebel neben dem Lenkrad mit der ganzen Faust, ein Griff, der ihm für einen solchen Wagen, der größer war als alles, was er je gefahren war, irgendwie passend schien. Das gleichmäßige Klacken, das jetzt ertönte, klang tiefer als in deutschen Autos. Kevin mochte das Geräusch. Es war beruhigend. Und vorwärtsgerichtet.
Unter dem Kamm des Bergmassivs, auf das sie bis eben zugefahren waren und das von demselben dichten, smaragdgrünen Wald überzogen war, der hier überall wuchs, hatten sich einige lose Wolken gesammelt, die an ihren Rändern ausfransten. Wie Fetzen von etwas, das einmal ganz gewesen war. Kevin wollte einen letzten Blick darauf werfen. Aber die Bäume der Sol Duc Road verbargen bereits alles, was dahinter lag, und rückten es in eine weite, irrelevante Ferne.
Es war aber nicht nur Glück, entschied Kevin dann. Wie ein guter Pass im Handball eben nur dann funktionierte, wenn derjenige, zu dem der Ball gespielt wurde, es auch mitkriegte, war auch Kevin im richtigen Moment geistesgegenwärtig gewesen. Wachsamkeit. Ganz im Hier und Jetzt zu sein. Das war etwas, was ihm schon immer leichtgefallen war. Und offenbar, stellte er zufrieden fest, gehörte es auch zu den Dingen, die wichtig waren, wenn man sich auf einer Reise befand. Wenn man unterwegs war, am Rande der Wildnis. So wie Lara und er.
Eben noch hatten seine Augen auf Laras nackten Zehen gelegen, mehr aus Langeweile. Sie hatte sich die Nägel frisch lackiert, vorhin, während er mit seiner neuen Kamera ein paar Fotos von dem sichelförmigen See geschossen und dabei versucht hatte, die bewaldeten, sich im stillen Wasser spiegelnden Hänge mit aufs Bild zu bekommen. Er hätte gern auch eine Aufnahme mit Lara gemacht, im Vordergrund, aber sie war nicht aus dem Wohnmobil gekommen. Wenn er an den Abenden die Fotos auf dem kleinen Display durchging, stellte sich bei ihm oft der Eindruck ein, dass die Bilder allesamt seltsam leer blieben und ohne Bedeutung, wenn nicht Lara mit drauf war, oder sie beide. Vielleicht war es aber auch nur eine Sache des Fokus. Die Bedienungsanleitung für die Kamera hatte er zu Hause gelassen.
Seit der kurzen Pause am See war sein Blick immer wieder zu ihren Füßen gewandert, die sie hochgelegt hatte, auf die Ablage über dem Handschuhfach. Es gab da eine Stelle, kurz oberhalb des Nagelbetts an ihrem linken mittleren Zeh, die sie offenbar übersehen hatte und die jetzt fahl und hell glänzte, immer dann, wenn die Bäume einen Strahl der Nachmittagssonne durchließen, der dann, plötzlich und warm, in die Fahrerkabine fiel.
Lara war neunundzwanzig. Die letzten fünfzehn Jahre da-von – inzwischen bereits etwas mehr als die Hälfte ihres Lebens – waren die beiden ein Paar. Trotz der fast kreisrunden Form mit den hohen, prallen Wangen hatte ihr Gesicht einen ernsten, entschlossenen Ausdruck, der besagte, dass man bei Entscheidungen im Leben ebenso sehr auf die möglichen Wechsel- und Nebenwirkungen achtgeben müsse wie sie es bei ihrer Arbeit in der Apotheke tat. Die dunkelblonden Haare, die sie wieder länger wachsen ließ, trug Lara die meiste Zeit über offen, was ihr gut stand.
Kevin ließ das Wohnmobil ausrollen und schaute der schwarzen Nadel auf der Geschwindigkeitsanzeige dabei zu, wie sie zitternd absank, hin zu den dreißig Meilen pro Stunde, die das rot umrandete Schild am Rand der schmalen Fahrbahn noch erlaubte. Zwischen den mächtigen Douglasien auf beiden Seiten der Straße wucherten helle Flechten, farnartiges Gestrüpp und ein Gewächs, das aussah wie Beerensträucher, und wohl Dornen besaß. Der kleine asphaltgraue Fleck im Rückspiegel, das letzte Stück der Schnellstraße, wurde rasch immer kleiner.
Kevin schaute zu Lara, die ihn interessiert musterte. Er hatte nicht angekündigt, dass er abbiegen würde. Sie strich sich eine blonde Strähne aus der Stirn, sagte aber nichts.
»Das muss sie sein«, sagte Kevin. »Das ist die Sol Duc Road.«
Wie zur Bestätigung setzte er sich im Fahrersitz aufrecht. Er schaute auf die Straße und kniff die Augen zusammen, obwohl ihn die Sonne nicht blendete.
Lara beugte sich vor und zupfte an einem Zeh.
»Das letzte Mal, als du dir sicher warst, musstest du das Wohnmobil im Schnee wenden«, sagte sie.
Ihre Stimme klang, als würde sie das, was sie da sagte, gar nicht betreffen. Und, fügte Kevin in Gedanken hinzu, als hätte sie ihm damals nicht in seiner Einschätzung zugestimmt, dass das kleine, unscheinbare Schild mit der Aufschrift Road closed for winter gewirkt hatte, als sei es vor langer Zeit am Straßenrand vergessen worden. Die Sonne hatte an jenem Tag, es war erst ihr zweiter im Wohnmobil gewesen, klar und leuchtend geschienen und sie waren beide im T-Shirt in der Fahrerkabine gesessen. Kurzerhand hatte Kevin das Wohnmobil um das Schild herumgelenkt. Die Straße sollte sie durch die Cascades-Gebirgskette bringen, weit oben im Norden, fast schon an der Grenze zu Kanada. Sie nicht zu nehmen, hätte einen Umweg von mindestens einer Tagesfahrt bedeutet.
Wenn er es genau bedachte, überlegte Kevin jetzt, hatte er da schon kein gutes Gefühl bei der Sache gehabt. Aber es war immerhin schon Mai, der Winter also lange vorüber. Außerdem hatte er nicht übervorsichtig wirken wollen, nicht unerfahrener als Lara. Dabei wusste Kevin natürlich, dass Lara ebenso wenig Erfahrung im Reisen besaß wie er.
Sie waren dann noch über eine Stunde gefahren, bis er den Wagen hatte wenden müssen. Der Schnee hatte da schon den Asphalt überzogen, wie ein dünner, trügerischer Film. Zwischen den Bäumen links und rechts der Straße hatte er deutlich höher gelegen, ein festes, dreckiges Weiß. Die allein stehende junge Fichte, deren Stamm aufrecht und störrisch aus der geschlossenen Schneedecke herausgeragt hatte, ganz nah am Straßenrand, hatte er im Rückspiegel nicht gesehen.
»Immerhin hast du an dem Baum deine Spur hinterlassen«, sagte Lara. Kevin wusste nicht, ob sie scherzte. Es klang eher so, als würde sie etwas daran bedauern.
Er sagte nichts.
Am Abend waren sie wieder zurück im Tal gewesen. Der Schriftzug Welcome to Concrete hatte die verwitterte Fassade eines wuchtigen Betonsilos am Ortseingang einer kleinen Stadt überzogen, in ausgeblichenem Orange. Er hatte diesen Anblick im Abendlicht fotografieren wollen, es dann aber vergessen, da er mit der Taschenlampenfunktion seines Mobiltelefons die Stelle am Wagen abgesucht hatte, mit der er beim Wenden die Fichte gestreift haben musste. Millimeter um Millimeter hatte er inspiziert, ohne auch nur den kleinsten Kratzer zu finden. Laras Eltern hatten das Wohnmobil angemietet und bezahlt. Kevin wusste nicht, welche Art von Schäden abgedeckt sein würden.
Weiter vorn tauchte jetzt ein braunes Schild am Straßenrand auf.
Lara schnalzte mit der Zunge. »Elf Meilen bis zu den heißen Quellen«, las sie laut vor, »zwölf bis zum Wanderparkplatz.«
Über den Entfernungsangaben prangte groß der Schriftzug Sol Duc Road.
Kevin trommelte leise mit den Fingern auf das Lenkrad. Er besaß eben doch ein Talent für das Unterwegssein, dachte er.
»Glück gehabt«, sagte Lara.
Sie klappte die Sonnenblende herunter. In dem kleinen Spiegel betrachtete sie ihre Lippen, die sie über den Zahnreihen spannte, bis sie fast weiß waren. Mehrmals schob sie ihr Kinn dabei vor und zurück.
Kevin setzte an, um ihr zu widersprechen. Es war eben nicht nur Glück gewesen. Aber dann tat er es nicht. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen, die trocken waren, und ließ das Fenster herunter.
Kühle, raue Waldluft, die noch nach dem morgendlichen Regen roch, blies ihm an der Wange vorbei. Er meinte, noch etwas anderes darin zu riechen. Einen scharfen, wilden Geruch. Wie nach etwas Lebendigem.
2
Kevin Dauth und Lara Michalsky waren vor etwas mehr als zwei Wochen von Köln mit dem ICE zum Flughafen nach Frankfurt gefahren und von dort aus über London nach Seatt-le geflogen. Auf dem Flug gab es Hähnchenbrust, in einer weißen Parmesansoße und mit einem cremigen Häufchen Kartoffelpüree. Lara schob die Reste von Kevins Püree auf ihre schwarze Plastikgabel und erzählte dabei, dass Flugzeuggerichte so stark gewürzt seien, dass sie, würde man sie am Boden probieren, vollkommen ungenießbar wären. Gemeinsam über-legten sie dann, woran das liegen mochte (Lara konnte sich nicht mehr erinnern) und überboten sich in immer aberwitzigeren Erklärungen, bis ein älterer Herr in der Reihe vor ihnen gereizt den Kopf wandte. Später schaute sich Kevin einen Film an, während Lara versuchte, aus dem ovalen Fenster durch die Wolken hindurch etwas vom Blau des Atlantiks zu sehen, den sie beide in jenem Moment zum ersten Mal in ihrem Leben überquerten.
In Seattle übernachteten sie zwei Tage in einem Hotel, bevor sie zu ihrer dreiwöchigen Wohnmobiltour aufbrachen. Auf der Hafenpromenade, an der die Luft salzig war und fremd und nach Autoabgasen schmeckte, aßen sie frittierte Venusmuscheln. Von den einfachen Plastikstühlen der Imbissbude aus beobachtete Lara eine alte Frau mit weit auseinanderliegenden Augen, die einige Reste aus ihrer Frittenschale zu drei Möwen hinwarf, die wie aufgereiht auf der Brüstung zum Hafenbecken verharrten. Die weißen Vögel schnappten die kalt gewordenen Kartoffelstäbchen mühelos aus der Luft. Eine große Fähre, deren Lichter bereits angeschaltet waren, lief aus dem Hafen aus und hielt auf die schneebedeckten Berge im Westen zu.
»Dort drüben, hinter diesen Bergen, muss der Pazifik sein«, sagte Lara kauend.
Beide blickten der hell erleuchteten Fähre nach. Mit der Zunge zerdrückte Kevin die inzwischen lauwarm gewordene Panade einer ausgebackenen Muschel langsam am Gaumen. Sie schmeckte fest, und nach Meer und Weite.
Am nächsten Tag sahen sie auf dem Pike Place Market, wie die Fischhändler mächtige Lachse über die Köpfe der Käufer hinweg zu einem Kollegen schleuderten, der die gekauften Fische wog, verpackte und das Geld kassierte. In einem großen Drogeriegeschäft blieb Lara lange vor dem Regal mit Schreibwarenartikeln stehen und suchte sich schließlich ein großes, in Leder eingeschlagenes Notizbuch aus. Kevin kaufte kurzentschlossen einen Rasierapparat und rasierte sich am Abend seinen Bart ab. Es fühlte sich gut an, etwas aus dem Bauch heraus zu tun. Solche Entscheidungen gaben dem eigenen Charakter etwas Spontanes.
Kevin Dauth war gelernter Kaufmann für Versicherung und Finanzen und arbeitete als Berater für Privatkunden in einem großen Bürogebäude in Köln, unweit der Universität. Mit seinen knappen Einsneunzig, weswegen die meisten Menschen zu ihm emporschauten, den klaren blauen Augen und einem einnehmenden Lächeln besaß Kevin das gute Aussehen, das ihm seinen Beruf leicht machte. Menschen vertrauten ihm gern und schnell. Vor einiger Zeit hatten zwar die Knöpfe seiner Hemden zu spannen begonnen und mit dem Handballspielen hatte er schon lange aufgehört. Aber seine sportliche Figur, das wusste er, hatte er noch nicht verloren.
Wie viele Jahre er seinen Vollbart getragen hatte, vermochte er gar nicht mehr genau zu sagen. Als er an dem Abend in Seattle sein glattrasiertes Gesicht zum ersten Mal im Spiegel betrachtete, staunte er darüber, wie weich es aussah. Lara lag auf dem breiten Bett, ihr neu gekauftes Notizbuch vor sich. Sie hatte es zugeklappt, als er aus dem Bad gekommen war, und ihn bloß gefragt, ob er sich so jünger fühle. Im August würde Kevin Dreißig werden.
Nach zwei Wochen im Wohnmobil hatten sie in der vergangenen Nacht zum ersten Mal wieder in einem normalen Bett geschlafen, in einem billigen Motel in Port Angeles. Lara hatte ausgerechnet, dass sie inzwischen schon über zweitausend Meilen zurückgelegt hatten, und die genaue Zahl dann in ihr Notizbuch geschrieben.
Als Kevin am Morgen, Lara duschte da gerade, die Zahl nachschlagen wollte, sah er, dass Laras Buch angefüllt war mit kleinen Bleistiftskizzen, die aussahen wie Bilder aus einem Comic. Sie zeigten Landschaften, wie die, in denen sie unterwegs waren. Aber es waren auch Menschen darin, Gesichter, die er nicht kannte, die ihm aber beim Durchblättern immer wieder begegneten, vor allem die von zwei Männern und einer Frau. Auf einer der Zeichnungen standen die drei dicht beieinander und schauten aufs offene Meer. Der Sand, in den ihre Füße bis zu den Knöcheln einsanken, war tiefschwarz schraffiert. Lara war offenbar wieder und wieder mit dem Bleistift drübergegangen. Plötzlich hatte er das Gefühl, dass ihn all das nichts anging. Er machte das Buch rasch zu und schob es zurück, unter das Magazin auf ihrem Nachttisch.
Während der kurzen Fahrt vom Motel zum Informationszentrum des Nationalparks überlegte er, wie er Lara auf die Zeichnungen ansprechen könnte. Er vermochte sich nicht daran zu erinnern, sie während ihrer Reise auch nur ein einziges Mal beim Zeichnen gesehen zu haben. Er wusste nicht mal, dass sie so etwas überhaupt konnte, Comics malen.
Der Nationalpark-Ranger, der ihnen im Informationszentrum den Weg zur Sol Duc Road beschrieb, drückte seinen platten Daumen beim Sprechen auf die dünne, kaum noch erkennbare graue Linie auf der Karte, die den breiten Highway in einem scharfen Winkel verließ und sich in sanften Bögen ins Nichts wand, wo sie bald, nach einigen Meilen, wie er sagte, endete. Auf Kevins Nachfrage hin bestätigte ihnen der Mann, dass man durchaus auch eine Mehrtagestour durch den Nationalpark machen könne. Für eine solche Wanderung müsse man sich allerdings bei der Ranger-Station anmelden und die geplante Route angeben, auch aus Sicherheitsgründen. Der Ranger bedachte Kevin dann, wie ihm schien, mit einem anerkennenden Blick. Er wusste, dass er Lara nie davon überzeugen würde, eine solche Wanderung zu machen, über mehrere Tage und bis hinauf zu den Bergspitzen, dorthin, wo der Wald endete und noch Schnee lag.
In dem langgezogenen Baucontainer, in dem das Informationszentrum übergangsweise untergebracht war, hatte es nach Chlor gerochen. Und nach noch etwas anderem, wohl nach dem, was das Chlor beseitigen sollte. Während der Mann gesprochen hatte, waren Kevins Augen an seinem breiten, gepflegt glänzenden Schnurrbart hängen geblieben. Er hatte nicht recht zum Gesicht eines Mannes passen wollen, der ihnen gerade Auskunft über die ungebändigte Natur gab, die, wie er sagte, den größten Teil dieser Halbinsel bedeckte und über fünfundneunzig Prozent des Nationalparks.
3
Unwillkürlich hob Kevin jetzt die Hand vom Lenkrad und fuhr sich über den Kiefer. Die glatte Haut dort fühlte sich noch immer ungewohnt an und zart, als wäre sie irgendwie jünger als der Rest seines Körpers. Heute Morgen, vor dem breiten Badezimmerspiegel des Motels, hatte er sich wieder mit dem elektrischen Apparat rasiert, der, anders als der Trimmer, den er die letzten Jahre über verwendet hatte, laut und dröhnend surrte.
Wenn Lara ihn noch einmal fragen würde, ob er sich ohne Bart jünger fühle, überlegte Kevin und schaute dabei auf die Straße, die sie mit jeder Windung tiefer in die Berge hineinbrachte, würde er sagen, dass er nun in einem Alter sei, in dem er keinen Bart mehr brauchte. Auch wenn er nicht genau wusste, was das heißen sollte.
»Kann ich den Rasierapparat eigentlich mit zurück nach Deutschland nehmen?«, fragte er.
»Mhm«, sagte Lara.
Ihr Blick ging hinaus zu den Bäumen am Straßenrand. Kevin sah dort nur Grün, hell und dunkel, das mit dem tiefen Braun der massigen Stämme verschwamm. Er gab darauf acht, das Wohnmobil auf der schmalen Spur zu halten und mit den Rädern nicht über die ockerfarbene Mittellinie zu kommen.
»Ich meine, wegen der Netzspannung«, setzte er nach.
Für die Stecker, die sie von zu Hause mitgebracht hatten, brauchten sie schließlich auch einen Adapter. Lara hatte ihn da-rauf hingewiesen, dass die amerikanischen Steckdosen allesamt aussahen wie menschliche Gesichter, der Mund weit aufgerissen, irgendwo zwischen Erstaunen und Entsetzen. In ihrem Notizbuch, erinnerte sich Kevin, hatte er eine ganze Doppelseite mit solchen Steckdosen-Fratzen gesehen.
»Glaubst du, das da draußen – ist das schon Wildnis?«, fragte Lara, ohne sich vom Fenster abzuwenden.
Ihr Gesicht hatte denselben Ausdruck, den es am Morgen angenommen hatte, als ihnen der Ranger mit dem Schnurrbart beschrieben hatte, wie am Ende der Sol Duc Road nur ein schmaler Wanderpfad sein würde, der zu einem Wasserfall führte und dann tiefer, immer tiefer hinein in die Berge.
Nachdem sie das Informationszentrum verlassen hatten, waren sie durch den trüben Regen hindurch zu einem nahen Supermarkt gefahren. Kevin hatte dort zwei große Becher Kaffee gekauft. Das rauchige Aroma hatte sich rasch im Inneren des Wohnmobils ausgebreitet und auch den muffig-verbrauchten Geruch, wie von zu lange getragenen Turnschuhen, überdeckt, den das Wohnmobil wieder einmal angenommen hatte. Dabei hatten sie in der letzten Nacht ja nicht mal darin geschlafen.
»Ich will dorthin«, hatte Lara gesagt und Kevin über den Rand des Kaffeebechers fest in die Augen geschaut. »Zur Sol Duc Road.«
Sie hatten sich dann gemeinsam über die Straßenkarte gebeugt, die vom vielen Auffalten der letzten Tage an zwei Stellen eingerissen war.
»Schau«, hatte Lara gesagt, nachdem sie die Sol Duc Road auf der Karte schließlich wieder entdeckt hatten, eine unscheinbare Abzweigung, nicht weit hinter einem sichelförmigen Waldsee, »dort endet sie. Die letzte Straße.«
Mit ihrem kleinen Finger war sie, fast zärtlich, die graue Linie entlanggefahren, um die herum auf der Karte nur noch flächiges Grün war. Das, was sie nun aus den Seitenfenstern des Wohnmobils sahen.
Auf einem längeren geraden Straßenabschnitt schaute Kevin zu Lara hinüber. Sie blickte noch immer mit zusammengekniffenen Augen dorthin, wo die Bäume waren. Ihre Lip- pen waren leicht geöffnet. Plötzlich schien ein Lächeln sie zu umspielen, ganz kurz nur. Dann war es wieder verschwunden.
»Siehst du dort etwas?«, fragte er.
Nach einem Moment wandte sie sich ihm zu und blinzelte zwei Mal, wie verwundert.
»Nein«, sagte sie und schüttelte den Kopf.
Kevin meinte, den grünen Sprenkel in ihrem linken Auge aufblitzen zu sehen. Aber dafür waren sie eigentlich zu weit von einander entfernt.
»Was glaubst du, wie es wohl am Ende der Straße aussehen wird?«, fragte er.
Ein einzelnes trockenes Blatt ratterte in der Lüftung. Dann brach es im Luftstrom und es war wieder still.
Gegenverkehr gab es kaum. Die schweren Holztransporter, die ihnen auf dem Highway begegnet waren, schienen hier nicht mehr unterwegs zu sein. Nur Leute wie wir, dachte Kevin, die in die Wildnis wollen. Oder zu den heißen Quellen, die ihnen der Ranger mit dem Schnurrbart ebenfalls empfohlen hatte. Erst würden sie wandern, wenigstens bis zum Wasserfall. Dann baden gehen.
In seiner Vorstellung waren die Hot Springs eine Ansammlung kleiner, unberührter Waldseen, auf einer Lichtung vielleicht, jenseits des dichten Gestrüpps, das zwischen den Bäumen wuchs. Ein kleiner Pfad würde dorthin führen. Lara und er würden ganz allein sein, im Wasser, das um sie herum in den dämmernden Abendhimmel dampfen würde. Vor seinem inneren Auge gewann dieses Bild mehr und mehr an Form. Das Wasser, das aus der Tiefe kam, würde warm sein, so warm, dass sich Laras Haut darin kühl anfühlen würde.
Zwei Wohnmobile kamen ihnen entgegen und Kevin musste sich darauf konzentrieren, den Wagen auf der Spur zu halten. Sie war inzwischen kaum mehr breiter als das Wohnmobil selbst.
»Die kommen sicher von dem Campingplatz, der gleich bei den Quellen sein soll«, sagte er.
Die Fahrer der Wohnmobile grüßten im Vorbeifahren und Kevin hob routiniert eine Hand vom Lenkrad. An den Flanken der Fahrzeuge prangte das Logo desselben Verleihs, von dem auch ihr Wohnmobil stammte. Allerdings waren es deutlich größere Modelle.
»Schau mal«, sagte Kevin und nickte zu den Fahrzeugen hin. »Glaubst du, das ist die Größe, die deine Eltern eigentlich für uns anmieten wollten?«
Statt einer Antwort beugte sich Lara vor und machte das Autoradio an.
Sie hatte ihren Musik-Player noch zu Hause vollgepackt mit Stücken, die aus dieser Region stammten, aus dem pazifischen Nordwesten der USA. Außer Nirvana kannte Kevin keine der Bands. Für Musik war schon immer Lara zuständig gewesen. Wenn es nach ihm ging, konnte auch einfach das Radio laufen. Aber Lara ließ ihren Player ständig eingestöpselt.
Im Grunde war ihm das egal. Doch inzwischen begann es ihn zu stören, dass die Lieder, die sie bislang auf der Fahrt gehört hatten, nichts, aber auch gar nichts mit der Landschaft zu tun hatten, durch die sie fuhren. Die wenigen lauten, rockigen Stücke und die vielen Songs, in denen Männer mit hohen Stimmen zu sanften Gitarren oder sphärischen Synthesizer-Sounds jammerten, klangen in seinen Ohren, als wären sie in einer gesichtslosen Großstadt entstanden, in der es schon seit Tagen ununterbrochen regnete, in Seattle vielleicht. Aber die weiten, urwüchsigen Wälder, die rauen Berge und die ungestüme Pazifikküste waren alles andere als gesichtslos und gleichförmig. Kevin konnte nicht sagen, welche Musik zu dieser Landschaft gepasst hätte. Er wusste nur, dass Laras Auswahl es nicht tat.
Während jetzt wieder eine dieser flehentlichen Fistelstimmen die Fahrerkabine erfüllte, versuchte Kevin, seine Gedanken zu den heißen Quellen zurückzulenken. Aber es wollte ihm nicht recht gelingen.
Er überlegte, wie lange es her war, seit Lara und er das letzte Mal miteinander geschlafen hatten.
4
»Wir möchten euch das gerne schenken«, hatte Laras Vater gesagt und die Broschüre mit den Wohnmobilen über den Tisch geschoben, auf dem eben noch die Platte mit den gebratenen Lachssteaks und die Petersilienkartoffeln gestanden hatten. Das war im letzten Sommer gewesen, kurz nach Laras Geburtstag.
Die Besuche bei Laras Eltern waren in den letzten zwei Jahren deutlich weniger geworden. Kevin mochte das weiträumige Haus, den Fußweg zum See und die unvoreingenommene Herzlichkeit ihrer Eltern. All das war schon immer so gewesen. Aber inzwischen wollte Lara die Strecke an den Bodensee nur noch fahren, wenn es einen triftigen Anlass dafür gab, Weihnachten zum Beispiel, oder eben einen Geburtstag.
Außer ihnen beiden war an jenem Abend auch noch Laras zwei Jahre jüngere Schwester Veronika zu Besuch, mit ihrem Mann und den beiden Kindern. Kevin wusste, dass Veronika und Simon schon mehrere Male mit dem Wohnmobil ausgedehnte Touren durch die Vereinigten Staaten gemacht hatten. Er ließ sich die Fotobücher, die Simon danach am Computer erstellte und Laras Eltern zu Weihnachten schenkte, immer gern zeigen.
Die Ankündigung, dass sie einen Wohnmobilurlaub geschenkt bekommen würden, traf Kevin völlig unvorbereitet und er wusste nicht recht, wie er Laras Eltern für ihre Großzügigkeit danken sollte. Hilfesuchend blickte er zu Lara hin, aber die erwiderte seinen Blick nicht.
»Ihr bekommt die Reise von uns zu eurem, na ja, fünfzehnjährigen Jubiläum«, sagte Laras Mutter und Kevin fiel auf, dass sie ebenfalls versuchte, Laras Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. »Wir hätten sie euch gern zur Hochzeit geschenkt. Aber heiraten wollt ihr ja nicht.«
Am Tisch herrschte plötzlich eine unangenehme Stille, die Laras Vater eilig unterbrach: »Ihr müsst uns nur sagen, welche drei Wochen euch im nächsten Jahr gut passen. Dann erledigen wir die Reservierung. All inclusive, sozusagen.«
Später, Laras Eltern waren da schon im Bett, tranken sie amerikanischen Whiskey. Simon hatte die Flasche bei ihrem letzten Urlaub direkt in einer kleinen Destillerie in Kentucky gekauft, einer von den unbekannteren, wie er sich ausdrückte. Er schenkte Kevin, Lara und sich selbst großzügig ein.
»Als erstes«, sagte er dann, »müsst ihr den beiden ausreden, dieselbe Kategorie von Wohnmobilen anzumieten, die wir immer nehmen. Das hat sich Rainer so in den Kopf gesetzt. Aber die sind viel zu groß für euch. Euch genügt etwas Schlankeres. Damit kommt man auch besser über die kleinen Straßen in den Nationalparks. Und da wollt ihr doch sicher hin?«
Kevin nickte begeistert. Viel Platz würden sie zu zweit sicher nicht brauchen.
Simon gab ihnen dann noch einige Hinweise, die Kevin allesamt sehr nützlich fand. Unter anderem erklärte er, dass sie mit dem Wohnmobil nicht einfach so am Straßenrand oder in der Natur übernachten dürften. Aber es würde auch nicht nötig sein, für jede Nacht teure Standgebühren auf Campingplätzen zu bezahlen. Manche Supermarktketten erlaubten Wohnmobilen nämlich, über Nacht auf ihren Kundenparkplätzen zu stehen. Das wüsste kaum einer, hatte Simon gesagt, und dabei die Augenbrauen hochgezogen.
Vor zwei Tagen hatten sie das zum ersten Mal probiert. Die Dame mit den hochgesteckten Haaren an der Informationstheke des Supermarkts war sehr freundlich gewesen und hatte ihnen gesagt, dass sie sich hinstellen dürften, wo sie nur wollten. Kevin hatte sich dann in dem Laden noch eine Jeans gekauft.