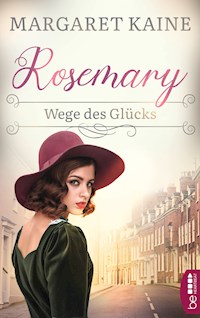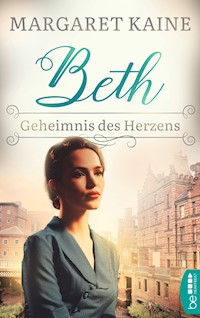4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Frauen aus den Potteries
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Eine Liebesgeschichte, die zu Herzen geht
Die 18-jährige Rebecca Lawson hat ihre Eltern im Zweiten Weltkrieg verloren und sehnt sich nach Geborgenheit. Als sie nach der langen Zeit der Evakuierung nach London zurückkehrt, lernt sie den liebevollen Ian Beresford kennen. Sie verlieben sich und wollen heiraten. Doch dann verschwindet Ian spurlos. Rebecca, die ein Kind von ihm erwartet, ist verzweifelt. Sie ist überzeugt, dass ein Unglück geschehen ist, und reist kurzerhand zur Familie ihres Verlobten. Dort erwartet sie eine schreckliche Nachricht - und Rebecca muss entscheiden, was mit ihrem Kind geschieht ...
Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Rosen für Rebecca" erschienen.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Weitere Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Sagas über die Frauen aus den Potteries:
Beth – Geheimnis des Herzens
Rosemary – Wege des Glücks
Maureen – Zeit der Sehnsucht
Über dieses Buch
Eine Liebesgeschichte, die zu Herzen geht
Die 18-jährige Rebecca Lawson hat ihre Eltern im Zweiten Weltkrieg verloren und sehnt sich nach Geborgenheit. Als sie nach der langen Zeit der Evakuierung nach London zurückkehrt, lernt sie den liebevollen Ian Beresford kennen. Sie verlieben sich und wollen heiraten. Doch dann verschwindet Ian spurlos. Rebecca, die ein Kind von ihm erwartet, ist verzweifelt. Sie ist überzeugt, dass ein Unglück geschehen ist, und reist kurzerhand zur Familie ihres Verlobten. Dort erwartet sie eine schreckliche Nachricht – und Rebecca muss entscheiden, was mit ihrem Kind geschieht …
Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel »Rosen für Rebecca« erschienen.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Margaret Kaine, geboren und aufgewachsen in »The Potteries«, in Mittelengland, lebt heute in Eastbourne. Ihre Karriere als Autorin startete sie mit Kurzgeschichten, die in mehreren Ländern veröffentlicht wurden. Anschließend erhielt sie für ihren Debütroman »Beth – Geheimnis des Herzens« gleich zwei literarische Preise. Seitdem schreibt sie mit großem Erfolg romantische Sagas, die vor dem Hintergrund der industriellen Entwicklung zwischen den 50er- und 70er-Jahren in ihrer Heimat spielen. Margaret Kaine ist verheiratet, hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder.
Homepage der Autorin: http://margaretkaine.com/.
MARGARET KAINE
Rebecca
Entscheidung aus Liebe
Aus dem Englischen vonKatharina Kramp
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Margaret Kaine
Titel der englischen Originalausgabe: „Roses for Rebecca“
Originalverlag: Hodder & Staughton, London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2007/2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: „Rosen für Rebecca“
Textredaktion: Britta Siepmann
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Nejron Photo / Shutterstock © Philip Openshaw / Getty Images (Abo) © Fourleaflover / Getty Images (Abo)
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-9540-2
www.luebbe.de
www.lesejury.de
1. Kapitel
»Ich bin der Bodenklopfer des Tonfassmachers!«
Als sie diese Worte hörte, blickte Rebecca an der Theke entlang. Sie grinste – nie im Leben! Schade, dass Sal und nicht sie den Gast bediente. Er war viel interessanter als ›Bier-Bill‹, wie man ihn hier in der Gegend nannte. Der kräftige Dockarbeiter beugte sich vor, um ihr noch einen seiner geschmacklosen Witze zu erzählen. »Oh, hör schon auf, Bill«, sagte sie ungeduldig. »Zwei von deinen Geschichten pro Tag reichen wirklich!«
Sie wusste, dass er ihr das nicht übel nehmen würde. Er war hier Stammgast, wie die meisten Besucher dieser Eckkneipe. Aber dann glitt Rebeccas Blick wieder an das andere Ende der Theke zurück. Der dunkelhaarige junge Mann war groß, gut gebaut und definitiv gutaussehend. Von seiner Erscheinung fasziniert schlenderte sie unter dem Vorwand hinüber, ein paar Flaschen Tonic holen zu müssen, und bückte sich, um sie aus einem der unteren Regale zu nehmen.
»Ach ja?«, sagte Sal, »und was soll das bitte sein? Auf den Arm nehmen könnense ’ne andere, klar!«
»Diesen Job gibt es wirklich«, begann er zu protestieren, hielt jedoch inne, als Rebecca sich aufrichtete. »Na, wenn das nicht Aphrodite ist, die sich aus dem Meer erhebt – oder sollte ich vielleicht sagen, hinter der Theke!« Erschrocken blickte sie direkt in zwei graue Augen, die sie bewundernd ansahen.
»Oh, Rebecca, bedien du ihn«, beschwerte sich Sal und wandte sich ab. »Dieser Kerl ist total verrückt! Er spricht nicht mal vernünftiges Englisch!«
»Sind Sie das?«, fragte Rebecca herausfordernd, während sie sein Glas entgegennahm.
»Mild, bitte«, meinte er, woraufhin sie den dekorativen Zapfhahn betätigte.
»Und?«, wiederholte sie. »Sind Sie verrückt?«
Er lachte. »Nein, aber Sie können nicht leugnen, dass man auf diese Art sehr gut mit jemandem ins Gespräch kommt.«
»Womit? Mit dem Bodenklopfer des Tonfassmachers oder dem Teil mit der Aphrodite?«
»Ersteres. Das zweite ist auf Sie allein zugeschnitten – ich konnte nicht widerstehen.«
»Dann nehme ich an, dass Aphrodites Haar rot war?«
»Ihr Haar ist nicht rot!« Er ließ den Blick über Rebeccas schulterlange Locken gleiten. »Es hat einen warmen rotgoldenen Ton, und lassen Sie sich von niemandem etwas anderes erzählen.«
»Meine Güte, Sie sind aber ganz schön herrisch.«
»Liegt wahrscheinlich daran, dass ich Lehrer bin.« Er lächelte. »Mein Name ist übrigens Ian. Ian Beresford.«
Rebecca zögerte, dann erwiderte sie: »Ich bin Rebecca Lawson.«
»Die volle Version? Dann hören Sie wohl nicht auf Becky?«
»Nein, tue ich nicht.« Ihre Stimme klang scharf, endgültig, und Ian hob die Augenbrauen. Sie besaß offenbar das zur Haarfarbe passende Temperament.
Rebecca wollte sich von ihm abwenden. »Kommen Sie zurück – bitte?«, bat er leise, dann runzelte er die Stirn, als er die zahlreichen Blicke der Männer bemerkte, die auf dem Mädchen ruhten, das weder in die Gegend noch in einen Pub zu passen schien. Sie sprach auch nicht mit dem Cockney-Akzent, den er überall um sich herum hörte.
Er schaute sich in der urigen Kneipe um. Ihm gefielen die alte Mahagoni-Theke, die Reihe Zinnkrüge auf dem Regal an der Wand über ihm, die kleinen intimen Nischen mit den Buntglasfenstern. Man konnte die vielen Geschichten, die diese Mauern mitangehört haben mussten, förmlich spüren, und grimmig fragte er sich, wie viele Männer die Wärme und Behaglichkeit dieser Kneipe in der Vergangenheit verlassen hatten, um sich den Schrecken des Krieges zu stellen.
»Woran denken Sie gerade?« Sal war zurückgekommen, um einen Schnaps einzuschenken.
Ian lächelte. »Ich habe nur gerade Ihre Kneipe und Ihr Barmädchen bewundert«, meinte er. »Sie ist nicht unbedingt die Frau, die man hier erwarten würde, nicht wahr?« Er grinste sie an, und es war klar, was er meinte, als sein Blick über Sals tiefen Ausschnitt und ihr wasserstoffblondes Haar glitt.
Sal war empört. »Aber ich bin die, ja? Damit Sie Bescheid wissen, ich arbeite hier nicht nur! Ron Bowler – mein Mann – ist hier der Wirt. Und Rebecca, von der Sie den Blick nicht abwenden können, ist meine Nichte. Passen Sie also lieber auf, was Sie sagen!« Sie ließ ihn stehen, und Ian verzog das Gesicht. Er hatte sie nicht beleidigen wollen. Als Rebecca in diesem Moment zu ihm hinüberblickte, lächelte er sie an. Sie war absolut umwerfend. Ein so schönes Mädchen hatte er noch nie gesehen. Und dabei war er nur in der Hoffnung hierhergekommen, Johnny Fletcher zu treffen!
Die Kneipe begann sich wie jeden Samstag um die Mittagszeit schlagartig zu füllen. Heimlich beobachtete Rebecca den jungen Mann und bemerkte, dass er immer wieder über die Schulter blickte, wenn jemand hereinkam. Ein paar Minuten später bediente sie den Mann neben ihm und fragte ihn dann neugierig: »Warten Sie auf jemanden?«
Ian blickte hoch. »Ja, das tue ich«, sagte er. »Auf einen Mann namens Johnny Fletcher. Er hat gesagt, ich würde ihn samstagmittags immer im Unicorn antreffen können, und ich dachte, ich überrasche ihn.«
»Johnny Fletcher? Oh, den kenne ich. Ich habe ihn schon oft bedient. Er hat nur ein paar Häuser weiter gewohnt. Aber er ist weggezogen. Seine Mutter konnte es nicht mehr ertragen, in dieser von den Bomben so zerstörten Umgebung zu leben. Sie sind zu ihrer Schwester gezogen, glaube ich. Sal hat mir erzählt, dass sie im Southend eine Pension betreibt.«
Ians Miene verdunkelte sich. »Verdammt!«, sagte er. »Ich hätte vorher schreiben sollen. Ich wollte mich mit ihm treffen, um das Ende des Krieges noch einmal mit ihm feiern zu können – wir sind zu spät heimgekehrt, um den eigentlichen Tag mitzuerleben.«
»So ein Pech!« Während Rebecca sich entfernte, starrte Ian niedergeschlagen in sein Bierglas. Nicht, dass er es irgendjemandem hätte verübeln können, dass er dieser ganzen Zerstörung entkommen wollte. Er hatte natürlich gewusst, dass London durch den Krieg sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden war. Aber selbst die Bilder in der Wochenschau hatten ihn nicht auf das Ausmaß der Verwüstung vorbereitet, das er heute Morgen in der Stadt gesehen hatte. Wie irgendjemand in einer solchen Umgebung guter Laune sein konnte, überstieg sein Vorstellungsvermögen, und doch war überall Entschlossenheit zu spüren. Es war, als ob die Leute sich sagten, dass sie nach allem, was sie in den letzten sechs Jahren durchmachen mussten, alles überleben konnten.
»Hast ein Auge auf ihn geworfen, was?«, fragte Sal bissig, als sie darauf wartete, dass Rebecca an der Kasse fertig wurde.
»Und wenn es so wäre?«
Sal zuckte die Schultern. »Über Geschmack lässt sich streiten!« Sal war berüchtigt für ihre scharfe Zunge, und Rebecca ignorierte sie.
»Er hat nach Johnny Fletcher gefragt.«
Ein Mann, der in der Nähe stand und den treffenden Spitznamen ›Tautropfen‹ trug, drehte sich um. »Wer, sagst du, hat nach ihm gefragt?«
»Der Typ am anderen Ende der Theke«, erwiderte Rebecca und wünschte, der Mann würde in ein Taschentuch investieren. Sie sah ihn in Ians Richtung schlendern und bediente die Gäste, die alle gleichzeitig hereingeströmt zu sein schienen. Als es dann schließlich wieder ruhiger wurde, bat Sal sie, noch eine Kiste dunkles Bier aus dem Keller zu holen.
»Ich weiß, das macht Ron normalerweise«, sagte sie, »aber …«
»Wie geht es ihm?« Rebecca deutete mit dem Kopf in Richtung Decke.
»Hustet sich immer noch die Seele aus dem Leib. Aber keine Sorge – das schwitze ich aus ihm heraus. Er darf Weihnachten nicht flach liegen, das würden wir alleine niemals schaffen!«
Zögernd öffnete Rebecca die Kellertür, schaltete das Licht an und stieg vorsichtig die steile Steintreppe hinunter. Sie hasste es, in den Keller zu gehen, obwohl ihr Onkel ihn in Ordnung hielt. Ängstlich blickte sie sich um. Ratten waren seit den Bombenangriffen eine echte Plage. Sie versteckten sich zwischen den Trümmern, verstört und verängstigt, und fanden den Weg in alle Häuser. Einmal war ihr hier unten eine begegnet, ein ekliges schwarzes Exemplar – dessen pinkfarbene Augen in dem plötzlichen aufflackernden elektrischen Licht geglänzt hatten. Sie hatte geschrien und das Tier entsetzt dabei beobachtet, wie es weggehuscht war. Das Geräusch der kratzenden Rattenfüße hatte sie tagelang verfolgt. Mäuse konnte sie gerade noch tolerieren, aber Ratten? Niemals!
Rebecca erschauderte, hob die schwere Kiste hoch und kämpfte sich zurück in den willkommenen Lärm und die verrauchte Atmosphäre der Kneipe. Sofort wanderte ihr Blick zu der Stelle, wo Ian gestanden hatte. Er war nicht mehr da! Verzweifelt blickte sie zu der Gruppe hinüber, die sich vor der Dartscheibe postiert hatte, dann zu dem Tisch, wo ein paar Männer Shovehalfpenny spielten, dann in die Kegelecke. Aber er war nirgendwo zu entdecken. Ich hätte es wissen müssen, dachte sie unglücklich. Ihr würde nichts Aufregendes passieren. War es nicht immer das Gleiche? Du hast einfach kein Glück, rief sie sich in Erinnerung. Das sollte dein bisheriges Leben dir doch bewiesen haben.
Offenbar war ihr die Enttäuschung anzusehen, denn Sal kam vorbei und kniff sie in den Arm. »Macht dir keine Sorgen, er ist nicht abgehauen. Er ist auf dem Klo!«
»Oh!« Rebecca spürte, wie sie errötete.
»Ein Glas Bier, meine Schöne. Ich geb dir einen aus.« Ein beleibter älterer Mann durchsuchte seine Taschen und hielt ihr einen Zehn-Schilling-Schein hin.
»Das ist sehr nett von Ihnen.« Das Geld für ihr Getränk würde in den schmalen Krug neben der Kasse wandern. Sie hielt sich ohnehin immer nur an Limonade. Die meisten Frauen, die in die Kneipe kamen, nahmen entweder dunkles Bier oder einen Drink. Gin Orange oder Port mit Lemon waren am beliebtesten, aber sie mochte beides nicht. An ihrem Geburtstag hatten Ron und Sal ihr ein paar Gläser Likör ausgegeben, aber davon hatte sie nur Kopfschmerzen bekommen. Außerdem hatte Rebecca ihre Gründe, den Alkohol zu meiden.
»Na, woran denken Sie gerade?« Der Gast erwartete offensichtlich eine Unterhaltung für sein Geld, und Rebecca bemühte sich, freundlich zu sein.
»Haben Sie schon alles für Weihnachten? Es wird bestimmt schön, wo es doch das erste nach dem Krieg ist.«
Er sah bedrückt aus und kratzte sich seinen mit Leberflecken übersäten, kahlen Schädel. »Ich weiß einfach nicht, was ich meiner Frau schenken soll! Ich weiß, dass sie sich ein neues Kleid wünscht, aber sie hat alle Kleidermarken verbraucht.«
Rebeccas Blick wanderte zu Ian, der hinter dem Mann vorbeiging. Er blickte über den Kopf des Mannes und lächelte Rebecca auf eine Art an, die ihr Herz schneller schlagen ließ. Als er langsam wieder an das andere Ende der Theke schlenderte und zu ihr herüberblickte, sagte sie schnell: »Kaufen Sie ihr doch etwas Romantisches, vielleicht ein Parfüm.«
»Das wär nichts für meine Gertie«, erwiderte er. »Die glaubt dann nur, ich würde was im Schilde führen.«
Rebecca lächelte mitleidig, dann ging sie langsam zu Ian hinüber, der offensichtlich mit ihr reden wollte. »Ich habe Johnny nur um ein paar Wochen verpasst«, sagte er. »Sein Nachbar kam zu mir rüber und hat es mir erzählt.«
»Noch eins?« Rebecca streckte die Hand aus und griff nach seinem Glas. Er schüttelte den Kopf. »Nein, danke. Ich muss gleich los. Ich bin nur für ein paar Tage hier.«
»Rebecca!« Sal versuchte, die Bestellungen einer ungeduldigen Gruppe Fußballfans zu erfüllen.
»Tut mir leid! Unsere Fußballmannschaft hat heute ein Heimspiel.«
»Fußball!«, meinte er achselnzuckend, während sie wegging. »Damit kann ich nichts anfangen. Dann schon lieber Tennis.«
Zu ihrer eigenen Frustration dauerte es eine Viertelstunde, bevor sie wieder mit ihm sprechen konnte. Er rauchte schweigend eine Zigarette, und sie wusste, dass er sie beobachtet hatte. »Hallo«, meinte er.
»Hallo.« Sie war plötzlich schüchtern – schließlich hatte er ihr schon gesagt, dass er nichts mehr trinken wollte.
»Ich wollte Sie gerne etwas fragen«, meinte Ian und hielt ihren Blick fest. »Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin zum ersten Mal in London. Sie hätten nicht vielleicht Zeit, sich ein bisschen die Stadt mit mir anzusehen?«
Rebeccas Herzschlag beschleunigte sich. Sie musste keine Minute darüber nachdenken – natürlich würde sie mitgehen! Aber es durfte auf keinen Fall so klingen, als könne sie es gar nicht abwarten. »Okay«, stimmte sie nach einem angemessenen Zögern zu. »Heute kann ich hier allerdings nicht weg – aber morgen könnte ich Sie irgendwo treffen.«
»Wo?« Ians Stimme klang drängend. Die Kneipe begann sich erneut zu füllen, und als zwei Männer sich hinter ihn stellten, stand er auf und beugte sich über die Theke. »Am Trafalgar Square, bei den Löwen, um zehn Uhr!«, flüsterte sie. Er nickte und bahnte sich seinen Weg durch die Menge zur Tür.
Rebecca sah ihn winken, bevor er ging, dann fragte sie einen der Stammgäste: »Das Übliche, Charlie?« Sie war aufgeregt, während sie ihn bediente, und ihre Gedanken überschlugen sich. Vielleicht war das doch ihr Glückstag! Wie lautete doch gleich der Titel dieses Liedes – Das Leben ist einfach wunderbar? In ihrem Fall traf das nicht zu, zumindest nicht bis jetzt. Ihre Kehle wurde eng, als die dunklen Erinnerungen sie wieder zu überwältigen drohten. Doch sie schob sie resolut zur Seite und zwang sich, an das viel drängendere Problem zu denken, was sie anziehen sollte. Vielleicht würde Sal ihr den neuen Hut leihen, den mit der schicken Feder. Ja, das wäre toll. Der würde gut zu ihrem warmen Karomantel passen. Und Pumps natürlich. Jeder wusste, dass hohe Absätze die Beine eines Mädchens betonten. Ein Hochgefühl überkam sie. Es würde nicht nur ihre erste echte Verabredung mit einem Mann sein, sondern sie würde auch ihren Horizont erweitern, neue Erfahrungen machen können. Seit ihrer Rückkehr vor sechs Monaten hatte sie ein regelrechtes Einsiedlerdasein geführt, nur für ihre Arbeit bei Ron und Sal gelebt und das Eastend nicht ein Mal verlassen.
Später verdarb ihr Sal diese Euphorie jedoch gründlich. »Da hast du aber einiges verschlafen, Mädchen, wenn du alles glaubst, was ein Kerl dir in einer Kneipe erzählt!«, machte sie sich lustig. »Er will dich am Trafalgar Square treffen? Das dürfte ein vergeblicher Ausflug werden, du wirst schon sehen.« Sie blickte ihre Nichte scharf an. Das Mädchen war in mancher Hinsicht so naiv. Na ja, das war ja auch nicht überraschend, wenn man bedachte, wo sie die letzten Jahre verbracht hatte! »Wenn du mich fragst, dann vergisst du das besser.«
2. Kapitel
Aber am nächsten Morgen stand Rebecca trotzdem pünktlich am Rand des imposanten Platzes. Würde er kommen?, fragte sie sich unsicher. Und dann sah sie ihn plötzlich. Obwohl Dezember war, trug er keinen Hut, und sein einziges Zugeständnis an das kalte Wetter war ein beigefarbener Schal. Ian stand groß und aufrecht da, und sein dunkles Haar, das nicht wie allgemein üblich mit steifem Gel gebändigt war, hob sich sanft im Wind.
Als Ian sah, wie Rebecca sich den Weg durch eine kleine Gruppe Touristen bahnte, schoss ihm sofort durch den Kopf – Tizian hätte sie sicher gerne gemalt! Er ging ihr entgegen. »Sie sind gekommen!«
»Das bin ich!« Für ein paar Sekunden standen sie sich in verlegenem Schweigen gegenüber.
»Ich dachte, wir könnten vielleicht in die Nationalgalerie gehen«, schlug er vor, »da wir doch schon praktisch davorstehen.«
»Ich war noch nie dort.«
Er blickte sie überrascht an. »Würden Sie gerne hingehen?« Als sie nickte, erklärte er: »Kunst gehört zu den Fächern, die ich studiert habe, deshalb würde ich gerne so viele Bilder wie möglich sehen, während ich hier bin.« Er grinste. »Ich habe meinem Vater versprochen, dass ich versuchen würde, The Fighting Temeraire zu sehen.« Rebecca schluckte nervös. Sie wusste nichts über Kunst. Und sie hatte auch noch nie etwas von The Fighting Temeraire gehört. Sie kannte die Mona Lisa, aber das einzige andere Bild, dessen Namen sie kannte, war der düster aussehende Druck mit dem Titel The Stag at Bay, der in dem kleinen Wohnzimmer hinter dem Pub hing. Sie beschloss, einfach zu schweigen, und innerhalb von Minuten waren sie die Stufen zu dem imposanten Gebäude hinaufgestiegen. Doch dort erwartete sie ein Zettel mit der Ankündigung: »Wegen der schweren Bombenschäden sind derzeit nur neun unserer 36 Räume geöffnet.«
»Der Rest unserer Sammlung ist immer noch eingelagert«, erklärte ihnen ein freundlicher Kurator, »aber wir hoffen, bald weitere Räume wieder öffnen und ab Ende Januar sehr viel mehr Bilder ausstellen zu können.«
Neugierig folgte Rebecca Ian in eine große, luftige Halle mit gerahmten Bildern an den Wänden. Sie blickten beide zu dem gewellten Eisendach hinauf. »Es wird lange dauern, bis das alles hier renoviert ist«, erklärte Ian grimmig, »die Nazis müssen sich für verdammt viel verantworten!«
Rebecca blickte sich um, fasziniert von der bloßen Größe einiger der Bilder. Als noch beeindruckender empfand sie aber die beinahe ehrfurchtsvolle Stille, die hier herrschte. Die wenigen anderen Besucher sprachen, wenn überhaupt, mit gedämpften Stimmen. Als Ian vor einem Stillleben stehen blieb, ging Rebecca langsam weiter und betrachtete all die Kunstwerke, von denen sie wusste, dass sie weltbekannt sein mussten.
»Gefällt es Ihnen?« Ian trat nach einigen Minuten wieder zu ihr. Sie zögerte. »Ich weiß, dass diese Bilder wohl alle berühmt sind, aber manche mag ich nicht – dieses dort drüben zum Beispiel.«
Ian lächelte sie an. »Natürlich gefallen Ihnen nicht alle. Kunst ist immer auch eine Sache des persönlichen Geschmacks.«
»Aber das dort drüben«, sagte sie, »das finde ich absolut wundervoll. Die Szene ist so friedlich, man hat fast das Gefühl, dort zu sein.«
»Sie mögen offenbar Landschaften. Also, mir persönlich gefallen meistens die Porträts besser.« Während sie langsam durch die neun Räume gingen, versuchte Rebecca, all die Eindrücke zu verarbeiten, die auf sie einstürmten. All diese Pracht lag nur wenige Kilometer von ihrem Zuhause entfernt, und doch war sie noch nie hier gewesen, nicht einmal vor dem Krieg. Einen Augenblick lang fragte sie sich, wie viele Menschen ihr ganzes Leben in der Hauptstadt verbrachten, ohne jemals eine der berühmten Kunstsammlungen zu besuchen.
»Gut«, meinte Ian später, »jetzt zum Buckingham Palace.« Er zog eine Karte aus seiner Tasche und konzentrierte sich. »Perfekt! Wir können die Mall zum Admirality Arch hinunter und dann durch den St. James’s Park gehen.«
»Sie klingen wie ein Touristenführer«, lachte Rebecca.
»Tut mir leid! Ist Ihnen das recht?« Er blickte zweifelnd auf ihre hochhackigen Schuhe. »Sie mussten schon in der Galerie viel laufen und herumstehen.«
»Mir geht es gut«, sagte sie und hoffte, dass ihre schmerzenden Zehen sie nicht noch schlimmer quälen würden.
»Sie kennen den Palast doch bestimmt schon, oder?«, fragte er, während sie über die breite Straße liefen.
Sie nickte. »Ja, als Kind war ich schon mal dort.«
Er blickte sie an, aber Rebecca sprach nicht weiter. Der St. James’s Park war eine friedliche Oase inmitten der überfüllten Londoner Innenstadt, und zuerst schlenderten sie in kameradschaftlichem Schweigen am Wasser entlang. Dann holte Ian sein Zigarettenetui heraus, öffnete es und bot es ihr an, aber sie schüttelte den Kopf.
»Ich musste gerade daran denken«, sagte er, »dass Charles I. hier entlanggegangen sein muss, bevor man ihn 1649 in Whitehall hinrichtete.«
»Sie sind wirklich ein unerschöpflicher Quell an Informationen.«
Ian ahmte einen amerikanischen Akzent nach. »Halt dich an mich, Kleines, dann siehst du was von der Welt.«
Sie lachte. »Ja, ich weiß – den Buckingham Palast.«
Sie standen vor den Toren, und Rebecca lächelte einen der steifen Wachposten an, der in schicker roter Uniform und mit Bärenmütze auf dem Kopf ausdruckslos geradeaus starrte. »Glauben Sie, der König und die Königin sind gerade da?« Rebecca sah zu den Fenstern des Palastes hinauf und hoffte, einen Blick auf die beiden Prinzessinnen erhaschen zu können.
Ian blickte am Fahnenmast hinauf. »Nein, die Flagge ist nicht gehisst. Ich schätze, sie sind nach Sandringham oder Balmoral gefahren.« Als er sah, wie enttäuscht sie war, neckte er sie: »Das macht doch nichts, Sie haben ja mich.«
Rebecca lächelte zu ihm auf, und ihr gefiel die Wärme, die in seinen Augen lag. »Wohin jetzt?«
»Ich dachte, wir gehen etwas essen. Ich weiß nicht, wie es mit Ihnen ist, aber ich sterbe vor Hunger.«
»Ich auch.« Rebecca zögerte. Am besten gingen sie in ein Lyons Corner House, und das nächste lag bei Charing Cross – dort hatte sie ihren elften Geburtstag feiern dürfen. Hastig schob sie die Erinnerung beiseite, versuchte verzweifelt, sie zu verdrängen. »Gute Idee«, sagte sie. »Und ich weiß auch schon, wo wir hingehen können.«
Er hielt ihr seinen Arm hin, und sie hakte sich mit ihrer behandschuhten Hand bei ihm ein. Es war kalt, und sie gingen schnell, aber trotzdem wollte Ian unbedingt mehr über das Mädchen an seiner Seite erfahren. »Was tun Sie gern, Rebecca? Wenn Sie nicht arbeiten, meine ich.«
»Mir bleibt nicht viel Zeit für Hobbys«, erwiderte sie. »In der Kneipe sind wir sieben Tage die Woche beschäftigt, und da ich dort lebe, versuche ich Sal so viel zu helfen, wie ich kann. Ich kann mir natürlich auch mal frei nehmen, aber dann muss ich alles andere später erledigen.« Als sie seinen forschenden Blick sah, lachte sie. »Sie wissen schon, mir die Haare waschen, bügeln und Socken stopfen. All die Dinge eben, die Frauen tun müssen und Männer nicht.«
»Ich muss mir auch die Haare waschen!«
»Ach ja?« Sie blickte auf seinen Kurzhaarschnitt und hob dann eine Locke ihres eigenen Haares hoch. »Kein Vergleich!«
Er lachte. »Akzeptiert.« Ians Neugier war eindeutig geweckt. Rebecca sprach nicht wie eine Londonerin. Da war ein ganz leicht singender Tonfall in ihrer Stimme. »Haben Sie immer in London gelebt?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Ich bin nach Wales evakuiert worden, als der Krieg ausbrach.«
»Ah, das erklärt es. Die Art, wie Sie reden, meine ich.«
»Was stimmt denn nicht mit der Art, wie ich rede?« Rebeccas Stimme klang scharf, und Ian versicherte schnell: »Ihre Stimme klingt wunderschön, wirklich. Sie reden nur ein kleines bisschen anders.«
»In welcher Hinsicht anders?«
Meine Güte, sie ist ganz schön kratzbürstig, dachte er. »Anders als die meisten anderen hier, das ist alles.« Er blickte sie an, während sie ein Café betraten. »Hey, das war keine Kritik. Ich wollte Ihnen damit ein Kompliment machen.«
Rebecca wurde rot. Jetzt war es ihr schon wieder passiert! Sie brauste immer viel zu schnell auf. Aber sie hasste es, wenn die Leute sie auf ihren Akzent ansprachen. In der Kneipe meinte ständig irgendjemand eine Bemerkung machen zu müssen. »Tut mir leid«, sagte sie knapp.
Ian bat um einen Tisch für zwei, und zu Rebeccas Freude führte man sie an einen Fensterplatz. Rebecca studierte die Menükarte und genoss den Augenblick. Hier diesem attraktiven jungen Mann gegenüber zu sitzen war ganz sicher eine Verbesserung zu der Art, wie sie normalerweise ihre Sonntage verbrachte!
»Lassen Sie uns die ganzen drei Gänge bestellen«, schlug Ian vor. »In dem billigen Hotel, in dem ich wohne, werde ich ganz sicher nichts bekommen! Zumindest ist das Essen hier nicht rationiert.«
Rebecca verzog das Gesicht. »Ich weiß, dass es auch in den großen Hotels nur wenig zu essen gibt. Erzählen Sie mir aber nicht, dass es den Leuten, die es sich leisten können, auswärts zu essen, nicht besser geht als uns anderen, selbst wenn die Restaurants nicht mehr als fünf Schilling berechnen dürfen. Schließlich können sie sich ihre Lebensmittelkarten aufsparen und sie später zu Hause verbrauchen!«
Er lachte. »Wie ich sehe, sind Sie eine kleine Rebellin!«
»Natürlich bin ich das! Ich warne Sie, Leute mit meiner Haarfarbe reagieren niemals passiv auf irgendetwas!«
»Da muss ich mich wohl in Acht nehmen!« Aber seine Augen funkelten sie an, und ihr gelang es nur mit Mühe, ihren Blick von ihm abzuwenden und zurück auf die Speisekarte zu richten.
»Ich nehme die Ochsenschwanzsuppe«, erklärte sie. »Und danach den Lammbraten.«
»Ich auch!«, meinte Ian prompt. »Und wie steht es mit Pudding?«
»Auf jeden Fall Treacle Sponge.«
»Ja, das nehme ich auch. Aber ich wette, es gibt nur ganz wenig Sirup und nicht mehr als einen Löffel voll Vanillesoße.«
»Was für ein Festessen!« Sie lachte, und Ian betrachtete ihr Gesicht. Er mochte ihr strahlendes Lächeln. In der vergangenen Nacht hatte er nur an sie denken können, hatte die Stunden gezählt, bis er sie wiedersah. Pass bloß auf, mein Junge, dachte er – du läufst Gefahr, dich ernsthaft in sie zu verlieben. Aber während er beobachtete, wie Rebecca sich mit glänzenden Augen im Raum umsah, musste er feststellen, dass es ihm egal war. Mit diesem Haar und der blassen, beinahe durchscheinenden Haut sah sie einfach absolut fantastisch aus, sodass alles andere völlig nebensächlich erschien.
Irgendwann kam eine Kellnerin mit einem weißen Häubchen und einer Rüschenschürze, um ihre Bestellung aufzunehmen. Als sie sich abgewandt hatte, erzählte Rebecca Ian, dass die Bedienungen hier ›die schnellen Mädchen‹ genannt wurden.
»Das muss ironisch gemeint sein«, meinte er grinsend. »Denn zur besonders schnellen Truppe scheinen sie wirklich nicht zu gehören!« Dann lehnte er sich in seinem Stuhl zurück und realisierte, dass er kaum etwas über das Mädchen wusste, das ihm gegenübersaß und von dem er den Blick nicht abwenden konnte. »Erzählen Sie mir etwas über sich«, meinte er aus einem Impuls heraus.
Sie blickte ihn an, und er sah, wie ein Schatten über ihr Gesicht huschte, und als sie lächelte, wirkte es gezwungen. »Alter vor Schönheit! Sie zuerst.«
»Nun«, er überlegte kurz, »ich wohne in Stoke-on-Trent. Und wie Sie bereits wissen, bin ich Lehrer. Zumindest wäre ich das geworden, wenn Hitler nicht dazwischengefunkt hätte. Können Sie sich vorstellen, dass der Krieg ausbrach, als ich gerade meine erste Stelle antreten wollte? Zum Glück hat mich dieselbe Schule erneut eingestellt, als ich zurückkam. Wie Sie vielleicht wissen, herrscht im Moment ein großer Lehrermangel.« Er brach ab, als die Kellnerin die Suppe und Brötchen brachte, dann fuhr er fort: »Ich hatte wirklich Glück. Ich war von Anfang an dabei und bin ohne eine einzige Schramme durchgekommen.«
»Wo waren Sie denn?« Als sie bemerkte, wie sein Blick sich verdunkelte, wünschte Rebecca, sie hätte das nicht gefragt. Es war allgemein bekannt, dass die Männer, die in der Armee gewesen waren, nicht gerne über ›ihren Krieg‹ sprachen. Wie hatte ihr ein müder, verschwitzter Soldat in einer schlecht sitzenden Uniform einmal gesagt, der auf dem Weg nach Hause noch kurz in die Kneipe gekommen war: »Wir wollen das alles einfach nur hinter uns lassen und wieder ein normales Leben führen. Ich habe seit Monaten von diesem Bier geträumt, Mädchen! Verdirb mir das jetzt nicht, indem du mich mit Fragen löcherst!«
Deshalb ging Rebecca nicht weiter auf das Thema ein, nachdem Ian knapp geantwortet hatte: »Ich war mehrere Jahre lang in Kriegsgefangenschaft.«
»Ich frage mich, wie lange wir wohl noch mit den Rationierungen leben müssen«, überlegte Ian laut. »Ich wette, es wird länger dauern, als die Leute glauben.«
»Ich kann mich kaum an ein Leben ohne Rationierungen erinnern.«
»Nein, Sie waren – wie alt? Als der Krieg ausbrach, meine ich?«
»Sie wollen mich wohl ein bisschen aushorchen, was?«, fragte sie grinsend. »Ich bin achtzehn, falls es das ist, was Sie herausfinden wollten.«
Er lächelte, biss von seinem Brötchen ab, und nach ein paar Sekunden meinte er: »Dann bin ich ein gutes Stück älter als Sie.«
»Wie alt denn? Fünfzig?«, neckte sie ihn.
Er lachte. »Siebenundzwanzig.«
Sie sah ihn an, und ihr gefiel, was sie sah. Ian hatte eine hohe Stirn mit ausdrucksstarken dunklen Augenbrauen, und dann waren da diese ungewöhnlichen grauen Augen. Auf jeden Fall ist er gutaussehend, beschloss sie und sagte: »Siebenundzwanzig ist nicht alt. Außerdem sehen Sie jünger aus.«
Und du, dachte Ian, siehst älter aus als achtzehn, aber er schaffte es, sich diese Bemerkung zu verkneifen. Vielleicht begann er endlich zu lernen, etwas taktvoller zu sein! Er betrachtete Rebeccas Gesicht und überlegte, was genau es eigentlich war, das sie älter aussehen ließ. Es liegt an ihren Augen, stellte er fest und fragte sich, was sie in den letzten Jahren erlebt haben mochte. Heutzutage wusste man nie.
Die Kellnerin kam zurück und räumte die Teller ab. »Alles in Ordnung, ihr Süßen?«
»Alles bestens«, antworteten sie beide gleichzeitig und lachten.
»Und wie gefällt Ihnen die Arbeit in der Kneipe?« Es war offensichtlich, dass Rebecca nicht gerne über ihre Vergangenheit sprach, deshalb beschloss Ian, das Gespräch auf ein unverfänglicheres Thema zu lenken.
Sie lächelte. »Es ist ganz okay. Man lernt dabei ein paar echte Originale kennen, das kann ich Ihnen sagen. Aber sie behandeln mich alle mit Respekt. Ron würde ihnen sonst auch sofort aufs Dach steigen.«
Ian runzelte die Stirn. »Er ist Ihr Onkel, nicht wahr? Ich habe ihn gar nicht gesehen.«
»Nein, er hat die Grippe.« Sie lachte. »Sonst hätten Sie ihn nicht übersehen können! Er war früher mal Schwergewichtsboxer – er hat sogar ein Blumenkohlohr, mit dem er es beweisen kann.«
»Hört sich an, als müsste man Angst vor ihm haben.«
»Oh, er kann ganz schön ruppig sein. Aber zu mir war er schon immer sehr gut.«
Sie blickten beide erwartungsvoll auf, als der Lammbraten serviert wurde, und Rebecca begann ihn beinahe ehrfürchtig zu essen. Verstohlen beobachtete Ian sie und bemerkte, wie vorsichtig sie schmale Stücke vom Fleisch abschnitt. Dann begann er selbst hungrig zu essen, und für eine Weile schwiegen sie. Der Rest des Essens verlief auf ähnliche Weise; sie unterhielten sich über unverfängliche Themen und genossen ihren Pudding, doch wenn ihre Blicke sich trafen, war die Anziehungskraft zwischen ihnen so stark, dass Rebecca errötete. Sie blickte auf seine Hände, die auf dem Tisch lagen. Die meisten Männer, die sie kannte, hatten raue, schwielige Hände. Ian dagegen schien mit seinen gepflegten Nägeln in eine andere Welt zu gehören.
»Sie sind so wunderschön, Rebecca«, meinte Ian leise, und als sie zu ihm aufblickte und er den schüchternen, sanften Ausdruck in ihren Augen sah, stockte ihm der Atem. Plötzlich verspürte er das dringende Bedürfnis zu gehen. Er wollte nicht von anderen Leuten umringt sein, er wollte mit ihr allein sein.
»Kommen Sie«, sagte er und holte Geld aus seiner Tasche, um die Rechnung zu bezahlen. »Lassen Sie uns gehen. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht das Parlament ansehen. Was meinen Sie?«
»Könnten wir vielleicht den Bus nehmen? Um ehrlich zu sein, bringen meine Füße mich um.«
Er grinste. »Angesichts Ihrer Schuhe überrascht mich das nicht.« Er bemerkte, wie sie leicht zusammenzuckte, als sie aufstanden. »Neuer Vorschlag. Wie fänden Sie es, wenn wir stattdessen ins Kino gehen? Obwohl wir nicht mehr genug Zeit für das ganze Programm haben.« Ian lachte, als er sah, wie erleichtert sie war.
Als sie glücklich im Kinosessel saß, konnte Rebecca es kaum glauben, dass es in dem Thriller Pink String and Sealing Wax mit Googie Withers, für den sie sich entschieden hatten, um die mordende Ehefrau eines Kneipenwirts ging.
»Ich sollte Ron besser warnen, sich in Acht zu nehmen«, scherzte sie, als sie am frühen Abend aus dem Kino traten.
Ian blickte auf die Uhr. »Es ist schon ganz schön spät, meine Liebste. Ich muss langsam zurück zum Hotel und meine Sachen holen, damit ich meinen Zug noch erwische.«
Der zärtliche Kosenamen ließ eine heiße Welle der Freude in Rebecca aufsteigen, aber der Gedanke, dass er London verließ, machte sie unsicher. Ian hatte mit keinem Wort erwähnt, ob sie sich wiedersehen würden! Und plötzlich wusste sie, den Gedanken nicht ertragen zu können, dass dies womöglich ihre einzige Verabredung gewesen sein würde.
Ians Augen trafen ihre, und er konnte seinen Blick kaum von ihr lösen, aber die Zeit wurde knapp. Er studierte noch einmal seine Karte und den Plan der U-Bahn, dann sagte er schnell: »Wir könnten eine dieser Straßen zum Victoria-Ufer hinuntergehen und dann später die U-Bahn nehmen. Was meinen Sie?« Dann grinste er. »Was bilde ich mir eigentlich ein, in Anbetracht der Tatsache, dass Sie sich hier viel besser auskennen als ich!«
Sie lächelte. »Aber ich kenne mich hier gar nicht wirklich aus. Ich war noch nicht ganz zwölf, als ich evakuiert wurde. Und ich bin erst seit sechs Monaten wieder zurück.«
Wenige Minuten später schlenderten sie Hand in Hand nebeneinander und betrachteten die Schiffe auf der Themse, aber tatsächlich waren sie beide in ihre eigenen Gedanken und Gefühle versunken. Rebecca war sich nur allzu bewusst, wie sehr es zwischen ihnen knisterte und wie attraktiv sie ihn fand; Ian dagegen war erleichtert, dass sie hier in der Dämmerung tatsächlich die Möglichkeit hatten, ein bisschen allein zu sein. In einem der Gärten konnte er sie endlich in seine Arme ziehen. Einen Augenblick lang hielt er sie einfach nur fest, doch als er dann in ihre lebhaften grünen Augen blickte, senkte er seine Lippen auf ihre, die ihm willig entgegengehalten wurden. Ihr erster Kuss war zärtlich, vorsichtig, aber als ihre Münder sich ein zweites Mal trafen, flammte die Leidenschaft unerwartet schnell zwischen ihnen auf. Erschüttert lehnte Rebecca einen Moment lang ihren Kopf an seine Schulter, und als sie sich schließlich voneinander lösten, blickte Ian ihr mit angespannten Zügen forschend in die Augen. »Rebecca, du weißt, was mit uns passiert ist, oder?« Sie schüttelte den Kopf.
»Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt!« Über sein Geständnis selbst überrascht, berührte er ihr Haar. »Ich kann gar nicht fassen, wie schnell das alles ging!«
Er küsste sie erneut, dann sagte er verzweifelt: »Ich muss gehen!« Sie liefen wieder zurück, und als er noch einmal über den Fluss blickte, meinte Ian: »Sieh mal, was für ein Dunst über dem Fluss liegt. Ich glaube, es zieht Nebel auf.«
»Ja, manchmal haben wir hier eine ganz schön dicke Suppe«, antwortete Rebecca, doch sie machte sich keine Sorgen über den Nebel, sondern war immer noch ganz benommen von dem Sturm der Gefühle, den Ians Kuss in ihr entfacht hatte.
Sie gingen zum U-Bahnhof Charing Cross, sodass Ian die Bahn nach Euston und Rebecca die District-Linie nach Stepney nehmen konnte. Als sie sich schließlich in der Menge am Bahnsteig gegenüberstanden, meinte Ian schnell: »Ich werde dir schreiben, das verspreche ich dir!«
Er küsste sie noch einmal und gab ihr dann einen zweiten kurzen Abschiedskuss. Rebecca blieb stehen, bis seine große Gestalt nicht mehr zu sehen war. Dann wandte sie sich ab und hoffte fieberhaft, dass er es ernst meinte und ihr auch wirklich schreiben würde – denn wie, wurde ihr mit Schrecken bewusst, sollte sie sonst Kontakt zu ihm aufnehmen?
3. Kapitel
»Na, was erwartest du denn, wenn er dir seine Adresse nicht gegeben hat?« Sals Stimme klang beinahe zufrieden. »Und du weißt, was ich darüber denke!«
»Ich habe es dir doch schon gesagt – er hat gesagt, dass er mir schreibt, und das glaube ich ihm auch«, gab Rebecca mit mühsamer Beherrschung zurück. Wütend schrubbte sie die Pfanne, spülte sie ab und stellte sie zum Trocknen auf die Spüle. Sal nahm sich ein Trockentuch. »Dein Cousin Bert wollte nur eine Flasche Milch holen gehen, und das ist jetzt zehn Jahre her!«
»Nun hör schon auf, Sal«, beschwerte sich Ron, der sich nach seiner Grippe immer noch schwach fühlte. »Ich habe ohnehin noch immer Kopfschmerzen, auch ohne euer Gezicke mitanhören zu müssen!«
»Heute ist erst Freitag«, meinte Rebecca, obwohl die Enttäuschung tief saß. Es war dumm gewesen zu erwarten, Ian würde ihr schreiben, sobald er zu Hause angekommen war. Und Sals ›Ich-habe-es-dir-gleich-gesagt‹-Blicke, die sie ihr jedes Mal zuwarf, wenn der Briefträger wieder weg war, gingen ihr auf die Nerven.
Auch Gloria machte nur bissige Bemerkungen. Als Rebecca in die Kneipe kam, wohnte Gloria, eine unzufriedene Brünette, nur zwei Häuser weiter und war das einzige ungefähr gleichaltrige Mädchen in der näheren Umgebung. Allein diesem Umstand war es zu verdanken, dass sich zwischen ihnen eine oberflächliche Freundschaft entwickelt hatte.
»Du weißt genau, dass ich sonntags immer vorbeikomme«, beschwerte sie sich, während sie sich eine Zigarette ansteckte.
»Deswegen kann ich mich doch trotzdem verabreden!« Rebecca wedelte den Rauch weg, den Gloria in ihre Richtung blies.
»Du hast nicht einen Gedanken an mich verschwendet, herzlichen Dank auch! Also, ich würde mich jedenfalls nicht einfach von irgendeinem Fremden abschleppen lassen!« Glorias kleine braune Augen musterten Rebecca verächtlich.
»Er hat mich nicht abgeschleppt, wie du das nennst. Das hört sich ja an, als wäre ich ein Flittchen! Sal hat ihn kennengelernt, nicht wahr?«
Aber Sal ließ sich nicht auf ihre Seite ziehen. »Ich habe ihm ein Bier gebracht, mehr nicht.«
Gloria hob ihre sorgfältig gezupften Augenbrauen, und Rebecca fuhr sie an: »Ihr werdet schon noch sehen, dass ihr euch irrt!«
Das Warten war quälend. Zweimal hörte Rebecca in dieser Woche das Lied Give Me a Kiss to Build a Dream On im Radio und dachte sehnsüchtig an die romantischen Momente am Ufer. Und dann fiel am Samstagmorgen endlich ein ungewöhnlich aussehender Umschlag auf die Matte. Und der Poststempel lautete Stoke-on-Trent! Rebecca schnappte sich den Brief sofort, rannte schnell nach oben in ihr Zimmer, setzte sich aufs Bett und riss ihn auf.
Meine liebste Rebecca,
ich habe mehrere Anläufe für diesen Brief gebraucht. Keiner drückte aus, was ich eigentlich sagen wollte. Dich zu treffen war die wundervollste Erfahrung in meinem Leben, und unser gemeinsamer Tag am Sonntag wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ich habe jedes meiner Worte ernst gemeint. Ich habe mich in dich verliebt, und ich kann kaum glauben, dass du genauso empfindest.
Ich versuche, vor Weihnachten noch einmal nach London zu kommen. Sobald ich kann, schreibe ich dir und nenne dir den genauen Zeitpunkt. Pass bis dahin gut auf dich auf, mein Liebling, und denk manchmal an mich.
Alles Liebe
Ian
Rebecca las den Brief wieder und wieder, vor allem die magischen Worte Ich habe mich in dich verliebt.
Sie tanzte beinahe die Treppe hinunter und wedelte mit dem Umschlag vor Sals Nase herum. »Da hast du es, du Besserwisserin! Und seine Adresse steht auch auf dem Umschlag! Das beweist, dass er nicht verheiratet ist!«
Sal, die davon überzeugt gewesen war, mit ihrem Verdacht richtig zu liegen, wurde ein bisschen weicher, als sie Rebeccas strahlende Augen sah. Aber dann zuckte sie nur mit den Schultern: »Bist du jetzt überhaupt noch in der Lage, vernünftig zu arbeiten?«
Aber nichts konnte Rebeccas gute Laune dämpfen, und sie summte leise vor sich hin, während sie bei den Vorbereitungen für das Öffnen der Kneipe half. Er würde vor Weihnachten noch einmal zu Besuch kommen, hatte er geschrieben!
Und Ian hielt sein Wort. Diesmal kam er am Samstagmorgen und blieb nur eine Nacht – wieder in dem billigen Hotel in der Nähe von Euston. Rebecca bettelte darum, den Abend frei zu bekommen. Ron und Sal gaben nach einigem Knurren schließlich nach. Allerdings gab es eine Bedingung.
»Ich will mal einen Blick auf ihn werfen«, erklärte Ron ihr. »Du weißt, um welche Zeit wir essen – am Nachmittag, wenn die Kneipe geschlossen ist. Bring ihn also morgen mit!« Und wenn Ron in diesem Tonfall sprach, gehorchte ihm selbst der wildeste seiner Gäste.
»Sie ist schon ein bisschen komisch, die Kleine«, meinte Ron, nachdem Rebecca nach unten gegangen war. »Ich nehme an, sie hat immer noch nichts gesagt, du weißt schon – über …«
Sal schüttelte den Kopf. »Nicht einen Pieps. Hab ich dir doch schon erzählt – als sie ankam und ich sie abholte, stand sie einfach nur da wie eine versteinerte Statue. Ich frage mich manchmal, ob ich ihr mehr Zeit hätte geben müssen, sich richtig einzugewöhnen!«
»Nee«, meinte Ron. »Es war schon besser, gar nicht darauf einzugehen.«
»Ich wünschte trotzdem, sie würde reden. Darüber reden, meine ich. Aber wenn ich versuche, etwas aus ihr herauszubekommen, macht sie sofort dicht!«
Er zuckte die Schultern. »Du musst eben Geduld haben und ihr Zeit lassen.«
Ian machte den Vorschlag, sich an der Oxford Street zu treffen. Ich bin erst gegen Mittag da, hatte er geschrieben, dann können wir dort etwas essen gehen, und dann könntest du mir vielleicht ein bisschen bei meinen Weihnachtseinkäufen helfen.
Diesmal war Rebecca etwas vernünftiger bei der Wahl ihrer Schuhe. Ein niedrigerer Absatz war ein Muss, wenn sie nicht wieder humpeln wollte, aber sie wählte trotzdem ein Paar, das ihre schlanken Fesseln betonte. Sie beschloss, die Konvention zu ignorieren und keinen Hut zu tragen. Der würde nur ihr Haar verstecken, und dabei war es doch gerade das gewesen, womit sie seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Sie hatte es gehasst, in der Schule ›Karottenkopf‹ genannt zu werden. Aber der Rotton war tiefer geworden, als sie älter wurde, und obwohl sie versuchte, nicht eingebildet zu sein, war sie doch stolz darauf und ließ die rotblonden Wellen über ihre Schulter fließen. Sie hatte sie schließlich während des Krieges schon lange genug immer unter einem Haarnetz oder unter einem Kopftuch verstecken müssen!
Zum Glück war das Wetter trocken, und Rebecca wartete am Eingang von Marks & Spencer. Während sie nervös die Menge absuchte, begann sie sich zu fragen, ob es nicht besser gewesen wäre, ihn in Euston abzuholen, denn dann hätte sie zumindest gewusst, ob sein Zug Verspätung hatte.
Aber plötzlich war er da. Er stand hinter einer großen Frau, die zwei streitende Kinder an den Händen hielt. Sie blockierten den Bürgersteig, und über ihre Köpfe hinweg suchte Ian ihren Blick und zuckte hilflos mit den Schultern. Dann, Sekunden später, lag sie in seinen Armen, und er drückte sie an sich, als wären Monate anstatt Wochen vergangen, seit sie sich zum letzten Mal gesehen hatten.
Er hielt sie ein Stück von sich ab und blickte ihr forschend in die Augen, musterte ihr Gesicht, betrachtete ihr Haar, und dann beugte er sich trotz der vielen Leute, die an ihnen vorbeigingen, zu ihr hinab und küsste sie. »Du bist sogar noch schöner, als ich dich in Erinnerung hatte.« Sie errötete, und er lachte. »Komm, lass uns irgendwo einen Tee trinken.«
Als sie in einem kleinen Café saßen, schlüpfte Rebecca aus ihrem Wintermantel, und darunter kam ein grüngepunktetes Kleid mit einem gekreuzten Oberteil zum Vorschein, das die sanfte Rundung ihrer Brüste betonte. Ian hatte das Gefühl, stundenlang einfach nur dasitzen und sie ansehen zu können, wurde aber von der Kellnerin in die Wirklichkeit zurückgeholt. So überlegten sie, was sie bestellen sollten, und entschieden sich für Frühstücksfleisch mit Pommes und Erbsen.
»Glaubst du, dass die Leute mich anstarren, wenn ich mir ein Pommesbrot mache?«, fragte er grinsend, nachdem das Essen serviert worden war.
»Ein was?«
»Ihr Londoner kennt aber auch gar nichts«, meinte er. »Schau.« Ian nahm eine Scheibe Brot, schmierte Butter darauf und legte fünf saftige, in Salz und Essig getauchte Pommes darauf, klappte es zu und biss hinein.
Rebecca machte es ihm nach. »Mm«, murmelte sie mit vollem Mund. »Ist man das so in Stoke-on-Trent?«
»Stoke«, korrigierte er sie. »Zuhause benutzt niemand den vollen Namen. Ja, das isst man bei uns so. Aber unsere Spezialität sind Oatcakes. Warte nur, bis du ein paar davon zu deinen Eiern mit Schinken probierst.«
Rebecca wurde ganz warm ums Herz. Das bedeutete doch wohl, dass er vorhatte, sie mit nach Hause zu nehmen, um sie seinen Eltern vorzustellen? Das würde Sal zum Schweigen bringen, dachte sie voller Befriedigung.
Ian wollte ins Liberty’s gehen, deshalb liefen sie ein wenig später zur Regent Street und dort in den unverwechselbaren schwarz-weißen Laden, wo er seiner Mutter ein paar Taschentücher mit Spitzenrand kaufte. »Sie wird sie nur zu besonderen Anlässen benutzen«, meinte er grinsend, »du weißt ja, wie Mütter sind.«
Rebecca antwortete nicht, und Ian wurde nachdenklich, während sie durch das Erdgeschoss des Ladens bummelten. Er wusste immer noch nichts über Rebeccas persönliche Geschichte. Manchmal, wenn sie sich unbeobachtet fühlte, erschien eine Traurigkeit in ihren Augen, aber er war sensibel genug, sie nicht mit neugierigen Fragen zu bedrängen. Sie genoss ganz offensichtlich die besondere Atmosphäre des Geschäfts, und er lächelte, als er sah, wie sie immer wieder irgendetwas in die Hand nahm, nach dem Preisschild suchte und es dann mit einem entsetzten Gesichtsausdruck hastig wieder zurücklegte.
»Nicht ganz das, was wir uns normalerweise leisten können«, flüsterte er. »Ich habe bekommen, was ich wollte. Sollen wir zurück zur Oxford Street gehen?«
Sie nickte, und innerhalb der nächsten Stunde kaufte Ian darüber hinaus noch ein Paar gefütterte Handschuhe für seine Mutter sowie einen warmen Paisley-Schal für seinen Vater.
Rebecca sah ihn an. »Du verstehst dich gut mit deinen Eltern, oder?«
»Ja. Wir stehen uns sehr nahe. Sie haben für mich viele Opfer gebracht. Ich bin nicht nur der Erste aus unserer Straße, der zur Universität gegangen ist – ich bin der Einzige!«
»Was macht dein Vater denn?«
»Das Gleiche wie die meisten Menschen in den Potteries. Er arbeitet in einer Topfbank.« Als Rebecca ihn fragend ansah, erklärte er: »Das ist der lokale Ausdruck für eine Porzellanfabrik.«
Ian trat zur Seite, um eine Frau vorbeizulassen. Sie schob einen Rollstuhl, in dem die zusammengesunkene Gestalt eines jungen Mannes saß. »Armer Teufel«, murmelte Ian, während er dem Paar nachblickte. »Hast du die Verbrennungen auf seinem Gesicht gesehen?«
Rebecca, die versucht hatte, nicht hinzustarren, nickte. »Wahrscheinlich war er bei der Royal Air Force.«
»Gott, ich hatte so viel Glück«, meinte er grimmig. »Weißt du, manchmal fühlt man sich deswegen richtig schuldig.«
»Damit ist niemandem geholfen«, erklärte sie überzeugt.
Aber Ian kommentierte das nicht weiter, und als sie den verschlossenen Ausdruck auf seinem Gesicht sah, fragte sich Rebecca, ob sie etwas Falsches gesagt hatte. Sie gingen schweigend weiter, und dann meinte er plötzlich: »Ich weiß nicht, wie das mit dir ist, aber ich habe jetzt genug von Geschäften.«
»Wie wäre es mit dem Hyde Park?« Rebecca deutete auf einen vorbeifahrenden Bus, und sie liefen ihm hinterher, um ihn noch zu erreichen, und kletterten wenig später auf die hohe Plattform. Außer Atem ging Rebecca durch den Gang voran zu einem Sitzplatz weiter vorne.
»Trainiert wohl für die Olympiade, was?«, scherzte der Schaffner, der vorbeikam und ihnen einen Fahrschein verkaufte. Mit einem bewundernden Blick auf Rebecca zwinkerte er Ian zu, dann wandte er sich einer alten Dame zu. »Hallo, mein Schatz. Auf dem Weg zu deinem Liebsten?«
»Frecher Kerl!« Aber die Frau lächelte.
»Ihnen gelingt es, die Stimmung der Leute zu heben, nicht wahr?«, flüsterte Rebecca.
»Wem?«
»Fröhlichen Schaffnern.«
»Ja, das hilft ein bisschen.« Doch Ian blickte geistesabwesend aus dem Fenster, wieder entsetzt über das schiere Ausmaß der Bombenschäden. Kriege waren so verdammt sinnlos! Was brachten sie außer Unglück und Trauer? Doch in ganz England war man sich darüber bewusst gewesen, dass es diesmal keine Alternative gab. Und erst jetzt wurde langsam überall die Wahrheit über die entsetzlichen Gräueltaten in den deutschen Konzentrationslagern bekannt. Ian erinnerte sich, wie seine Mutter geweint hatte, als sie das erste Mal die Wochenschaubilder sah. Die Szenen über die ausgezehrten Überlebenden hatten sie so aufgewühlt, dass sie das Kino noch vor dem nächsten Film verlassen mussten.
Nervös blickte Rebecca ihn an und bemerkte, dass er ganz in Gedanken versunken war. Irgendwie hatte ihre Begegnung mit dem Mann im Rollstuhl die unbeschwerte, kameradschaftliche Atmosphäre zwischen ihnen verändert. Aber als sie ein paar Minuten später an der Serpentine-Galerie vorbeigingen, schien sich Ians Stimmung zu heben. Er lächelte sie an, und Rebecca meinte: »Du wolltest mir erzählen, was dein Vater von Beruf ist.«
»Ja, das wollte ich. Er war ein Werfer, das bedeutet, dass er auf der Töpferscheibe Tonwaren herstellte – ein Job, der sehr viel Fingerspitzengefühl verlangt. Als ich ein Kind war, hat er mir immer erzählt, er sei der Bodenklopfer des Tonfassmachers, und die Bezeichnung fand ich so lustig, dass ich immer lachen musste. Auch wenn man es kaum glauben mag, eine solche Tätigkeit gibt es wirklich, allerdings ist sie nicht sehr weit verbreitet. In einigen Porzellanfabriken gibt es jemanden – normalerweise einen Jungen –, der einen Klumpen Ton so zurechtschlägt, dass man daraus den Boden des Saggars machen kann.«
»Was ist ein Saggar?«
»Ein Tongefäß, in dem Keramik gebrannt wird.«
»Wie ich schon sagte«, meinte sie grinsend, »du bist ein unerschöpflicher Quell an Informationen.«
»Und wie ich schon sagte …«
»Ich weiß«, sagte sie und lachte, »wenn ich mich an dich halte, dann sehe ich was von der Welt!«
Ian grinste, als Rebecca ihm von Rons Ultimatum erzählte. »Er will mich unter die Lupe nehmen, was?«
»So etwas in der Art! Das macht dir doch nichts aus, oder?«
»Natürlich nicht.«
Rebecca lächelte zu ihm auf, und es versetzte ihm einen Stich, als ihm wieder bewusst wurde, wie jung sie war. Sie wirkte so unschuldig, so unverdorben, so vertrauensvoll. Er hielt inne und nahm sie plötzlich in die Arme, weil er sie einfach festhalten wollte. So genossen sie das für die Jahreszeit sehr milde Wetter, indem sie den Rest des Nachmittags herumliefen, stehen blieben, sich umarmten und küssten. Rebecca war noch niemals so unendlich glücklich gewesen.
Als aber der Abend näherrückte, wurde es langsam kälter. Ian blickte sie an. »Ist dir kalt?«
Sie nickte. »Ein bisschen.«
»Und du hast bestimmt auch Hunger«, meinte er und fügte hinzu: »Sieh doch – ist das nicht Speaker’s Corner?« Er deutete auf die Stelle, wo ein dünner älterer Mann mit einem eng sitzenden gestreiften Schlips auf einer Seifenkiste stand und der kleinen Gruppe von Leuten, die sich vor ihm versammelt hatte, eine Strafpredigt hielt.
»Worüber spricht er?« Als sie näher kamen, versuchte Rebecca zu verstehen, was die heisere Stimme sagte.
Ian grinste. »Über die Gefahren des Alkohols! Da du in einer Kneipe arbeitest, solltest du dir das wohl besser nicht anhören.«
»Er hat aber recht«, sagte sie später, während sie Hand in Hand den Park verließen, »der Alkohol ist an vielem schuld.«
Etwas in ihrer Stimme ließ Ian aufhorchen. Er sah sie scharf an, aber Rebecca schien sich in diesem Moment völlig auf den Verkehr zu konzentrieren, um den richtigen Moment abzupassen, die Straße überqueren zu können. Sie gingen weiter, bis sie ein Lyons Corner House fanden, und bestellten sich beide eine Tasse Tee und ein paar getoastete Rosinenbrötchen.
»Das ist besser«, meinte Rebecca und stellte ihre Tasse ab.
»Und was machen wir jetzt?«, fragte Ian.
»Könnten wir uns I Know Where I’m Going ansehen?«
»Wer spielt denn mit?«
»Wendy Hiller und Roger Livesay. Sal sagt, der Film spiele auf der Isle of Mull und die Landschaftsaufnahmen seien wunderschön.«
»Das wäre wirklich mal etwas anderes als das hier«, meinte er grimmig auf dem Weg ins Kino, als sie an einer Lücke vorbeikamen, in der einmal ein Haus gestanden hatte. »Findest du es nicht deprimierend, ständig diese ganze Zerstörung vor Augen zu haben?«
»Doch, das tue ich«, erwiderte sie leise. Ian musterte das schlanke Mädchen an seiner Seite. Sie hatte ihre Eltern immer noch nicht erwähnt; und nicht zum ersten Mal fragte er sich, ob diese bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen waren. Aber wenn das der Fall war, dann konnte er nicht verstehen, wieso sie ihm das nicht erzählte. Ich bin vielleicht bis über beide Ohren in sie verliebt, dachte er, aber in mancherlei Hinsicht ist sie mir immer noch ein Rätsel.
Der Film war romantisch und machte einen die Sorgen vergessen, auch die Landschaftsaufnahmen waren tatsächlich wunderschön. Aber diesmal zog es sie unwiderstehlich auf zwei leere Sitzplätze in der letzten Reihe, und im Halbdunkel des Kinosaales konnte Ian endlich das tun, wonach er sich gesehnt hatte. Er küsste Rebecca lange und leidenschaftlich, und als sie ihren Mantel auszog und er spürte, wie ihr weicher Körper sich an ihn presste, legte er die Lippen in die weiche Mulde an ihrem Hals. »Ich liebe dich«, flüsterte er, und sie saßen eng umschlungen und ineinander versunken da, während auf der Leinwand der Film lief.
»Er war gut, nicht wahr?«, meinte Rebecca später, als sie vor dem zweiten Film hinausgingen. Sie lächelte ihn verschmitzt an. »Jedenfalls die Szenen, die ich gesehen habe.«
»Einiges haben wir schon mitbekommen. Hast du gesehen, wer mitgespielt hat? Valentine Dyall – du weißt schon«, er senkte seine Stimme, »›Der schwarze Mann‹.«
»Oh, der aus dem Radio! Irgendwie kam mir die Stimme auch bekannt vor. Ich hatte solche Angst vor ihm!«
Ian lachte. »Ich habe mir die Sendung immer angehört, wenn ich zu Hause war – das tue ich immer noch.« Er blickte auf die Uhr. »Komm, es wird Zeit für dich, nach Hause zu gehen – ich begleite dich zur U-Bahn.«
Später, als Rebecca gerade ins Bett gehen wollte, versuchte Sal noch einmal, ihre Nichte zur Vernunft zu bringen. »Das wird nicht halten«, warnte sie. »Nein«, sie hob eine Hand, »du brauchst es mir nicht zu sagen – ein Blick auf dein Gesicht hat gereicht, und ich wusste Bescheid. Du hast dich Hals über Kopf in ihn verliebt, oder?« Ihr Gesicht, faltig und müde nach einem arbeitsreichen Abend, wirkte plötzlich bedrückt. »Findest du nicht, dass du in deinem Leben schon genug gelitten hast? Musst du dir jetzt auch noch das Herz brechen lassen?«
»Wie meinst du das?« Rebecca funkelte ihre Tante an, wütend darüber, dass sie ihre glückliche Stimmung zerstörte.
»Na, es ist doch wohl mehr als wahrscheinlich, dass es so laufen wird, oder etwa nicht? Er wird das nicht lange durchhalten, weißt du – ständig herzukommen. Zugfahrten kosten Geld, mein Mädchen, genauso wie Hotelzimmer – selbst wenn sie billig sind.«
»Er könnte hier übernachten! Wir haben doch den Abstellraum, und wir könnten uns bestimmt irgendwo ein Klappbett leihen«, erklärte Rebecca aufsässig.
Sal starrte sie an. »Du fackelst nicht lange, was? Also, das muss dein Onkel Ron entscheiden. Und seine Entscheidung wird davon abhängen, ob der Bursche ihm gefällt. Und da ist noch etwas«, rief sie Rebecca nach, die sich abgewandt hatte, um nun endlich in ihr Zimmer zu kommen. »Vergiss nicht, er ist siebenundzwanzig und du bist erst achtzehn!«
Und noch sehr naiv für dein Alter, dachte Sal grimmig und löschte das Licht.
4. Kapitel
Mit seinen fast ein Meter neunzig, dem großen, runden Kopf und den starken Kieferknochen war Rebeccas Onkel einer der bedrohlich aussehendsten Männer, denen Ian je begegnet war. Seine krumme Nase war rotgeädert, und seine speckigen Nackenwülste quollen ihm über den Hemdkragen. Als er aufstand, um Ian die Hand zu schütteln, konnte man einen schweren Ledergürtel sehen, der nicht nur seine Hose, sondern auch einen gigantischen Bierbauch hielt.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Ron«, brachte Ian heraus.
»Ebenso.«
Sal kam mit rotem, verschwitztem Gesicht aus der Küche. Sie war nervös. Obwohl sie sich besonders viel Mühe mit dem Essen gegeben hatte, war das Kochen für sie meistens wie ein Glücksspiel, weil sie zwischendurch immer wieder in der Kneipe nach dem Rechten sehen musste.
Ian streckte die Hand aus, und sie wischte sich ihre eigene an ihrer Schürze ab, bevor sie sie ergriff. »Das Essen ist fertig, also können Sie sich ruhig schon neben Ron setzen. Der Braten ist ein bisschen klein, aber er sollte für vier reichen. Möchten Sie ein Bier trinken?«
»Ja, gerne, vielen Dank.«
»Hol ihm eins, Rebecca.«
Gehorsam ließ Ian sich am Tisch, der einen Großteil des Raums einnahm, nieder und blickte sich um. Das Zimmer war mit Möbeln vollgestellt. Es gab ein geschmücktes Sideboard, auf dem Porzellanhunde und andere Figürchen auf Spitzendeckchen drapiert waren, und an der Wand neben der Tür stand eine Mokett-Garnitur in einem verblassten Grünton. Darüber hing ein alter Druck von The Stag at Bay, und die gegenüberliegende Wand schmückte ein geschliffener runder Spiegel an einer verchromten Kette.
»So, dann sind Sie also Lehrer, ja?«, meinte Ron, lehnte sich auf seinem Stuhl am Kopfende des Tisches zurück und hakte die Daumen in seinem Gürtel ein. Er musterte den jungen Mann voller Misstrauen. Ron hielt nichts von diesen, von ihm als verweichlicht bezeichneten Männern, die sich niemals die Hände schmutzig machten. Aber vielleicht war Lehrer gar kein so schlechter Beruf. Schließlich musste ja irgendjemand die Gören unterrichten!
»Ja, genau«, erwiderte Ian und überlegte krampfhaft, über was er mit einem Mann reden sollte, von dem er instinktiv wusste, dass er rein gar nichts mit ihm gemeinsam hatte.
»Hab es gehasst – die Schule, meine ich. Die meiste Zeit bin ich gar nicht erst hingegangen!«
»Du warst immer ein ziemlicher Rabauke«, meinte Sal, während sie einen dampfenden Teller vor ihn stellte. »Haut kräftig rein, hinterher ist noch genug Zeit zum Reden!«
Rebecca brachte ein kleines Glas Bier und setzte sich Ian gegenüber. Er blickte auf seinen Teller. Was immer Sal für Qualitäten haben mochte, Kochen gehörte offensichtlich nicht zu ihren Stärken. Die dünnen Scheiben Fleisch sahen trocken und die Stampfkartoffeln klumpig aus, und die blasse, wässrige Flüssigkeit über den Möhren und dem Kohl waren eine Beleidigung für das Wort Soße. Sehnsüchtig dachte Ian an die krossen Bratkartoffeln und den lockeren Yorkshirepudding, den seine Mutter normalerweise servierte, und begann sich tapfer seinem Teller zu widmen.
Nachdem sie schweigend gegessen hatten, legte Ron sein Messer und seine Gabel auf den Teller. »Das war lecker, Sal! Ich sehe, Sie haben den ganzen Teller leer gemacht, Ian.«
Ian nickte, immer noch auf dem letzten Stück Fleisch kauend, und sagte: »Ja, danke, Sal. Ich hatte wirklich Hunger.«
Sie begann, das Geschirr abzuräumen. »Das überrascht mich nicht. Ich wette, unsere Rebecca hat Sie durch die halbe Stadt gejagt.«
Rebecca lächelte nur und stand auf, um ihr zu helfen. Wie ihre Verwandten hatte auch sie während der gesamten Mahlzeit nicht ein Wort gesprochen. Hielt man es hier für schlechtes Benehmen, während des Essens zu reden, fragte sich Ian. Aber dann sagte ihm sein gesunder Menschenverstand, dass Ron und Sal nach einigen hektischen Stunden in der Kneipe wahrscheinlich einfach genug Gespräche geführt hatten. Sie wollten dann wahrscheinlich einfach nur essen. Und zu seiner Erleichterung war der Nachtisch, den Sal ihnen nun noch auftischte, viel besser als der Hauptgang – ein klassischer Reispudding, sehr cremig und mit einer leckeren braunen Muskatnusshaut oben drauf.
»Den kann ich einfach unten in den Ofen stellen und sich selbst überlassen«, erklärte Sal ihm. »Mögen Sie die Haut?«
»Ja, gerne.«
»Kriegst die Zähne heute wohl nicht auseinander, was, Rebecca?«, meinte Ron plötzlich, woraufhin Rebecca rot wurde. Seit sie hergekommen waren, fühlte sie sich unwohl. Ian wirkte in diesem vertrauten, schäbigen kleinen Zimmer so fehl am Platz. Außerdem schämte sie sich. Während Ian in seinem weißen Hemd und dem Schlips sehr schick aussah, saß Ron in Hosenträgern am Tisch. Warum er einen Gürtel und Hosenträger brauchte, war ihr ohnehin schleierhaft. Im Zimmer war es unerträglich heiß. Im Kamin brannte ein Kohlenfeuer. Sie hatten nie Schwierigkeiten mit ihrer Kohleration, was einem Tauschgeschäft zwischen Ron und einem seiner Stammgäste zu verdanken war. »Ich bin lieber innen drin feucht und glücklich«, hatte Stan, ein Witwer, der allein lebte, erklärt, »als draußen warm und unglücklich!« Und so lag als Gegenleistung für das Freibier regelmäßig ein Sack mit den besten Briketts vor der Hintertür.