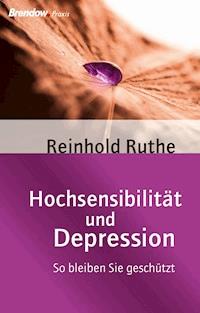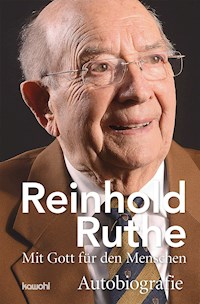
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kawohl Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Neun Jahrzehnte Reinhold Ruthe Offen über Seelennöte zu sprechen, sich selbst zu reflektieren oder Partnerschaft und Familie zu thematisieren, ist heute für viele Christen selbstverständlich. Ein Blick auf den konfessionellen Buchmarkt mit seinen zahlreichen Lebenshilfe-Ratgebern zeigt das anschaulich. Doch das war nicht immer so. Reinhold Ruthe gilt als Wegbereiter der psychologisch fundierten Seelsorge im deutschsprachigen, protestantischen Bereich. Als er in den 60er-Jahren ein christliches Buch zu intimen Fragen eröffentlichte, war das ein Skandal – und ein Bestseller. Wenig später wurde er Sexualpädagoge des CVJM und leitete eine kirchliche Beratungsstelle. Unermüdlich arbeitete er daran, psychologische Erkenntnisse für die christliche Seelsorge nutzbar zu machen und Menschen zu helfen, deren Probleme bislang wenig Beachtung gefunden hatten. Als Referent, Dozent und Autor prägte er die christliche Öffentlichkeit und eine neue Generation von Seelsorgern. Kein Eisen war ihm zu heiß und mit über 150 Büchern hat er entscheidende Impulse gesetzt. 1927 geboren, schaut er heute – immer noch rege und aktiv – auf ein reiches Leben zurück und erzählt von den Stationen seines Weges durch das Jahrhundert. Die nationalsozialistische Propaganda prägte seine Kindheit. Die letzten drei Kriegsjahre erlebte der Jugendliche als Soldat. Doch sein ganzes Leben erfuhr eine Umkehr, als er sich in der Kriegsgefangenschaft bekehrte. Daraus erwuchs die neue Perspektive: Gott und den Menschen zu dienen – ein Leben lang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2016 Kawohl Verlag, 46485 Wesel
Alle Rechte vorbehalten
Titelfoto: Bülent Yasar
Lektorat: Ulrich Parlow und Kawohl Verlag / Jürgen Dörr
Korrektorat: Bettina Stockmayer
Printausgabe:
ISBN: 978-3-86338-008-3
Bestell-Nr.: RKW 5008
E-Book:
eISBN: 978-3-86338-996-3
www.kawohl.de
Reinhold Ruthe
Reinhold Ruthe
Mit Gott für den Menschen
Autobiografie
Inhalt
Vorwort
1Kindheit und Jugend in Westfalen
2Von der Außenwelt abgeschottet
3Der Weg in die Kriegsgefangenschaft
4Auf dem Weg zum CVJM-Sekretär
5Zwei Jahre Studium an der Sekretärschule
6Vierzehn Jahre CVJM-Sekretär
7Lektor im Verlag und Sexualpädagoge
8Leitung einer evangelischen Lebensberatungsstelle
9Das Magnus-Felsenstein-Institut für beratende und therapeutische Seelsorge
10Im „Unruhestand“ – Rückblick und Ausblick
Zeittafel
Vorwort
Wenn ich zurückblicke, tun sich Welten zwischen damals und heute auf:
Aufgewachsen in der Weimarer Republik. Massenarbeitslosigkeit. Unzufriedenheit der Bürger. Aber auch die Goldenen Zwanzigerjahre. Und bald schon marschierten die ersten braunen Trupps durch das Land. Der „Führer“ mobilisierte seine Gefolgsleute.
Ich kam in die Schule mit sechs Jahren, Adolf Hitler war inzwischen Reichskanzler. Das unselige „Dritte Reich“ entfaltete seine Macht. Kindheit und Jugend in der braunen Ära prägten mich damals und bestimmten mein Denken. Der junge Lehrer an der Volksschule war ein überzeugter Nazi. Vier Jahre lang, vom ersten bis zum vierten Schuljahr, wurden wir von ihm unterrichtet.
Ein Lehrer, ein Führer, ein Volk, ein Vaterland. Eine Meinung, eine Richtung, ein Ziel. Immer nur ging es um Einheit, ja Einförmigkeit. Und logisch: Wer diese erzwungene Einigkeit störte, wer sie untergrub, wer sie infrage stellte, war ein Feind und Landesverräter.
Jungvolk, Wehrertüchtigung, Luftwaffenhelfer, Kriegsdienst als Panzergrenadier, schließlich Kriegsgefangenschaft waren unvergessliche Abschnitte in meinem Leben. Die Kriegsgefangenschaft schließlich stellte mein Leben auf den Kopf. Hier wurden die Weichen umgestellt. Der christliche Glaube revolutionierte Kopf, Herz und Gesinnung. Das ist bis heute so geblieben. Der Glaube hat alle meine weiteren Lebensentscheidungen beeinflusst.
Mir liegt am Herzen, deutlich zu machen, was Propaganda, Gehirnwäsche und blinder Gehorsam anrichten können. Aber Gott sei Dank müssen solche Fehlprägungen nicht ein ganzes Leben bestimmen. Wir können umlernen, wir können umdenken, wir können umplanen. Wir können unser Leben neu ausrichten.
Ich habe es erlebt und davon soll in diesem Buch die Rede sein. Dankbar schaue ich zurück, wie Gott meine Existenz geplant und gestaltet und mich geführt hat. Ein Wunder – allem zum Trotz.
Lassen Sie sich überraschen!
Kapitel 1
Kindheit und Jugend in Westfalen
Am Pfingstsonntag des Jahres 1927 wurde ich in Falscheide, einem kleinen Vorort der späteren Stadt Löhne in Ostwestfalen, geboren. Die Sonne strahlte, der Himmel war blau und wolkenlos, so hat man es mir erzählt.
Das Land zwischen Teutoburger Wald und Wiehengebirge verläuft weitgehend flach, lediglich einige Hügel verleihen der Gegend einen anziehenden Reiz. Grüne Wiesen, kleine Wälder und verstreute Bauernhöfe prägen das Aussehen meiner Heimat. Die Menschen sind im Allgemeinen wortkarg, arbeitsam und strebsam. Gefühle werden nur sparsam gezeigt. Herzlichkeit wird praktiziert, aber selten zur Schau gestellt. Man braucht schon eine Weile, um mit ihnen warm zu werden. So jedenfalls hören wir es oft von Fremden, die sich länger dort aufhalten.
Löhne liegt an einem kleinen Fluss, der Werre, die sich durch das Minden-Ravensberger Land schlängelt.
Vor der Ehe gezeugt
Bevor ich auf die Welt kam, spielte sich bei den werdenden Eltern und im Dorf bei den Großeltern ganz schlicht ein Drama ab. Wenn ich jene Zeit richtig verstehen will, darf ich das Geschehene nicht verharmlosen.
Mich beschleicht ein merkwürdiges Gefühl, wenn ich darüber nachdenke. Zwei Welten, damals und heute. Heute Normalität, damals eine Tragödie, eine Schande, eine Blamage erster Güte. Mein Vater und meine Mutter liefen – noch unverheiratet – wie Gezeichnete durch das Dorf. Das war der Pranger seinerzeit. O Gott, o Gott, eine offenbare Sünde in der Schneiderfamilie.
Die Leute dachten konservativ. Recht und Ordnung, gute Sitten und ein anständiges Verhalten waren Pflicht. Man hatte anständig, ehrlich und korrekt zu sein. Jeder schaute über den Zaun des Nächsten und wusste über alles Bescheid. Auch wenn es nur unterstellt war, bloß vermutet.
Meine Eltern mussten heiraten. Wieso mussten sie? Ein Kind war vorzeitig unterwegs. Sie wollten selbstverständlich heiraten. Aber die „anderen Umstände“ spielten ihnen einen Streich.
In den Zwanzigerjahren des vorigen Jahrhunderts lebte der Ort von Tratsch und Klatsch, von Gerede, das hinter vorgehaltener Hand weitertransportiert wurde. Das Dorf damals hatte andere Gesetze als Dörfer heute. Es fehlten die täglichen Sensationen, die Horrorgeschichten, die unzähligen Verbrechen, die negativen Nachrichten aus der weiten Welt, wie sie heute in den Medien unters Volk gebracht werden. Stattdessen wurden kleine Gemeinheiten im Ort oder in der Nachbarschaft, Bosheiten der Bewohner, Betrug und Vermutungen über den Gartenzaun gereicht.
Ich bin ganz sicher, meine Eltern liebten sich. Wie komme ich darauf? Sie setzten sich mit dem Namen durch, den sie für mich vorschlugen: Reinhold. Ein Protest ihrer gekränkten Seelen. Ein Ausdruck ihrer Zusammengehörigkeit. Reinhold, der Reine, der Holde, ein Ergebnis ihrer inneren Überzeugung. Meine Eltern sahen in ihrem Tun keine Schande und empfanden mich nicht als einen Makel.
Und der kleine Junge wurde auch noch zu Pfingsten geboren. Pfingsten, das Fest des Geistes, der Menschen in Bewegung bringt. Der Geist von Pfingsten schlägt Brücken des Verstehens. Wo dieser Geist am Werke ist, da gibt es gegenseitiges Verständnis. Er ist der Rechtsbeistand, der Tröster, der Anwalt, wenn wir rufen.
Meine Eltern werden ihn nötig gehabt haben.
Und dann musste meine Mutter auch noch mit Schwiegervater und Schwiegermutter in einem Haus zusammenleben. Vielleicht als die böse Schwiegertochter, die den lieben Sohn verführt hatte. Jetzt musste sich meine Mutter beweisen, jetzt musste sie vieles – jedenfalls in den Augen der anderen – wiedergutmachen. Jetzt musste sie vielen hämischen Blicken begegnen.
Meine Geburt fand zu Hause statt, wie es damals üblich war. Und einige Wochen später war meine Taufe in der Löhner Kirche. Das Pfingstfest wurde von den meisten Bewohnern des Dorfes gefeiert. Meine Eltern waren froh, dass die Geburt ausgerechnet an einem hohen Feiertag der Kirche stattfand.
Aber der schöne, makellose Sonnentag zeigte auch eine dunkle und beschämende Seite. Ich weiß bis heute nicht, wie es meine Eltern und die gesamte Großfamilie erlebt haben, dass meine Mutter und mein Vater heiraten mussten. Im Mutterleib, während der Hochzeitsfeierlichkeiten, rekelte sich schon der kleine Reinhold. Damals war eine Mussheirat eine bittere Pille für alle Beteiligten. Erinnern kann ich mich natürlich an nichts. Der kleine Mensch bekommt zwar viel mit, denn Mutter und Kind sind ja eine unteilbare Einheit, sodass seelische Schmerzen der Mutter auch das ungeborene Baby belasten. Im Nachhinein bin ich sicher, dass ich verschont geblieben bin. Mit Eltern und Großeltern habe ich im Übrigen nie darüber gesprochen.
Woher kommt der Name Reinhold?
Meine Eltern haben es ganz sicher nicht gewusst. Aber ich las im 1958 erschienenen Buch „Pfeiler im Strom“ von Reinhold Schneider eine Deutung des Namens. Unter der Zwischenüberschrift „Der unbekannte Heilige“ schreibt Schneider: „Die altehrwürdige Reinoldikirche in Dortmund, deren hoher Turm einst Pilgerscharen den Weg wies, wurde nach der Zerstörung in den Jahren 1943–1945 wiederhergestellt. In Lindlar, im Bergischen, feiert die Steinhauergilde, deren Schutzpatron der Heilige ist, ihr zweihundertfünfzigjähriges Bestehen … Nach einer Abschrift aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts stammte Reinoldus, der Name bedeutet ‚Ratwalter‘, von erlauchten Eltern ab. Er war einer der vier Haymonskinder … Durch göttliche Weisheit erleuchtet, fährt die Legende fort, verließ Reinoldus die Welt, um Mönch in Sankt Pantaleon in Köln zu werden. Hier hat er viele Wunder getan, namentlich zur Pestzeit … Der 7. Januar, der Festtag des Heiligen, soll der Tag der Übertragung (der Reliquien) in die Dortmunder Kirche sein.“
Im 87. Lebensjahr schreibe ich an dieser Biografie. Ich habe nichts von dem Heiligen gewusst, versuche auch nicht andeutungsweise einen Vergleich. Wir haben lediglich den gleichen Namen. Und mich interessierte seine Herkunft.
Das Hochzeitsfoto meiner Eltern
Als junger Mann, also viele Jahre später, fiel mir das Hochzeitsfoto meiner Eltern in die Hände. Der weiße Schleier der Mutter, der selbstverständlich getragen wurde, der elegante schwarze Anzug des Vaters und die schicke Fliege vor dem weißen Hemd konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass beide niedergedrückt aussahen. Der seelische Schmerz offenbarte sich in ihren Gesichtern. Die Aufnahme war in einem Fotostudio gemacht. Kein Hochzeitsbild, sondern ein Leidensbild, kein Höhepunkt des Lebens, sondern ein Tiefpunkt. Die eingefallenen Wangen beim Vater, der schmerzverzerrte Mund der Mutter waren Zeichen eines „Gerichtsurteils“, das sie gerade vernommen hatten: ein Jahr Gemeindepranger, Spießrutenlaufen durch die Öffentlichkeit. Keine Eintragung ins Vorstrafenregister.
Ganz sicher weiß ich, dass sie nicht deshalb unglücklich aussahen, weil sie heiraten mussten und sich etwa nicht liebten. Sie litten, weil sich der Sohn zu früh angemeldet hatte. Die ethische Grundeinstellung zu Liebe und Ehe war offensichtlich angekratzt.
Die Taufe des kleinen Reinholds war ein eindrückliches Liebesbekenntnis meiner Eltern. Beide liebten sich unverbrüchlich. Und das Produkt dieser Liebe betrachteten sie nicht als Unfall, sondern als Geschenk Gottes. Sie gehörten fest zusammen, waren ein Paar und sahen in dem reinen und holden Geschöpf ein Zeichen seiner Barmherzigkeit. Ein Leben lang erinnert mich der Name daran, dass ich ein Kind wirklicher Liebe bin. Zeit meines Lebens hat mich dieser Gedanke beflügelt: Ich habe liebevolle Eltern gehabt. Bis zu ihrem Tode war niemals Unfriede zwischen uns.
Aufgewachsen im Bauernhaus
Groß geworden bin ich in einem alten Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert. Die vordere Hausfront bestand bis zur Dachspitze aus Holz. Alles musste alle paar Jahre neu mit Farbe gestrichen werden. Eine mörderische Arbeit! Auf halber Höhe durchzog das Haus eine „Deele“ (Diele) aus roten Backsteinen. Hoch über der Deele war eine Decke aus Holzplanken, die den Dachboden bildeten. Er war bis unter die Dachpfannen voll mit Heu- und Strohballen. Diese Deelendecke war lediglich mit breiten, ungehobelten Brettern ausgelegt, die über dicken Baumstämmen angenagelt waren. Immer wieder rieselten Strohstaub und feine Heuteilchen durch die Ritzen auf die Deele, die daher mehr oder weniger jeden Tag gefegt und geschrubbt werden musste. Fast die gesamte Vorderfront des Hauses zur Straße hin bestand aus einer vierteiligen Tür, die in der Erntezeit völlig geöffnet werden konnte, um mit Pferdewagen hineinzufahren. In der übrigen Zeit blieb das große Tor verschlossen, nur eine normale Holztür diente als Aus- und Eingang.
Vor der Tür und neben dem Haus führten ungepflasterte Wege vorbei, die weder geteert noch mit Steinen befestigt waren. Und genau im Winkel neben dem Haus, wo sich zwei Wege kreuzten, befand sich ein übel riechender Mistpfuhl, der damals bei Bauernhöfen üblich war. Alle Besucher und Passanten, die vor dem Haus oder neben dem Anwesen vorbeigingen oder mit dem Fahrrad vorbeifuhren, mussten den Geruch des Mistpfuhles ertragen.
Ich mache keinen Hehl daraus, dass mich schon als Kind dieser stinkende Mist ärgerte und wütend machte. Leider konnten wir nicht darauf verzichten, weil der Mist aus Schweine- und Ziegenstall in diese Grube gekippt wurde.
Gleichzeitig war dieser Mistpfuhl mit einer Jauchegrube und einer Toilette verbunden, die neben dem Ziegenstall untergebracht war. Toilettenschüsseln aus Porzellan gab es zwar schon, aber in Bauernhäusern waren schlichte Plumpsklos aus Holz üblich. Mittendrin ein großes Loch, alles direkt mit der Jauchegrube verbunden. Eine leichte Brettertür diente als Verriegelung. Die Toilette war mit dem offenen Ziegenstall verbunden, sodass sich die Gerüche von rechts und links vermischten.
Iphigenie wehrt sich mit Hörnern und Füßen
Die Ziege war der tägliche Milchlieferant. Ein knochiges und lebendiges Etwas mit großen, neugierigen Augen. Angekettet fristete sie im Ziegenstall neben dem Plumsklo ihr gefesseltes Dasein. Wenn jemand auf selbigem saß, richtete sie sich auf den Hinterbeinen auf und schaute interessiert über den Bretterverschlag, um so in ihr eintöniges Leben ein bisschen Abwechslung zu bringen. Arme Iphigenie.
Ja, der weiße Milchproduzent hieß tatsächlich Iphigenie, „das Land der grünen Wiesen mit der Seele suchend“ oder so ähnlich. Wieso ihr armes Dasein mit dem Dichterfürsten Goethe in Verbindung gebracht worden war, blieb mir ein Rätsel. Denn nur im Frühjahr und Sommer wurde sie draußen auf der Wiese angeleint. Dann schaute sie neugierig auf alle Passanten, genoss das schöne Wetter und gab dankbar noch mehr Milch.
Iphigenie war sehr keusch erzogen worden. Sie hatte schöne volle Brüste. An diese Milchzapfstellen ließ sie nur meine Mutter – zum Kummer der ganzen Familie. Schlimm, Iphigenie, die stolze Griechin, sie konnte nur von meiner Mutter gemolken werden. Die übrigen Familienmitglieder ließ das Tier nicht heran.
Nur einmal verreiste meine Mutter zu ihrer Freundin nach Dortmund. Im Ziegenstall brach das Chaos aus. Mein Vater und mein Onkel hatten sich das so ausgedacht: Einer wollte sie festhalten und der andere sollte sie melken. Aber sie hatten nicht mit der streitsüchtigen Iphigenie gerechnet. Sie empfand die Schmach als himmelschreiende Gewalttat. Das Melken wurde zum Drama.
Mein Onkel, ein kraftvoller Draufgänger, hatte vorher noch zu meinem Vater gesagt: „Das wäre doch gelacht, wenn wir das hagere weiße Gestell nicht melken könnten.“ Nachdem meine Mutter abgereist war, kam er mit dem Fahrrad aus dem Nachbardorf angefahren. Er streifte sich eine Arbeitshose über und ging mit meinem Vater in den Stall. Ich stand im Toilettenraum und schaute über die Balustrade, um dem Spaß aus nächster Nähe beizuwohnen.
Unsere zartbesaitete Iphigenie ahnte schon, was sie erwartete, als die beiden Männer hinter sich die Stalltür schlossen und sich der verängstigten Dame näherten. Iphigenie konnte nicht weglaufen, denn sie war kurz angebunden. Sowie mein Vater auch nur in ihre Reichweite kam, strampelte sie mit Vorder- und Hinterbeinen wie eine Furie. Da beide Männer die Hinterbeine der Ziege nicht anbinden konnten, besaß Iphigenie eine schlagkräftige Waffe. Abwechselnd trat sie rechts und links mit einem Bein zu und traf mal Hände, Arme oder Schienbeine der beiden Männer. Onkel und Vater schrien immer wieder auf.
Mit einer Hand hielt mein Vater einen Blechnapf, mit der anderen versuchte er zu melken. Er ergatterte nur die Hälfte der Milch, die meine Mutter dem Tier sonst abgewann. Der Ringkampf mit Iphigenie ging über einige Runden. Onkel und Vater gewannen schließlich nach Punkten, aber ein strahlender Sieg war es nicht. Außerdem mussten sie einige Blessuren verkraften. Beide fluchten sonst selten, aber hier kannten sie plötzlich viele abscheuliche Flüche, die Iphigenie nur noch wütender machten. Ich muss schon sagen, die Melkschlacht habe ich als Zehnjähriger damals richtig genossen, denn Fernsehen gab es ja noch nicht. Meine kleine Schwester von vier Jahren schaute nur einmal ganz kurz zu und rannte dann ängstlich und voller Mitleid mit Iphigenie zurück in die Küche. So war unsere Ziege. Sie ließ sich gern von Vater und mir füttern, mehr aber auch nicht.
Als der Milchkampf beendet war, ließen sich Onkel und Vater schachmatt und stöhnend in die Sessel fallen. Während Vater in zwei Gläser Bier einschenkte, hechelte mein Onkel, ein erfahrener Handwerker mit entsprechenden Muskelpaketen und kräftigen Händen: „Das strengt ja mehr an, als wenn du einen Morgen Roggen mit der Hand gemäht hast.“
Mein Vater meinte kleinlaut: „Wenn du die Milch kaufst, sparst du viel Energie, aber das störrische Luder muss ja gemolken werden.“ Mein Onkel schüttelte nur seinen Kopf und erwiderte erschöpft: „Leider.“
Als ich eine Viertelstunde später neugierig in den Ziegenstall schaute, lag Iphigenie abgekämpft und müde auf dem Stroh und leckte ihre strapazierten Beinchen. Ich hatte den Eindruck, sie blickte mich dankbar an, dass ich ihr nicht auch Gewalt angetan hatte.
Schwalben bringen Glück
Ein besonderes Ereignis war jedes Jahr der Einzug der Schwalben in unser Haus. Wenn der Frühling kam und die Temperaturen anstiegen, kamen die Rauchschwalben aus dem warmen Süden zurück in den kühleren Norden. Der Flug ist eine Strapaze. Sie müssen die trockene und heiße Wüste Sahara passieren, über das Mittelmeer fliegen und schließlich auch noch die Alpen überwinden. Die flinken und eleganten Tiere haben sich an die Menschen gewöhnt. Die Mehlschwalben bauen ihre Nester unter den überhängenden Dächern draußen an Dachbalken oder an die Häuserwände. Die Rauchschwalben fliegen in die Häuser und präparieren ihre Nester etwa vier bis sechs Meter tief im Raum unter den Querbalken des Dachbodens. Es ist ein Wunder, dass die Tiere nach einem halben Jahr in Afrika ihre angestammten Nistplätze wiederfinden. Ob es die Eltern sind, die im Vorjahr ihre Jungen großgezogen haben, oder diese die Brutplätze einnehmen, weiß ich nicht. Kenner der Materie wissen es bestimmt.
Unsere große Vordertür bestand aus vier etwa gleich großen Teilen. Zwei große Flügel, die tagsüber geöffnet wurden, befanden sich in etwa zwei Metern Höhe. Die unteren Flügel blieben über Tag geschlossen. Da wir keine Fenster in den oberen Türflügeln hatten, standen sie bis in die Abendstunden offen. Die Tiere konnten also ohne Anmeldung ihr Sommerquartier beziehen. Meine Eltern, meine kleine Schwester und ich waren glücklich, wenn die nützlichen Vögel wieder daheim waren.
„Schwalben bringen Glück!“, meinte meine Mutter. Und sie sagte das nicht nur so daher. Sie wusste es. Sie glaubte daran. Wir konnten die Deele rauf- und runtergehen, konnten fegen und Krach machen, die Schwalben ließen sich nicht irritieren. Sie fühlten sich bei uns geborgen und zwitscherten ihre Lieder.
Schon nach wenigen Wochen flog immer nur noch eine Schwalbe raus und rein. Im Nest lagen nun einige Eier, die abwechselnd von Vater- oder Mutterschwalbe ausgebrütet wurden. Manchmal fütterten sich die Tiere auch, sodass die Brutstätte ununterbrochen besetzt blieb. Noch Ende Juni, wenn die Tage lang und die Nächte kurz waren, blieb ein Flügel der Hoftür bis um 22.30 Uhr offen. Viele andere Vögel hatten längst ihre Schlafplätze aufgesucht, während die Schwalben noch durch den dämmrigen Abendhimmel schwirrten und sich Mücken, Fliegen und Motten im Flug schnappten. Schwalben fliegen selten schnurstracks geradeaus. Ihr Flug wird ruckartig nach rechts oder links, nach unten oder oben gelenkt. Sie haben gute Augen und erspähen ihre Beute sofort. Wenn es ganz dunkel wurde, saßen die Vögel ruhig im Nest und schliefen. Die obere Flügeltür wurde von den Eltern geschlossen, wir Kinder waren da längst im Bett.
Bei Schwalben ist die Nacht kurz. Wenn draußen die ersten Vogelstimmen zu hören waren, stimmten auch die Schwalben ihr lautes Gezwitscher an, um die Menschen mit ihrem Konzert zu wecken. Sehnsüchtig warteten sie darauf, dass sich in den Schlafzimmern ein Mensch erbarmte und die oberen Flügeltüren des Hauses öffnete. Dann schossen sie hinaus, um sich ihr Frühstück zu erjagen.
Und dann wurde der Nachwuchs geboren. Zwei bis vier kleine Mäuler wollten pausenlos gestopft werden. Die Vogeleltern waren im Dauerstress. Alle paar Minuten schoss ein Elternteil durch die obere Türöffnung. Die Jungen begannen sofort zu schreien und reckten ihre großen, weit geöffneten gelben Schnäbel dem Futterbringer entgegen. Ich bin nie dahintergekommen, in welcher Reihenfolge die Kleinen ihre Nahrung bekamen. Die Prozedur dauerte nur wenige Wochen, dann flogen die Kleinen ins Freie.
Nur einmal fiel ein kleines Schwälbchen hilflos auf die Deele. Es hatte sich zu weit aus dem Nest gewagt und war mit unbeholfenen Flugbewegungen in die Tiefe gestürzt. Ein Elternteil saß im offenen Türrahmen und beobachtete den unglücklichen Nachwuchs. Ich wollte erst eine große Leiter holen und das Tier wieder ins Nest bringen, überlegte es mir dann aber anders. Das Schwälbchen piepste jämmerlich, vielleicht hatte es sich etwas gebrochen. Ich nahm den Winzling und setzte es nach draußen auf das flache Dach unseres Hühnerstalls. Ein Elternteil verfolgte aus der Luft die Aktion. Ein paar Minuten später sah ich, dass die Eltern abwechselnd das verunglückte Kind auf dem Dach fütterten. Ich muss gestehen, dass ich nicht mehr weiß, was aus dem Tier geworden ist.
Die übrigen Kleinen, die flügge geworden waren, saßen vor dem Haus auf Telefondrähten. Noch kurze Zeit wurden sie von ihren Eltern versorgt. Zwischendurch übten sie mit ihren Flügeln und kamen abends wieder zurück in die häusliche Geborgenheit. Tage später flogen sie mit ihren Eltern nach draußen. Im Handumdrehen hatten sie die Technik der Alten verinnerlicht, kreisten ebenfalls im Zickzack und konnten sich eigenständig Nahrung besorgen. Manchmal flogen sie im Pulk, jagten um Häuser und Bäume und stießen dabei wilde Schreie aus. Ich bin kein Schwalbenflüsterer, glaube aber, dass sie dabei eine diebische Freude empfanden.
Anfang September sammelten sich alle auf den vorbeiführenden elektrischen Drähten. Auch aus der Nachbarschaft kamen sie dazu. Teilweise saßen sie sehr nahe beieinander und tauschten schwatzend Botschaften aus. Ich vermute, sie unterhielten sich nach Schwalbenart über die Reise in den Süden, besprachen den gemeinsamen Aufbruch und erklärten ihren Kindern die bevorstehenden Strapazen beim Überqueren der Alpen.
„9. September, Mariä Geburt, ziehen alle Schwalben furt.“ So habe ich es als Kind gelernt. Wenn dann Mitte September das Haus leer war, überfiel uns alle eine gewisse Wehmut. Sicher, wir mussten jetzt ihren Dreck, der immer wieder die Deele bekleckerte, nicht mehr wegschrubben. Niemand musste mitten in der Nacht aufstehen, um einen der Türflügel für die Tiere zu öffnen. Aber es fehlte etwas, ein Stück Natur, ein Stück Leben, ein Stück Glück, das Schwalben ganz sicher ins Haus tragen.
Jahresrückblick 1927
Heute ist ja alles möglich. Wir können in alten Zeitungen aus dem Jahre 1927 blättern. Es lohnt sich, einen kurzen Blick in die damalige Zeit zu werfen:
Politik
In einer Zeitung lesen wir, dass Arbeitslose ab dem 7. Juli Geld bekommen. Der Reichstag verabschiedete das Gesetz über Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung. Damit hatte jeder, der unfreiwillig arbeitslos geworden war, einen Rechtsanspruch auf Unterstützung durch den Staat. Auch die neuen Arbeitsgerichte nahmen in Deutschland ihre Tätigkeit auf. Das Inkrafttreten des Arbeitsgerichtsgesetzes war ein wichtiger Wendepunkt in der Rechtspflege.
Sport
Der Sportler des Jahres war der Boxer Max Schmeling.
Überblick
Der Reichspräsident Paul von Hindenburg wurde 80 Jahre alt. Charles A. Lindbergh überflog den Atlantik.
Das Theaterstück „Der Hexer“ von Erfolgsautor Edgar Wallace erlebte in Berlin die Erstaufführung.
Wirtschaft
Die relativ stabile wirtschaftliche Lage wurde von der Bevölkerung voll ausgekostet. Es entstanden die „Goldenen Zwanziger“, die geprägt waren durch ein Aufblühen von Kultur und Musik. Man verdiente wieder mehr und konnte sich somit auch mehr leisten. Der Lebensstandard wurde beträchtlich angehoben.
Preise
1 Liter Bier
RM 0,77
1 Kilo Brot
RM 0,46
250 g Butter
RM 1,00
Stundenlohn
RM 0,89
Zahlen
1927 hatte Deutschland 64.023.619 Einwohner, 136,6 pro km2.
1927 betrug der durchschnittliche Monatslohn für ungelernte Arbeiter 126 RM und für Arbeiterinnen 93 RM.
1927 gab es auf deutschen Straßen 707.971 Kraftfahrzeuge.
Das Auto von Opel mit dem Namen „Laubfrosch“, ein Vierzylinder mit anfangs 12, später bis zu 20 PS, kostete circa 4.000 RM.
1927 hatten 1.377.000 Haushalte ein Radio.
1927 wurden 1.161.719 Babys geboren, darunter auch Reinhold und Charlotte, von der wir gleich hören werden.
In der Schule begegne ich der Frau meines Lebens
Haben Sie das auch schon mal gehört, dass sich Kinder, die die erste Grundschulklasse besuchen, für das andere Geschlecht interessieren? Dass da so etwas wie Liebe entsteht? Dass man sich aufmerksam anschaut? Immer zwischendurch den anderen beobachtet?
Ob meine Schulleistungen damals darunter gelitten haben, weiß ich bis heute nicht. Es interessiert mich auch nicht. Aber das kleine süße, blonde, lebendige, lachende Mädchen, das einige Bänke von mir entfernt saß, das interessierte mich.
Ich kann mir kaum vorstellen und erklären, dass ich mich mit sechs bis sieben Jahren schon für Mädchen interessierte. Aber es ist so, ich kann es nicht verhehlen.
Wie habe ich sie angeschaut? Darüber habe ich als späterer Eheberater oft nachgedacht. Kein begehrlicher Blick, kein triebhaftes Gieren mit den Augen, kein schmachtendes Verliebtsein, keine Fantasien, keine Gedanken an Zärtlichkeiten, wie sie bei Erwachsenen zu finden sind.
Auch bei ihr müssen Gefühle gewesen sein, das Empfinden, in mir etwas wahrzunehmen, was sie beglückte. In den Pausen warteten wir aufeinander, gingen gemeinsam nach draußen. Wir wechselten einige belanglose Worte. Jeder redete nach einigen Sekunden wieder mit anderen, spielte mit anderen, tobte über den Schulhof mit anderen, wie es bei Kindern üblich ist.
Die alte Volksschule, in die wir gingen, hatte ganze zwei Klassenzimmer. Irgendwie mussten in diesen zwei Räumen acht Jahrgänge untergebracht werden. Und zwei Lehrer mussten uns den gesamten Unterrichtsstoff vermitteln. Ein alter, ernster Lehrer, er sah aus wie Bismarck, mit einem rechteckigen Schädel, grauen Haar und einem schön gezwirbelten Schnurbart, war der eine. Er humpelte und konnte mit seinem verkrüppelten Fuß nur langsam gehen. Ein böses Andenken an den Ersten Weltkrieg. Er unterrichtete die Klassen fünf bis acht.
Charlotte ging in Klasse eins. Ich war inzwischen in Klasse zwei, obschon wir gleichaltrig waren. Eines Tages tauchte sie im gemeinsamen Klassenzimmer auf. Sie kam aus Gelsenkirchen, wo ihr Vater Lehrer war, der sich jedoch von seiner Frau getrennt hatte. Das Kind kam zu den Großeltern nach Löhne, in eine Großfamilie.
Der zweite Lehrer, der zuständig war für die ersten vier Jahrgänge, war jünger und ein ausgemachter Nazi. Wenn er seine braune Uniform anhatte, musste er seine stramme Überzeugung demonstrieren. Seine Stimme wurde lauter. Vor den Schülern stand ein kleiner Kommandeur. Er hätte aus uns am liebsten eine disziplinierte Hitlergruppe geformt. Offenbar machte die Uniform einen anderen Menschen aus ihm. Fast immer gab es Schläge mit dem Stock für kleinste Fehler und Vergehen.
Gern ließ er kleine Diktate auf Schiefertafeln schreiben. In keinem Tornister der Sechs- und Siebenjährigen fehlte die Schiefertafel. Geschrieben wurde mit langen, dünnen Griffeln. Die Tafel zeigte etwa zehn Zeilen, wobei jede Zeile wiederum drei kleine rote Linien hatte. Die großen und kleinen Buchstaben mussten genau zwischen den richtigen Linien untergebracht werden. Danach wurden die Tafeln getauscht. Die Mädchen der ersten Klasse mussten mit den Jungs der zweiten Klasse und die Jungs der ersten Klasse mussten mit den Mädchen der zweiten Klasse die Tafeln tauschen. Der Lehrer ging davon aus, dass Jungen und Mädchen in diesem Alter von Verliebtheit und Zuneigung noch weit entfernt waren. Sie würden darum ehrlich und konsequent die Fehler anstreichen. Alle schwierigen Worte hatte der Lehrer an die Tafel geschrieben.
Ich tauschte jedes Mal mit Charlotte meine Tafel. Mein Vater und meine Mutter erzählten mir, dass ihre Eltern geschieden seien und sie nun bei den Großeltern in unserer Nähe lebe. Die glatten blonden Haare, die rechts und links vom Scheitel bis weit über die Ohren reichten, waren ihr Markenzeichen. Nur ein kleiner Pony bedeckte die hohe Stirn. Sie hatte große braune Augen. Und was mir besonders auffiel, war ihr starkes, klar geschnittenes Seitenprofil. Das Kinn stand vor und das imponierte mir. Ich selbst hatte ein fliehendes Kinn und vor allem dünne Arme, die ich sommers wie winters in langen Ärmeln versteckte, weil ich mich schämte. Ich kam mir so dünn und unmännlich vor.
Gott sei Dank war mein Vater Schneidermeister, denn ich legte großen Wert darauf, immer mit gut sitzenden Hosen und ordentlich aussehenden Oberteilen in die Klasse zu kommen. Charlotte, kein anderes Mädchen in der Klasse hieß so, war nicht dünn, aber auch nicht dick. Für meine Begriffe hatte sie die ideale Figur. Schöne lange Beine schauten unter kurzen Röckchen hervor. Ich erinnere mich an ihre weißen wollenen Strümpfe. Manchmal schauten wir uns an, sie lächelte nur wenig, aber ich war der festen Überzeugung, es sei für mich bestimmt.
Und dann schrieben wir Diktate. Ich nahm meinen Mut zusammen und wir tauschten die Tafeln, um einander die Falschschreibungen anzuzeigen. Charlotte hatte null Fehler. Als ich ihr die Tafel reichte, zeigte ich ihr, dass ich in dem Diktat beide Fehler, die sie gemacht hatte, mit einem leicht feuchten Finger abgewischt und korrigiert hatte. Zweimal war sie die Einzige mit null Fehlern. Und vierzehn Tage später, als wieder ein Diktat fällig war und wir wieder die Tafeln gegenseitig getauscht hatten, wurden wir beide vom Lehrer gelobt: Wir hatten keinen Fehler auf unseren Tafeln.
Das Schlimme war, das fällt mir erst jetzt auf, wo ich es niederschreibe: Ich hatte damals nicht ansatzweise ein schlechtes Gewissen. Auf dem Schulhof, in der Pause, standen wir einen Augenblick zusammen. Ich war ganz aufgeregt, als sie auf mich zukam. Sie schüttelte ihre blonden Haare aus dem Gesicht und sagte leise: „Ich habe dir heute zwei Fehler ausgestrichen.“
Sie war nicht einmal rot dabei geworden. Verlegen drehte sie sich zur Seite und wartete keine Antwort ab. Sie rannte los und stand tuschelnd mit anderen Mädchen zusammen. Wie verrückt und glücklich wie ein Frischverliebter lief ich eine Runde um den Schulhof. Für mich war das ein kleiner, aber handfester Liebesbeweis.
Das Weihnachtsgeschenk
Eine eindrückliche Erinnerung habe ich an das Weihnachtsfest als Achtjähriger. Das Fest begann immer am ersten Weihnachtstag. Das war bei uns so üblich. Eine Bescherung am Heiligen Abend wie in vielen anderen Familien gab es nicht. Die Festtage fingen für uns mit dem Gottesdienst am ersten Weihnachtstag an, der schon um sechs Uhr morgens stattfand.
Mitten in der Nacht mussten wir aufstehen. An diesem besonderen Tage wurden wir von der Mutter mit einer Glocke geweckt. Die Glocke war wie ein Klang aus einer anderen Welt. Die Müdigkeit war abrupt verschwunden. Ich flog in die Kleider. Unter der Pumpe, die selbstverständlich nur kaltes Wasser lieferte, machte ich meine Katzenwäsche. Die gute Stube, die nur sonntags, an Feiertagen und zu besonderen Anlässen benutzt wurde, war abgeschlossen. Das kleine Fenster neben der Tür war mit einem Vorhang fast ganz verdeckt, nur ein Streifen von ein bis zwei Zentimetern am Fensterrahmen gab den Blick frei in das Wohnzimmer. Der Baum war festlich geschmückt mit kleinen und großen silbernen Kugeln und mit viel Lametta. Unter dem Baum war alles verdeckt. Ein großes rotes Tuch hüllte die Geschenke ein.
In der Küche wurde gegessen. Nur eine Kleinigkeit. Mutter war längst auf den Beinen. Für die Erwachsenen gab es richtigen Kaffee, keinen Muckefuck, wie der Ersatzkaffee damals hieß. Aber es gab ein paar Plätzchen und ein Stück selbst gebackenen Kuchen. Die kleine Schwester schlief noch. Mutter blieb darum zu Hause und bereitete das üppige Frühstück nach dem Weihnachtsgottesdienst vor.
Der nächtlich-frühmorgendliche Gottesdienst hieß „die Uchte“. Selbstverständlich gingen alle Hausbewohner, die abkömmlich waren, hin. Der Weg zur Kirche dauerte etwa zwanzig Minuten. Über zwei Kilometer mussten zu Fuß bewältigt werden.
Als mein Vater und ich das Haus verließen, sahen wir in der Dunkelheit überall kleine Lichter. Die Gottesdienstbesucher hielten kleine Taschenlampen in ihren Händen, um den Weg zu finden. Helle Laternen waren damals noch nicht üblich.