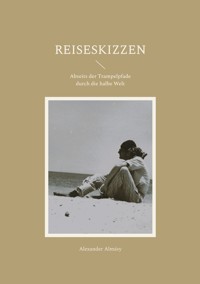
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine unterhaltsame Lektüre für Weltenbummler und solche, die es noch werden wollen.
Das E-Book Reiseskizzen wird angeboten von BoD - Books on Demand und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Abenteuer, Motorrad, Rucksack, Solo, Reisen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Eigenverlag
Für Aurelia und Valentin
INHALT
Prolog
Ägypten
Syrien
Südafrika & Lesotho
Uganda & Kenia
Kuba
Argentinien & Uruguay
Türkei
Ungarn & Rumänien
Tunesien
Palästina
Iran
Letzte Reise
Nachwort
Ein strenges Wort an die Verfasser von Reiseführern
Glossar
„Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung jener Leute, die die Welt noch nie geschaut haben.“ Alexander von Humboldt.
PROLOG
Der Abenteurer ist nichts anderes als ein Reisender, der in eine unangenehme Situation gerät, aus der er sich durch einen glücklichen Zufall wieder herauswinden kann. Ein Held ist ein Reisender, dem das nicht gelungen ist. Deshalb sind Helden meistens tot. Eigentlich wollte ich immer bloß ein Reisender sein, die Umstände haben mich aber oft zum Abenteurer gemacht. Ich habe es bis jetzt vermeiden können ein Held zu sein.
Reisen zu unternehmen ist heutzutage anders. Ich bin vermutlich ein Vertreter der letzten Generation, der solche Unternehmungen ohne Smartphone und Tablet absolviert hat. Ich muss zugeben, dass ich diesen Luxus später doch genützt habe. Dennoch, eine Reise ausschließlich mit Landkarte hatte einen besonderen Reiz. Heutzutage gibt es hauptsächlich Touristen, die das Risiko auf den Reise-Veranstalter abwälzen. Ich war mir immer selbst verantwortlich. Meine einzige Verbindung nach Hause war die mühsame Suche nach einem Telefon. Heute schickt man ein SMS, wenn sonst gar nichts geht. Reisepass, Geld und ein Ticket, das war alles, was ich hatte.
Es gab nirgendwo Sicherheit für eine Unterkunft, die man im Voraus buchen konnte. Stattdessen war man auf die Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Bevölkerung angewiesen. Wie zum Beispiel, als ich in Afrika kein Quartier finden konnte, wurde ich vom ortsansässigen Lehrer eingeladen, im Schulgebäude zu übernachten. Die Kinder waren am nächsten Tag ziemlich überrascht, als sie einen schlafenden Weißen in ihrem Klassenzimmer gefunden haben.
Egal ob mit Rucksack oder mit dem Motorrad, ich möchte mich hier bei allen bedanken, die mir unbeschwerte Tage im Ausland ermöglicht haben. Brenzlige Situationen haben sich immer irgendwie regeln lassen. Und selbst wenn ich einmal übervorteilt worden bin, so war das auch immer eine wertvolle Erfahrung für spätere Reisen.
Der Dank gilt meiner Familie, die immer hinter meinen Projekten gestanden hat, obwohl sie wusste, dass es nicht immer ungefährlich war.
Was mich am meisten beindruckt hat, war die Tatsache, wie Menschen unter einfachsten Verhältnissen ihre Probleme lösen. Im Gegensatz zum fetten Europa, gibt es Menschen, die wirklich Probleme haben: Wassermangel, kaum Hygiene, schlechte Straßen, Korruption oder auch nur, die einfachsten Bedürfnisse zu befriedigen. Überall habe ich immer trotz prekärer Lage Optimismus und Humor gespürt.
Ich rate jedem, vor allem Entscheidungsträgern, eine Reise in die sogenannte dritte Welt zu unternehmen. Dort gibt es wirklich existentielle Probleme. In unseren Breiten, so habe ich das Gefühl, macht man sich bewusst welche. Jeder, absolut jeder, sollte sich selbst ein Bild davon machen können, und in Bescheidenheit zurückkehren.
Massentourismus ist der Tod des Reisenden. Ein einfaches Beispiel, ob Touristen schon da waren? In Afrika habe ich immer eine Schar von Kindern um mich. „Give money“, sagen die einen. „Pen, pen, please“, sagen die anderen.
Mein Reisemotorrad hat inzwischen 160.000 km auf dem Tacho. Als Backpacker bin ich ungefähr genauso viel gereist. Ich bereue keinen Moment trotz vieler Unannehmlichkeiten. Ich möchte keine Erfahrung missen.
Dann gibt es noch Elke, die ehrliche Schneiderin, die das Innenfutter meiner Motorradjacke nach der dreimonatigen Reise durch den mittleren Osten erneuert hat. Zu ihrem großen Erstaunen hat sie 500 Euro gefunden. Ich hatte völlig vergessen, dass das Geld im Zwischensaum versteckt war. Ich habe sie gebeten, sich ihr Honorar gleich zu nehmen und den Rest wieder einzunähen.
Dieses Buch gibt eine Auswahl von dem, was ich auch anderen Menschen wünsche: Erfahrung sammeln, sich sein eigenes Bild von der Welt machen, und nicht zu glauben, was uns täglich in den Medien vorgegaukelt wird. Und mögen sie als Abenteurer zurückkehren und nicht als Helden.
Alexander Almásy
Bernstein im Frühjahr 2023
ÄGYPTEN
1981
Meine erste Reise auf eigene Faust führt mich ganz unvermutet nach Afrika. Ich warte im Hafen von Piräus auf mein Schiff nach Rhodos oder nach Amorgos, ganz gleich.
Bevor es allerdings so weit ist, muss ich zuerst einmal nach Piräus gelangen. Als mittelloser Student habe ich kaum Geld in der Tasche. Also stelle ich mich mit einem Pappschild in der Hand an die Stadtausfahrt von Wien: „Süden“
Damals war Autostopp normal. Heutzutage sieht man kaum noch jemanden, der das tut. Es war für viele Studenten eine günstige und oft die einzige Möglichkeit zu reisen. Auf der ersten Etappe nimmt mich ein Handelsreisender mit.
An der jugoslawischen Grenze (zum heutigen Slowenien) wird gerade gestreikt. Ausschließlich Fußgänger werden durchgelassen, Autos und LKWs nicht. Ich gehe ein Stück landeinwärts und überlege, ob ich mit dem Zug weiterfahren soll, was aber Geld kostet, oder das Ende des Streiks abwarten soll. Nicht weit weg steht ein griechischer LKW. Der Fahrer macht gerade eine Pause und kocht sich einen Kaffee.
Irgendwie muss er noch durch die Grenze geschlüpft sein. Auf meine Frage hin, lässt er mich einsteigen und nimmt mich mit. Die einzige Verbindung nach Süden ist der berüchtigte Autoput (Autoput bratstva i jedinstva), eine Gastarbeiterroute, die ständig überlastet ist. Links und rechts der Fahrbahn zeugen zahlreiche Autowracks von waghalsigen Überholmanövern.
Unterwegs aber wird der Grieche namens Stavros immer zudringlicher und spricht die ganze Zeit nur von Sex. Als er abends seinen Lastwagen parkt um sich schlafen zu legen, bietet er mir die zweite Koje an, die er aber bald mit mir zu teilen gedenkt. Er ist nur mit einer schmutzigen Unterhose bekleidet, drängt mich an die Rückwand der Kabine und verspricht mir in Athen die schönsten Frauen, wenn ich ihn nur jetzt an mich heranlasse. Zum Glück habe ich meine Kleidung angelassen.
Jetzt kommen acht Jahre Gymnasium zum Tragen: Mein Chemielehrer hat immer gesagt: “Burschen, ihr müsst immer drei Dinge bei euch tragen: Zwei Taschentücher und ein Messer! Ein Taschentuch für euch selbst, ein sauberes, das man einer Dame in Nöten anbieten kann, und ein Messer, das kann man immer brauchen.”
Die Taschentücher helfen jetzt nicht, aber das Springmesser, das ich aus meiner Hosentasche hole, es sichtbar aufschnappen lasse und die Spitze an den Hals des Fettsacks drücke. Ich klettere ganz langsam über ihn und seine sich sichtbar entspannende Unterhose und springe aus dem Führerhaus. Mein Rucksack ist auf dem Reservereifen festgeschnallt, den schnappe ich mir noch und verkrieche mich in den Büschen oberhalb der Straße, wo ich die restliche Nacht verbringe.
Stavros macht keinerlei Anstalten mich zu suchen, sondern fährt im Morgengrauen weiter. Das war bis jetzt das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich eine Waffe zu meiner Verteidigung eingesetzt habe.
All das passiert in der Nähe von Niš (Serbien). Es ist noch ein gutes Stück zu Fuß bis zur Stadt und ich hoffe, von hier aus mit dem Zug bis Athen weiterfahren zu können. Ich erinnere mich von einer früheren Reise her, dass es von Wien aus zweimal täglich einen Zug nach Athen gibt. Ich brauche also nur zu warten. Tatsächlich trudelt der Zug irgendwann ein und ich erreiche bald darauf Griechenland.
Von Piräus aus möchte ich eine Fähre nehmen, um von Insel zu Insel zu springen, und jede für sich ausgiebig zu erkunden. Es ist bereits später Abend. Es haben sich eine Reihe von Trampern eingefunden, und allesamt lagern wir im Park am Hafen, ohne dass jemand etwas dagegen gehabt hätte.
Als ich mir am nächsten Morgen eine Fähre nach Amorgos suche, fällt mir ein kleiner Stand neben einem Frachtschiff auf, an dem für eine Überfahrt nach Ägypten geworben wird. Der Preis ist annehmbar und so ändere ich kurz entschlossen meinen Plan: Griechenland geht immer, aber Afrika… Ich kaufe ein Ticket und das Abenteuer kann beginnen.
Die Überfahrt bis nach Alexandria soll auf dem kleinen ägyptischen Frachter drei Tage dauern. An Bord bin ich der einzige Passagier und bin ein bisschen erstaunt, denn das Ticket beinhaltet lediglich die Überfahrt. Von einer Kabine war nicht die Rede. In der Messe gibt es ein Linsengericht. Draußen beginnt es zu regnen. Später abends schließt der Speisesaal und gezwungenermaßen suche ich mir ein Plätzchen an Deck. Das Schiff schlingert in den Wellen und ständig bläst der Wind Meerwasser über die Reling. Vergeblich suche ich einen trockenen Ort. Der Zahlmeister erbarmt sich meiner. Er weist mir einen Platz in der Mannschaftskajüte zu und die orientalischen Matrosen nehmen mich freundlich auf.
Das Schiff hat seine besten Tage schon längst hinter sich. Alles ist verrostet: Die Wände, der Boden, sogar die Bettgestelle und das Wasser aus der Leitung. Die Matratze dünstet noch den Schweiß meines Vorgängers aus. Die Luft ist geschwängert mit den Abgasen des Dieselmotors, der ganz in der Nähe sein muss. Ich mache auch Bekanntschaft mit meiner ersten arabischen Toilette. Der Wasserhahn, der meiner Meinung nach als Spülung dienen sollte, ist in Wirklichkeit das, was man in feinen Häusern ein Bidet nennt. Mir fällt im Augenblick die arabische Bezeichnung für Sauberkeit und Hygiene nicht ein. Das ist auch nicht nötig, so wie das hier aussieht. Jedenfalls bekomme ich einen Schwall öligen Wassers mitten ins Gesicht, samt den Resten der Hinterlassenschaften meiner Vorbenützer dieses heimlichen Örtchens. Ich frage mich, ob es eine gute Idee war, Afrika auf diese Weise zu erkunden. Jedenfalls ist mir das Gelächter der Matrosen sicher. Ich stelle mich mitsamt meiner Kleidung unter die Dusche. Die Wasser- Ölmischung gibt mir den Rest. Ich bin das größte Ferkel an Bord und von den Matrosen nicht mehr zu unterscheiden. Ich beschließe, diesen Zustand bis zu unserer Ankunft beizubehalten.
Tagsüber bekomme ich eine Einweisung Taue zu spleißen und darf mich auch sonst in der Kombüse nützlich machen. Mir gefällt das Leben an Bord unter diesen Menschen, und ich lerne ganz nebenbei ein paar arabische Flüche, die sich später als nützlich erweisen sollten.
Bei unserer Ankunft in Alexandria legt eine Barkasse an. Die Einreise- und Zollformalitäten werden direkt an Bord erledigt. Meine Arbeitskluft wird in einem Plastiksack verstaut und ich präsentiere mich den Beamten als sauberer und adretter Student. Das Visum ist gleich ausgestellt und ich darf mit der Amtsbarkasse an Land: Afrika.
Ich betrete afrikanischen Boden! Vor drei Tagen hätte ich nicht einmal davon geträumt. Jetzt stehe ich im belebten Hafen von Alexandria! Bewaffnet mit ein paar Dollars und einer Handvoll arabischer Flüche bin ich bereit dieses Land zu erkunden.
Bei den vielen Wechselstuben studiere ich den günstigsten Kurs für das ägyptische Pfund. Ein Araber spricht mich an: Er könne sehr günstig wechseln, inoffiziell natürlich. Ich lasse mich darauf ein und möchte 100 Dollar tauschen, ein Viertel meines Vermögens. Er zählt einen dicken Packen Geldscheine auf den Tisch, lauter 100er in ägyptischen Pfund. Plötzlich ruft er: „Police, Police!“, schiebt mir das Geldbündel hin und schnappt sich meinen Geldschein. Weg ist er. Ich stecke die Scheine ein und mache mich ebenfalls aus dem Staub. Kurz darauf möchte ich das Geld da und dort verteilen: in der Börse, in der Tasche und im Rucksack. Aber: dieser Pirat, der elende Schurke, dieser verfluchte Halsabschneider! Er hat irgendwie das Päckchen vertauscht und statt der 100 Dollar halte ich nur den Gegenwert von höchstens 15 Dollar in der Hand. Ich könnte ihn umbringen vor Wut, aber natürlich gibt es keine Spur von ihm.
Ab jetzt heißt es, streng haushalten. Zum Glück ist alles sehr billig und ich komme gut durch. Ansprüche stelle ich keine. Im Nachhinein kann ich sagen, ich habe dadurch Ägypten von seiner ursprünglichen Seite kennengelernt. Diese Erfahrung möchte ich nicht missen. Ich habe fortan in den einfachsten Massenquartieren gewohnt und mich in Armenausspeisungen ernährt: zwei Monate nur Linsen!
Die Stadt ist laut und hektisch. Eine Wäscherei bringt mein öliges Gewand wieder in Schuss und ich suche mir einen Zug nach Kairo, dritte Klasse selbstverständlich, wo alle Reisenden überrascht sind, einen Europäer zu sehen. Ich genieße jeden Moment, den ich in die orientalische Welt tauchen darf. Seither hat sie mich nicht mehr losgelassen und ich nütze jede Gelegenheit, wieder und wieder in den Orient zu fahren, und zwar genau auf diese Weise. In diesem Moment habe ich beschlossen, ein Reisender zu sein und hege seither tiefste Verachtung für Touristen. Ich mache keinen Hehl daraus und lasse es jeden wissen, ob er will oder nicht: Niemand sonst verdirbt den Charakter der Landbewohner mehr und verbraucht unnötig Ressourcen mit Flugzeugen und auf Kreuzfahrtschiffen. Der ökologische Fußabdruck von Touristen ist katastrophal, mein öliger hingegen scheint vertretbar.
Vermutlich wäre mein berühmter Vorfahre und Afrikaforscher wesentlich eleganter aus dieser betrügerischen Situation herausgekommen. Er hätte seinem Bruder lapidar ein Telegramm geschickt: János, schicke Geld. Ich habe leider keinen Bruder und muss mich mit billigen Unterkünften zufriedengeben.
Almásy Lászlo (1895 – 1956): Er war eine der schillernden Figuren unter den Forschern der Zwischenkriegszeit, der sowohl in Michael Ondaatjes ‚Der Englische Patient‘ als auch im gleichnamigen Film als Protagonist große Berühmtheit erlangt hat. Die Grundlage für beides waren zahlreiche Bücher und Essays; das bekannteste Werk ist unter dem Titel „Unbekannte Sahara“ erschienen.
Das abenteuerlichste Unternehmen war zweifellos die Operation ‚Salaam'. Hier musste Almásy im Auftrag der deutschen Wehrmacht zwei Spione von Libyen aus quer durch die Wüste in das von England besetzte Ägypten bringen. Die Unternehmung war erfolgreich, die beiden Agenten sind letztlich durch die Inkompetenz des deutschen Afrikacorps und ihrer eigenen Dummheit aufgeflogen und in Kairo verhaftet worden. Darüber wurden ein Bericht von Almásy selbst und zwei Bücher geschrieben. Hat man alles gelesen würde man nicht glauben, dass es sich um ein und dieselbe Geschichte handelt. So unterschiedlich sind die Erinnerungen der Teilnehmer.
Aber es gibt zusätzlich unzählige Geschichten, die bis jetzt nirgendwo aufgezeichnet worden sind.
Was zum Beispiel kaum jemand weiß, ist die Tatsache, dass jener berühmte Vorfahre, Almásy Lászlo, in Kairo eine Flugschule gegründet hat, und deshalb auch die ägyptische Fluglizenz Nr. 1 besitzt. Es gibt noch heute ein Flugfeld, das mitten in der Stadt liegt und seinen Namen trägt: Al Almas. Das rührt daher, dass es außer einer Sandpiste noch eine kleine Baracke gab, die als Büro und Tower gleichzeitig diente. Am Telefon hatte ein Ägypter Dienst, der immer wieder auf das Flugfeld rannte und rief: Almas, Almas, Telefon!
Wie dem auch sei: Das Pflichtprogramm in Kairo sieht auf jeden Fall einen Besuch der Pyramiden von Gizeh vor. In meinem bescheidenen Quartier hat auch Jutta, eine junge Krankenschwester aus Frankfurt, ihre Unterkunft gefunden. Wir beschließen, den nächsten Tag gemeinsam zu einem Besuch der Pyramiden zu nützen. Ein klappriger Bus bringt uns dorthin. Pflichtbewusst steigen wir über die große Galerie in die Königskammer, und in die tiefer gelegene Kammer der Königinnen. Das erstaunliche ist, dass wir ziemlich alleine sind. Es ist Nebensaison und es gibt kaum andere Touristen. Die Gänge sind schmal, die Luft ist verbraucht und überall riecht es streng nach Urin. Unseren Führer scheint das nicht zu stören und er erzählt uns endlos die abenteuerlichsten Geschichten über Pharaonen und Grabräuber, die allesamt gelogen sind, aber vermutlich das Trinkgeld in die Höhe treiben sollen. Jutta und ich sind jedenfalls froh endlich wieder im Freien zu sein. Frische Luft, heiß zwar aber herrlich.
Kaum den stickigen Kammern entronnen stürzt sich eine Horde von Kameltreibern auf uns, die mangels anderer Kundschaft das große Geschäft mit uns wittern. Ein Ritt auf einem Kamel rund um die Pyramiden ist uns zu banal, aber einer dieser Spitzbuben verspricht das unvergessliche Abenteuer zu einem Ausflug zur Stufenpyramide von Sakkara, und das zu einem akzeptablen Preis. Warum eigentlich nicht? Drei Kamele stehen bereit und nach einer oder zwei Stunden durch Sanddünen und schier unerträglicher Hitze erreichen wir gemächlich Sakkara.
Wir steigen von unseren Tieren und schauen uns um. Außer einem mürrischen Wächter hinter einem rostigen Gittertor ist nichts zu sehen, abgesehen von viel Sandwüste natürlich. Unser Kameltreiber allerdings meldet sich zu Wort: Der Preis sei nur für den Ritt in eine Richtung. Die Tour zurück koste ein Vielfaches.
Ritt nach Sakkara
Wir starren ihn ungläubig an. Er meint es ernst und nützt unsere Situation schamlos aus. Von hier gibt es keinen anderen Weg, als sein Angebot anzunehmen. Bevor die Lage im Streit eskaliert, schicken wir den Gauner weg. Wir denken, dass dieser mürrische Wächter eigentlich auch irgendwie irgendwohin zurückfahren muss. Da können wir uns sicher anschließen, gegen entsprechendes Trinkgeld versteht sich. Überhaupt scheint hier alles nur gegen entsprechendes Trinkgeld zu funktionieren.
Während wir überlegen, wie wir uns aus dieser Lage befreien könnten, sehen wir wie sich von Osten eine Limousine in einer Staubwolke nähert. Kurz darauf bleibt sie vor dem Eingang zur Pyramide stehen, der Chauffeur öffnet die Türe und es steigt ein sichtlich derangierter japanischer Geschäftsmann aus. Der Anzug klebt ihm am Körper, die Krawatte gelockert. In der schattenlosen Hitze fühlt er sich nicht sehr wohl und offensichtlich hat sein Auto keine Klimaanlage.
„Ihr habt nicht zufällig etwas Wasser?“ lautet seine Frage.
Wasser ist das einzige, das wir in unserem Gepäck haben, und wir bieten ihm gerne eine Flasche an. Sehen wir doch eine wunderbare Gelegenheit zurück nach Kairo zu kommen. Er nimmt sie dankbar an und macht sich daran, die Pyramide ausgiebig von innen und außen zu erkunden. Wir warten geduldig.
Bevor wir die entsprechende Frage an ihn richten können, bietet er von sich aus an uns mitzunehmen. Auf der Fahrt bedankt er sich noch vielmals und sehr höflich für unsere Hilfe: Er sei das Klima nicht gewohnt und wir wären Rettung in letzter Minute gewesen. Ob er nicht etwas anderes für uns tun könne. Der Transport wäre das mindeste.
Wenn er uns zu unserer Jugendherberge bringen könnte, wäre das schon großartig.
Bald darauf erreichen wir die Hauptstadt und halten vor seinem Hotel, nicht irgendein Hotel, nein, es ist das „Nile Ritz Carlton“, das schon mit seinen berühmten Gästen Geschichte geschrieben hat. Der Japaner bedeutet uns ebenfalls auszusteigen und ihm bis zur Rezeption zu folgen. Dort weist er den Angestellten an, uns ein Zimmer zu geben und alles, wirklich alles, was wir wünschen, auf seine Rechnung zu setzen. Er hat sehr wohl begriffen, dass wir uns halb mittellos nur die einfachsten Quartiere leisten können. Er verabschiedet sich mit ausgesuchter Höflichkeit und der Entschuldigung, dass wichtige Geschäfte seine weitere Anwesenheit unmöglich machen.
Wir bleiben sprachlos zurück und werden von einem Lakaien in eine prachtvolle Suite geleitet. Dort empfängt uns schier unglaublicher orientalischer Luxus. Wir können uns gar nicht satt sehen.
Wir könnten unsere Garderobe gleichfalls hier reinigen lassen, falls wir das wünschten, fügt der Lakai hinzu als er uns die Schlüssel überlässt.
Wir sind von der Situation beide mehr als überrascht. Kurz darauf schlüpfen wir in zwei Bademäntel und überlassen einem Boy unsere Kleider, der sich auch gleich unserer Schuhe annimmt.
Kurz darauf sitzen wir nach einer ausgiebigen Dusche am Balkon unserer Suite und plündern langsam, aber genüsslich die Minibar. Es ist später Nachmittag. Hunger stellt sich ein. Zum Glück gibt es eine Speisekarte. Hat unser Gastgeber wirklich gesagt, jeder Wunsch solle erfüllt werden? Ja, hat er. Darüber sind wir uns einig und bestellen über den Room Service, was das Herz begehrt, samt passender Getränke. Der Orient kann so märchenhaft sein. In weinseliger Atmosphäre genießen wir den Abend und die laue Nacht. An Schlaf ist kaum zu denken. Jede Minute will in jeder Hinsicht ausgekostet sein.
Am Morgen finden wir unsere spärliche Garderobe sauber und fein säuberlich gebügelt vor unserem Zimmer und begeben uns zu einem ausgiebigen Frühstück ins Foyer. Man könnte sich an dieses Leben gewöhnen, aber unsere Art zu reisen führt uns doch näher an die Ursprünglichkeit des Landes heran. Und deshalb verlassen wir dieses imposante Hotel und kehren zu unserem Hostel zurück. Unglücklicherweise ist Juttas Urlaub zu Ende. Ich bin sicher, wir hätten noch einige aufregende Wochen in Ägypten verbringen können.
Luxor ist eine lohnende Sehenswürdigkeit. Ein Zug bringt mich in endloser Fahrt dorthin. Während ich aus dem Fenster die eintönige Landschaft betrachte, fällt mir eine Episode meines Großonkels ein:
Almásy Lászlo muss in den 1920er Jahren ebenfalls hier unterwegs gewesen sein, als er mit seinem Freund Taher Pascha in den Süden reiste, nicht mit dem Zug, sondern standesgemäß mit einem Rolls-Royce Phantom II, samt Entourage in einer Autokolonne, die ihnen folgte. Unglücklicherweise hatte der Rolls-Royce einen Defekt: Achsbruch.
Nachdem der Schaden begutachtet worden war, setzte der Prinz seine Fahrt in einem anderen Fahrzeug fort, und bat Almásy darum, sich um seinen Rolls zu kümmern.
Dieser setzte sich telefonisch mit der Firma in England in Verbindung, erklärte das Problem, und bekam zur Antwort, man werde sich am nächsten Tag darum kümmern. Tatsächlich landete in der Nähe ein Transportflugzeug samt Ersatzteilen und Mechanikern. Bald darauf war der Schaden behoben und die Mannschaft kehrte zurück nach England. Almásy konnte mit zwei Tagen Verspätung die Gruppe des Prinzen wieder einholen.
Einige Zeit später ruft der Prinz Lászlo zu sich: Er habe ungern Schulden und würde gerne die Reparatur des Rolls-Royce bezahlen. Bisher wäre noch keine Rechnung gekommen. Er, Lászlo, möge sich bitte darum kümmern.
Almásy lässt sich am Telefon mit der Zentrale des Automobilwerks verbinden. Er erklärt seine Sache. Nach endlosem Weiterreichen innerhalb der Firma, scheint er endlich mit einem kompetenten Mann zu sprechen. Er erklärt seine Angelegenheit erneut. Ungläubiges Staunen am anderen Ende der Leitung: Das sei völlig ausgeschlossen, dass ein Mechaniker Trupp in die Wüste geflogen sei, um die Achse eines Phantom II zu reparieren.
„Aber genauso war es, und seine Hoheit wünscht die Rechnung zu begleichen.“, sagt Almásy.
„Das ist unmöglich. Denn bei einem Rolls Royce Phantom II bricht keine Achse.“, vernimmt der erstaunte Lászlo, „Daher kann es auch keine Rechnung geben.“
Es gibt noch eine andere faszinierende Episode aus seinem Leben:
Gegen Ende des zweiten Weltkrieges wurde er von russischen Soldaten aufgegriffen und ins Hauptquartier des Geheimdienstes in Budapest gebracht. Seine Bewachung war nicht besonders gut. Er hatte vorgegeben unter Durchfall zu leiden und wurde deshalb mehrmals täglich immer wieder zur Toilette gebracht. Beim letzten Mal hatte er jedoch unter dem Pyjama seine Zivilkleidung angezogen und zwängte sich durch das Toilettenfenster ins Freie.
Er konnte sich bei Freunden verstecken, aber es war ihm dort so langweilig, dass er sich abends in die Stadt wagte und ein Kino besuchte. Unglücklicherweise wurde er entdeckt und erneut verhaftet. Er galt schließlich als Spion für das Deutsche Reich.
Diesmal wurde Laszlo in ein anderes Gefängnis in Budapest verbracht und gemeinsam mit mehreren Schwerverbrechern in eine Zelle gesperrt. Er muss unerträgliche Folter ertragen haben und lag übel zugerichtet auf seiner Pritsche. Seine Mitinsassen planten für ihn gut hörbar einen Coup auf einen Postzug, sobald sie entlassen werden.
Er konnte dem Dilettantismus nicht länger zuhören und plante nun seinerseits für die schweren Jungs, wie der Raub gelingen könnte. Viel später erzählte er, dass sein Plan aufgegangen war und die Täter niemals gefasst worden sind. Planung und Vorbereitung waren das A und O bei allen Unternehmungen Lászlos.
Letztendlich wurde er in einem Prozess freigesprochen und Lászlo setzte sich nach Rom ab. Er wähnte sich in Sicherheit, aber der russische Geheimdienst war ihm noch immer auf der Spur. Das blieb dem englischen Nachrichtendienst nicht verborgen, der seinerseits Interesse an Lászlos Wissen hatte. Eines Nachts klopfte es heftig an seiner Wohnungstüre. Ein englischer Agent drängte ihn zum raschen Aufbruch: Die Russen wollten ihn entführen, jetzt. Bei einer wilden Verfolgungsjagd kreuz und quer durch Rom wurde Lászlo buchstäblich in ein Flugzeug geworfen und in Sicherheit gebracht.
Nie wieder hatte er russisch besetztes Gebiet betreten und deshalb auch nie wieder seine Heimat Bernstein gesehen. Er starb geschwächt von den Folgen seiner Folter und einer nicht gänzlich ausgeheilten Amöbenruhr schließlich 1954 in Salzburg.
Die Bequemlichkeit eines Rolls kann ich mir nur insgeheim vorstellen: Meine dritte Klasse Bank aus Holz ist hart und die Fahrt dauert schon ewig.
Aber irgendwann erreiche ich doch Luxor, ein bescheidenes Städtchen mit einigen Hotels am Ufer des Nil. Heute würde ich es vermutlich nicht wiedererkennen, aber 1981 war es sehr beschaulich.
Ich suche mir ein billiges Quartier und finde eine kleine Pension in der Altstadt. Es ist sehr heiß Ende Mai. Selbst in der Nacht kühlt es kaum ab.
Am angenehmsten ist es auf dem Flachdach des Hauses. Kurzerhand holen der andere Gast und ich unsere Matratzen aus den Zimmern und beschließen, gleich hier draußen zu übernachten. Etwas befremdlich wirkt der Boy, der uns zuerst anbietet, Drinks zu holen, dann aber auch jeden anderen Service.
„Welchen Service noch?“, fragen wir.
„Any service“, sagt er mit sanfter Stimme. Wir verstehen aber auch gar nicht, was er meint.
„Halt, warte!“, ruft mein Mitbewohner, „schicke uns doch deine Schwester!“
Mit einem üblen Fluch auf den Lippen trollt er sich schmollend davon.
Hatte er sich doch selbst zu einem Rendezvous angeboten.
Der andere Gast kommt aus England. Ein ähnliches Schicksal hat ihn seiner Barschaft beraubt und keinesfalls möchte er das, so wie ich, seiner Familie eingestehen. Es gibt so viel zu sehen und überall muss Eintritt gezahlt werden. Wir sparen uns die Kosten dafür vom Mund ab: Linsen zum Frühstück, mittags und abends. Etwas Billigeres finden wir nicht.
Es lockt das Tal der Könige. Es ist spät im Jahr, - bereits Juni - und die Hauptsaison schon längst vorbei. Nachdem wir zum anderen Ufer übergesetzt haben, verzichten wir auf das verlockende Angebot, auf rassigen Araberpferden in das Tal zu reiten oder auf den etwas günstigeren Kamelen, das heroische Bild von Lawrence von Arabien vor Augen. Der Blick auf die Denare in unserer Börse lässt lediglich einen Ritt auf zwei Eseln zu. So erreichen wir das Tal der Könige statt auf heroische eher auf biblische Art. Zum Glück reichen meine langen Beine auf den Boden und ich kann auf dem Eselsrücken quasi mittrippeln. Mein englisches Pendant kann das nicht und landet mehrmals im Staub. Unser fellachischer Führer lacht lauthals auf, ich muss mir mein Grinsen verbergen. Man ist ja nicht unhöflich.
Im Tal der Könige: kein Mensch weit und breit. Wir sind vollkommen allein. Jedes Grabmal, das zu besichtigen ist, gehört nur uns. Die Atmosphäre ist unbeschreiblich schön. Wir betreten Orte, die vor 4000 Jahren erschaffen und erst vor wenigen Jahrzehnten wieder entdeckt wurden. Und das ganz ohne Touristen.
Natürlich stehen auch der Tempel der Hatschepsut auf dem Programm, wie auch die Memnon Kolosse, die uns leider keine Lieder in der untergehenden Sonne singen. Warum das so ist, beantwortet Google und würde hier zu weit führen.
Zurück in Luxor lasse ich mich vor einem kleinen Café nieder und bestelle mir Tee, der in kleinen bauchigen Gläsern serviert wird und ganz köstlich schmeckt. Am Nebentisch sitzt ein ehrwürdiger schlanker Ägypter und geht der gleichen Beschäftigung nach. Ich beobachte, wie immer wieder andere Einheimische das Lokal betreten und mit einer oder zwei Zigaretten in der Hand herauskommen. Sie bedanken sich mit einer leichten Verbeugung bei meinem Tischnachbarn und verschwinden wieder. Merkwürdig, hier muss man nicht gleich eine ganze Packung kaufen.
Gamal, der Eigentümer dieses Cafés, klärt mich auf. Er entstammt einer alten koptischen Familie, die maßgeblich an der Errichtung der historischen Kirche (ca. 1895) beteiligt war. Er ist der letzte Abkömmling und hat beschlossen, sein restliches Leben so großzügig wie angenehm zu gestalten. Er besitzt genug Geld, um nicht arbeiten zu müssen und betreibt das Café nur, um sein Vermögen mit bedürftigen Menschen zu teilen. Diejenigen, die bezahlen können, sollen es tun, die anderen nicht. Irgendwann darf auch ich nichts mehr bezahlen. Er muss wohl bemerkt haben, dass mir nicht mehr viel Geld zur Verfügung steht.
Die nächsten Tage verbringe ich mehr in diesem Café als mich den historischen Sehenswürdigkeiten zu widmen. Und irgendwie kommt mir der Gedanke, dass es genau das ist, was ich auch irgendwann erreichen möchte. 2017 ist mir das mit meinem eigenen Kaffeehaus gelungen, wobei der Focus allerdings darauf liegt, jeder muss für seinen Tee oder Wein bezahlen, aber mir hat Gamals Großzügigkeit imponiert, und deshalb lade ich meine Gäste auch gerne manchmal ein.
Über Umwege habe ich gehört, dass es in Bernstein, meinem Heimatort, jemanden gibt, der den ganzen Tag vor dem Café sitzt und so tut, als würde ihm alles gehören. So gesehen ist es mir gelungen, irgendwie wie Gamal zu sein und mir meinen Traum zu verwirklichen. Es ist ein schönes und angenehmes Leben, wobei Tee eher eine untergeordnete Rolle spielt. Im Burgenland steht der Wein im Mittelpunkt eines geordneten Lebens.
Die Reise geht weiter, muss weitergehen: Ich möchte gerne das Rote Meer sehen. Ich finde ein Sammeltaxi, das ich mir mit einigen Ägyptern teile. Um ans Meer zu gelangen, muss man auf ca. 300 km die Sahara durchqueren. Die schmale Straße ist immer wieder von Sandverwehungen blockiert. Der Fahrer hat große Mühe den Wagen unbeschadet auf der Piste zu halten. Es ist sehr heiß. Zu allem Überfluss streikt irgendwann auch noch der Motor. Die Passagiere müssen abseits warten, bis der Schaden behoben ist. Es gibt keinen Schatten. Wir sind durstig. Ich bin der einzige, wie es scheint, der sich mit reichlich Wasser versorgt hat. Obwohl ich selbst sehr durstig bin, traue ich mich nicht, davon zu trinken. Ein Dilemma: Das Wasser reicht nicht für alle. Und deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, als von meiner Wasserflasche zu träumen. Heimlich zu trinken, geht nicht. Es gibt keinen Ort, wo ich das tun könnte. Ich hatte gedacht, dass die Einheimischen wesentlich besser mit der Situation umgehen können. Aber dem ist nicht so. Der Durst quält mich weniger als die Wüstenbewohner scheint es.
Dem Fahrer gelingt es, das Fahrzeug wieder in Gang zu bringen und nach endloser Zeit erreichen wir ein kleines Dorf an der Küste, das sich Hurghada nennt. Die Bevölkerung lebt hauptsächlich von Fischfang. Außerhalb gibt es lediglich das alte Grand Hotel, das einige Touristen beherbergt. Am Markt besorge ich mir ein Säckchen mit frischen Datteln, mein heutiges Abendessen.
Am Strand suche ich mir einen ruhigen Platz, wo ich übernachten möchte. Nicht weit davon leuchten die Lichter des Hotels. Ich kann nicht widerstehen und gönne mir von meinem spärlichen Budget ein Bier an der Strandbar. Nur leider verträgt sich das überhaupt nicht mit den Datteln. Die Nacht verläuft, gelinde gesagt, sehr unruhig. Zum Glück bin ich allein und störe niemanden.
Heute ist Hurghada ein übler Ort, ohne jegliche Authentizität, alles ist auf Touristen abgestimmt. Vom damaligen kleinen Fischerdorf ist nichts übriggeblieben.
Zurück nach Kairo: Die Fahrt im Bus kommt mir endlos vor. Ich sehne mich zurück nach Europas fettem Grün. Der Sand und die Wüste sind sehr schön und die trockene Luft lässt die Sterne besonders stark leuchten. Meine Eindrücke von diesem Land sind überwältigend.
Inzwischen ist Hochsommer und die Hitze fast unerträglich. Deshalb beschließe ich, die Rückreise anzutreten.
Ich mache meine letzte Reserve locker: Im tiefsten Inneren meines Rucksacks befindet sich noch ein Traveler-Scheck. Überraschenderweise lässt sich dieser auf einer Bank sogar einlösen und ich bekomme 100 Dollar ausbezahlt.
Für 80 Dollar buche ich einen Flug nach Athen. Zumindest gelangt man damit nach Europa und irgendwie werde ich mich schon über den Balkan durchschlagen.
In Athen besorge ich mir für 10 Dollar ein Bahnticket bis zur Grenze nach Jugoslawien. Dann sehen wir weiter.
In meinem Zugsabteil sitzen ein paar Lastwagenfahrer, die im Auftrag Fahrzeuge in die Türkei überstellen und per Bahn zurückfahren, um die Reise erneut anzutreten. Dadurch kennen sie alle Schaffner auf der Strecke, mit denen sie ein für beide Seiten vorteilhaftes Abkommen getroffen haben:
Die Fahrer kaufen das Ticket nicht am Schalter, sondern warten bis der Schaffner kommt. Diesem zahlen Sie einen gewissen Betrag, einen Bruchteil des Fahrpreises. Der Schaffner steckt das Geld für sich ein und die Fahrer kassieren die volle Summe von ihren Auftraggebern. So einfach ist das.
Meine Mitreisenden im Abteil erfahren von meinem finanziellen Dilemma und schwindeln mich als einen der ihren durch. Somit komme ich zu einer kostenlosen Reise bis an die Grenze von Österreich.
Jetzt bin ich schon fast zu Hause. Die letzten 10 Dollar bringen mich bis zu meinem Heimatbahnhof in Salzburg. Ich habe ein Abteil für mich allein, und obwohl der Zug relativ voll ist, will sich niemand zu mir setzen. Als der Schaffner das Ticket kontrolliert tut er das mit den Worten: „Du stinkst fürchterlich" und verlässt rasch das Abteil.
Nicht einen Groschen habe ich mehr in der Tasche. Nicht einmal der Bus ist leistbar.
Mir bleibt nichts anderes übrig als die letzten Kilometer zu Fuß zu gehen.
Noch ganz in Gedanken von meiner Reise versunken überquere ich die Straße bei einer Ampel, die auf Rot geschalten ist. Die letzten drei Monate hat sich kaum jemand um Ampeln geschert. Dort, wo ich herkomme, gilt auf der Straße das Gesetz des Stärkeren.
Nicht so in Österreich. Hier wacht über jede Ampel scheint es ein Hüter von Recht und Ordnung, „dein Freund und Helfer".
Eine schrille Trillerpfeife reißt mich aus meinen Gedanken und ein sauberer und gebügelter Uniformierter macht sich wichtig, was mir einfiele, die Straßenverkehrsordnung zu missachten, was auf der Stelle 50 Schilling koste.
Als ich ihm zu meiner Rechtfertigung erkläre, dass ich soeben nach einer Reise von 4000 km aus Afrika deswegen zu Fuß auf dem Weg zu meiner Familie bin, weil ich total pleite bin und ich unmöglich die Strafe bezahlen kann, hat er Mitleid. Er kontrolliert meinen Pass, sieht an den Visa, dass ich nicht gelogen habe, und lässt mich gehen.
„Du stinkst, wasch‘ Dich gefälligst, wenn Du unter Leuten bist.", sagt er noch.
Nach drei Monaten stehe ich am Gartentor unseres Familienhäuschens und freue mich darauf, meine Mutter wieder in die Arme schließen zu können. Ihre Wiedersehensfreude hält sich allerdings in Grenzen und die Gute hebt abwehrend ihre Hände: „Wie siehst du denn aus!? Du stinkst! So kommst du mir nicht ins Haus!“
Eine nette Begrüßung hört sich anders an.
„Auf der Stelle ziehst du dich aus und gehst sofort unter die Dusche!“
Was bleibt mir übrig, als der strengen Hüterin häuslicher Sauberkeit zu gehorchen. Ein Kleidungsstück nach dem anderen fällt zu Boden und splitterfasernackt trolle ich mich ins Haus. Aus dem Fenster des Badezimmers sehe ich, wie sich meine Mutter ein paar Gummihandschuhe anzieht, ein Kleidungsstück nach dem anderen hochhebt und mit gestreckten Armen von sich hält, bis es in der Mülltonne verschwindet. Sie hält sich meine geliebten Clarks-Schuhe, die mich so weit getragen haben, kurz an die Nase, und dann verschwinden auch diese im Müll. Schade!
Nach 20 Minuten unter der Dusche sind alle Spuren meines ersten großen Abenteuers getilgt und eigenartigerweise fühle ich mich in sauberer Wäsche überhaupt nicht wohl.
Es wird wohl noch eine Zeit dauern, bis ich mich wieder an das geordnete Leben gewöhnen werde. Aber der nächste Wüstenstaub kommt bestimmt. Das weiß ich genau!
PS: Vor meiner Abreise hat mich mein Freund Peter gebeten, ob er sich während meiner Abwesenheit mein Motorrad ausborgen dürfe.
Nach meiner Rückkehr hat er sich bitter darüber beklagt, dass es nicht funktioniert hat und schon nach kurzer Zeit liegen geblieben ist.
Vielleicht war kein Benzin drinnen, sage ich ihm.
Das war die Ursache. Er tankt und bringt es zähneknirschend zurück.
SYRIEN
1996
Syrien ist heutzutage nicht das klassische Reiseland. Das war es vor dem Krieg auch nicht. Es stand damals schon unter dem Regime der Familie Assad. Tourismus gab es nur in Form von Busreisen mit dem Schwerpunkt Jordanien und einem Abstecher nach Syrien. Gute Hotels am Land sind sehr spärlich, außer an Orten, die von den Bustouristen zu den Attraktionen angefahren wurden.
Die andere Möglichkeit besteht im Reisen mit Rucksack und die Fortbewegung mit öffentlichen Mitteln. Das aber ist dem Regime sehr suspekt. Mir ist es nicht gleich aufgefallen, aber mit der Zeit habe ich bemerkt, dass jeder meiner Schritte stets überwacht wird. Am einfachsten geschieht das, indem man mir jemanden unterjubelt, der dezente Fragen stellt. Ich habe später schon gespannt darauf gewartet, wie sie es diesmal anstellen. Ich habe auf der ganzen Reise nur einen einzigen Europäer getroffen, der auf dieselbe Weise wie ich unterwegs war, und mir von den gleichen Erfahrungen berichtet hat.
Nachdem ich in Damaskus angekommen bin und die Formalitäten erledigt habe, suche ich nach dem Bus, der zwischen Flugplatz und Damaskus pendelt. Natürlich ist der letzte schon längst weg. Die andere Möglichkeit ist, ein Taxi zu benutzen. Aber weit und breit ist keines zu sehen. Ich richte mich schon darauf ein, die restliche Nacht am Flughafen zu verbringen, als mich ein Einheimischer anspricht, und mir eine Fahrt in Hauptstadt anbietet. Ich verstoße wissentlich gegen Grundregel Nummer 1: Tu das nicht! Ich ignoriere diese Regel und, nachdem der Preis ausgehandelt ist, nehme ich sein Angebot an. Als wir losfahren, bleibt er nach kurzer Zeit stehen und nimmt noch einen Fahrgast mit, seinen Onkel, wie mein Fahrer sagt. Jetzt werde ich vorsichtig. Es kommt mir nicht ganz geheuer vor, als der Wagen kurz darauf die Schnellstraße verlässt. Ich weiß aber, dass diese Strecke direkt nach Damaskus führt und es keinen Grund gibt, abseits durch die finstere Landschaft zu fahren. Ich habe kein gutes Gefühl. Auf meine Frage hin, bekomme ich die Information, man müsse noch etwas abholen. Nein, nein, das ginge nicht, sage ich, und auf gut Glück schwindle ich dem Fahrer vor, dass ich in 20 Minuten im UNO-Hauptquartier erwartet werde. Das wirkt. Stillschweigend nimmt er die nächste Auffahrt zur Autobahn und setzt mich kurz darauf wie gewünscht vor dem Büro der UNO ab.
Ich war mir nicht sicher über das Vorhaben der beiden. Aber bestimmt nichts Gutes. Vielleicht war es auch unfair, soviel Misstrauen gleich am Anfang diesem gastfreundlichen Land entgegenzubringen. Normalerweise reist man in totalitären Ländern besonders sicher. Was die beiden wirklich vorhatten, wird wohl für immer offenbleiben.
Ein anderes Beispiel dafür ist meine Reise nach Tadmur zum Baal Heiligtum in Palmyra:
Ich suche mir ein Taxi, das mich zuerst zu einem außerhalb liegenden Wüstenpalast bringen soll. Nach kurzer Fahrt zeigt mir der Fahrer seine Pistole, und meint, dass wir mit ihm sicher wären. Sicher wovor? Das ist doch sehr seltsam. Und ständig Fragen über Fragen. Merkwürdig ist auch, dass es immer Leute sind, die englisch sprechen. Dabei ist die primäre ausländische Sprache Französisch, was geschichtliche Ursachen hat.
Und noch ein Beispiel: In einem Restaurant in Tartous setzt sich ein alter Mann zu mir. Er behauptet Fischer zu sein, war aber früher Chauffeur für den libanesischen Botschafter in Wien. „Habe ich müssen immer fahren nach Annagasse.“, sagt er auf Deutsch. (Das war früher das Hurenviertel in Wien.)
Der Botschaftsfahrer und Fischer
Oder im Bazar von Aleppo, als ich aus dem Hammam komme und alle Geschäfte schon geschlossen sind, lauert hinter einer Ecke noch ein Spitzel. Ich lasse mich nicht stören und genieße meine Ausflüge.
Als ich also Damaskus hinter mir gelassen habe und der Taxifahrer mir seine Artillerie gezeigt hat und ich mich ‚sicher‘ fühlen kann, fahren wir ostwärts in die Wüste zu diesem alten Palast, zumindest zu dem, was davon übriggeblieben ist. Die Fassade war als Titelbild auf meinem Geschichtsbuch der ersten Schulklasse abgebildet. Mich hat das so fasziniert, dass ich beschlossen habe, irgendwann dorthin zu reisen. Was man uns in der Schule natürlich nicht erzählt hat, war, dass sich reiche Prinzen wahre Paradiese auf Erden gebaut haben: Um den Palast gab es eine hohe Mauer, die vor neugierigen Blicken schützen sollte und die einen riesigen Garten umschloss, in dem es nicht nur seltene Blumen gab, sondern auch reichlich Wildtiere. Die Jagd war nur eine der Vergnügungen. Natürlich hat man sich, weitab vom religiösen Damaskus, auch allen anderen Vergnügen gewidmet, in der Hoffnung, Allah würde nicht allzu genau hinschauen. Selbstverständlich gab es Alkohol, Drogen und die obligaten 77 Jungfrauen. Die warten normalerweise erst nach dem Tod, aber warum nicht gleich, wenn man es sich schon im Diesseits leisten kann. Wer reich ist, ist näher dem Himmel - oder der Hölle. Das ist Ansichtssache und war schon immer so.
Heute kann man die einstige Pracht nur erahnen. Aber diese Anlage muss schon sehr beeindruckend gewesen sein.
Vor der Mauer lagert ein einsamer Beduine, der als eine Art Aufpasser fungiert. Er ist hoch erfreut über unseren Besuch und lädt uns zum Essen ein. Wir sind gerne bereit, die Einladung anzunehmen. Es ist ein Ritual, denn die Einladung erstreckt sich über mehrere Gläser mit Tee und ist etwas umständlich. Peinlich bin ich darauf bedacht, im Schneidersitz meinem Gastgeber nicht meine Fußsohlen zu zeigen. Das wäre eine große Unhöflichkeit. Aber das gehört zum Orient und erst wenn diese Prozedur überstanden ist, kann man sicher sein, willkommen zu sein. Das Gericht ist denkbar einfach. Es besteht nämlich nur aus einem Kegel aus Reis, der auf einem großen Teller angerichtet ist. Wir sitzen auf dem Boden vor dem Zelt und als Gast habe ich die Ehre, zuerst zugreifen zu dürfen. Wir essen selbstverständlich mit der rechten Hand. Die linke gilt als unrein. In der Mitte des Kegels obenauf liegt etwas undefinierbar Fettiges, das als ein besonderer Leckerbissen gilt: die Stinkdrüse eines alten Hammels. Die beiden anderen sehen mit genüsslichem Grinsen zu, wie ich das abscheuliche Ding runterwürge. Ich glaube, da war auch eine gewisse Häme dabei. Mit reichlich Tee spüle ich den Geschmack so gut als möglich weg.
„Mehr?“, fragt der alte Schurke. Ich lehne dankend ab und reibe mir den Bauch, um zu zeigen, dass ich satt bin.
Wir verlassen den gastlichen Ort. Mein Fahrer hat es plötzlich ziemlich eilig zurück nach Damaskus zu fahren, entgegen unserer Vereinbarung, mich nach Tadmor, zu den Ruinen von Palmyra, zu bringen. Er meint, ich könne ja den Bus nehmen, der jede Minute eintreffen müsse, und bringt mich zur Landstraße. Dass es hier eine Bushaltestelle gibt, beweist lediglich ein verrosteter Eisenmast am Rand der Straße.
Diese weist schnurgerade nach links und nach rechts, quer durch die Wüste. Das letzte Lebenszeichen, das ich sehe, ist die Staubwolke, die mein Ex-Fahrer hinterlässt, als er sich buchstäblich nach Westen aus dem Staub macht.
Es ist heiß, es ist trocken und ich bin allein. Was bedeutet es bei einem Araber, wenn er sagt, der Bus würde jederzeit hier eintreffen? Verkehr ist nicht vorhanden, es gibt niemanden, den ich um eine Mitfahrgelegenheit bitten könnte. Einmal, als sich eine Staubwolke am Horizont abhebt, habe ich die Hoffnung, dass es sich mein Taxifahrer doch anders überlegt hat. Aber es braust nur eine Regierungslimousine vorbei. Nach einer weiteren Stunde, ungefähr, ist wieder eine Staubwolke auszumachen: der Bus, tatsächlich. Die Rettung naht und bringt mich glücklich nach Tadmor.
Was es in Palmyra zu sehen gab ist bestens auf Wikipedia dokumentiert. Während des Bürgerkrieges ist viel zerstört worden. Ich war in der glücklichen Lage, die Anlage weitgehend intakt zu sehen. Faszinierend ist das Amphitheater aus römischer Zeit, das fast komplett erhalten ist. Ein paar Jahre später, während des Bürgerkrieges, wurden in diesem Theater politische Gegner auf der Böhne öffentlich mit dem Schwert geköpft und hingerichtet.
Mich treibt es weiter, und zwar nach Deir ez-Zor. Diese Stadt liegt am Ufer des Euphrat, und ist somit das Tor zum Zwischenstromland, das Land zwischen Euphrat und Tigris, wo Milch und Honig fließen. In erster Linie fließt hier Plastikmüll im verdreckten Fluss. Dass hier die Wiege der westlichen Zivilisation gestanden haben soll, ist nur schwer vorstellbar.
Ich suche mir ein Quartier in einem Hotel mit der Bitte, mir ein Zimmer mit Blick auf den Fluss zu geben. Zu meiner Überraschung sind die Fenster mit blauer Farbe bemalt. Immerhin gibt es eine Türe zum Balkon. Jetzt verstehe ich. Der Balkon verläuft rund um das Gebäude. Man könnte also jederzeit von außen in jedes Zimmer schauen und sehen was sich darin abspielt. Hier ist niemand auf die Idee gekommen, vielleicht den Balkon zu unterteilen, oder Vorhänge an den Fenstern zu montieren.
Auch von oben gesehen ist der stolze und geschichtsträchtige Euphrat zu einer mickrigen Drecksbrühe verkommen. Vor mir steht die einzige Brücke, an der einige Jugendliche halsbrecherische Kletterübungen machen.
Es ist nicht besonders einladend hier und deshalb suche ich mir eine Verbindung nach Ar-Raqqa, von wo ich über die Grenze in die Türkei reisen möchte. Das Ziel ist Sanliurfa (Urfa), das biblische Edessa. Der Legende nach soll König Nimrod angeordnet haben, den biblischen Abraham/Ibrahim wegen seines Vergehens, nämlich den Glauben an nur einen Gott, ins Feuer werfen zu lassen. Durch ein Wunder wurde er gerettet: Gott selbst verwandelte das Feuer in Wasser und die Holzscheite in Karpfen. Abraham landete dadurch unverletzt in einem Rosengarten, in dem der Karpfenteich heute noch zu sehen ist. Das sind für mich Geschichten, die das Reisen lohnend machen.
Aber Allah, sein Name sei gepriesen, hatte andere Pläne mit mir: Am Grenzübergang in die Türkei erwartet mich ein mürrischer syrischer Beamter, der sich darüber wundert, warum mein Einreisezettel, den ich am Flughafen bekommen habe, nicht grün, sondern weiß ist. Bis er das mit seiner Dienststelle abgeklärt und diese ihr ok gibt, dauert es ein Weilchen. Schließlich nehme ich mein Gepäck auf und wandere zwei Kilometer weit durch das Niemandsland. Überall sind Zäune zu sehen, dahinter stehen Trauben von Menschen, die nur darauf warten, jemanden dazu zu animieren, irgendwelche Güter oder sonstiges Schmugglerzeug mitzunehmen. Ich halte mich sicherheitshalber da raus.
Der türkische Grenzbeamte ist überrascht mich zu sehen. Kein gutes Zeichen! Bevor er sich mit unnötigem und bürokratischem Aufwand belastet, verweigert er mir die Einreise, trotz gültigen Visums. Er macht sich nicht die Mühe irgendjemanden anzurufen oder zu fragen, sondern er blättert ewig lang in einem Folianten herum. Dieser stammt vermutlich aus dem 17. Jahrhundert, als die Habsburger Monarchie noch mit dem osmanischen Reich im Krieg lag. Somit bin ich für ihn ein feindlicher Ausländer. Selbst auf die Frage, was ein neues Visum ‚kostet‘, sprich Handsalbung, bekomme ich bloß die Antwort, ich möge es 50 km weiter westlich versuchen. Hier komme ich jedenfalls nicht durch.
Aber dann greift er doch zum Telefon und Hoffnung keimt in mir auf. Schnell begreife ich, dass er mit seinem syrischen Amtskollegen spricht, der kurz darauf mit dem Dienstfahrrad aufkreuzt. Innerhalb kürzester Zeit stehe ich im Kreuzverhör zweier missmutiger und übel gelaunten Beamten, die mir die Schuld für die Störung ihres sonst so ruhigen Arbeitstages geben. Zum Glück kann ich ein weiteres syrisches Visum vorweisen, sodass mich der Beamte wieder einreisen lassen muss; diesmal mit dem richtigen, dem grünen Einreisezettel. Besonders höflich waren die beiden nicht. Auch wenn es einem missfällt und man knapp davor ist, die Geduld zu verlieren, ist es besser ruhig zu bleiben und sich dumm zu stellen.
Nachdem ich also die türkische Grenze nicht passieren durfte, fahre ich nach Aleppo. Ich muss herausfinden, welches Visum jetzt Gültigkeit hat und wie lange ich noch in diesem Land bleiben kann. Der ursprüngliche Plan, das zweite Visum in Anspruch zu nehmen, indem ich kurz die Türkei besuche und dann wieder nach Syrien komme, ist nicht aufgegangen. Der Türke wollte mich nicht einreisen lassen. Warum auch immer, bleibt mir ein Rätsel.
Angekommen in Aleppo erkundige ich mich nach dem Amt für Aufenthaltsgenehmigungen. Im Foyer trifft mich fast der Schlag. Der gesamte Raum ist voll von laut rufenden und heftig gestikulierenden Arabern, die sich vor einem winzigen Schalter drängen. Höflichkeit ist nicht angebracht und ich schiebe mich so gut als möglich nach vorn. Eigentlich möchte ich nur wissen, ob mein zweites Visum jetzt gültig ist oder nicht. Stattdessen drückt mir der Beamte ein Bündel Papiere in die Hand: „Ausfüllen!“
Die Anweisungen auf der ersten Seite sind auf Arabisch, das Pendant auf der Rückseite ist Französisch. Ich kann es mir aussuchen. Ich spreche beides nicht, aber Französisch kann ich wenigstens lesen und frei assoziieren. Neben mir sitzt ein junger Syrer, der ebenfalls mit Ausfüllen beschäftigt ist. Als er fertig ist, nimmt er mir den Pass aus der Hand und beginnt einige meiner Formulare zu bearbeiten. Was er da mache, frage ich ihn. „Nur das Wichtigste, das andere liest kein Mensch.“, sagt er, „der Rest ist deiner Fantasie überlassen.“ Oben prangt ein freies Feld, worauf ein Passfoto zu befestigen ist. Zum Glück und in weiser Voraussicht habe ich immer etliche bei mir. Ein Erfahrungswert.
Ich zeige die Papiere einem Beamten, der mich in den nächsten Raum weist, wo schon unzählige andere warten. Ein anderer Beamter an einem überfüllten Schreibtisch nimmt mir alles ab und legt Reisedokumente und Papiere auf einen Haufen. Meinen Pass sehe ich nie wieder, denke ich, wie soll sich dieses Chaos je auflösen? Kafka lässt grüßen: Sein Schloss in Wirklichkeit.
Wie dem auch sei, Orientalen lassen sich Zeit und auch ich habe Zeit zur Genüge. Zum Glück habe ich etwas zum Lesen dabei. Ich wollte schon immer wissen, was der Koran zu bieten hat. Vielleicht eine Weisheit, die mir helfen kann. Ich besitze eine hübsche Ausgabe: Schwarzes Leder mit Golddruck, sehr handliches Format und ständiger Begleiter in orientalischen Ländern. Praktischerweise ist das Buch in beiden Sprachen herausgegeben, arabisch samt deutscher Übersetzung. Abgesehen davon birgt es ein paar hohle Seiten, in denen ich eine Geldreserve versteckt habe. 500 Euro in kleinen Scheinen sind im hinteren Teil untergebracht. Der vordere ist durchaus lesbar.
Ich setze mich und warte. Als Lesezeichen habe ich mir im Bazar aus purem Jux ein Bildchen vom syrischen Präsidenten Hafiz al-Assad, dem Vater von Bashir, gekauft. Als ich die gewünschte Seite aufschlage, fällt dummerweise das Lesezeichen auf den Boden. Araber sind da empfindlich. Ehe ich mich darum bücken kann, steht schon der Beamte vor mir, der mir zuvorgekommen ist, und gibt mir das Bild seines Präsidenten wortlos zurück. Dabei fällt auch sein Blick auf meine Lektüre. Er nimmt das wortlos zur Kenntnis und all das öffnet eine Türe, durch die auf einmal alles relativ schnell geht.
Als ich schon einige Zeit in Mohammeds Weisheiten vertieft bin, sehe ich, wie der Beamte scheinbar unauffällig meine Papiere vom Stapel nimmt und als nächstes bearbeitet.
Er belässt eine Kopie bei sich, reicht mir den Rest und schickt mich ins nächste Bureau. Ich weiß nicht mehr, wieviel Stationen ich durchlaufen muss, bis ich im Archiv lande, wo ein unbeschreibliches Chaos herrscht. Unzählige Anträge sind im ganzen Raum verstreut: in Regalen, am Tisch in der Mitte und der ganze Boden ist übersät mit ausgefüllten Papieren wie meines und über die achtlos hinweg gegangen wird.
Irgendwann sind alle meine Papiere vergeben, bis auf eins.
„Zum General!“, sagt der Archivar und schickt mich in den obersten Stock, wo alles sehr elegant und geschmackvoll eingerichtet ist. Ein Adjutant führt mich zum obersten Chef dieses Hauses, der mich mit sauberer Uniform, genüsslich an einer Zigarre ziehend hereinbittet. Ich darf sogar Platz nehmen. Er betrachtet ausführlich meinen Pass samt den Angaben auf dem letzten Formular. Ein leichtes Lächeln ist hinter seinem gestutzten Spitzbart zu erkennen.
„Herzlich willkommen in Syrien. Ich wünsche Ihnen eine gute Weiterreise.“, sagt er und überreicht mir meinen Pass.
Ich frage mich, ob es jemals einem Syrer in Österreich gelingen würde, innerhalb von drei Stunden einen Aufenthaltstitel zu bekommen.
1931 kam es in der Nähe von Aleppo zu einem schwerwiegendem Flugzeugabsturz: Ladislaus Almásy hatte den Plan, das Flugzeug, das er für seine Expedition in Ägypten benötigte – ein De Havilland Gipsy Doppeldecker – selbst und in Begleitung von Nandor Graf Zichy nach Kairo zu überstellen. Sie starteten am 21. August in Budapest und gerieten einige Tage später in Syrien in einen Sturm und stürzten unweit von hier ab. Beide überlebten mit nur wenigen Kratzern, aber das Flugzeug war ein Wrack.
Aleppo besticht durch seine alles überragende Zitadelle, seinem Hamam und durch den riesigen Bazar, der gänzlich mit Kuppeln überdacht ist. Die mittelalterliche Badeanstalt liegt mittendrin und ist nur schwer zu finden. Ich frage mich durch und kann bald die Annehmlichkeiten dieses Ortes genießen. Auf dem Weg dorthin fällt mir ein japanischer Tourist auf, der über und über mit Kameras und Objektiven behängt ist. Das Unangenehme ist, dass er unverfroren Menschen fotografiert, die von seinem Tun nicht erfreut sind. Zum Teil wird er mit Beschimpfungen fortgejagt, was ihn aber nicht davon abhält, sich andernorts ein neues fotogenes Opfer zu suchen. Als ich nach einiger Zeit das Hamam verlasse, sind alle Läden geschlossen. Ich habe Mühe, den richtigen Weg zum Ausgang zu finden, erinnere mich aber, dass er ganz in der Nähe der Seilmacher gewesen ist. Ich finde diese Stelle leicht, da die Seile außen an den Läden hängen. Dahinter muss der Weg ins Freie liegen. Kein Mensch ist zu sehen. Dennoch, ich höre Schritte und habe das Gefühl, verfolgt zu werden. Ich verberge mich hinter einer Ecke und möchte wissen, ob mir jemand folgt.
Tatsächlich: Der Japaner pirscht hinter mir her. Offensichtlich hat er sich verirrt und findet aus diesem Labyrinth nicht heraus.
Hämisches Grinsen und Schadenfreude machen sich breit. Ich werde ihm nicht helfen. Ganz im Gegenteil: Ich schlage schnell ein paar Haken durch vertraute Gassen, so schnell, dass er mir nicht folgen kann, und entschwinde durch einen schmalen Schlupf hinaus. Ich fürchte, dass der aufdringliche Mensch aus Fernost die Nacht hier verbringen muss, währenddessen ich mein Quartier im warmen Bett genießen kann.
In ein paar Tagen wird Andrea nach Damaskus kommen. Ich bemühe mich, rechtzeitig da zu sein. Ich möchte aber vorher noch unbedingt den Kraq de Chevalier sehen und außerdem noch Tartus und Latakia.
Tartus ist eine Hafenstadt am Mittelmeer und wurde unter dem Namen Tortosa im Jahr 1102 von den Kreuzfahrern gegründet. Allerdings musste die Stadt 1292 auf Grund der Übermacht der Mamelucken wieder aufgegeben werden. Damit verschwand auch der letzte Stützpunkt der Templer-Ritter in Syrien.
In der Altstadt sind nicht nur die Zitadelle zu sehen, sondern auch Ruinen aus dem Mittelalter. In diese Ruinen sind neue Häuser ein- und angebaut. Romanische Fassaden mischen sich mit Betonblöcken. Ein kleiner Platz wird von einem riesigen Kreuzrippengewölbe überspannt. Dieses ist der Rest einer Kathedrale oder eines Palastes. Es stehen noch die Eckpfeiler, die Seiten sind offen, darüber spannt sich der steinerne Bogen des Gewölbes.
Fast vollständig erhalten ist die Kathedrale Notre-Dame de Tortosa. Sie wird nicht mehr als Gotteshaus genützt, sondern dient als Museum. Mangels Besuchern wirkt die Kirche ziemlich verwahrlost. Zwar gibt es eine Beamtin, die Eintrittskarten verkauft, aber der Überraschung nach zu urteilen, bin ich der erste Besucher seit langem. Die Räumlichkeiten sind fantastisch. Man hat den Eindruck, als wäre der letzte Ritter gerade erst beim Tor hinausgelaufen, um dem nächstbesten Moslem den Kopf abzuhacken, wäre da nicht das Kreuz mit dem Gekreuzigtem, das anstatt über der Apsis zu hängen, schief in der Ecke lehnt. Ich bin überhaupt nicht religiös und schon gar nicht kann ich mich mit der Institution der Kirche anfreunden, aber der Anblick des Heilands erschüttert mich zutiefst.
So eigenartig es klingt, aber ich entschuldige mich in Gedanken bei dem vor mir in der Ecke lehnenden Christus, dass wir in der Schlacht bei den Hörnern von Hattin so sehr versagt haben, dass das Abendland das Königreich von Jerusalem verloren hat.
„Das macht überhaupt keinen Unterschied.“, höre ich eine Stimme sagen, ganz deutlich. „Mein Vater hat viele Namen. Sogar die Moslems haben ihm 99 davon gegeben.“
Christus legt mir seine Hand auf meine Schulter. Ich spüre, wie Gott selbst mich in diesem Moment berührt. Ich bin gerührt und breche zum Erstaunen der Museumswächterin in Tränen aus.
„Sei nicht traurig. Mir geht es gut hier und ich habe noch viel zu tun.“, sagt Christus deutlich hörbar. Das Erlebnis ist zu stark, als dass ich noch länger hierbleiben könnte. Nahezu fluchtartig verlasse ich die Kirche. An einem Ort wie diesem, Jerusalem oder vielen anderen klebt das Blut an den Wänden. So viele sinnlose Kämpfe hat es gegeben, um was zu gewinnen? Keine Religion befiehlt zu töten, und dennoch, hier im Nahen Osten ist es in einem ganz besonderen Ausmaß geschehen. Selbst nach nahezu 1000 Jahren ist kein Ende abzusehen. Und alles geschieht im Namen des einzigen Gottes. Ob jüdisch, christlich oder moslemisch. Würde sich jeder Mensch an die zehn Gebote halten, könnte es vielleicht Frieden geben. Dieses Gebiet aber ist nach wie vor ein Pulverfass.
Auf dem Weg nach Damaskus statte ich noch Latakia einen Besuch ab. Im Jahr 333 vor Christus kam es in der Nähe zu einer berühmten Schlacht zwischen Alexander und dem persischen Reich:
„Dreidreidrei
Bei Issos Keilerei“
Diesen Vers kennt wohl jeder.
Ich komme an den Ruinen von Ugarit vorbei, wo angeblich das Alphabet ‚erfunden‘ wurde.
Auch der Kraq de Chevalier liegt nicht weit entfernt. Diese Burg der Templer übersteigt jedes Vorstellungsvermögen einer befestigten Anlage, so riesig ist sie. Die Gemeinschaftslatrinen bieten Platz für 100 Personen und die vielen Herdplatten in der Küche haben einen Durchmesser von sechs Metern. Letztendlich hat es nichts genützt. Der Kreuzzug wurde verloren, weil aus militärischer Inkompetenz 1187 bei den schon erwähnten Hörern von Hattin alles auf eine Karte gesetzt wurde.
Wie dem auch sei, die letzte Station ist die Stadt Hama mit seinen imposanten Wasserrädern.
Zurück in Damaskus bereite ich mich darauf vor, meine Ehefrau zu empfangen. Ich suche mir ein anständiges Hotel, das ‚Omayad‘ und freue mich über den Luxus eines bequemen Zimmers. Da ich Andrea unmöglich in dem an mir angehäuften Schmutz entgegentreten möchte, beschließe ich, einen der alten Hammams zu besuchen. Man will mir weismachen, es haben sich hier vor 800 Jahren Sultan Saladin und Kaiser Friedrich II. zu Verhandlungen während der Kreuzzüge getroffen. In Wirklichkeit sind sich die beiden nie Aug in Aug begegnet, weil Friederich II. 1194 geboren wurde und Saladin bereits 1193 verstorben war.
Ganz in Gedanken daran unterziehe ich mich einer langwierigen und spannenden Prozedur: Am Eingang fragt mich der Kassier auf Arabisch, was ich alles möchte. Ich verstehe natürlich nichts. „Tout!“, sagt er, „alles“, nimmt mir einige Geldscheine aus der Hand und bindet mir ein paar verschiedenfärbige Bänder ums Handgelenk. Ein Gehilfe geleitet mich in den mittelalterlichen Ruheraum. In der Mitte plätschert ein Brunnen. Rund um den Raum sind Wandnischen angeordnet. Über allem spannt sich eine riesige Kuppel. Wände und Decke sind allesamt mit bunten Fliesen geschmückt. Man kann sich gut vorstellen, dass hier schon Templer-Ritter und arabische Fürsten vor 1000 Jahren die Annehmlichkeiten eines Hammams genossen haben. Ich bekomme ein Handtuch ausgehändigt, sowie eine Blechschale, einen Schwamm und Seife. Meine Kleidung hänge ich an einen Haken in einer der Nischen und verdecke alles mit einem Vorhang. Ich bekomme ein Zeichen, dass ich nichts zu befürchten habe, mein Eigentum ist sicher. Eine der angenehmen Seiten des Korans: Reisende bestiehlt man nicht.
Nachdem ich mir das Handtuch um die Hüften geschlagen habe, geleitet mich der Gehilfe zum ersten Raum und nimmt mir ein buntes Bändchen ab. Ich nenne ihn Waschsalon. Denn hier säubert man sich zuerst einmal selbst. Heißes Wasser kommt aus einem der unzähligen Hähne aus Messing, die an einen großen Marmorblock in der Mitte montiert sind. Der Raum ist relativ voll mit Syrern, die sich ebenfalls gemächlich waschen. Alles geht sehr gesittet zu. Jeder bemüht sich die Privatsphäre des anderen nicht zu verletzen. Der Gehilfe von vorhin beobachtet genau, was ich tue. Als er der Meinung ist, dass es genug ist, führt er mich in eine abgelegene Kammer. In der Mitte steht ein Tisch, ebenfalls aus Marmor. Er deutet mir, mich daraufzulegen und zu warten. Kurz darauf erscheint ein Männchen und nimmt mir Schale, Seife und Schwamm ab. Außerdem ringelt auch er eines meiner bunten Bändchen von meinem Handgelenk ab. Jetzt erkenne ich das System: für jede Prozedur eines.
Der kleine Mann rührt die Seife schaumig. Er stülpt sich einen Handschuh über und beginnt meinen ganzen Körper abzuschrubben. Zuerst liege ich am Bauch, später am Rücken. Er achtet peinlich genau darauf, intime Zonen nicht zu berühren. Es fühlt sich so an, als ob er mich mit einer Drahtbürste bearbeitet. Er schrubbt und reibt endlos. Ich habe das Gefühl, keine Haut mehr zu haben. Tatsächlich ist der blasse Teint verschwunden, ich bin rot wie ein Krebs.
Mit einer Handbewegung entlässt er mich und deutet zum nächsten Raum: die Sauna; und das nächste Bändchen geht an den Bademeister. Die Hitze wirft mich fast um. Unermüdlich kommt heißer Wasserdampf aus einem Rohr und umgibt mich mit dichten Schwaden. Ich suche mir ein Plätzchen zwischen anderen Männern und warte. Zu früh möchte ich nicht gehen, zu spät auch nicht, aber auf jeden Fall bevor mein Kreislauf kollabiert. Tatsächlich macht sich einer meiner Nachbarn bemerkbar, und will wissen, was ich von Syrien halte. Ganz schnell entspannt sich eine Diskussion über unsere Religionen. Er weiß viel mehr vom Christentum als ich vom Islam. Bevor ich gänzlich in die Enge getrieben werde, verabschiede ich mich höflich und werde auch schon in die nächste Kammer geleitet, wieder mit einem Marmortisch in der Mitte. Ein Bändchen habe ich noch. Was kommt jetzt auf mich zu? Ein Vorhang wird beiseitegeschoben und heraus tritt ein Hüne von Mann. Ein Muskelpaket, ein syrischer Sumoringer. Mein Hals wird trocken als er auf mich zukommt. „Massage!“, grunzt er.





























