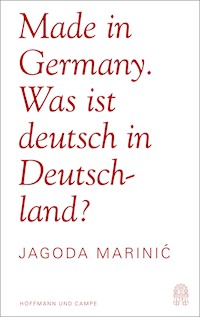12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ihr Roman setzt den sogenannten Gastarbeitern […] ein Denkmal.« Sabine Berking, FAZ Vor zehn Jahren erschien erstmals Jagoda Marinićs Roman "Restaurant Dalmatia". Von der Presse hochgelobt, thematisierte er literarisch Migration, Integration und die verschiedenen Generationen der sogenannten Gastarbeiter in Deutschland – und war seiner Zeit weit voraus. Denn erst heute finden seine Motive und Themen Widerhall in den aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen, weshalb der Roman neu aufgelegt wird. Als die Mauer fiel, war eine der größeren Minderheiten die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, sie eroberten sich die deutsche Einheit – während ihr Land zerfiel… Der Roman erzählt die Geschichte von Mia, deren Erfolg als Fotografin nicht zu Glück, sondern zu einer Blockade führt, und die sich in das Berlin der Wendezeit aufmacht, um den Ort ihrer Jugend wiederzufinden. Jagoda Marinić fängt auf unnachahmliche Weise das Lebensgefühl der zweiten Generation von Migrant:innen ein, die zwischen dem Land ihrer Eltern und der Suche nach eigenen Wurzeln und der eigenen Identität hin und hergerissen werden. »Große Kunst«, wie Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung schrieb.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jagoda Marinić
Restaurant Dalmatia
Mit einem Nachwort von Michel Friedman
Roman
Über dieses Buch
Vor zehn Jahren erschien erstmals Jagoda Marinićs Roman „Restaurant Dalmatia“. Von der Presse hochgelobt, thematisierte er literarisch Migration, Integration und die verschiedenen Generationen der sogenannten Gastarbeiter in Deutschland – und war seiner Zeit weit voraus. Denn erst heute finden seine Motive und Themen Widerhall in den aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen, weshalb der Roman neu aufgelegt wird. Als die Mauer fiel, war eine der größeren Minderheiten die Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, sie eroberten sich die deutsche Einheit – während ihr Land zerfiel…
Jagoda Marinić fängt auf unnachahmliche Weise das Lebensgefühl der zweiten Generation von Migrant:innen ein, die zwischen dem Land ihrer Eltern und der Suche nach eigenen Wurzeln und der eigenen Identität hin und hergerissen werden.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jagoda Marinić, geboren 1977, ist Schriftstellerin, Publizistin, Moderatorin und Podcasterin. Auf »arte« moderiert sie die Sendung »Das Buch meines Lebens«, auf HR2 den Podcast »Freiheit de luxe«. Mit Katrin Eigendorf und Golineh Atai bestreitet sie den Podcast »Brave New World« des ZDF. Darüber hinaus schreibt sie Kolumnen für den »stern«, die »taz« und die »Deutsche Welle«, international publiziert sie in der »New York Times«. Sie studierte Politikwissenschaft, Germanistik und Anglistik und hat danach viel im Ausland gearbeitet, etwa in Kroatien, den USA, Kanada und Rumänien. Heute lebt sie in Heidelberg, wo sie als Kulturmanagerin das Interkulturelle Zentrum aufgebaut hat und seit 2023 die Heidelberger Literaturtage leitet.
Inhalt
[Widmung]
[Inhalt]
In jener Nacht
Rafael
Mia Markovich
Mija
Zora
Sara
Die alten Sommer
Maja Marković
Laphroaig
Jesus
Adoro te Devote
Marko Marković
Ivo
Između dazwischen
Baba Ana
Mija Marković
[Widmung]
[Nachwort]
»Wer sich in einem zu noblen Umfeld aufhält, verpasst das Leben.«
Mark Knopfler
In jener NachtToronto
RafaelToronto
Mia MarkovichBerlin
MijaBerlinZoraBerlinSaraBerlin
Die alten SommerBerlin. Dalmatien
Maja MarkovićBerlin
LaphroaigBerlinJesusBerlin. Dalmatien
Adoro te DevoteBerlin. Zagora
Marko MarkovićBerlin. Dalmatien
IvoBerlin. Zagreb
Između dazwischen
Baba AnaBerlin. Dalmatien
Mija MarkovićBerlin Airport
In jener Nacht
Toronto, Januar 2013
»… und dieses Bild?«
»Welches?«
»Das hier, mit der Mauer.«
»Weiß ich nicht.«
»Weißt du nicht?«
»Nein, weiß ich nicht.«
»Ist es von dir?«
»Ja. Sicher.«
»Warum weißt du es dann nicht?«
Rafael
Toronto, 14. Januar 2013
Sie greift nach dem Koffer und verdreht die Augen: »Warum packe ich eigentlich immer zu viel ein? Selbst wenn ich nur drei Tage verreise, packe ich zu viel ein! All das Zeug für keine zwei Wochen Europa!« Plötzlich steht Rafael hinter ihr, atmet ihr in den Nacken und löst ihre Gedanken, ihre rechte Hand vom Gepäck. Sie schließt die Augen, als er nach ihren Handgelenken greift, sie hinter ihrem Rücken zusammenlegt, übereinander. Ihr Rücken rundet sich. Ihre Brust hebt sich. Ihr Kopf fällt mit sanftem Druck gegen sein Schlüsselbein. Er presst ihre Fingerknöchel gegen ihre unteren Wirbel, fährt auf und ab mit ihnen, bis ihr die Knöchel fast wehtun. Sie halten den Atem an, doch sie dreht sich nicht um. Kein Kuss jetzt, nein. Die Entscheidung ist gefallen. Seither ein Beil aus Gestern zwischen den beiden.
Vor ein paar Nächten war ihm dieses alte Polaroid-Bild von ihr in die Hände gefallen, und nur wenig später fiel die Entscheidung, zurückzugehen. Du musst zurück nach Hause, flüsterte er in jener Nacht, du musst einfach zurück. Der letzte Kuss, bevor sich alles nur noch um Zurück drehte. ZURÜCK. Als wäre das ein Ort, der auf einen wartet, der dasteht, selbst wenn man sich verspätet, wie warme Suppe auf Großmutters Herd. Trotzdem nickte sie. Rafael, in jener Nacht noch ihr Rafael, strich ihr mitten in dieses Nicken hinein die Haare aus dem Gesicht, fasste sie in seinen Händen zu einem Zopf, zog fest an ihrem Haaransatz, dass sich ihre Augen zu Schlitzen verzogen. Dann kam er so nah an ihr Gesicht, bis sich seine Augen in ihren verzerrten. Er sagte nichts weiter, nicht in jener Nacht – aber sie meinte, sie hätte etwas wie Liebe in seinem Schweigen gehört. Ja, sie würde nach Hause gehen. Dorthin, wo er es vermutete. Zuhause schien ein Ort zu sein für ihn, ein gestriger Ort, einer, der mehr mit dem zu tun hatte, wer man einst war, als mit dem, wer man sein wollte, jetzt. Oder morgen. Sie schwieg. Widersprach nicht. Fügte sich. Ihm zuliebe. Denn er wusste von ihrer weiblichen Unfähigkeit, etwas sich selbst zuliebe zu tun. Über das Weibliche an dieser Unfähigkeit hätte sie sich stundenlang erzürnt, wenn er es ausgesprochen hätte, doch war sie ihm weiblich, diese Eigenschaft, das Eigene zu vergessen, sich in den Dienst von etwas zu stellen, völlig ungebeten und ungefragt; Frauen sind große Aufopfernde, diese Erfahrung hatte er längst gemacht, wusste von daher, wie kurz die Halbwertzeit dieser Aufopferung war, die alles Opfern in Zersetzung verwandelte, eine alles Wesentliche zersetzende Zersetzung, die nichts von dem mehr stehen ließ, was zuvor noch ein Opfer wert gewesen war; gerade die aufopfernden Frauen sind es, die eines Tages ihre Schwerter heben und sich vor alles stellen, was ihnen diese Opfer abverlangt; Es muss jetzt einzig um dich gehen, ließ er sie spüren in jener Nacht, als er ihr den Zopf hielt. Kaum dass sie ausgeatmet hat, ausgeseufzt, lässt er ihre Handgelenke los. Rafael verschwindet aus ihrem Nacken. Und die Tür fällt ins Schloss.
Mia Markovich
Berlin, 15. Januar 2013
Sie will durch die Straßen von damals gehen, es können nicht viele sein. Zu einer Kindheit gehören vier oder fünf Straßen, zu einer Jugend vielleicht das ganze Viertel oder auch zwei. Es ist nur ein Block, den sie ablaufen müsste, um alles, was sie sehen wollte, zu sehen, einen halben Tag bräuchte es, einen halben Morgen, nicht mehr. Mit ihrer Nikon um den Hals macht sie sich auf den Weg. Von der Bernauer in die Brunnenstraße, vorbei an der jüdischen Synagoge und ihren Wächtern in die Anklamer, dort entlang der kleinen Buchhandlung zum Arkonaplatz, wo sie sich an die Straßenecke stellt, als würde sie gleich von jemandem abgeholt. Doch niemand kommt, nicht einmal ein Fremder biegt um die Ecke und gibt ihr das Gefühl, hier zu sein. Links von ihr ein Café namens Weltempfänger, leer. Sie geht in Richtung Zionskirchplatz, der ihr gefällt, weil eine Kurzgeschichte, die sie im Flugzeug gelesen hat, in einem Zimmer mit Blick auf die Zionskirche spielt. Zur Kastanienallee. Sie macht ein Bild von jedem Straßenschild, an dem sie vorbeiläuft. Es sind schöne Straßennamen. Auch die Schilder sind verziert. Am U-Bahn-Eingang Rosenthaler Platz das letzte Motiv für heute:
DIESES HAUS
STAND FRÜHER
IN EINEM ANDEREN LAND
Kein Punkt. Darüber, in viel kleinerer Schrift:
MENSCHLICHER WILLE KANN ALLES VERSETZEN.
Sie muss ein paar Schritte zurückgehen, um das Haus mit dem Satz ganz aufs Bild zu bekommen. Wenig später hat sie ihr Foto, sitzt hinter Fensterglas und blättert durch die Straßen, Häuser von heute. So, wie sie jetzt in diesem Café sitzt, erinnert sie an ein Edward-Hopper-Motiv, ein bestimmtes. A Woman in the Morning Sun. Das, obwohl sie nicht in einem morgenlichtdurchfluteten Schlafzimmer steht, schon gar nicht nackt, obwohl sie keine Zigarette raucht und auch kein Bett zu sehen ist, unter dem sich schwarze oder rote Pumps vor der Helligkeit des Tages verstecken. Eine zurückhaltende Kellnerin stellt endlich die Tasse Kaffee auf den Tisch. Aus der Vase, die sie zurechtrückt, verströmt eine Amaryllis aussichtslos Frühling.
Die Häuser waren nicht so grau früher. Wenn sie überhaupt grau waren. Von hier zur Gedenkstätte Berliner Mauer wären es nur wenige Minuten zu Fuß. Sie hatte sich fest vorgenommen, sich das anzusehen. So wie das Holocaustmahnmal. So wie unzählige andere Denkmäler. Als wäre sie Touristin hier. Als hätte sie nicht ihre eigene Karte, ihre ganz eigene Topographie der Erinnerungen. In Toronto hörte und las man viel über Berlin. Der englischsprachige Lonely Planet im Rucksack hatte ihr Distanz versprochen, aus dieser Distanz heraus hatte sie sich viel vorgenommen, Distanz schafft Raum. Einen Raum, den sie jetzt, da sie hier ist, nicht füllen kann. Es geht nicht. Manchen Menschen ist das Können ein mühseliger Gegenspieler des Wollens. Statt aufzustehen oder Zweikämpfe mit sich selbst zu führen, malt sie, wie im Halbschlaf, wieder und wieder ihren Namen auf die weiße Serviette: Mija Marković. Mia Marković. Markovich. Sie streicht die Namen alle nacheinander dick durch und blättert zurück in ihrem Display: DIESES HAUS STAND FRÜHER IN EINEM ANDEREN LAND. Menschlicher Wille kann alles versetzen. Und was ist mit dem Rest?
Neben ihrer Profi-Nikon trägt sie die alte Polaroid ihrer Eltern im Rucksack. Als Kind hatte sie diese Polaroid heimlich aus dem Schlafzimmer ihrer Eltern gestohlen. Zu wertvoll war sie damals für Kinderhände und doch gedankenlos verborgen im Nachttisch auf der Bettseite ihrer Mutter, in der zweiten Schublade von oben. Oder war es die oberste? Je wertvoller die Dinge in ihrer Familie waren, desto weniger wurden sie verwendet. Selbst wenn es reine Nutzgegenstände waren, zur Zierde nicht tauglich. Mit Teurem wurde umgegangen wie mit Accessoires. Und weil Kinder selbst mit Accessoires gerne umgehen wie mit Nutzgegenständen, hatte Mija sich mit kindlicher Obsession diese schlecht gehütete und mit Verboten versehene Polaroid ihrer Eltern gewünscht; sobald sie alleine in der Wohnung blieb, stahl sie sich ins Schlafzimmer ihrer Eltern und nahm die Polaroid aus der Schublade, oft nur, um sie in den Händen hin und her zu drehen. Du darfst keine Bilder machen, die Filme sind teuer, hieß es. Schnell rechnete sie sich jedoch aus, dass sie ein bis zwei Bilder pro Film unbemerkt verschwinden lassen konnte, probierte es aus, bis sie sicher war. Und ging eines Tages los.
Sie nimmt die alte Kamera in die rechte Hand, klappt den Sucher auf und erinnert sich, wie sie eines Nachmittags um jeden Preis auf die Straße wollte. Schnee fotografieren. Oder sonst etwas. Beim Gehen hatte sie die Augen weit aufgerissen, als könnte sie so ihre Schritte besser überwachen, ihr Gleichgewicht genauer ausrichten, gewappnet sein gegen das Eis auf den Straßen und die unsägliche Aussicht, zu fallen – mit der neuen Polaroid in der Hand. Nur zwei Bilder wollte sie machen, nur zwei, ganz gleich, wie schön der Schnee war, sie wusste, ihre Mutter bemerkte fast alles, außer eben den kleinsten Abweichungen, die nicht. Das erste Polaroid pustete sie schon trocken, da hatte sie das Haus kaum verlassen, sie hielt es am weißen Rand fest, um keine Fettabdrücke zu hinterlassen, war unzufrieden mit dem Ergebnis. Die zweite Chance wollte sie besser nutzen und lief von einer Straße in die andere auf der Suche nach einem Motiv, dem Motiv, das allen möglichen Ärger und vielleicht eine Ohrfeige wert wäre, oder gar mehr als eine Ohrfeige. Sie dachte damals nur an ein Bild, das sie machen könnte, sie dachte nicht an Straßen und ihre Namen, nur an Plätze, Ecken, Läden, die ihr im Kopf waren. Auf der Karte, die jetzt vor ihr auf dem Cafétisch liegt, fährt sie die Straßen ab, fragt sich, von welcher Straße in welche sie damals wohl abgebogen ist. Sie kann nur schwer rekonstruieren, ob sie aus der Volta- in die Wattstraße bog und dann von der Strelitzer in die Bernauer kam, oder ob sie anders gelaufen ist. Sie weiß beim besten Willen nicht mehr, ob sie an der Mauer entlang oder auf sie zuging, als es geschah. Wenn sie auf die Mauer zuging, dann war sie entweder über die Usedomer oder Stralsunder gekommen und in die Hussitenstraße gebogen. Eines jedoch kommt ihr jetzt, an diesem Tisch, mit großer Sicherheit: Das Erste, was ihr damals auf der Bernauer ins Auge stach, war ein Pulk Menschen von hinten. Rücken. Kaum ein Mensch im Profil. Alle standen sie mit dem Rücken zu ihr. An eine Kamera erinnert sie sich noch, eine große Videokamera stand da, glaubt sie, nachdem sie als Mädchen in die Hussitenstraße gebogen war. Ja, so war es, flüstert sie, fährt dabei die Straßen mit dem Zeigefinger nach: von der Usedomer Straße in die Stralsunder in die Hussitenstraße. Noch bevor sie um die letzte Ecke gebogen war, hatte sie ein lautes Horn gehört. Seinem einfarbigen Tönen folgte ein überwältigender Knall. Sie bewegte sich langsamer, wie in Zeitlupe, vergaß das Motiv, nach dem sie Ausschau gehalten hatte, ein paar Schritte lang ging das gut, ihr Blick klebte an der Stelle, an der der Kirchturm eben, vor ihren Augen, gen Osten gefallen war, in einem Stück war er gefallen, wie ein Klotz. Sie rutschte aus, fiel hin, die Kamera fest gegen den Bauch gedrückt, den Blick auf den gefallenen Turm gerichtet, an dessen Stelle nun eine gefräßige Staubwolke wuchs; zwei kahle Bäume waren das Letzte, was an dieser Stelle noch über die Mauer ragte. Sie sah auf die beiden Straßenschilder, Bernauer Straße und Hussitenstraße, und zu den winterkahlen Bäumen zurück. Ja, so war es, denkt sie, genau so war es, flüstert sie, blickt noch einmal auf die Karte, die vor ihr liegt und dann zurück zu dem Mädchen, das sie an jenem Tag war, sieht, wie es aufsteht und plötzlich, ohne nachzudenken, ein Bild von den beiden Straßenschildern im rechten Winkel schießt: Bernauer Straße und Hussitenstraße. Der Turm der Versöhnungskirche ist an jenem Nachmittag im Januar in den Osten gefallen, das Kreuz auf der Turmspitze, das hat sie erst viele Jahre später auf Bildern gesehen, zeigte dabei in den Westen.
Jahre später, schon in Toronto, konzipiert dieses Mädchen als junge Frau eine Ausstellung. Ihre erste eigene. Zu Hause in den Kisten stößt sie auch auf das Polaroid von jenem Tag. Dieses Bild mit den Straßenschildern und ein paar Metern Mauer. Eine weiße Trompete war auf die Mauer gesprüht, die ihr als Kind nicht weiter aufgefallen war. So wie eines der vielen »Die Mauer muss fallen« im gleichen Weiß darunter. Sie hatte dieses Bild, kurz nachdem sie es geschossen hatte, in ihr Tagebuch geklebt, ein Tagebuch, das sie, wie alle ihre Tagebücher, nie wieder gelesen, aber doch mit nach Kanada genommen hat. Von diesem Moment war ihr nur geblieben, wie sie das Bild geschossen hatte, mit diesem Herzrasen, mit dem Kinder Verbotenes tun. Nun sitzt sie mit Rafael im Wohnzimmer, sie wühlen sich durch ihre Vergangenheit in Kisten, bis ihm dieses Bild in die Hände fällt. Es macht ihn neugierig. Rafael fragt, als hätte sie sich viel bei diesem Bild gedacht. Sie antwortet, wie sie fast immer antwortet, lückenhaft und unbefriedigend. Er ärgert sich, will mehr wissen. Das hatte sich angekündigt. Seine Neugier steht seit Wochen im Raum. Fordernd, ungeduldig, rücksichtslos. Statt zu erzählen, wirft sie ihm sein Verhalten vor. Was es ihn angehe, fragt sie. Er steht auf, geht ins Schlafzimmer, zieht sich aus und schmeißt seine Hosen gegen die Wand. Überzogen. Völlig überzogen. Als sie immer noch meint, es gehe ihn nichts an, ihre Vergangenheit gehe ihn nichts an, bricht es aus ihm heraus. Er wolle so nicht mehr. Er habe ein Recht auf eine normale Beziehung, eine stinknormale Beziehung. Was er denn mit einer stinknormalen Beziehung wolle, fragt sie, gerade er. Sie weiß genau, was er von ihr will und stellt sich tot.
Sie denkt an diesen Abend wie an eine Geburt. Schmerzhaft und doch der Beginn von etwas Nicht-da-Gewesenem. Etwas, das, wenn sie Glück hatte, wachsen würde, das spürte sie. Seine Ungeduld wuchs mit. Sein Verlangen nach einem Menschen, der auch gestern war, der vor ihm war. Es ging bei all den Fragen auch um ihn. Er war es, der anders gekannt sein wollte, als sie es bisher vermutet hatte, der sie anders begehrte, vielleicht tiefer, als sie geahnt hatte. Seine Fragen waren nicht nur Neugier, sie waren vor allem Sehnsucht nach ihr. Sie konnte gut damit leben, nicht durchdrungen zu werden. Doch sie konnte nicht gut damit leben, ihm nicht genug zu sein. Er löchert sie mit Fragen. Sie wisse es einfach nicht, antwortet sie, sie wisse es wirklich nicht mehr. So wie sie auch nichts über die Mauer wisse oder das Bild mit der Trompete. Man könne doch nicht nichts mehr wissen, das gehe einfach nicht. Allein die Bilder erzählten doch, wann sie gemacht worden seien und wie. Doch sie hat in der Tat keinerlei Erinnerung an die Trompete oder den weißen Satz auf der Mauer. Als hätte die Kamera sich an jenem Nachmittag vor sie gestellt, für sie gesehen.
Nach diesem Streit war ihr zumindest der Titel ihrer Ausstellung eingefallen: What photographs hide. Sie hatte den Grange Prize gewonnen, sie. Sie sollte nun in der Gallery 44 ihre Bilder ausstellen, sie. Bis dahin kannten nur Rafael und ihr engster Freundeskreis ihre Bilder, nur mit Rafael sprach sie über ihre Arbeit, er war es, der sie darin bestärkt hatte, kleine Galerien aufzusuchen, die Bilder für Wettbewerbe einzureichen. So hatte sie Sophie und Kenneth von der Wedge Gallery kennengelernt, die ihr halfen, eine Auswahl für den Grange Prize zu treffen. Sophie mit ihrem viel zu sanften Lächeln und Kenneth, der sich eigentlich für die fotografische Erkundung afroamerikanischer Identität engagierte, ein erfahrener Kurator und Kunstsammler. Mia war die zweite Grange-Preisträgerin überhaupt. Fünfzigtausend kanadische Dollar. Die Mühe hatte sich gelohnt. Der Plan war aufgegangen. Nur sie ging unter. Mit dem Preis machte sich etwas Platz, das sie nicht erwartet hatte: Ihr Unwille zum Gelingen. Etwas in ihr war ins Misslingen verliebt. Dieses Etwas fühlte sich jetzt gestört. All die Menschen, die sie mit einem Schlag verstanden, etwas in ihrer Kunst zu sehen meinten. Allein das Wort Kunst für ihre Bilder zu verwenden kam ihr plötzlich, da man es mit solcher Sicherheit tat, spöttisch vor. Niemand fragte mehr nach ihrem Brotjob, nur noch nach ihren Projekten. Projekte, die sie nun, da sie keinen Brotjob mehr brauchte, nicht mehr hatte. Sie hatte ihren Hunger auf Motive verloren. Seit Wochen fand sie kein Motiv, das sie fesselte. Gestillt war das Verlangen nach Bildern, befriedet die Unruhe der Deplatzierten. Ihr Platz war ihr nun zuteil geworden. Und sowie sie ihn eingenommen hatte, schlossen sich mit jedem Tag Türen in ihr. Bis sie die Wohnung nicht mehr verließ. Rafael hing ihr seit ein paar Wochen mit einer Therapie in den Ohren, was sie kränkte. Sie kam nicht aus der Welt der Psychologen. Überhaupt kam sie nicht aus einer Welt, in der andere etwas über sie zu wissen hatten. Er verstand ihre Ablehnung nicht. Sie verstand sein hilfloses Bedürfnis nicht, sich anderen anzuvertrauen, Antworten dort zu suchen, wo man ihre Tiefen weniger kannte, schlechter kannte als sie selbst. Sie glaubte nicht an Hilfe. Nur an ihre Bilder. Doch sie fand sie nicht mehr. Sie ging durch die Straßen und fand ihre Bilder nicht. Also blieb sie zu Hause.
»Du hast deine Menschen verloren, das ist es«, sagt er. Sie liegen im Bett, sie hat gerade den Kopf an seinen Oberarm gelegt.
»Ich wüsste nicht, dass ich eine Frage gestellt habe.«
»Du bist eine einzige Frage, Mia. Ich spüre dich nicht mehr.«
»Ich bin nicht mit dir ins Bett, damit du mich spürst oder nicht spürst, verstehst du?«
»Sondern?«
»Einfach so.«
»Es liegt auf der Hand. Es ist alles da …«
Sie zieht das Bettlaken über ihre Brust, steigt aus dem Bett und rollt sich in den weißen Stoff ein.
»J-e-d-e-s Mal muss deine Arbeit bei uns im Bett landen. Jedes Mal.«
Sie läuft ins Wohnzimmer, legt sich auf die Couch und platziert ein kleines Kissen unter ihrem Kopf. Er folgt ihr. Wie ein Dreijähriger stellt er sich ans Fußende der Couch.
»Seit du den Preis gewonnen hast, geht es dir schlecht. Und es wird nicht besser, im Gegenteil. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen, oder? Du willst deinen Erfolg nicht, Mia, du willst keinen Platz in dieser Welt hier. Du willst ihn nicht, weil du denkst, so bleibst du in deiner. Sag was du willst, aber so ist es!«
Sie holt das Kissen unter ihrem Kopf vor, nimmt ein zweites und hält sich die Ohren zu.
»Es ist, wie es ist.«
Sie wirft ein Kissen nach ihm.
»Dieser verfluchte Film! Dein gottverdammter kleiner Film, den keine drei Leute auf dieser Welt sehen werden, zumindest keine drei Leute bei Verstand, dieser idiotische Film macht noch unsere Beziehung kaputt, sag ich dir.«
Rafael ist Dokumentarfilmer und begleitet seit vier Monaten drei Einwanderer, für die er sich nach mühseliger Recherche entschieden hat, durch ihren Alltag und zu ihren Therapiesitzungen. Er hat für seinen Film Menschen gesucht, die nicht länger als zehn Jahre in Toronto leben und gerade mit einer Therapie anfangen wollen. Dafür hat er sich in Freud eingelesen, in Theorien der Verhaltenstherapie. Er hat Familienaufstellungen besucht, stand dort abwechselnd als Vater, Großmutter oder Bruder zur Verfügung, je nach Bedarf; ein Seminar in systemischer Beratung hat er auch belegt. Mia bekam dabei jede Station im Detail geschildert. Einmal musste sie mit ihm eine Familienaufstellung nachstellen, die ihn beeindruckt hatte. Er war wenig beeindruckt davon gewesen, wie unbeeindruckt sie sich zeigte. Sie hatte alle seine Projekte gerne verfolgt, doch das mit den Psychos sei nicht ihr Ding, wiederholte sie immer wieder. Er wollte Interviews vermeiden. Keine Selbstportraits. Stattdessen ging es ihm um das, was sie nicht sagten, das Nebenher, von dem sie nicht wussten, nicht bewusst erzählten, für das sie keine Geschichte hatten. Er gehe so lange mit, bis er für sie unsichtbar werde, erklärte er seinen Darstellern. Dabei folge er ihnen bei ihren Reisen aus einer Welt in die andere, er meinte damit den Wechsel von ihrem Alltag zu ihren Therapiesitzungen, der komme ihm krasser vor als jener zwischen den Ländern, zwischen denen sich diese Menschen hin und her bewegten. Er wolle in diesem Film eine Welt zeigen, in der die Wunde zwanzig Quadratmeter Platz fände, zwanzig Quadratmeter in einer Praxis, der Rest sei Überlebenskampf, geschichtsloses Leben, das keine Fragen stellt nach dem Dahinter oder Woher. Im Grunde war er mit seinem Projekt und den Darstellern ausgelastet. Doch seit Mia den Preis gewonnen hatte, war sie, entgegen seiner Erwartung, wie ausgewechselt. Fremd. Er konnte es zunächst nicht verstehen. Nur wenige Wochen nach der Preisverleihung hörte sie, nach einem kurzen Höhenflug, mit dem Fotografieren auf. Auch in der Dunkelkammer arbeitete sie nicht mehr. Sie ließ sich gehen. Je tiefer sie fiel, desto weiter entfernte sie sich von ihm. Er begriff, dass es etwas gab, das weder er noch sie kannten, etwas in ihr, das plötzlich, nach all den stummen Jahren, sein Recht einforderte. Erst jetzt fiel ihm auf, wie wenig sie während der letzten Jahre von früher erzählt hatte. Wirklich erzählt hatte, so, dass sich ein Bild von Früher ergab. Wenn er nachfragte, wich sie aus. Doch er wollte verstehen, weshalb sie mit ihrer alten Welt nur alle zwei Wochen telefonierte, weshalb ihr seine Familie reichte, weshalb sie nie nach Europa flog und vor allem, weshalb ihr Desinteresse an sich selbst so weit ging, dass es ihn einschloss.
Mija
Wedding, 28. Januar 1989
Marko Marković raucht auf dem Balkon seiner Wohnung und wartet auf den Sommer. Er wartet immer auf den Sommer, zu jeder Jahreszeit, selbst im Sommer. Im Winter gehört der zwei mal drei Meter große Balkon nur ihm. Schnee fällt. Seit Tagen. Schnee ist ihm nicht mehr und nicht weniger als ein Bote, der die Nachricht vom Ausbleiben des Sommers bringt. In diesem Viertel ist es besonders unerträglich, wenn der Sommer ausbleibt, denkt er. Er weiß, jede Stadt dieser Welt kennt solche Häuser, in denen jedermann wohnen könnte, aber keiner wohnen will. Häuser, denen mindestens vier weitere Häuser dieser Art gegenüberstehen, eineiige Zwillinge des Hauses, in dem keiner wohnen will. Inmitten dieser Hausgeschwister findet sich, in verlässlicher Regelmäßigkeit, ein Sandquadrat. Es muss ein Schild vor diese Sandquadrate gestellt werden, damit klar wird, hier sollen Kinder spielen und nicht Hunde scheißen, denkt er. In diesem Hundeklo bleibt der Schnee nun unberührt liegen, immerhin für etwas scheint er gut zu sein, denkt Marko. Er hasste den Schnee schon als Junge. Seine Frau erklärte ihm seinen Hass auf Schnee damit, dass er als Kind keine Schuhe hatte und barfuß zur Schule gehen musste; das winkte er ab, dann müsste sie den Schnee doch mindestens so hassen wie er, entgegnete er, aber Hass sei eine Veranlagung, eine Charakterstärke, zu der sie gar nicht in der Lage sei. Sie lachten, wenn er das sagte, diese Gespräche waren wie Spielbälle, die sie einander oft zuspielten, nur, um dem Anderen dabei zuzusehen, wie er ihn loswurde. Marko hielt seinen Hass gegen den Schnee jedoch für Veranlagung und glaubte, diese seiner ersten Tochter, Mija, vererbt zu haben. Er wusste es schon bei ihrer Geburt, er wusste, dieses Kind wurde mir geboren, so wie der Pfarrer, wenn er an Weihnachten aus der Bibel liest, jedes Jahr aufs Neue weiß, es ist uns ein Christkind geboren. Sie war nicht einmal zwei, da machte er den genetischen Schneetest mit ihr: Er nahm sie mit auf die Straße, hielt sie den Flocken entgegen und rief Snig – das dalmatinische Wort für Schnee. Snig, Mijo. To ti je snig. »Das hier, das ist dir Schnee, Mijo.« Im Kroatischen steht selten etwas für sich, ist einfach so, immer ist es dem Menschen, alles ist ein Dativ, alles auf dieser Welt ist für jemanden. Mija bückte sich, fasste mit ihren Kinderhänden in den kalten Schnee und schaffte es nicht, sich wieder aufzurichten. Er sah ihr zu, wie sie ganze fünf Sekunden still hielt, bevor sie zu schreien begann. Da zündete er sich zufrieden eine Zigarette an, packte seine Kleine unter den Arm und ging mit ihr die Treppen zurück hoch in die Wohnung. Im Wohnzimmer setzte er sie wieder ab, wo sie weiter weinte, was ihn zufrieden stimmte. »Ich hab’s gewusst«, dachte er. »Das Kind kann auch nicht mit Schnee«, rief er in Richtung Küche, aus der seine Frau gleich ins Zimmer gerannt kam und ihre Tochter in die Arme nahm. »Idiote!«, schimpfte sie ihn, »Idiote!«, während er zufrieden auf den Balkon ging, um seine Zigarette zu Ende zu rauchen.
Das war vor über zehn Jahren gewesen. Jetzt sieht er sie diese verschneite Straße entlanglaufen, als wäre sie im Schnee aufgewachsen. »Ist sie ja auch«, denkt er. »In diesem verdammten Berlin, sechs Schneemonate pro Jahr, was für ein Wahnsinn«, denkt er, »was für ein Wahnsinn …«, er bremst sich. Mija ist seit einem Jahr eine Tochter geworden, der alle und alles nicht gut genug sind: die Mutter nicht, der Vater nicht, die Brüder nicht und nicht einmal sie selbst. »Auch das hat sie von mir«, lächelt er. Seit sie Teenager ist, stellt der Wedding als Feind aller Feinde jeden in den Schatten. Sie hat es auf dieses Viertel abgesehen, als hätte sie neben seiner Abneigung gegen Schnee und den Rest der Welt auch noch jene gegen Beton von ihm vererbt bekommen. Er lacht. Aufs Gymnasium geht sie nach Moabit, es heißt, da seien weniger schlechte Familien. Zora und seine Frau kamen darauf, sie lieber zu den guten Familien zu schicken, die lange Busfahrt und die Kosten durften kein Problem sein. Sie meinen es gut mit Mija, wollen, dass sie bessere Freunde hat, als es sie im Wedding gibt, weil sie den ganzen Tag über weit weg von zu Hause ist, soll sie von netten Kindern umgeben sein. Aber Mija findet die Schule nicht richtig, die Schüler nicht richtig und diese Entscheidung erst recht nicht. Sie ist kaum wiederzuerkennen, seit sie auf dem Gymnasium ist, keiner weiß mehr, ob sie nun das Gymnasium, den Wedding oder ihre Mutter hasst. Gestern Abend erst wieder schrie sie in einem Streit: »In diesem Scheißwedding hier werde ich jedenfalls nicht sterben! Das könnt ihr ja machen, aber ich mache das sicher nicht!« Er war insgeheim stolz auf sie, während seine Frau ihr eine Standpauke über Demut hielt. Sie müsse jetzt dankbar dafür sein, in so eine gute Schule zu gehen. Seine Frau ist die erste katholische Priesterin, dessen ist er sich sicher, zu allem weiß sie etwas Biblisches, nur fehlen ihr die Gläubigen, weshalb sie ihre Familie als Glaubensgemeinschaft missbraucht. Am schwierigsten ist es für sie, Mija zu missionieren, zumal sie dafür gesorgt hat, dass sie auf ein gutes Gymnasium kommt, in dem man das Diskutieren lernt. Marko Marković hält bei diesen Diskussionen inzwischen den Mund. Maja Marković, seine Frau, spricht kaum Deutsch, ist eine stolze Köchin und lenkt die Geschicke der Familie. Seit Mija aufs Gymnasium geht, schlecht gelaunt ist und immer weniger Interesse an der Küche zeigt, ist der Ärger im Haus regelmäßig zu Gast. Marko hat manchmal den Verdacht, die Kleine bekommt auch den ein oder anderen Ärger ab, der eigentlich ihm gilt, allein deshalb, weil sie aussieht wie er, aber weniger cholerisch ist, doch er behält es für sich, um nicht noch mehr Ärger zu provozieren. Seit sie auf dem Gymnasium ist, kann Maja ihre Tochter nicht mehr ertragen. Mija behauptet jeden Tag, wenn sie von der Schule nach Hause kommt, die Lehrer in Moabit denken, sie könne weniger als die anderen, nur weil sie Ausländerin ist und die dort kaum Ausländer gewohnt sind. Sie wäre lieber im Wedding geblieben, ganz gleich, wie schlecht es hier ist, da wäre sie Klassenbeste gewesen.
»Es fragt später keiner danach, ob du Klassenbeste warst, sondern wie gut du bist!«
»Aber neben den anderen Ausländern war ich besser als jetzt! Und die Lehrer haben mich gemocht, die jetzt können mich nicht leiden!«
»Warum sollten sie dich nicht leiden können, du bist doch nur ein Kind? Denkst du denn, meine Schnitzel verneigen sich täglich vor mir?«
»Nein, aber sie halten zumindest den Mund. Mich pöbeln da alle nur an … Die Lehrer, die Schüler …!«
»Dann mach doch den Mund auf!«
»Das bringt nichts, ich habe die falschen Eltern. Deutsche Eltern kommen in die Sprechstunden, die nehmen mich ja schon nicht ernst, weil meine Mutter lieber Hackfleisch einrollt, statt in die Sprechstunde zu kommen! Diese Jugos und ihre Čevapćići, so denken die doch!«
»Das stimmt nicht, es stimmt einfach nicht! Die Deutschen haben nichts gegen uns! Türken sind Türken, sag ich dir, die haben vielleicht Probleme mit den Deutschen, die Türken! Araber! Moslems! Die!« Ihr Gesicht läuft rot an. »Aber die kannst du doch alle nicht mit uns vergleichen! Wir sind Katholiken. Wir und die Deutschen, wir haben denselben Gott!«
»Die Deutschen haben gar keinen Gott mehr, schon gar nicht euren, diesen Irren! Kapier’s doch endlich: Für Deutsche seid ihr genauso Bauern, Ausländer und Fleischfresser wie der Rest hier im Wedding! Und ich bin das fleischfressende Kind von Bauern, Ausländern und Fleischfressern aus dem Wedding, die im Leben noch nichts erreicht haben, außer ihr bescheuertes Dorf hinter sich zu lassen – und nicht einmal das richtig.«
»Moslems essen kein Fleisch, Mijo!«
Maja holte tief Luft und presst die Lippen zusammen.
»Zumindest essen sie kein Schwein. Moslems trinken keinen Alkohol, weil Allah es nicht will, verstehst du? Du kannst uns nicht mit denen vergleichen, wir trinken mindestens so viel wie die Deutschen!«
»Ihr kapiert es einfach nicht, ihr kapiert es echt nicht, oder? Ihr seid nicht die Besseren für die, ihr seid für die genau wie die, die ihr nicht leiden könnt, versteht ihr das nicht? Da hilft euch kein Gott und kein Tito! Das alles weiß doch hier kein Mensch, wer euer Tito war und wer euer Gott ist! Die wissen nur, dass ihr ihre Toiletten und die Hintern ihrer Eltern putzt für ein bisschen Kleingeld! Und auf euer Essen haben die auch keinen Bock mehr, weil’s widerlich ist, Ausländerfraß halt! Die essen lieber um die Ecke beim Deutschen und zahlen doppelt so viel, damit Ausländer wie du in der Küche versteckt werden und keiner merkt, dass ihr eure Drecksfinger im Spiel habt!«
Mijas Mutter verpasste ihr eine Ohrfeige. Zwei.
»Dass du es nicht mehr wagst, mich so anzuschreien. Ist das klar? Ist das klar? Du wagst es, so zu brüllen, und in der Schule? Da kriegst du den Mund nicht auf! Dauernd höre ich, du redest nicht. Die sagen, deine schlechten Noten kommen davon, dass du nicht redest! Wieso merk ich denn nichts davon, dass du nicht redest? Kostet es denn was, in der Schule zu reden? Uns kostet es, dass du nicht redest, weil wir dir diese ganzen Lehrer ins Haus holen müssen, damit du …«
»Ach, was weißt du denn schon. Du gehst ja nie hin! Sprichst nie mit den Lehrern. Und wenn, würden die dich eh nicht verstehen! Gar nichts weißt du, von nichts weißt du was! Nur, was alles kostet weißt du!«
Noch eine. Und noch eine.
»Ich weiß, dass ich mit meiner Arbeit deine Nachhilfe bezahle, nur damit du den Mund nicht aufkriegst! Ist denn dein Reden mehr wert als meine Zeit? Ja? Ist es das? Du weißt nicht, was arbeiten heißt, und machst dich über Menschen lustig, die arbeiten, Ärsche putzen, was auch immer. Mijo, sie arbeiten, das ist mehr, als du je getan hast!«
»Mama, ich bin ein Kind!«
Das war erst letzte Nacht, denkt er. Letzte Nacht. Jetzt läuft sie wieder durch den Schnee wie eine Große, eine Unverletzte.
»Tata!«, ruft Mija von unten und winkt. »Tata!«
»Schrei nicht so laut, wir sind nicht allein im Viertel!«
Wenig später klingelt sie. Marko geht zur Sprechanlage und lässt sie ins Haus. Mija stellt ihrer Mutter die Butter, die sie besorgen sollte, auf den Küchentisch, geht ins Wohnzimmer, zu ihren beiden Brüdern.
»Sag mal, müsst ihr den ganzen Tag über Atari zocken?«
»Nö.«
Die beiden äffen sie nach und krümmen sich vor Lachen. Sie spielen im Winter fast den ganzen Tag über Atari, es sei denn, Marko vertreibt sie aus dem Wohnzimmer ins Kinderzimmer, weil er fernsehen will.
»Yo! MTV Raps! Yo! MTV Raaaaaps, Mijo!« Seit letztem Herbst sendet das Fernsehen diese Hip-Hopper, und Mijas Brüder spielen ständig die Doppelgänger von Dr. Dre und Ed Lover. Sie ballen die Hand zur Faust, spreizen dabei Daumen und kleinen Finger und rappen pausenlos: »Yo! MTV Yo! MTV Raaaaaps!«
»Mijo, guckst du später mit uns Fab5 Freddy?« Sie nickt. Fab5 Freddy mag sie, denn seit Fab5 Freddy über den Bildschirm in ihr Wohnzimmer getreten ist, haben ihre Brüder endlich etwas zu tun. Ihr kleiner großer Bruder malt Graffiti auf Blätter, die ihr großer großer Bruder dann auf die Mauer im Wedding sprüht. Künstlername: ALTA. Der kleine Große hat das Talent, der große Große den Mut. Die Zeichnungen vom Kleinen findet Mija – wie die meisten – beachtlich. Selbst ganz einfache Namen zeichnet er inzwischen wie Buchstabenkunstwerke. GANGSTA-Kunstwerke. Oder HOMEBOY-Kunstwerke. Oder RAP. Manchmal schreiben sie auch Gümnasiastin als Graffiti und hängen es über Mijas Bett. Mija schämt sich vor ihren Brüdern nicht dafür, eine Gymnasiastin zu sein. Vor ihren Gymnasiasten schämt sie sich nicht für ihre Brüder. Und bringt trotzdem keine Freunde vom Gymnasium mehr mit nach Hause. Ihre Freunde von der Grundschule sind ihr sowieso lieber. Die haben nämlich, neben der Tatsache, dass sie sie lieber mag, auch nichts gegen ihre Brüder.
Draußen auf der Straße sind ihre Brüder Gold wert. Niemand im Viertel kommt ihr dumm. Den ganz Großen kennen so gut wie alle hier. Der ist nämlich befreundet mit Avni dem Albaner, und Avni ist berühmt dafür, dass er im Supermarkt in der Schönhauser Allee seinen Kopf hinhält für den Fall, dass besoffene Kassendiebe den Laden stürmen. Avni trägt eine schusssichere Weste, er hat zwar keine Knarre, dafür aber eine Trillerpfeife mit Alarmsystem um den Hals. Wenn Avni an die Trillerpfeife langt und den Knopf drückt, sind die Bullen, die abends Streife um den Block fahren, in Nullkommanix im Kaiser’s. Trotz der Bullen hat Avni schon sieben Messerstiche in die Brust gerammt bekommen, und wenn es möglich wäre, würde er sich die Stichwunden eingerahmt an die Wand hängen. Seit der Messerstecherei im Laden haben ihm seine Chefs eine schusssichere Weste umgehängt, und er stolziert durch den Laden wie Ben Hur letzte Weihnachten durchs Fernsehen. Mijas Mutter mag ihn, obwohl er Albaner ist, vor allem mag sie ihn deshalb, weil er so viel isst und immer das Essen vom Vortag verputzt. Sie mag ihn auch, weil er im Gegensatz zu den anderen Freunden ihres Sohnes