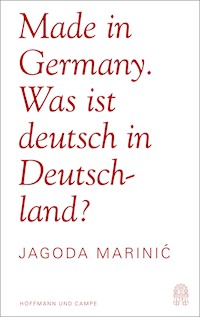16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Klug beobachtet, eisheiss geschlussfolgert. Jagoda Marinić beschreibt unsere Zeit, wie sie sein sollte.« Robert Habeck Die letzten Jahre waren geprägt von einer Aufbruchstimmung und dem Selbstbewusstsein vieler Minderheiten, gesellschaftlichen Wandel vor allem durch laute Töne und harte Forderungen voranbringen zu können. Die einen sahen darin die große Chance, die Machtverhältnisse umzukehren, die anderen eine große Gefahr, eine Art »woke Wutpropaganda«, die das Bestehende zersetzen will. Seit über zehn Jahren engagiert sich Jagoda Marinić für den Aufbau einer diverseren Gesellschaft. In Heidelberg hat sie das Interkulturelle Zentrum Heidelberg mit aufgebaut und das International Welcome Center mit konzipiert. Vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen macht sie nun Vorschläge, wie wir aus dieser Radikalität herauskommen. Wie geht Wandel vor Ort? Was bietet unsere Zeit an Möglichkeiten jenseits von Positionierungen auf Instagramkacheln, wie werden wir Menschen wieder zu handelenden Subjekten, statt uns in den Empörungsspiralen der sozialen Medien zu verlieren? Ausgehend von Begriffen wie »Sehen«, »Identität«, »Streit«, mit denen wir über Gesellschaft sprechen und Prozesse beschreiben, erzählt sie, wie es möglich wurde, ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen und Menschen für ihren Traum zu begeistern – mit sanfter Radikalität. »Das Alleinstellungsmerkmal von Zukunft ist Anders, Veränderung, Neu. Darüber reden können schon nicht viele, es umsetzen noch weniger. Hier nun geht Jagoda Marinić auf ein Date mit Utopie und Realität, schaut mal amüsiert, mal verzweifelt dabei zu, wie Zukunft aus dem Ei schlüpft.« Florence Gaub
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 168
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jagoda Marinić
Sanfte Radikalität
Zwischen Hoffnung und Wandel
Über dieses Buch
Die letzten Jahre waren geprägt von dem Selbstbewusstsein vieler Minderheiten, gesellschaftlichen Wandel vor allem durch laute Töne und harte Forderungen voranbringen zu können. Die einen sahen darin die große Chance, die Machtverhältnisse umzukehren, die anderen eine Art »woke Wutpropaganda«, die das Bestehende zersetzen will. Seit über zehn Jahren engagiert sich Jagoda Marinić für eine diversere Gesellschaft. Vor dem Hintergrund ihrer konkreten Erfahrungen macht sie nun Vorschläge, wie wir aus dieser Radikalität herauskommen. Was können wir jenseits von Positionierungen auf Instagramkacheln tun, um wieder zu handelenden Subjekten zu werden, statt uns in den Empörungsspiralen der sozialen Medien zu verlieren? In ihrem Buch erzählt sie, wie es möglich wurde, ihre Ideen Wirklichkeit werden zu lassen – mit sanfter Radikalität.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Jagoda Marinić, geboren 1977, ist Schriftstellerin, Publizistin, Moderatorin und Podcasterin. Auf »arte« moderiert sie die Sendung »Das Buch meines Lebens«, auf HR2 den Podcast »Freiheit de luxe«. Mit Katrin Eigendorf und Golineh Atai bestreitet sie den Podcast »Brave New World« des ZDF. Darüber hinaus schreibt sie Kolumnen für den »stern«, die »taz« und die »Deutsche Welle«, international publiziert sie in der »New York Times«. Sie studierte Politikwissenschaft, Germanistik und Anglistik und hat danach viel im Ausland gearbeitet, etwa in Kroatien, den USA, Kanada und Rumänien. Heute lebt sie in Heidelberg, wo sie als Kulturmanagerin das Interkulturelle Zentrum aufgebaut hat und seit 2023 die Heidelberger Literaturtage leitet.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60395 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Simone Andjelković
ISBN 978-3-10-492147-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Prolog
Sehen
Identität
Streit
Self-Esteem
Lösungslust
Dank
Bücher
Prolog
Sanfte Radikalität, das ist für mich die Entscheidung, eine Idee oder ein Projekt wirklich in die Welt zu bringen, statt Radikalität nur dafür zu nutzen, jene anzuprangern, die anders denken. Wer Wandel will, muss jene finden und gewinnen, die für eine Sache zu begeistern sind, statt auf Radikales mit derselben Art von Radikalität zu antworten. Das bedeutet nicht, schwächer zu sein, sich übergehen zu lassen, es bedeutet lediglich, dass Zustände, die sich verändern sollen, nicht besser werden können, wenn die Menschen, die sie verbessern wollen, auf dem Weg dorthin ihre Werte und ja, ihre Sanftmut verlieren.
Die letzten fünfzehn Jahre schrieb und arbeitete ich oft zu den Themen Minderheitenrechte, Feminismus, schrieb für einen emanzipatorischen Wandel in einer Gesellschaft, in der die Machtverhältnisse etabliert zu sein schienen. Genau genommen fing ich schon im Studium damit an. Ich entschied mich jedoch nach einigen Jahren dafür, nicht nur durch Vorträge, Bücher und Konferenzen den Blick auf die Welt, in der ich lebe, mitgestalten zu wollen, sondern auch durch Handeln. Mag sein, dahinter steckte der Wunsch, die eigenen Ideen und Utopien auf ihre Umsetzbarkeit und Gegenwartsfähigkeit hin zu prüfen, vielleicht war es auch nur die Naivität, zu glauben, ich könne tatsächlich etwas ausrichten. Ich im Sinne eines jeden Einzelnen. Dieses »etwas bewegen« war nicht einfach, es forderte viele Lernprozesse von mir und den Menschen, mit denen ich arbeiten und Dinge bewegen wollte. Aber mit der Zeit stellte sich heraus, oder zumindest ich musste feststellen, dass Bewegung nicht entsteht, weil man sie laut schreiend fordert, sondern weil man leise, aber beharrlich Erlebnisse und Räume schafft, die das Denken verändern und insbesondere das Vertrauen in die Veränderbarkeit der Umstände, in denen man lebt. Je handlungsfähiger ich und die Menschen, mit denen ich Ideen umsetzen durfte, wurden, desto mehr entfernte ich mich von der diskursiven Radikalität, die heute oft den Ton bestimmt, gerade auch bei vielen meiner Generation, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, die sogenannte Gesellschaft vor allem durch Diskurse, Debatten und Diskussionen wahrnahmen und zu beeinflussen versuchten. Für manche wurde ein Hot Take wichtiger als der Langzeiteffekt ihrer Gedanken und der daraus erwachsenden Handlungen.
Während in den letzten zehn Jahren sowohl von Feministinnen als auch von Menschenrechtskämpferinnen die »Wut« als verändernde Kraft gepriesen und zurückerobert werden sollte, distanzierte ich mich im selben Maße von dieser Emotion, wie es mir gelang, etwas Reales aufzubauen. Wut erschien mir eher wie eine zersetzende Kraft, die vor allem jene frisst, die meinen, man brauche sie, um glaubwürdig auf Unrecht zu reagieren und es anzuprangern. Es kam so, dass einige mir sogar vorwarfen, einfach nicht ausreichende Marginalisierungserfahrungen gemacht zu haben, um Wut verstehen zu können, als bräuchte es die Bereitschaft, Gefühle öffentlich zu Schau zu stellen, um glaubwürdig zu sein. In einer emotionalisierten Gesellschaft wird die Emotion zur Währung, zu dem, was einen vermeintlich authentisch macht, nicht das Argument zählt, sondern vor allem die Emotion.
Wie sehr gerade diese Emotion mir jedoch schadete und mich in die Opferrolle presste, spürte ich schnell. Ich suchte bei Persönlichkeiten, deren Denken und Schreiben mich seit jeher geprägt hatten, und fand nicht zuletzt in einem Interview von Toni Morrison eine Haltung, in der ich mich bestätigt fühlte in meinem Misstrauen gegen die Wutmanie:
Anger … is a paralyzing emotion … you can’t get anything done. People sort of think it’s an interesting, passionate, and igniting feeling – I don’t think it’s any of that – it’s helpless … it’s absence of control – and I need all of my skills, all of the control, all of my powers … and anger doesn’t provide any of that – I have no use for it whatsoever.
Das war es: Ich brauchte meine Klarsicht, um meine Fähigkeiten zusammenzuhalten, um das, was ich als Möglichkeitsraum sah, zu betreten und meine Kritik an Missständen in etwas Konstruktiveres zu verwandeln. Natürlich fand ich viele Momente insbesondere in Fernseh-Interviews, in denen auch Toni Morrison wütend wurde, weil sie etwa rassistische Vorurteile der Interviewer bloßstellen musste, es ging aber nicht darum, die Wut über Missstände nicht zu spüren, sie nie zum Ausdruck zu bringen; es ging nur darum, nicht in das Gefühl der Hilflosigkeit zu verfallen, das dem Wutausbruch meistens vorausgeht und das einem die Kontrolle über die eigene Reaktion nimmt. Kann man Sanftmut als Prinzip wählen, ohne zu nachgiebig zu werden?
Wer Wandel als etwas Prozesshaftes versteht, das Zeit bedarf, das niemand wütend wegschreien kann, weil auch Wut sich im Neuen festsetzt, der versteht, dass die eigenen Gefühle ein Ausgangspunkt sind; wer sich für Aggression entscheidet, setzt die Gewaltspirale fort, in sich und in anderen. Der Wutmodus reproduzierte auch die Gewalt, die man erfahren hat. Er hält einen in der Vergangenheit und ist die schrille Seite einer unerträglichen Ohnmacht. Oft mag diese Wut berechtigt sein, aber durch Lärm und Lautstärke allein wird sie nicht in etwas Neues verwandelt. Diese berechtigte Wut, die ich auch oft spürte, die zugegebenermaßen hilfreicher ist als die apathische Hilflosigkeit, die viele überkommt, wenn sie Ungerechtigkeit sehen, ließe sich durch ein anderes Gefühl in etwas Konstruktives verwandeln, ohne an Kraft zu verlieren: Es wäre eine sanfte Radikalität, die nicht schreien muss, weil sie aus der Gewissheit erwächst, kraftvoll am Wandel zu arbeiten. Die Voraussetzung für diese sanfte Radikalität ist Hoffnung.
Ich hatte mich etwa ab 2012 dafür entschieden, nicht mehr nur zu beschreiben, zu schreiben, zu konferieren und zu diskutieren, sondern Strukturen zu verändern, das Bestehende zu nutzen, um Neues zu schaffen. Wie hoffnungsvoll dieser Schritt war, das erschloss sich mir erst, als ich den Prozess vollzogen hatte, denn anfangs war zugegeben auch bei mir die Wut eine der treibenden Kräfte. Ich hätte es in diesem Wutmodus aber nicht zum Ziel gebracht. Ich musste lernen, die Wut eher als Seismograph zu sehen, eine Art Kontrastmittel, das mit anzeigte, woran gearbeitet werden musste. Erst indem ich lernte, die Wut zu kontrollieren, konnte es so etwas wie ein Marsch durch die Institutionen werden, der für viele Aktivisten heute keine Option mehr zu sein scheint: Die meisten möchten außen vor bleiben, die Institutionen haben vor allem für jüngere Bewegungen wie Fridays for Future ihre Glaubwürdigkeit verloren. Es war ein unerwarteter Wandel, die Letzte Generation nun doch dabei zu erleben, wie ihre Mitglieder für das EU-Parlament kandidierten, statt sich auf die Straßen zu kleben. Warum verzichten viele politisch interessierte junge Menschen darauf, in dieser Demokratie die demokratischen Strukturen von innen heraus zu verändern, sie zu verjüngen und mit ihren Inhalten zu prägen und versuchen stattdessen, von außen mühevoll menschenrechtlichen oder klimafreundlichen Lobbyismus zu betreiben? Die »Wut auf die da oben« wird zum Accessoire für die eigene Aktivismus-Glaubwürdigkeit, denn man ignoriert das Versprechen der Demokratie, das im politischen System der Bundesrepublik Deutschland im Gegensatz zu den USA noch eher gilt, dass jeder versuchen kann, über Parteien am politischen Willensbildungsprozess teilzuhaben.
Mein Umgang mit Wut begann sich mit jenem Moment zu verändern, in dem ich Verantwortung übernahm und spürte, dass sie mir Handlungsmöglichkeiten eröffnet, die Spielräume der Demokratie aufzeigt. Der Einzelne kann immer auch Verantwortung übernehmen, statt anderen nur vorzuwerfen, dass sie die Dinge nicht so tun, wie man es selbst richtig fände. Selten bleibt man dabei lange allein. Verantwortung ist verbindend. Diese Art, das politische System für die Bündelung von Kräften zur Durchsetzung eigener Interessen zu nutzen, findet sich derzeit leider eher bei rechtspopulistischen oder gar rechtsextremen Kräften. Wer also aufgibt, das politische System auch von innen prägen und gestalten zu wollen, überlässt es jenen, die demokratische Strukturen missbrauchen, um demokratische Grundsätze abzuschaffen.
Das Bedürfnis, dieses Buch zu schreiben, entstand in einem langen, ruhigen Sommer, nachdem ich die Verantwortung für das Interkulturelle Zentrum Heidelberg, das ich jahrelang mitaufgebaut hatte, und das International Welcome Center, das ich mitkonzipiert hatte, wieder abgegeben hatte. Es war in diesen Jahren etwas entstanden, das mehr war als mein eigenes Engagement, das eine etablierte Struktur bildete, Räume für Menschen und ihre Themen öffnete. Das Gelingen in der Demokratie kann eine ebenso korrektive Erfahrung sein wie im Persönlichen: Wenn es möglich ist, eigene Ideen umzusetzen, ein integratives Projekt zum Teil von kommunalen Strukturen werden zu lassen, dann ist die Behauptung, struktureller Rassismus sei einfach da und es fehle vor allem der Wille, etwas zu ändern, nicht vollständig. Vielleicht fehlt diskriminierenden Strukturen die Fähigkeit, Neues zu integrieren, vielleicht fehlt aber auch die Bewegung, die konkrete Ideen in die bestehenden Strukturen einbringt und so die Veränderung auslöst, bis schließlich gemeinsam mit anderen Neues entsteht.
Manchmal stößt man ja in solchen ruhigen Sommern auf Menschen und Bücher, die man zum jetzigen Zeitpunkt braucht und die man erst in diesem Moment verstehen lernt, obwohl man schon jahrelang von diesen Menschen und ihrem Wirken gehört hat. In diesen Momenten findet man sie – oder sie einen. Für mich war in diesem Sommer Jane Goodall dieser Mensch und das Buch ein Interviewband mit ihr: HOPE. Ich las die Interviews mit ihr, und mit jeder Seite verstand ich, wie ihre Art zu denken in den letzten Jahren mein Handeln geprägt hat, ich es aber kaum öffentlich artikuliert hatte, weil in den deutschen Diskussionen die Hoffnung und ihre Wirkmacht zu selten vorkommt, weil jene mit Aufmerksamkeit belohnt wurden, die wütend, kampflustig und vorwurfsvoll waren. Wer über Einwanderung redet, über Feminismus, über Wandel ist diskursiv meist damit beschäftigt, die Scherben der Debatten der letzten Jahrzehnte aufzuräumen, natürlich lässt das wenig Raum für das Konstruktive. Mir wurde klar, dass ich mich auch deshalb ans Tun gehalten hatte, weil Deutschland in der Praxis oft viel weiter ist als diskursiv. Jane Goodalls Ansichten über Hoffnung, über das Betrachten der Natur zeigten mir, wie viele Menschen auch bei uns genau das praktizieren, ohne dass sie es öffentlich zur Sprache zu bringen wüssten.
Das präzise Hinhören, der Wunsch, Lebenswirklichkeiten für andere zu verbessern, das alles findet in der erschöpfenden Gleichförmigkeit des alltäglichen Tuns kaum Platz und wird überlagert von »Kulturkämpfen«. Die Diskussionen sind voller Aggressionen, weil angeblich vor allem rechte Kräfte bekämpft werden müssen. In diesem Kampf gegen sie reproduziert man jedoch vor allem ihre Ideologien und macht sie zur Diskussionsgrundlage, all das Scheinwerferlicht liegt auf der Zersetzungswut. Die gesellschaftliche Mitte hat sich jahrzehntelang vor allem Angstnarrative servieren lassen, die in Krisenzeiten wie diesen mit Leichtigkeit abzurufen sind. Das Gelingen wurde überlagert von den Kulturkämpfen auf der einen Seite, der Negation der Kulturkämpfe auf der anderen Seite und dem Angstschüren auf beiden Seiten.
Als ich Jane Goodalls Buch in den Händen hielt, Absatz für Absatz in die Ruhe ihrer Gedanken einstieg, spürte ich zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit, wie sehr diese Art, die Welt zu betrachten, Hoffnung als Grundsatz von allem zu sehen, meine letzten zehn Jahre geprägt haben. Es wäre vieles anders gewesen, wenn ich nicht diese Hoffnung gehabt hätte, dass sich das Zurückstellen vieler für mich wichtiger Tätigkeiten wie das Schreiben lohnt, wäre da nicht die Hoffnung gewesen, mit dem eigenen Handeln etwas ausrichten zu können, was das Zusammenleben zumindest auf dem kleinen Raum, den ich mitprägen darf, für eine Weile verbessert, statt nur am Status Quo neurotisch festzuhalten und ihn wortstark anzuprangern. Ein Haus der Kulturen aufzubauen, jahrelang für Vorträge durch die Republik zu reisen, durch Europa, in die USA, um darüber zu diskutieren, wie man in Deutschland demokratischen Wandel gestalten könnte, wie Einwanderung auch in Deutschland eine Geschichte werden könnte, die zu uns gehört, statt aufgedrückt zu sein. Je besser man von Einwanderung erzählt, desto mehr wird diese Erzählung dazu beitragen, dass Menschen sich in Deutschland beheimaten und sich einbringen, dieses Land lebenswerter zu machen.
Ich hatte aus Hoffnung gehandelt, ein Wort, das hier in Deutschland gerne mit Naivität belegt wird, das gerne dem enthusiastischen anglosächsischen Raum überlassen wird, wo es dann wiederum von hier aus euphorisch beklatscht wird. Selbst wenn ich nach zehn Jahren Wandel eine Erschöpfung spüre, weil einerseits das Interkulturelle Zentrum nun fester Bestandteil einer Stadtgesellschaft geworden ist und viele Menschen mit ihrer Selbstwirksamkeit in Verbindung brachte, die ihre Inhalte vertreten, sieht jeder gleichzeitig in Europa und weltweit autoritäre Kräfte alles in Frage stellen, was ich im europäischen Mikrokosmos, das dieses Haus war, zehn Jahre erfolgreich aufbauen durfte: ein friedliches, tolerantes Zusammenleben in Verschiedenheit, natürlich über Europa hinaus.
Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, marschierten Hunderttausende von Bürgerinnen und Bürgern durch Deutschland und setzen ein Zeichen gegen rechts. Demonstrationen in München und Hamburg müssen aufgelöst werden, weil mehr Demonstranten erscheinen, als geplant war. Vor dem Reichstag in Berlin stehen Menschen im Lichtermeer und verteidigen die demokratische Gesellschaft, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aufgebaut wurde. Für viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte ist dieses Signal eines, auf das wir lange gewartet haben, niemand weiß bisher, mit welcher Strategie der Rechtsruck aufgehalten werden kann, zumal er global ist. Doch die Massendemonstrationen sind ein Signal an die Politik, immer mehr Bürgerinnen und Bürger sind nicht länger bereit, dabei zuzusehen, wie demokratische Grundwerte zur Disposition gestellt werden. Aus diesem Protest kann Wehrhaftigkeit erwachsen.
Nun wenden kritische Stimmen nicht zu Unrecht ein, mit Demonstrationen sei das Gedankengut längst nicht aus der Welt geschafft, und wenn es schließlich darum geht, die Werte, für die man eindrucksvoll demonstriert, im Kleinen für die Demokratie zu erkämpfen und Strukturen aufzubauen, so werden die Bundesbürger im Alltag wieder alleine gelassen, insbesondere im ländlichen Raum oder in strukturschwachen Regionen. Noch während ich dieses Buch schreibe, wählen viele Menschen in Europa bei den Europawahlen rechts oder gar rechtsaußen. Die Aufbruchstimmung hat nicht lange gehalten, viele Europäer meinen, selbst rechtsextreme Parteien seien besser als das Weiter-So. Antidemokratische Bewegungen werden zum Hoffnungsort für die Hoffnungslosen, was an sich schon eine Geschichte der Verzweiflung in Demokratien ist.
Auch gegen dieses Gefühl der Ohnmacht schreibe ich dieses Buch. Für die Tage nach den selbstvergewissernden Demonstrationen, in denen es darum geht, die gezeigte Haltung in demokratische Realität zu verwandeln: Es ist höchste Zeit, die bestehenden Strukturen wieder für mehr Demokratie zu nutzen, zu lernen, dass wir in Diskussionen nur einen kleinen Teil leisten können, der jedoch ohne das hoffnungsvolle Handeln verpuffen wird, weil antidemokratische Kräfte eine konzertierte Zusammenarbeit an den Tag legen, die mehr als die Machtübernahme zum Ziel hat, sondern die Macht missbrauchen will, um demokratische Strukturen auszuhöhlen. Wie gelingt in diesen Zeiten nicht nur der Erhalt des Gestern, sondern doch noch ein Wandel in eine Zukunft, die es mehr Menschen ermöglicht, am demokratischen Prozess teilzuhaben? Ich möchte die Erfahrungen, die ich machen konnte, teilen, die Zweifel beschreiben, die Frustrationen, aber auch das, was man lernen kann in solchen Auseinandersetzungen und wie man beharrlich bleibt, bis der Wandel einsetzt.
In Jane Goodalls Buch sitzt sie in einer Szene mit ihrem Interviewer in ihrem Garten, und er fragt sie, ob sie nicht auch die Hoffnung verliere, wenn sie sieht, wie Konzerne Natur aufkaufen, teure Immobilien und Supermärkte bauen. Jane Goodall beschreibt den Schmerz, den sie spürt, wenn sie Natur verschwinden sieht, überlegt kurz und wendet sich dann dem Möglichen zu: Neben dem neuen Bau ist ein Stück Natur, das sie noch retten könne, für das sie noch kämpfen könne, bevor sie in Verzweiflung verfällt. Weil sie den Raubbau nicht verhindern konnte, überlegt sie sich, wie sie das Stück Natur, das noch geblieben ist, retten könnte.
Erschöpfung stellt sich ein, wenn sich der Blick auf das richtet, was nicht gelungen ist, statt auf die nächsten Möglichkeiten, etwas Sinnvolles zu tun. So wie ich zunächst erschöpft war, als ich dachte, zehn Jahre etwas aufgebaut zu haben, nur damit rechte Kräfte jetzt auf die Idee kommen könnten, das wieder rückabzuwickeln, die Wut der Menschen für ihre rechten Unphantasien zu missbrauchen. Meine Hoffnung war anfangs, Nachahmer zu finden, die in verschiedenen Städten demokratische Räume schaffen, die Menschen Mut machen. Hoffnung ist es auch, die mich dazu bringt, nun darüber zu schreiben, was ich in diesen zehn Jahren des Aufbaus gelernt habe, weshalb ein Rückschluss aus dieser Zeit ist, Diskussionen nicht zu überschätzen; auch wenn sie eines der Austragungsinstrumente der Demokratie sind, werden sie nur einen kleinen Teil der Probleme lösen. Was es jetzt braucht ist die Bereitschaft, sich einzubringen, aus dem Gespräch ins Handeln zu gehen.
In einer funktionierenden Demokratie wird dabei niemals der Radikalste Erfolg haben. Wer in einer Demokratie seine Vorstellungen auf dem Marktplatz der Ideen durchsetzen möchte, muss lernen, seine Ideen für möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zugänglich zu machen. Das gelingt nicht, indem ich andere anschreie oder ihnen ein schlechtes Gewissen mache, es gelingt nicht rein pädagogisch und schon gar nicht dogmatisch. Es ist ein Lernprozess, in dem ich die Idee nie aus den Augen verliere und doch immer neue Mittel finde und neue Wege, Demokratie zu verstehen und zu leben. Ich wurde sanfter auf diesem Weg, aber meine Vorstellungen von einer gerechteren Gesellschaft nicht weniger radikal.
Ich möchte in diesem Buch erzählen, wie es möglich wurde, meine Ideen Wirklichkeit werden zu lassen, wie ich Menschen für meinen Traum begeistern lernte, aber auch lernte, mit ihnen neu zu träumen. Ich habe in diesem Jahr viel über die Konflikte unserer Gesellschaft gelernt, über Machtverhältnisse, Bürokratie und über strukturellen Rassismus, auch über die Schwächen jener, die meinen, eine gute und gerechte Agenda zu verfolgen. Wenn es diesem Buch gelingt, einigen seiner Leserinnen und Lesern den Schritt weg von der Wut oder der aktivistischen Hybris zum hoffnungsvollen Handeln hin zu ermöglichen, hat es einige meiner Hoffnungen erfüllt.