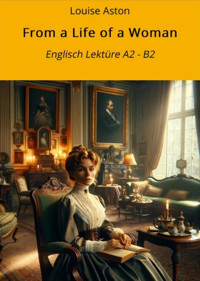Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In ihrem Roman "Revolution und Contrerevolution" dokumentiert Louise Aston die revolutionären Umbrüche von 1848 und entwickelt mit dem Porträt ihrer Protagonistin Alice von Rosen die Utopie vom selbstbestimmten Leben einer Frau, die bürgerliche, demokratische Rechte einfordert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Revolution und Contrerevolution
Louise Aston
Inhalt:
Louise Aston – Biografie und Bibliografie
Revolution und Contrerevolution
Erstes Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
Zweites Buch
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Drittes Buch
I
II
III
IV
V
Revolution und Contrerevolution, L. Aston
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849604271
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Vladislav Gansovsky - Fotolia.com
Louise Aston – Biografie und Bibliografie
Deutsche Schriftstellerin, geboren am 26. November 1814 in Gröningen, verstorben am 21. Dezember 1871 in Wangen im Allgäu. Tochter eines Geistlichen im Halberstädtschen, heiratete im 19. Jahre Samuel A., Engländer von Geburt u. Besitzer einer Maschinenfabrik in Magdeburg. Ihre damals als eigentümlich angesehenen Ansichten von der Stellung der Frauen in der sozialen Welt hatten die Scheidung ihrer Ehe zur Folge. Gleichwohl heiratete sie A. nach 2 Jahren wieder, trennte sich aber auch ebenso bald wieder von ihm. Sie lebte darauf erst in mehreren kleinen Anhaltschen Orten, dann in Berlin, u. betrug sich hier ganz als Mann; im März 1846 wurde sie aus Berlin verwiesen. Nachdem ihr Scheidungsprozess mit ihrem Ehemanne Ende 1847 zu ihren Ungunsten entschieden war und sie sich 1848 in den Kreisen der Männer des freien Geistes bewegt hatte, ging sie 1848 nach Schleswig-Holstein, um die Verwundeten zu pflegen. Nach ihrer Rückkehr von dort ging sie Ende 1848 auf kurze Zeit nach Hamburg u. verheiratete sich 1851 von Neuem in Bremen. Sie schrieb: Wilde Rosen (Gedichte), Berlin 1846; Meine Emanzipation, Verweisung u. Rechtfertigung, Brüssel 1846; Freischärler-Reminiszenzen (Gedichte), Leipzig 1849; die Romane: Aus dem Leben einer Frau, Hamburg 1847; Lydia, Magdeburg 1848; Revolution u. Contrerevolution, Mannheim 1849.
Wichtige Werke:
1846: Wilde Rosen1846: Meine Emanzipation, Verweisung und Rechtfertigung1847: Aus dem Leben einer Frau1848: Lydia1849: Revolution und Contrerevolution1850: FreischärlerreminiszenzenRevolution und Contrerevolution
Vorrede
Die folgenden Blätter führen dem Leser Skizzen aus dem Revolutionsdrama des Jahres 1848 vor. Ich übergebe sie der Oeffentlichkeit, weil dadurch vielleicht hie und da eine kleine Lücke in dem Intriguennetz der Contrerevolution ausgefüllt wird, die es selbst manchem Politiker von Profession unmöglich machte, den rothen Faden, der sich durch das scheinbare Gewirre der revolutionairen und reactionairen Bewegungen unsrer Zeit hinzieht, überall zu folgen. In Rücksicht auf die poetische Darstellung mag statt jeder Entschuldigung für deren Mangelhaftigkeit daran erinnert werden, daß es leicht ist, Romane zu schreiben, wenn der Zeitgeist vor Langerweile den Griffel aus der Hand fallen läßt, mit dem er die Tafeln der Weltgeschichte beschreibt, – sehr schwer aber, wenn er, in den Strudel der gewaltigen Thaten hineingerissen, die Geschichte selber aber in ein romantisches, oft sogar märchenhaftes Gewand zu kleiden gezwungen wird.
Je märchenhafter unser heutiges politisches Leben ist, desto weniger bedarf die Darstellung desselben einer Ausschmückung. Ein Vortheil für meinen Leser, wie für mich selbst.
Bremen, den 1. Juni.
Die Verfasserin.
Erstes Buch
I
Ein milder und sonnenheller Frühlingshimmel blickte zum ersten Male wieder nach dem an Stürmen mancherlei Art so reichen, unfreundlichen Februarmonat auf die Kaiserstadt Wien nieder und lockte Jung und Alt vor die Thore hinaus in die langen, schnurgeraden Alleen, welche die breiten Plätze und Anlagen zwischen der inneren Stadt und den Vorstädten durchschneiden. Es war der fünfte März 1848. Wer hätte es – nach der unbefangenen und sorglosen Miene dieser rasch durch einander wandelnden Gruppen von Spaziergängern, damals zu schließen gewagt, daß Wien, berühmt durch seine ans Patriarchenthum erinnernde Pietät, mit der es an dem Kaiserhause hing, auf einem Krater der Revolution stand, der in wenig Tagen seinen Schlund öffnen werde, um das Kaiserhaus nebst Pietät, und anderen Sentimentalitäten – fast zu verschlingen. Fast – dieses »Fast« ist der Fluch unsrer Zeit, das Haar, an dem der Teufel der Reaktion das betrogene Volk festhält, um es bald wieder ganz beim Schopf zu fassen und in das alte Joch der Knechtschaft zu spannen. – Auch in Preußen ist ein solches unseliges »Fast« die Mutter einer eklatanten Contrerevolution geworden. – Doch am fünften März waren die guten Wiener freilich noch nicht so klug, denn sie wußten noch gar nicht, was eine Revolution zu bedeuten habe. Vielleicht thue ich jedoch den gemüthlichen Wienern Unrecht; vielleicht gab es doch Manche unter ihnen, die den im Westen ausgebrochenen Sturm mit ungeheurer Eile seinen Weg nach Osten fortsetzen sahen, und sogar die Minute berechneten, in der er die schöne Kaiserstadt erreicht haben würde.
Unter den Spaziergängern, welche die den Exerzierplatz durchschneidende jetzt noch blätterlose Allee hinabschritten, würde des Lesers Aufmerksamkeit besonders von einer Gruppe erregt worden sein, die ich deßhalb, weil das von ihnen geführte Gespräch zum Verständniß unsrer Erzählung nothwendig ist, kurz skizziren will. Sie bestand aus drei Personen, die eine davon, – dem runden, breitkrämpigen Hut, so wie der schwarzen, eigenthümlich geschnittenen Kleidung nach zu urtheilen, ein katholischer Priester – war ein Mann von etwa vierzig und einigen Jahren. Aus seinem magern, aber starkknochigen und bleichen Gesicht, dessen Muskeln selbst beim Sprechen in unveränderter Ruhe blieben, traten als Hauptzüge vorzüglich eine große Entschiedenheit neben eben so großer Besonnenheit hervor. Das Haar, welches unter der breiten Krämpe seines schwarzen Rundhutes schlicht herabfiel, war schwarz und von großer Feinheit. Der Schnitt seiner edelgeformten Nase ließ auf eine sehr ernste Stirn schließen, die jetzt großentheils ebenfalls vom Hute überschattet wurde. Am charakteristischsten aber waren die tiefliegenden schwarzen Augen, in denen sich eine fast unnatürliche Mischung von Leidenschaft und Kälte, Schärfe und Sanftheit, List und Gutmüthigkeit abspiegelten. Fügen wir noch hinzu, daß der Mann, wir wollen ihn Pater Angelicus nennen, beim Gehen eine etwas gebückte Haltung hatte, so weiß der Leser von dem äußern Erscheinen desselben, – und weiter wissen wir jetzt selbst nichts von ihm – genug.
Die beiden Begleiterinnen des frommen Herru zeigten dem Anscheine nach ein sehr verschiedenes Interesse an dem Gespräch. Denn während die Aeltere – eine junge Frau von etwa 27-30 Jahren – mit gespannter Aufmerksamkeit den mit einer absichtlich tonlos gehaltenen Stimme gesprochenen Worten lauschte, schritt ihre jüngere Begleiterin mit theilnahmloser Miene und, ob aus Zerstreutheit oder Gleichgültigkeit, war schwer zu entscheiden, zu Boden geschlagenen Augen neben ihnen her. Ueberhaupt war nicht leicht ein größerer Unterschied zwischen zwei Freundinnen zu finden. Beide hatten ein schönes dunkelbraunes Haar und tiefblaue Augen, aber das Haar Alicens umschattete mit seinen tausend wallenden Löckchen eine erhabene, freie Stirn, während das ihrer Freundin Lydia glatt und gescheitelt die Schläfe bedeckte. Beide waren von anziehender Schönheit, aber wie verschieden war der Typus der Schönheit Alicens von der Lydias. Jene leuchtend, intelligent, fast ritterlich stolz um sich blickend –: der Charakter eines seines eigenen Werthes bewußten und in diesem Bewußtsein starken Weibes; diese verschleiert, in sich zurückgezogen, von beinahe melancholischer Bescheidenheit – der Charakter eines nur in seiner innern – vielleicht vereinsamten – Welt hinein lebenden Mädchens. – Und doch umschlang diese beiden Frauen ein Band unzerstörbarer Freundschaft, geknüpft durch gemeinsame Erfahrungen, durch gemeinsamen Schmerz. Es war ein Band, dessen Knoten unter dem Deckel eines Sarges verborgen war, das Herz eines Mannes, den sie beide einst glühend geliebt – Alice bis zur Verachtung der Männer, Lydia bis zum Wahnsinn.
»Jetzt habe ich Ihnen Alles mitgetheilt« – fuhr der Pater nach einer Pause sein Gespräch wieder aufnehmend fort – »Alles wenigstens, was Ihnen zu wissen nöthig. Hier sind die beiden Briefe. Diesen hier geben Sie in dem ersten Städtchen jenseits der Grenze auf die Post, – den zweiten an den Probst Bergmann müssen Sie bis nach Berlin mitnehmen und dort eigenhändig Seiner Hochwürden überreichen. – Wann werden Sie reisen?« –
»Wenn es nothwendig ist, noch heute Abend – doch wie? dieser Brief lautet, wie ich sehe, an die Herzogin von Nagas –«
Ein lautes Gelächter schien zu dieser mit unendlichem Muthwillen accentuirten Frage einen Commentar zu liefern, dessen Sprache dem gelehrten Pater jedoch völlig fremd war. Indessen verschmähte er es, sich durch eine Frage darüber aufzuklären, sondern wiederholte nur, indem er Anstalt machte, von seinen Begleiterinnen Abschied zu nehmen, noch einmal die Worte Alicens: »Also noch heute Abend.«
»Wenn es nothwendig ist, habe ich gesagt. Und dann, ich besinne mich eben, – nein, heute Abend geht es nicht, aber morgen früh bestimmt.« Eine kleine Falte legte sich bei diesen Worten Alicens zwischen die dunkeln Augenbrauen des Paters. Nach einer Pause sagte er, einen kurzen aber forschenden Blick auf das Gesicht seiner schönen Begleiterin werfend:
»Verzeihen Sie meine Indiscretion – aber bei den großen Ereignissen, denen wir in kurzer Zeit entgegen gehen, müssen dergleichen kleinliche Bedenken wichtigeren Motiven nachstehen – Sie haben heute Abend um 9 Uhr ein Rendez-vous verabredet. Darf ich fragen, mit wem?«
Die flüchtige Röthe, welche Alicens Wangen bei Erwähnung des Rendez-vous bedeckte und welche mehr durch Ueberraschung über die Mitwissenschaft des Paters, als durch die Verlegenheit, in welche sie etwa hätte gesetzt werden können, hervorgerufen schien, machte bald ihrer gewöhnlichen, halb schalkhaften, halb schwermüthigen Miene Platz, als sie mit dem natürlichsten Tone der Welt erwiederte:
»Glauben Sie, daß ich conspirire, Pater?«
»Ich habe das nicht gesagt. Indessen liegt darin nichts Unwahrscheinliches. Sie wollen mich also in dies Geheimniß nicht einweihen?«
»Du lieber Himmel – – das große Geheimniß, was zwischen der liebenswürdigen Alice und dem ebenso liebenswürdigen Fürsten Lizinsky verhandelt werden könnte.«
Der Name Lizinsky brachte eine ebenso plötzliche als gewaltige Veränderung in dem Antlitz des Paters hervor. Sein früher bleiches Gesicht verlor alle noch übrige Farbe. Seine bisher marmornen Züge wurden plötzlich beweglich, als zuckten in seinem Innern Blitze, deren Widerschein in ihnen abglänzte. – Doch bedurfte dieser gegen Aufregungen aller Art abgehärtete Mann nur eine kurze Minute, um über die Gewalt der Leidenschaften, welche jener Name in ihm entfesselt, vollständig Herr zu werden. Nur einige Schweißtropfen, welche auf seiner Stirne perlten, ließen die Größe des innern Kampfes ahnen.
»Also der Fürst – Lizinsky ist hier?« – sprach er mit der ihm eigenthümlichen Ruhe in Ton und Geberde.
»Und was finden Sie Auffallendes darin, daß Lizinsky in Wien ist?« fragte Alice, die sich die ungeheure Aufregung, in die ihr geistlicher Freund durch jenen Namen versetzt wurde, gar nicht erklären konnte. – »Steht etwa der Fürst bei Ihnen ebenfalls in dem Verdachte, daß er conspirire – – vielleicht mit mir conspirire?« – setzte sie laut lachend hinzu.
Der Pater blickte sich besorgt um. Es war Niemand in der Nähe, der die letzten Worte hätte hören können.
»Sprechen Sie nicht so laut. Sie wissen noch nicht, was zuweilen an einem Namen hängt, doch das ist jetzt Nebensache.«
Es trat eine Pause ein, in welcher der Pater über das nachzudenken schien, was er in Folge der eben gemachten Entdeckung gegen Alice beobachten müsse. Noch war er zweifelhaft, ob Alice wüßte, daß eine Beziehung zwischen dem Fürsten Lizinsky und der Herzogin von Nagas existire. Wüßte sie hievon Nichts, so wäre es vielleicht besser, darüber zu schweigen, wenn nicht die Möglichkeit zu nahe lag, daß dem Fürsten bei dem heutigen Rendez-vous der Brief an die Herzogin zufällig in die Augen fallen könnte. Er hätte den Brief zurückfordern können, allein dies würde Alicen jedenfalls aufmerksam gemacht und sie vielleicht zur unmittelbaren Entdeckung geführt haben. Auch hatte sie ja die Adresse bereits gelesen und konnte sich durch eine einzige Frage an den Fürsten völlig darüber aufklären. Dies aber mußte unter jeder Bedingung verhindert werden. Andrerseits aber schien Alice in der That etwas davon zu wissen. Wenigstens sprach für diese Vermuthung der Umstand, daß das Lesen der Adresse an die Herzogin sie zugleich an das auf heute Abend mit dem Fürsten verabredete Rendez-vous erinnerte. – Des Paters Entschluß war gefaßt.
»Sie kennen« – sprach er mit so leiser Stimme, daß Lydia, auch wenn sie, statt ihrer völligen Indifferenz, dem Gespräche die gespannteste Aufmerksamkeit gewidmet hätte, keinen Laut davon vernahm – »Sie kennen das Verhältniß, welches zwischen dem Fürsten und der Herzogin besteht?«
»Besteht? – bestand wollen Sie sagen, frommer Vater –« erwiederte sie mit schelmischer Miene.
Der Pater sah sie mit großen Augen an. Darauf schüttelte er unter ironischem Lächeln den Kopf: »Sie dürften sich diesmal im Irrthum befinden, theuerste Freundin. Die Bande, welche den Fürsten an jene Frau fesseln, sind nicht Ketten von Rosen und Vergißmeinnicht, sondern von Perlen und Diamanten.«
»Sie sind heute nicht galant gegen mich, Pater. Indeß Vertrauen um Vertrauen. Sie gehen mit einem Plane in Betreff Lizinskys um. Doch! Doch! Mich überzeugt Ihre verwunderte Miene nicht vom Gegentheil. Also wir sind in gleichem Falle. Auch ich habe meinen Plan. Tauschen wir unsre Geheimnisse aus. Die Frucht unsrer Aufrichtigkeit kann möglicherweise ein Bündniß auf Leben und Tod werden.«
»Auf Leben und Tod« – wiederholte langsam der Pater, indem er einen Finger auf's Kinn legte, was er immer that, wenn er zu einem wichtigen Entschlusse kommen wollte. –
»Wohl, es sei, doch unter einer Bedingung, daß ich, versteht sich – unsichtbarer – Zeuge des Gesprächs bin, welches sie heute Abend mit ihm führen werden.«
»Gut, daß Sie schon vorhin Ihre Indiscretion befürwortet haben. Ein frommer Diener der Kirche Zeuge eines Rendez-vous zweier zärtlich Liebenden. Das Verlangen ist wenigstens originell. Ich willige ein.«
Der Pater drückte ihr die Hand. »Was meinen Plan oder vielmehr den der Kirche betrifft – denn ich handle hier nur als Diener der Kirche – so beschränkt sich derselbe darauf, das unsittliche und fast unnatürliche Verhältniß zwischen den beiden vorhin erwähnten Personen aufzulösen.«
»Und zu welchem Zwecke wird dieser Plan verfolgt?«
Der Pater lächelte: »Das geht über unsre Verabredung hinaus.«
»Es ist wahr. Indessen liegt der Schlüssel neben dem Räthsel. Die Herzogin ist über die Funfzig hinaus, kinderlos und Besitzerin eines ungeheuern Vermögens, das sie, im Falle kein Fremder darauf Anspruch macht, nicht abgeneigt ist, zu milden Stiftungen zu verwenden. Habe ich richtig gerathen, mein frommer Freund?«
»In der That, Sie sind der Wahrheit ziemlich nahe gekommen. Doch nun zu Ihrem Plane.«
»Ha, das ist etwas ganz Anderes, tief angelegt, künstlich construirt, von unberechenbaren Folgen – kurz ein Riesenwerk.«
»Wenns gelingt« – sagte halb zweifelnd, halb spöttisch der Pater. Die stolze Gestalt Alicens richtete sich noch höher auf, als sie mit dem Lächeln des Triumpfs auf den Lippen und einer unnachahmbar graziös gebieterischen Handbewegung erwiederte:
»Es wird gelingen. – Hören Sie mich an, Pater. Sie kennen mich noch nicht, darum will ich mich Ihnen so zeigen, wie ich bin. Wir haben beide ein Geheimniß, wir sind bereit, eins gegen das andere auszutauschen; ich weiß wohl, daß im Falle des Verrathes meinerseits mein Leben keinen Papierschnitzel werth ist. – Unterbrechen Sie mich nicht, genug, ich weiß es und sage es nur deshalb, weil ich mit Ihnen in demselben Falle mich befinde. Sie sind eine Macht, eine ungeheure Macht: sie heißt die allein seligmachende Kirche. Wohlan, auch ich bin eine Macht, ein Weib, schutz-und hülflos, wie ich hier neben Ihnen herschreite, wage ohne Bangigkeit den Kampf mit Ihrer allein seligmachenden Kirche aufzunehmen. – Diese Macht heißt: Aristokratie und Proletariat. Haben Sie mich verstanden, frommer Vater?«
Der Pater war nachdenklich geworden. Nach einer Pause sagte er: »Fahren Sie fort!«
»Sie haben mich also verstanden?«
»Wozu die Frage? Ich habe Sie verstanden!«
»Und Sie wollen noch wissen, was mein Plan mit dem Fürsten Lizinsky ist? –« sagte Alice mit einer gewissen spöttischen Verachtung in Ton und Blick. »Gehen Sie, ich habe Ihnen mehr Talent in der höhern Intrigue zugetraut. – Leben Sie wohl!« Alice nahm den Arm Lydiens und entfernte sich mit ihr schnell durch eine Nebenstraße, während der Pater, ihr nachsehend, die Worte vor sich hinmurmelte:
»Dieses Weib müssen wir gewinnen oder – vernichten.« Er hüllte sich in seinen langen schwarzen Mantel und verlor sich in der Menge.
II
Wir hatten den frommen Vater Angelicus in der Altstadt verlassen, wo er in den dichten Haufen, welche die Quais der Donau sich hinabwälzten, unsren Augen entschwunden war. Wir finden ihn bald darauf jenseits des Flusses, in der Leopoldstadt wieder, wie er mit langen Schritten, die, obgleich keinesweges den Schein von Eile verrathend, ihren Besitzer doch sehr schnell weiter beförderten, auf den Gasthof zum »goldenen Lamm« zusteuerte. Hier angekommen, fragte er den Portier, ob kein Brief für ihn abgegeben sei.
»Nein, ehrwürdiger Herr« – erwiederte dieser, respektvoll die goldbetreßte Kappe ziehend. –
»Hat auch Niemand in meiner Abwesenheit nach mir gefragt?« Der Pater schien mit der Antwort auf diese Frage, die ebenfalls verneinend ausfiel, unzufrieden und wollte sich eben nach seinem Zimmer begeben, als des Portiers Zuruf ihn zur Rückkehr bewegte. »Eines habe ich vergessen, ehrwürdiger Herr; aber es ist auch kaum der Rede werth. Es war allerdings Jemand hier, der nach Ihnen fragte; aber da es ein zerlumpter junger Bursche war, der wahrscheinlich nur betteln –
»Gerade den erwartete ich« – unterbrach der Pater den verblüfften Thürsteher. – »Ich bin,« sagte er, seinen Fehler bemerkend mit salbungsvollem Ton hinzu, »für die Hungrigen und Entblößten immer zu Hause. Ihr habt Unrecht gethan, ihn hart fort zu weisen.«
»O, habe ich gesagt, daß ich ihn hart fort gewiesen? Nein, ehrwürdiger Herr, das sei ferne von mir. Ich glaube übrigens, daß er nicht weit sein wird, denn solch Lumpengesindel lungert überall umher.«
Der Pater warf einen strafenden Blick auf den menschenfreundlichen Thürsteher, der diesen zum Schweigen brachte und befahl, ihm den armen Knaben sofort zuzuführen, sobald er sich zeigen werde.
Brummend und kopfschüttelnd kehrte der Portier wieder in seine Klause zurück und war eben im Begriff, sich dem vorhin unterbrochenen Schlummer von Neuem hinzugeben, als ihn ein Klopfen am Fenster seiner Bude abermals störte.
»Ach, da bist Du ja wieder, Du kleiner schwarzer Taugenichts« – fuhr er auf – »hast wohl schon gewittert, daß Se. Ehrwürden zurückgekehrt ist, he?«
Der Angeredete war ein Knabe von etwa 15 Jahren. Sein wunderlich finsteres Aussehen und der frühreife Ernst in seinen dunkeln braunen Zügen mußte einen – man wußte nicht ob anziehenden oder abstoßenden – Eindruck auf Jeden, der ihn zum ersten Male sah, machen. Sein langes rabenschwarzes Haar fiel in vollen und glänzenden Locken auf den braunen Hals und Schultern herab, die von einem zerrissenen Hemdkragen nur schlecht verhüllt wurden. Seine übrige Kleidung war sonst fragmentarisch: ein Paar faltige, weiße, weite Beinkleider von grober Leinwand und eine abgetragene blaue Sammetjacke mit kurzen Schößen und blanken Messingknöpfen. In je schlechterem Zustande sich diese Stücke befanden, um so mehr stach davon eine rothseidene Schärpe ab, welche der Knabe sich um den Leib gewunden und deren mit goldenen Franzen besetzte Enden kokett über die linke Hüfte herabhingen. Ein italienischer Strohhut, den er in diesem Augenblicke in der Hand hielt und ein Paar Schnürstiefeln, die noch in passablem Zustand waren, vollendeten die Toilette des Knaben.
»Pater Angelicus ist zu Hause?« – fragte er mit dem Accent eines Südländers, ohne die Höflichkeiten des Portiers eines Wortes zu würdigen. – »Welche Nummer?«
»Nummer 21, vorn heraus, eine Treppe« – brummte der Portier.
Mit einigen raschen Sprüngen eilte er die Treppe hinauf und öffnete, ohne anzuklopfen, mit geräuschloser Hand die Thür und verschloß sie in derselben Weise. Darauf ging er langsamen Schrittes auf den Pater zu, welcher, an einem eleganten Büreau sitzend und mit Schreiben beschäftigt, entweder das Eintreten des Knaben gar nicht gehört hatte, oder, mit seiner Weise schon bekannt, sich darüber nicht verwunderte.
»Buen tio« – sagte der Knabe, indem er sich mit einem Knie auf den Teppich an der Seite des Paters niederließ und einen Kuß auf dessen Hand drückte. Pater Angelicus wandte seinen Kopf und sah mit einem Blick leidenschaftlicher Zuneigung auf das schwarzlockige Haupt in seinem Schooße herab.
»Bist Du endlich gekommen, Salvador! – – Was macht Inés, Deine Mutter? Hat sie mir nicht geschrieben?« –
Salvador richtete sich empor und griff in seine Schärpe. Aus den Falten der rechten Seite zog er einen zierlichen Brief.
»Allá, Sennor« – sagte er, dem Pater den Brief überreichend. Dieser beschaute mit der größten Sorgfalt das Siegel, dessen Wappen aus zwei Rosen bestand, darüber eine Grafenkrone, darunter die Worte: El no tiene fortuna ni go tampoco1. Er lächelte bitter, als er diese Worte las und erbrach darauf den Brief. –
»Gut« – sagte er mit zufriedener Miene – »Wann wird die Sennora hier eintreffen, Salvador?« –
»Noch heute Abend« – erwiederte der Knabe in seiner Muttersprache, obwohl er deutsch verstand und sprach, so bediente er sich desselben doch nur im Nothfalle.
»Und sie ist wohl, mein Sohn, nicht wahr?« – fragte der Pater, jetzt ebenfalls spanisch redend, mit einer an Zärtlichkeit grenzenden Milde. – »Este corazon orgulloso no se puede rompes2,« erwiederte Salvador mit zitternder Stimme, indem sich seine Augen senkten. »O tio« – fuhr er fort, indem plötzlich seine schlanke Gestalt sich aufrichtete und sein Nacken die schwarzen Locken zurückwarf – »Ich bin stolz auf meine Mutter. Wann aber wird der Tag kommen, wo die stolze Inés sagen kann: Ich bin stolz auf meinen Sohn« – Seine Augen sprühten ein vulkanisches Feuer und seine Hand fuhr krampfhaft nach seinem Herzen. – Der Pater folgte dieser Bewegung mit aufmerksamem Auge. –
»Ruhig, Salvador, mein Sohn. Es wird die Zeit kommen. Siehst Du dort den Vollmond sich aus den dunkeln Fluthen der Donau erheben? Wohlan, höre, was ich Dir sage. Bevor er zum 5. Male um diese Zeit an dieser nämlichen Stelle steht, wird Dein Dolch das Herzblut dessen getrunken haben, der das Herz Deiner Mutter gebrochen hat.«
»Este corazon orgulloso no se puede rompes« – murmelte der Knabe, indem er langsam die Hand von der Schärpe sinken ließ. –
»Du hast ihn nie gesehen, Salvador?« –
»Nie.«
»Du wirst ihn heute sehen, Salvador.«
Der Knabe taumelte einen Schritt rückwärts. Sein Gesicht überzog eine Leichenblässe. Seine Brust hob sich in krampfhaften Zuckungen. Abermals fuhr er mit der Hand nach der linken Seite. Dann lächelte er verächtlich, kreuzte die Arme über einander und sprach mit verhaltener Stimme, als wollte er seine innere Bewegung verbergen:
»Ich höre tio« –
»Du bist ein braver Junge, Salvador – und Deiner Mutter würdig. – Was ich Dir zu sagen habe, ist kurz. Heute Abend halb 9 Uhr wirst Du mich in die Stadt begleiten. Du wirst mich in ein Haus hineingehen sehen und mich dort erwarten. Du wirst mich mit einem Manne, der mir zur rechten Seite gehen wird, wieder herauskommen sehen. Auf der Donaubrücke werde ich ihn verlassen. Sieh ihn Dir genau an, Salvador. Dieser Mann ist's, den Du suchest.«
Die intelligenten Augen des Knaben waren mit ängstlicher Sorgfalt auf die Lippen des Paters geheftet gewesen, als wolle er jede Silbe tief in sein Inneres einsaugen.
»Und was soll ich mit dem Manne thun, Sennor?« –
»Du wirst suchen, in seinen Dienst zu treten, Salvador.« Einen halb ängstlichen, halb verachtenden Blick des Knaben übersehend, fuhr er fort:
»Hier hast Du Geld, Du wirst Dich davon kleiden, wie es hier Sitte ist. Du begreifst, mein Sohn, daß Dein jetziger Aufzug Dich nur auffällig macht und Verdacht erregt. Gedenke Deiner Mutter und des Gelübdes, welches Du mir abgelegt. – Und nun lebe wohl, um 1/2 9 Uhr findest Du mich hier.« Salvador war während der Rede des Paters in einem tiefen innerlichen Kampfe begriffen. Die letzten Worte aber schienen seinen Entschluß befestigt zu haben; denn er küßte mit heftiger, leidenschaftlicher Innigkeit die Hand des frommen Vaters und war bald darauf ebenso geräuschlos, als er gekommen, aus der Thür verschwunden. Pater Angelikus aber schien in tiefes Nachdenken versunken. Ein Seufzer endlich, der unwillkürlich, wie ein schwermuthsvoller Gruß an ehemaliges Glück, seiner Brust entstieg, brachte ihn wieder zum Bewußtsein der Gegenwart zurück. Er nahm den Brief, küßte ihn mit einer Inbrunst, die man von diesem verknöcherten kalten Manne, in dem alle Leidenschaften längst abgestorben schienen, nicht erwartet hätte, und legte ihn dann sorgfältig in eine verschließbare Brieftasche, die er sofort zu sich steckte. – Darauf setzte er sich – es war indeß dunkel geworden – in die Ecke des Sophas und überließ sich von neuem seinen Träumereien. –
III
In einem kleinen, aber höchst geschmackvoll eingerichteten Boudoir im zweiten Stocke eines der elegantesten Häuser der »Wallzeile« finden wir unsere beiden Freundinnen, Alice und Lydia wieder. Während diese, in nachlässiger Stellung in einen Polsterstuhl gelehnt, mit der Linken auf den Tasten eines Kisting'schen Flügels umherphantasirte und sich in die Aufsuchung der melancholischsten Mollübergänge zu vertiefen schien – ging Alice, die Hände über die Brust gekreuzt und gesenkten Hauptes mit raschen, aber durch die elastische Weichheit des Teppichs bis zur Unhörbarkeit gedämpften Schritten das Zimmer auf und nieder. Es war Abend, aber der herrliche Vollmond, welcher bereits die Thurmspitzen der über die jenseitige Häuserreihe hinausragenden Stephanskirche versilberte, hatte das Azur des unbewölkten Abendhimmels mit einem so intensiven Lichtglanz getränkt, daß der Reflex desselben das Zimmer hinlänglich erhellte. Mochten es die abgebrochenen tiefschwermüthigen Accorde sein, welche Lydia den Saiten des Instruments entlockte – oder waren es vielleicht die wunderbaren Tinten, welche das falbe Mondlicht in das Zimmer warf, oder war die Spannung, worin Alice durch das bevorstehende Gespräch versetzt wurde, davon Ursache: sie befand sich in einer sonderbaren, an Unruhe grenzenden Aufregung.
Die Töne des Instruments klangen immer sanfter und schienen sich aus mannichfachen Verschlingungen endlich in eine wohlthuende Harmonie auflösen zu wollen, als sie plötzlich in einem schreienden Disaccord, der das ganze Instrument erzittern machte, schlossen. – Mit einem Schrei des Entsetzens war Lydia aufgesprungen und stand nun unbeweglich mit geisterhaftbleichem Gesichte da, die starren Augen auf die rothseidenen Vorhänge des Alkovens gerichtet, die in diesem Augenblicke, gerade vom vollen Mondenlichte bestrahlt, sich zu bewegen schienen. Alice hatte sich erschreckt umgewandt: Was ist's? Was hast du, Lydia? – fragte sie.
Lydia antwortete nicht. Alice trat auf sie zu und legte die Hand auf ihre eiskalte Stirn: da hob sich die Brust der Unglücklichen in einem tiefen Seufzer: aus ihren Augen perlten zwei große Thränen nieder und ihr Kopf senkte sich in die Hand der Freundin.
– Du bist nicht wohl, mein Kind – sagte Alice liebevoll – Du solltest Dich zur Ruhe legen. Lydia schüttelte den Kopf. Sie schlug ihre Augen, in denen eine verzehrende tiefe Schwärmerei glänzte, zum Himmel auf, machte sich sanft von der Umarmung der Freundin los und verließ langsam das Zimmer.
– Sie wird wieder beten gehen – murmelte Alice.
In diesem Augenblicke klopfte es an die Thür.
– Endlich – sagte Alice für sich – als der Pater Angelikus mit leisem Tritte die Schwelle überschritt, offenbar verwundert über die Dämmerung, welche im Zimmer herrschte.
– Sie sind allein – fragte er, vorsichtig sich im Zimmer umschauend.
Alice schellte. Ein Diener brachte Lichter und verließ lautlos, wie er gekommen, das Zimmer.
– Mein armer, frommer Freund – sagte sie, ohne die Frage des Paters zu berücksichtigen, mit ihrer gewohnten liebenswürdigen Ironie, deren Bitterkeit sie durch die sentimentale Weichheit des Tones zu lindern wußte –
– Weshalb bedauern Sie mich? – antwortete, einen mißtrauischen Blick auf das Gesicht Alicens heftend, der Pater.
– Sie sind ein schlechter Menschenkenner, Angelikus, und, was die Folge davon ist, ein noch schlechterer Seelenarzt. Sie glaubten das arme Kind heilen zu können durch den Glauben an die alleinseligmachende Kirche, nicht wahr?
– Nun?
– Nun, ob sie Glauben hat, weiß ich nicht; aber daß Sie ihr eine tüchtige Portion Aberglauben eingeflößt haben, so daß sie jetzt im Schooße ihrer alleinseligmachenden Kirche Gespenster sieht, das weiß ich.
Der Pater blickte die schöne Frau durchdringend scharf an. – – Darauf schüttelte er mit einem Anflug von Hohn den Kopf und erwiederte: Ich könnte Ihnen den Vorwurf zurückgeben. Aber ich will Sie nur fragen: wie, wenn ich das, was Sie mir erzählen, nun gerade vorausgesehen und gewollt hätte? – –
– Sie mögen Recht haben, Pater. – Indessen kann ich Ihnen die Furcht nicht verhehlen, daß der Einfluß, den Sie auf die Schwärmerin gewinnen, den meinigen mit der Zeit paralysiren möchte; und das – werden Sie begreifen – kann wenigstens nicht mein Zweck sein. –
Jetzt war die Reihe an Alice, einen forschenden Blick auf die kalten Züge des Paters zu werfen. – Jener lächelte – Sie thun sich selber Unrecht, Alice, wenn sie ihren Einfluß so gering anschlagen. – Indessen – fuhr er rasch fort, um das Ausweichende in seiner Antwort zu verstecken – da zu hoffen steht, daß wir stets gemeinsam handeln werden, so sind Ihre wie meine Befürchtungen in dieser Rücksicht wohl nutzlos.
Alice hielt es für klug, nicht weiter zu gehen und brach daher ab. Denn so viel ihr daran gelegen sein mußte, einen Blick in die Pläne des Paters zu thun, so war sie einerseits doch ihrer Herrschaft über Lydia gewiß, oder – wenn sie es nicht war – so durfte sie ihre Besorgniß deswegen nicht allzusehr durchblicken lassen.
In diesem Augenblicke warf die große Glocke des Stephansthurms ihre volle Töne über die Stadt hin.
– Es ist Zeit – sagte Alice, einen flüchtigen Blick auf das Zifferblatt einer prächtigen Alabasteruhr werfend, welche auf der vergoldeten Console über dem Sopha stand. Die Zeiger wiesen auf 20 Minuten nach 2 Uhr. Der Pater, dem keine Bewegung Alicens entging, folgte ihrem Blicke und bemerkte, daß sie aufgezogen werden müsse.
– Lassen Sie – sagte Alice – die Kette ist gesprungen. Doch jetzt kommen Sie – fuhr sie fort, indem sie den rothseidenen Vorhang vor dem Alkoven zurückschlug. Er war leer und in seinem Fond eine offene Tapetenthür. Pater Angelikus trat hinein und blickte, als er die Tapetenthür öffnete, eine schmale und sehr steile Treppe hinab. Er zauderte einen Moment und blickte fragend rückwärts.
– Sie gelangen, für den Fall, daß man uns überraschte, hier auf dem kürzesten Wege in die Seitenstraße. Haben Sie Mißtrauen gegen mich, so will ich mit dem Lichte Ihnen vorangehen.
– Es bedarf dessen nicht – erwiederte Angelikus kurz, indem er seine Hand an die Brusttasche steckte und mit der andern die Tapetenthür von Innen verriegelte.
In diesem Augenblicke hörte man das Klirren eines Säbels auf dem Korridor.
Alice zog rasch die Vorhänge des Alkovens zu und rief auf ein hastiges Klopfen an die Thür ein unbefangenes und lautes: Herein!
Fürst Felix Lizinsky war wie männiglich bekannt, ein schöner, liebenswürdiger und kluger Mann. Mehr als alle diese Eigenschaften charakterisirte ihn – wie ein ebenfalls liebenswürdiger und kluger Mann sich ausdrücken würde, der überdies mit ihm in manchen andern Dingen viel Aehnlichkeit besitzt – eine
»selbst in ihrer Uebertreibung noch anmuthige Ritterlichkeit«
oder vielmehr chevalereske Schwärmerei, die, um ihn zum modernen Donquichote zu machen, nur Zweierlei entbehrte, Tiefe und Wahrheit. Lizinsky wird nie eine historische Person werden, nicht weil er für die Geschichte zu früh gestorben, sondern weil er dafür zu leben nie angefangen. Zu leben aber hat er nie angefangen, weil Er nur für sich und seine Eitelkeit gelebt. – Sein Gott war der Schein, der anmuthige Schein, der nach Triumph lüsterne und des Sieges sichere Schein. Den Schein betete er an, weil er sich selbst anbetete, denn er war vor Allem eitel. Die Eitelkeit, die mit sich selbst liebäugelnde Anmuth ist der erste Grundzug seines Charakters. – Diese Eitelkeit des Scheins, der sich selbst und nur sich selbst genießen will, machen ihn frivol. Frivolität ist der zweite Grundzug seines Charakters.
Als er hereintrat, fiel ein erster Blick auf die in ruhiger Haltung auf dem Sopha sitzende und scheinbar in die Lektüre einiger Briefe vertiefte Alice, und dieser Blick schien zu sagen: Sieh', bin ich nicht schön? – In der That, er war schön, schön wie ein Adonis würden wir sagen, wäre dieser Vergleich nicht abgenützt, und hielten wir es nicht für lächerlich, einen Adonis in Uniform uns zu denken. Des Fürsten schlank und wohlgebauter Körper war bekleidet mit der einfachen, doch reichen Uniform eines spanischen Generals. Sein volles dunkelblondes Haar streichelnd, das mit seinen weichen elastischen Wellen die eine Seite der edeln, aber vielleicht nur einige Linien zu niedrigen Stirn bedeckte, trat er an das Sopha heran, küßte mit Grazie die Hand der schönen Frau und sagte statt jeder andern Begrüßung mit einem Blicke auf die Briefe:
– Wir werden also heute Politik treiben, schöne Frau? –
– Was verstehen Sie unter Politik, ritterlicher Fürst? – gegenfragte Alice, indem sie auf die letzten Worte einen ironischen Nachdruck legte, der noch durch ein Lächeln ihrerseits unterstützt wurde.
– Sonderbare Frage!
– Sagen Sie lieber: »Schwierige Frage!« Die Wahrheit ist, daß Jeder etwas Anderes darunter versteht.
– Auch Sie und ich? – der Fürst studirte mit seinen schwarzen großen Augen die Züge Alicens, indem er diese, scheinbar leichthin geworfenen Worte sprach.
– Doch wohl. Beweis dafür ist, daß wir einander unterstützen. Sie werden bei sich denken: um einander zu benutzen. Das gebe ich zu. Allein beweist das nicht für mich?
– Sie meinen? sagte der Fürst, indem er seinen schönen Schnurrbart strich – Hätten wir dieselbe Politik, oder mit andern Worten, verfolgten wir dieselben Zwecke, so würden wir einander weder unterstützen noch vertrauen, selbst nicht um einander zu benutzen. Indessen –
– Fahren Sie fort, Fürst: Indessen –
– Indessen liegt der Unterschied zuweilen nicht sowohl in der Richtung, als in der Länge des Wegs. – Wieder ließ er seinen feurigen und durchdringenden Blick über das bleiche Gesicht Alicens schweifen.
Diese aber wußte wohl, was der Fürst sagen wollte, ja sie hatte sogar eine ziemlich richtige Vorstellung von seinen an's Abentheuerliche streifenden Plänen, sie hütete sich jedoch, ihm zu zeigen, daß sie ebenso schlau als schön sei.
Andrerseits hatte sie dem Gespräch gleich zu Anfang diese Wendung gegeben, um dem lauschenden Pater einen Beweis für das Mißtrauen zu geben, welches in ihrem Verhältniß zum Fürsten ebenfalls eine Rolle spielte. So weit war die Stellung, welche sie augenblicklich zu einander eingenommen, wahr. Freilich aber wußte der gute Angelikus nicht, daß die Rolle, welches dies Mißtrauen bei ihnen spielte, nur eine sehr untergeordnete war, und daß der Grundton ihres Verhältnisses, besonders zu gewissen Stunden, eine schrankenlose Offenherzigkeit – wenn nicht von Alicens so doch von des Fürsten Seite bildete. Mochte es nun der Umstand sein, daß des Fürsten Lieblingspferd gerade heute gestorben, oder hatte ihm Alice eine Andeutung darüber zukommen lassen, daß sie heute wichtige politische Angelegenheiten abzumachen hätten – für das Letztere schien wenigstens seine erste Frage zu sprechen; kurz der Fürst befand sich heute zur großen Genugthuung von Alicen in einer Stimmung, wie sie sie für die gegenwärtige Situation nur wünschen konnte.
– Ich bin überzeugt, theure Baronin – fuhr der Fürst fort – wir können eine lange Strecke miteinander gehen, bis – – – –
– Bis unsere Wege sich trennen?
– Nein, bis der Eine von uns sein Ziel erreicht hat. Der Andere wandert dann allein weiter.
– Eitler Narr – murmelte Alice für sich, indem sie lachte. – Gestehen Sie, Felix – sagte sie laut – daß dies Räthselspiel unendlich albern ist. Sprechen wir vernünftig und deutsch. Ich reise morgen nach Berlin. Haben Sie mir einen Auftrag mitzugeben? Vielleicht an Carolotta, die Göttliche? Oder an die kleine Tänzerin? Wie heißt doch die Himmlische? – Helfen Sie mir, Fürst! Mein Gott, was sind Sie heute unbehülflich! Ich kenne Sie gar nicht wieder.
– Sie reisen morgen wirklich nach Berlin? – fragte der Fürst, welcher sich von seinem Erstaunen theils über die unerwartete Nachricht, theils über die plötzlich veränderte Stimmung Alicens noch nicht erholt hatte, indem er vom Stuhle aufsprang. – Oder ist es ein Scherz, Alice? –
– Ein Scherz? Im Gegentheil: Die Angelegenheit, welche mich dorthin führt, ist sehr ernster Natur. – Alice sagte dies in so bestimmten Tone und mit solchem Accent der Wahrheit, daß das ironische Lächeln, welches dabei um ihre feingeschnittenen Lippen schwebte, offenbar eine andere Beziehung hatte, als die, dem Sinn der eigenen Worte zu widersprechen. Lizinsky ging, mit hastigen Schritten im Zimmer auf und ab und warf, wenn er vor Alicens Platz vorüberkam einen bald forschenden, bald unentschlossenen Blick auf sie. Sie ließ ihn ruhig gewähren und blätterte indeß in den vor ihr liegenden Briefen. Endlich blieb er vor ihr stehen und sagte:
– Alice, haben Sie Vertrauen zu mir?
– Wenig.
– Warum?
– Weil Sie nicht offen sind. Nicht, ob ich Vertrauen zu Ihnen hätte, sondern ob Sie mir trauen dürften: das wünschten Sie zu wissen. Also woher der Umweg? Aus Mißtrauen. Können Sie verlangen, daß ich Ihnen mehr vertraue, als Sie zu erwiedern geneigt sein möchten?
Der Fürst biß sich in die Lippen. – Sie sind ein gefährliches Weib, Alice – sagte er seufzend.
– Diese Schmeichelei scheint Ihnen schwer geworden zu sein. Vielleicht weil sie diesmal eine Wahrheit enthält. In der That, ich bin ein gefährliches Weib. Fahren Sie fort.
Der Fürst setzte sich wieder – Alice – begann er mit gedämpfter Stimme – ich habe eine Bitte an Sie. Doch ehe ich sie ausspreche, hören Sie. Sie wissen, was vor 14 Tagen in Paris vorgegangen. Es mag wenige geben, die sich schon mit dem Gedanken befreunden können, daß die französische Republik Bestand habe. Ich gehöre zu diesen Wenigen, ja ich bin sogar der festen Ueberzeugung, daß die französische Revolution des Jahres 1848 keine französische, sondern eine europäische ist, und daß wir großen und ernsten Stürmen entgegengehen: ich meine Deutschland, und vor Allem Oesterreich und Preußen.
Der Fürst schien eine Antwort zu erwarten. Alice aber winkte ihm fortzufahren.
– Ich glaube, daß die Wenigen, von denen ich sprach, und zu denen ich auch Sie rechne – Alice lächelte dankend – auf die kommenden Ereignisse gerüstet sein müssen, ja daß sie die Leitung derselben womöglich in die Hand nehmen müssen. Denn wenn die beiden Mächte, Absolutismus und Volksbewußtsein, einander gegenübertreten, so kann der Kampf nur ein Kampf auf Leben und Tod sein. Wenn, glauben Sie nun wohl, werden wir gewinnen? Wenn der Absolutismus oder wenn das Volksbewußtsein siegt?
– Vielleicht weder in dem einen noch in dem andern Falle, sagte Alice mit Indifferenz.
– Desto schlimmer für uns. Doch aber nur, wenn wir neutral bleiben wie bisher. –
– Oder mit beiden Parteien liebäugeln, wie bisher – persiflirte Alice.
Diese Anspielung auf die Thätigkeit bei dem Landtage, – – verletzte den Fürsten.
Aber Meister in der Schauspielkunst, lächelte er höchst anmuthig zu diesem Stich und sagte in scherzendem Tone:
– Eben darum müssen wir Partei nehmen, schöne Freundin.
– Und welche Partei würden Sr. Durchlaucht der Fürst Felix Lizinsky ergreifen – anticipirte sie ihn – vielleicht die, welche die meisten Chancen auf Erfolg hat.
– Das zu entscheiden ist eben die große Frage. –
– Deren Beantwortung Sie sicherlich nicht von mir erwarten werden.
– Und warum nicht? Denn Sie werden mir gegenüber nicht behaupten wollen, daß Sie weder mit den Mitteln noch mit den Führern der Parteien bekannt genug sind, um den wahrscheinlichen Erfolg voraus bestimmen zu können. – Also warum nicht?
– Vielleicht darum, weil Sie Ihre Ansicht schwerlich nach der meinigen ändern werden.
– Das käme auf den Versuch an – der Fürst legte ein gewisses Gewicht auf diese Worte. Alice schüttelte den Kopf. Sie hatten mir eine Bitte mitzutheilen? Lizinsky runzelte die Stirn und schwieg einige Sekunden.
– Dann sagte er – ich sehe, Sie sind unbezwinglich. So will ich den Anfang des Vertrauens machen. – Sie wissen, daß sich hier in Wien in aller Stille ein revolutionairer Verein gebildet hat. Eben jetzt komme ich aus einer Versammlung, fast die ganze Aula hat sich definitiv erklärt. Aber darin liegt auch die Gefahr. Es sind schon zu viele Mitwisser. Es könnte sich leicht ein Verräther unter ihnen finden.
– Er hat sich bereits gefunden – sagte kalt Alice.
Der Fürst erbleichte. – Woher wissen Sie –? Alice bat ihn fortzufahren. –
– Die Zeit drängt. Die Bewegung beginnt bereits in dem Volke sich durch ein dumpfes Vorgefühl kund zu geben. Der Hof selbst ist noch ruhig, aber die Metternichsche Partei ist schon aufmerksam geworden.
– Durch wen? – fragte Alice mit derselben Kälte, indem sie ihn durchdringend anblickte.
Sie mißhandeln mich, Alice, durch ihr maßloses Mißtrauen. Was solls mit diesen Blicken?
Reden Sie! Wollen Sie mich absichtlich beleidigen? Das müßte, dächte ich, Ihnen schon Ihre Klugheit verbieten.
Alice lachte: Sie haben ein empfindliches Gewissen, theurer Fürst. Ich dachte nur daran, daß die Fürstin Metternich eine schöne Frau ist. –
– Lassen Sie das jetzt – so stehen also die Sachen hier in Wien. Höchstens gebe ich noch eine Woche: dann bricht der Sturm los. Vielleicht, ja wahrscheinlich – denn jeder Anlaß muß benutzt werden – schon früher. Wir sind nun aber der Ueberzeugung, daß es hiebei sein Bewenden nicht haben dürfe. Wien allein macht nur eine österreichische, keine deutsche Revolution. Berlin ist das Herz Deutschlands. Hier müßte eigentlich der erste Schlag fallen, allein das wird nach allen Anzeichen und Nachrichten nicht geschehen. Aber Berlin muß rasch folgen; und – fügte der Fürst leiseren Tones hinzu – es wird folgen.
Auch in Berlin sind alle Vorbereitungen getroffen; das Uebrige aber hängt von der Gestaltung der hiesigen Verhältnisse ab. Heute nun sind diese zum bestimmten Abschluß gekommen. Wollen Sie – dies ist meine Bitte – außer dem, was ich Ihnen eben mündlich mitgetheilt und was ich Ihnen in weiterer Ausführung, besonders in Rücksicht auf den nöthigen Vertheidigungsplan der Stadt, aufgezeichnet, noch einige Briefe an Personen mitnehmen, die theils der einen, theils der andern Partei angehören?
– Gern, doch unter einer Bedingung, nämlich der, daß Sie mir offen sagen, für welche Partei Sie sich schließlich zu erklären die Absicht haben. Denn da ich bereits entschlossen bin, so würde ich mir oder vielmehr meiner Partei möglicherweise durch Uebernahme ihrer Aufträge entgegenarbeiten.
– Ich kann diese Bedingung zwar nicht eingehen, doch glaube ich, werden Sie zufrieden sein, wenn ich Ihnen mein Ehrenwort gebe, daß Ihre Befürchtungen in jedem Falle grundlos sind.
– Also hatte ich vorher doch Recht mit meinen Vermuthungen. Indeß kommen wir zu Ihren Aufträgen.
– Hier ist zunächst der Plan, von dem ich vorhin sprach. Verwahren Sie ihn wohl. Sie übergeben ihn dem Ingenieurofficier Latorp. Sie finden seine vollständige Adresse ebenfalls hier aufgezeichnet. Von ihm werden Sie vielleicht in die nähern Verhältnisse der Berliner Bewegung eingeweiht werden, wenn Sie eine Rolle darin übernehmen wollen. Dann sehen Sie hier ein Packet Briefe, die Sie eigenhändig an die Adresse überreichen müssen. –
Als Alice die Briefe ansah, konnte sie ein lautes Lachen nicht unterdrücken. Es fanden sich darunter auch ein Brief an die Herzogin von Nagas und einer an den Probst Bergmann. Sie warf einen raschen Blick auf die Vorhänge des Alkovens, und zog dann die beiden, ihr von Pater Angelikus übergebenen Briefe aus dem Busen, und hielt sie dem Fürsten vor.
Dieser sprang erschreckt in die Höhe. – Was ist das? – rief er fast drohend aus. In diesem Augenblicke gerieth die eine Seite des Vorhangs in eine zitternde Bewegung. Alice legte den Finger auf den Mund. Der Fürst trat einen Schritt zurück und sagte, indem er die Hand an den Säbel legte, mit zitternder Stimme und bleichen Lippen: Wir sind nicht allein? Zugleich sah er sich in dem Zimmer nach allen Richtungen um und ließ seinen Blick zuletzt auf dem Vorhange ruhen. In dem nächsten Augenblick stürzte er aber auch schon darauf zu und riß ihn mit krampfhafter Hand auseinander. – Er hatte sich getäuscht in seinem Verdacht: der Alkoven war leer.
Alice hatte diese Scene durch ihre eigene Unvorsichtigkeit hervorgerufen und schwebte eine Secunde in wirklicher Angst um den Fürsten, denn sie wußte, daß der Pater stets bewaffnet war. Jetzt aber hatte sie ihren Gleichmuth so völlig wiedergefunden, daß sie vortrefflich die Erstaunte zu spielen im Stande war.