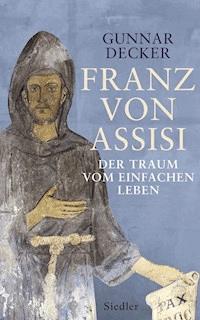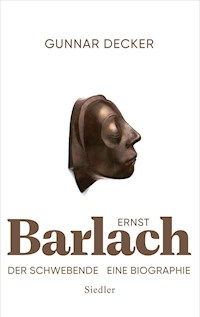12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siedler Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Der größte Dichter der frühen Moderne: die neue, überraschende Biographie von Rilke
Rainer Maria Rilke ist auch nach über einhundert Jahren ein Welteröffner. Er verführt seine Leser zur existenziellen Selbstbefragung und fordert Entschlüsse: »Du musst dein Leben ändern.« Seine Dichtung, das stellt Gunnar Decker auf faszinierende Weise heraus, war immer auch eine Reaktion auf die Krisen der Gegenwart, der Versuch, sich eine Gegenwelt zu erschreiben, die für ihn lebenswerter war als jene, die er in Prag, München, Worpswede, Moskau, Berlin, Rom, Duino, Venedig oder Paris vorfand. So scheinen Rilkes ruheloses Leben und sein metaphysische Fragen umkreisendes Werk auf einzigartige Weise verwoben. In seiner wunderbar erzählten Biographie widmet sich Decker auch erstmals Rilkes schwierigem Verhältnis zu seiner Mutter Phia, dem Nicht-Verhältnis zu seiner lebenslangen Ehefrau Clara und zur Tochter Ruth. Er beschreibt seinen Kampf gegen den körperlichen Verfall, der einen Schlüssel zum Verständnis des Werkes bietet, und deutet seinen Entschluss nach dem Ersten Weltkrieg, kein deutscher Dichter mehr sein zu wollen. Ein neuer, überraschender Blick auf eine der schillerndsten Dichterfiguren unserer frühen Moderne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 784
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
BUCH
Rainer Maria Rilke ist auch nach über einhundert Jahren ein Welteröffner. Er verführt seine Leser zur existenziellen Selbstbefragung und fordert Entschlüsse: »Du musst dein Leben ändern.« Seine Dichtung, das stellt Gunnar Decker auf faszinierende Weise heraus, war immer auch eine Reaktion auf die Krisen der Gegenwart, der Versuch, sich eine Gegenwelt zu erschreiben, die für ihn lebenswerter war als jene, die er in Prag, München, Worpswede, Moskau, Berlin, Rom, Duino, Venedig oder Paris vorfand. Ein neuer Blick auf eine der schillerndsten Dichterfiguren unserer frühen Moderne.
AUTOR
Gunnar Decker wurde 1965 in Kühlungsborn geboren, studierte an der Berliner Humboldt-Universität Philosophie und promovierte 1994 über Ketzergeschichte. Er lebt als Autor und Journalist in Berlin, veröffentlichte vielfach gelobte Biographien wie »Franz Fühmann. Die Kunst des Scheiterns« (2009), »Hermann Hesse. Der Wanderer und sein Schatten« (2012), »Franz von Assisi. Der Traum vom einfachen Leben« (2016) und »Ernst Barlach. Der Schwebende« (2019). Zudem erschienen die Geschichtsbücher »1965. Der kurze Sommer der DDR« (2015) und »Zwischen den Zeiten. Die späten Jahre der DDR« (2020). 2016 wurde er mit dem von der Berliner Akademie der Künste verliehenen Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet.
Die vorliegende Biographie schließt an »Rilkes Frauen oder Die Erfindung der Liebe« (2004) an.
Gunnar Decker
RILKE
Der ferne Magier
Eine Biographie
Siedler
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Siedler Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Covergestaltung: Favoritbüro, München
Coverabbildung: © Schweizerisches Literaturarchiv, Bern
Lektorat: Eckard Schuster
Bildredaktion: Annette Baur
Reproduktion: Mohn Media Mohndruck, Gütersloh
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-21627-6V004
www.siedler-verlag.de
Für Kerstin
Habe ich es schon gesagt? Ich lerne sehen. Ja, ich fange an. Es geht noch schlecht. Aber ich will meine Zeit ausnutzen.
Rainer Maria Rilke, »Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge«[1]
Inhalt
Prolog
Hälfte des Lebens
Kapitel I
Anfänge
Prag als dunkler Traum
Die Schüler-Liebe zu Valerie von David-Rhonfeld, erste Gedichte
Prag im Rücken: »Ewald Tragy«
Neue Freiheiten im Unterwegs
Zum ersten Mal Venedig
Kapitel II
Aufbrüche
Die Frau, die ihm einen neuen Namen gibt: Lou Andreas-Salomé
Lou im Herzen. Von München nach Berlin und zurück nach Prag
Florenz als Exerzitium. Neues in Sachen Kunst
Erlebnis Russland zum Ersten (1899)
Der »Cornet«. Geschwindigkeitsrausch im historischen Gewand
Erlebnis Russland zum Zweiten (1900)
Worpswede im Moor. Zwei Mädchen in Wei
Kapitel III
Krise
Die Weltstadt Paris und das Ereignis Rodin
Rodin-Monographie und erster Brief an einen jungen Dichter
Zwischenspiel in Viareggio
Rückkehr nach Worpswede und Wiederannäherung an Lou, wenn auch auf Distanz
In Rom am falschen Ort
Ellen Key und ihr »Jahrhundert des Kindes« treffen auf Rilkes »Geschichten vom lieben Gott«
Sören Kierkegaard und Jens Peter Jacobsen als Wegweiser gen Norden
Von Rom nach Schweden
Kurgast auf dem Weißen Hirsch. Wiedersehen mit Lou
Das »Stunden-Buch«
Wieder bei Rodin in Paris
Weiter Paris, weiter Geldsorgen
Zwischenzeitliches Refugium auf Capri
Kapitel IV
Verwandlung
Urszenen des »Malte Laurids Brigge«
Anders sehen mit Cézanne
»Der Panther« als Sinnbild der »Neuen Gedichte«
Liebe und Distanz. In Venedig bei Mimi Romanelli
Der Stellvertreter. Maltes Leben und Sterben in Paris
Reisebegleiter nach Ägypten. Eine Verfehlung
Scheidung von Clara?
Schloss Duino und Marie von Thurn und Taxis. Die beiden ersten Duineser Elegien
Die Duse als Ereignis. Noch einmal Venedig
Offenbarung in Toledo, aber keine christliche
André Gide und »Die Rückkehr des verlorenen Sohnes« 335
Kapitel V
Absturz
Kriegsausbruch Sommer 1914
Die vierte Duineser Elegie. Einberufung zum Kriegsdienst
Letzte Begegnung mit der Mutter
Hertha Koenig und Picassos »Gaukler«
Einberufung zum Militärdienst. »Dichterdienst« im Presseamt
Rodins Tod, Schmerz und Befreiung zugleich
Novemberrevolution 1918 und Münchner Räterepublik
Kapitel VI
Flucht
Die Schweiz vor Augen
Zuflucht gesucht
Angela Guttmann. Geliebte auf Abstand
Zum letzten Mal Venedig und wieder in Paris
Virtuose der Fernstenliebe. Rilke und die Frauen
Wahltochter als Spiegel: Anita Forrer
Lisa Heise. Briefwechsel mit einer jungen Frau
Schloss Berg. Paradies mit Sägemühle
Langsamkeit lernen bei Regina Ullmann
Kapitel VII
Isolation
Als Burgvogt im Château de Muzot
Vater aus der Ferne: Ruth heiratet und bekommt ein Geschenk, das Zwietracht sät
Erster Winter auf Muzot. Vorspiel mit »Mitsou« von Balthus
Die Vollendung der »Duineser Elegien«
»Gesang ist Dasein.« Die »Sonette an Orpheus«
»Der Brief des jungen Arbeiters« und die Frage nach Gott
Mit Sekretärin auf Zeit
Kapitel VIII
Sterben
Enttäuschte Hoffnung auf Paris und der »Fall Rilke«
Das langsame, aber unaufhaltsame Sterben des Dichters
Hermetik im »Gong«-Gedicht. Ungaretti und Mussolini – wie politisch ist Rilke?
Prousts Welt
Das Leben ein hochpräziser Tanz: Paul Valéry
Erfüllte Fernstenliebe. Briefgespräch mit Marina Zwetajewa
Der Tod
Epilog
Ein »Begräbnis zweiter Klasse« für Rilke?
Anhang
Bibliographie
Zeittafel
Anmerkungen
Prolog
Hälfte des Lebens
Er weiß nicht, dass nun bereits die zweite Hälfte seines Lebens beginnt. Rainer Maria Rilke ist 1901 gerade einmal fünfundzwanzig Jahre alt. Aber dass sich eine folgenreiche Veränderung mit ihm vollzieht, weiß er wohl.
Er blickt ab jetzt anders auf sich selbst, schaut anders zurück auf seine Prager Kindheit, sein Leben als Sohn, seine ihn überwältigende Liebe zu Lou Andreas-Salomé, die die wichtigste Frau seines Lebens bleiben wird. Aber auch das ahnt er noch nicht.
Rilke bedenkt seine Mission als Dichter wieder einmal neu – nun vor dem Hintergrund zweier Russland-Reisen mit Lou. Bringt Worpswede die Rettung oder aber Rodin in Paris, zu dem er im Jahr darauf reist?
Da drängt einer in allem, was er unternimmt, erwartungsvoll nach vorn, doch die Zukunft verbirgt sich ihm. Dem Ungewissen trotzt er mit einer männlichen Entschlossenheit, die ihn selbst erstaunt.
Am Ende des Jahres 1901 scheint Rainer Maria Rilke ein anderer zu sein als noch zu dessen Beginn. Unerwartet ernst ist die Lage, in der er sich befindet. Am 28. April hatte er Clara Westhoff geheiratet. Die ist zweiundzwanzig Jahre alt und dabei, Bildhauerin zu werden, aber nun erst einmal schwanger. Die Westhoffs in Bremen sind evangelisch, die Rilkes in Prag katholisch. Rilke löst diesen konfessionellen Konflikt dadurch, dass er – ohne zu zögern, erst recht, ohne es jemals zu bedauern – aus der katholischen Kirche austritt. (In seiner Heiratsurkunde, so wird sich später zeigen, ist diese kurz zuvor ausgestellte Austrittsbescheinigung jedoch nicht berücksichtigt worden – und er wird darin als katholisch aufgeführt.[2])
Die Kaufmannsfamilie Westhoff ist nicht arm, zum Glück für das junge Ehepaar. Denn das hat fast keine Einnahmen. Rilke lebte bislang von einem Stipendium, das sein bereits 1892 verstorbener Onkel Jaroslav ihm für die Zeit seines Studiums gestiftet hatte. Seine Töchter zahlten es nach dessen Tod widerwillig weiter, wohl wissend, dass ihr Cousin nur ein Alibi-Studium in Prag, München und Berlin absolvierte. Aber damit ist zum Jahresende 1901 Schluss. Soeben sechsundzwanzig Jahre alt geworden, wird Rilke am 12. Dezember Vater einer Tochter, die die Eltern Ruth nennen. Die Vaterrolle liegt ihm nicht, ebenso wenig wie die eines Ehemannes.
Rilke heiratet Clara Westhoff auch, weil seine bereits vier Jahre andauernde Beziehung mit Lou Andreas-Salomé abrupt zu Ende gegangen war. Lou Andreas-Salomé, die vierzehn Jahre ältere, überaus selbstbezogene Intellektuelle, fühlte sich von Rilke zunehmend okkupiert, entschloss sich, ihn loszuwerden, wohl wissend, wie sie am 10. Januar 1901 in ihr Tagebuch notierte: »Ich bin ein Scheusal. (Schlecht war ich auch gegen Rainer, aber dies tut mir nie weh.)«[3]
Will er Lou mit seiner Eheschließung beweisen, dass er sehr wohl zu einer entschlossenen Tat fähig ist, der Gründung einer eigenen Familie? Doch wie soll der junge Dichter diese ernähren? Rilke hofft immer noch auf einen Durchbruch als Dramatiker, am 20. Dezember hat sein Stück »Das tägliche Leben« am Berliner Residenztheater Premiere. Ein heftiger Misserfolg. Das Berliner Publikum lacht an den besonders pathetischen Stellen. Rilke, ein ausgelachter Dramatiker!
Doch gibt er sich in einem Brief vom 28. Dezember 1901 betont optimistisch, interpretiert den Reinfall zum Erfolg um: Der große Mißerfolg meines Stückes in Berlin hat sich reichlich belohnt, durch Briefe vom Direktor und vom Oberregisseur des Theaters, darin beide unter Worten des Vertrauens und der Anerkennung, entgegen der Meinung des Publikums, sagen, daß sie an mein Stück und seine Vorzüge glauben nach wie vor.[4]
Dass man mit Gedichtbänden wie »Mir zur Feier«, der 1899 erschienen war, kein Geld verdient, war ihm bereits bekannt. Also versucht er sich – intensiver noch als bisher – als Journalist und verfasst in hoher Frequenz Buchbesprechungen für verschiedene Zeitungen und Magazine. Bislang fiel es ihm nie schwer, viel zu schreiben. Doch immer mehr wird Rilke, inmitten der Fülle seiner Produktion, auch des Gewichts der Worte gewahr, das oft schwer zu tragen ist.
Plötzlich ist da ein neuer, geradezu sachlicher Ton in seinen Texten, der aufmerken lässt. Diesen Ton hatte Lou immer wieder angemahnt, aber auf ihrer zweiten gemeinsamen Russland-Reise sah sie Rilke erneut im Sumpf bodenloser Schwärmerei versinken, den sie bei ihm schon überwunden glaubte.
Nun, da Rilke, der sich beim Schreiben beeilen muss, keine Zeit hat, sich in einen stilisierten Ton hineinzusteigern, trifft er in seinen Rezensionen, darunter für den »Berliner Börsen-Courier«, für Maximilian Hardens »Die Zukunft«, auch für das »Bremer Tageblatt«, den Nerv von Neuerscheinungen junger Autoren wie Thomas Mann, dessen »Buddenbrooks« er bespricht. Auch über Ellen Keys »Das Jahrhundert des Kindes« wird er schreiben – und sich mit der Autorin anfreunden. Schnell ist klar: Hier versteht jemand etwas von Literatur.
Aber was nutzt ihm das, da er als Familienvater doch Geld verdienen muss und die Honorare für seine so bemerkenswerten Rezensionen nur tröpfeln? Er versucht, eine Stelle als Redakteur bei einer Zeitung, egal welcher, zu bekommen, ein festes Einkommen wäre ihm das höchste Ziel – aber vergeblich. So muss er im Juli dieses Jahres, das zur Mitte seines Lebens wird, konstatieren, dass sie arme, sehr arme Leute sind.[5]Dabei hat er genau ausgerechnet, was sie beide monatlich verdienen müssten, um in Westerwede im eigenen Haus als kleine Familie leben zu können: 250 Mark!
Er wird also zum Auftragsschreiber, bietet überall seine Dienste an. Aber beliebig will er trotz der finanziellen Notlage nicht werden. Als ihm der S. Fischer Verlag vorschlägt, ein Buch über Walther von der Vogelweide herauszugeben, sagt er am 31. Mai 1901 dankend ab. Dieser Dichter sei ihm zu fremd, heißt es in seiner Antwort an den Verlag: In einer Zeit, da ich noch viel Mitteldeutsch las, hielt sein »politisch Lied« mich oftmals ab, Walther blindlings lieb zu haben. Und ich bin seither nicht geneigter geworden, politische Lyrik zu ertragen.[6]
Aber so jung der Dichter auch immer noch ist, er gibt sich betont gebrechlich – das verbindet ihn mit seiner Mutter Phia – und befindet sich als Dauerrekonvaleszent immer nach und schon wieder vor einer Krankheit. Das ist bereits jetzt eine Konstante in seinem Leben und wird es auch in der nun beginnenden zweiten Lebenshälfte bleiben.
Erst im Dezember 1923 – da hat er noch drei Jahre zu leben – überwindet ihn die Krankheit, mit der er bislang ein spielerisches Verhältnis zu unterhalten versuchte. An ihre ständige Gegenwart hatte er sich längst gewöhnt, mal war sie mehr, mal weniger belastend.
Vermutlich sind es nun die nicht weichen wollenden – und sich dann plötzlich massiv verstärkenden – Folgen einer Virusinfektion, die ihn dauerhaft schwächen, ihm jede Reise- und Arbeitslust rauben. Kaum vermag er es nun mehr, kurze Spaziergänge zu unternehmen, in die nächste Stadt zu fahren. Nachts liegt er wach, am Tage ist er zu müde, um sich zu konzentrieren.
An Max Picard wird er darüber am 12. November 1926 schreiben: Niemand wird je erklären können, w a s dieses reine Ineinandergreifen meines Daseins hat verstören dürfen: soviel steht fest, daß ich Tag und Stunde nennen kann, da, von einem Augenblick zum anderen, als ob ein Pakt abgelaufen sei, meine reinste Sicherheit mir gekündigt schien: plötzlich, im Ablauf einer einzigen Minute, war ich mit allem, was ich bin, auf eine schiefe Ebene gestellt. Das werden nun im Dezember drei Jahre sein.[7]
Diese mysteriöse Gefangensetzung in einem hellwach-müden Zustand dauert bis zu seinem Tod. Oft steht er nun erst am späten Nachmittag auf, verdämmert die Tage – und schreibt dennoch gegen die wachsende innere Lähmung an, nicht nur Briefe, auch Übersetzungen von Paul Valéry oder André Gide. Wie ein Seismograph registriert er den in ihm wachsenden Tod, sucht nach einem Ausdruck für das Unbekannte, das von ihm Besitz ergreift.
Auch im Herbst 1901 ist die Lage ernst, fast schon verzweifelt. Immerhin unterstützt nun Rilkes Vater Josef seinen Sohn finanziell. Und der arbeitet hart, wenn auch nicht kontinuierlich. Aber – gelegentlich – hart arbeiten und als Autor Geld verdienen sind zweierlei Dinge. Rilke greift nach jedem Strohhalm. So bewirbt er sich beim Landgrafen Alexander Friedrich von Hessen als Vorleser, wahlweise als Gesellschafter – auch das vergeblich. Zum Glück für Rilke, denn solche Haushofmeisterstellen, wie Hölderlin eine durchlitt, gehören doch eher ins 18. Jahrhundert – und waren für die Betreffenden immer demütigend. Das weiß auch Rilke und arbeitet nun an einem anderen, würdigeren Weg hin zu Adel und Schlössern: als gern gesehener und respektierter Gast. Dazu jedoch muss er als Dichter unbedingt erfolgreich werden.
Dieses Buch fragt nach Wendepunkten und Widersprüchen in Rilkes Leben, nach seiner Auffassung von Religiosität im Verhältnis zur Kunst. Ebenso nach verwandelnden Begegnungen mit Menschen und Orten, die in seinem Werk einen Resonanzraum finden. Paris mit all seiner Anziehungs- und Abstoßungskraft, so wird sich zeigen, ist der Mittelpunkt seines Lebens, und neben dem großen Bogenschlag zwischen Liebe und Tod bleiben immer auch die Themen Arbeit und Armut – spirituell überhöht wie auch in nackter sozialer Brutalität – bestimmend für ihn.
Früh weiß Rilke um die Verwandtschaft von Gedicht und Gebet, um die Nähe der Sprache der Liebe zur Religion. Das wird zur Voraussetzung seiner Poetik. Ist Rilke der Gottsucher unter den modernen Dichtern? Aber was heißt für ihn überhaupt »Gott«? Es geht seinem Gedicht um die Frage nach Heimat in unserer modern erkaltenden Welt, der das metaphysische Obdach abhandengekommen ist. Gott scheint dabei nur der konventionelle Name für etwas, das einstmals als Bürge der festgefügten Weltordnung galt. Doch der Name weckt falsche Assoziationen. Denn die Mystiker aller Zeiten wussten: Gott existiert nicht ohne mich! Bereits 1899 hatte Rilke diese Verse geschrieben: Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? / Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?) / Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?) / Bin dein Gewand und dein Gewerbe, / Mit mir verlierst du deinen Sinn.
Rilke einen Gottsucher zu nennen, wäre demnach zu kurz gegriffen, denn das Wort legt nahe, was Rilke gerade abwehrte, wenn er vom kapellenlosen Glauben spricht, der leise seine Wunder tue. Anfangs redet er den Nachbar Gott mit Du an, bereits ahnend, dass dieser Nachbar abwesend ist: Und meine Sinne, welche schnell erlahmen, sind ohne Heimat und von dir getrennt.
Bis in sein Spätwerk hinein sucht Rilke die Spur Gottes in der Welt und in den Menschen. Denn auch der abwesende Gott hinterlässt paradoxerweise seine Spuren. Das ist der atheistische Stachel in jeder Mystik. Rilkes Wort dafür lautet Weltinnenraum.
Wie ein Eremit in der Wüste auf Erleuchtung wartet, so harrt Rilke, immer öfter Weltflüchtling auf abgeschiedenen Schlössern, der Worte, die das Paradox des anwesend-abwesenden Gottes fassen. Er hat dabei etwas von einem säkularen Mönch, einem fernen – oft auch traurigen – Magier, der weiß, dass die von ihm gewollte fortwährende Vergeistigung ihre Grenze im eigenen Leib findet. Und der bleibt sterblich.
Dieses Buch will Rilke als modernen Mystiker vorstellen, als einen Beschwörer der Als-ob-Existenz Gottes. Das ist einer, der nicht in Einheitsvisionen schwelgt, sondern voller Skepsis deren Bruchstücke aufhebt. Mystik sei die Wiedergeburt Gottes auf dem Grunde der Seele, hatte Meister Eckhart gesagt. Und Robert Musil spricht für das 20. Jahrhundert von der »taghellen Mystik« (im Unterschied zur liederlichen »Schleudermystik«). Die »taghelle Mystik« rechnet in höchster Präzision mit der Leerstelle, die der abwesende Gott in dieser Welt hinterlassen hat. Womit sich diese füllen ließe, danach fragt Rilke in seiner Dichtung.
Mit Clara Westhoff zusammenleben kann er nicht, die Ehe funktioniert auch als Künstlerehe nicht – das weiß er nach nicht einmal einem gemeinsamen Jahr. Seiner Tochter Ruth (die sich 1972 das Leben nehmen wird) ein guter, also in Lebenskrisen präsenter Vater sein vermag er ebenfalls nicht. Sie bleibt ihm dauerhaft fremd, anders als jene feengleichen »Wahltöchter«, um deren Gunst er wirbt.
In den letzten einsamen Lebensjahren in der Schweiz erscheint ihm das Deutsche – auch die deutsche Sprache – immer fremder, in eine Ferne gerückt, die ihn nichts mehr angeht. Rilke, in der französischsprachigen Schweiz lebend, hat einen Traum: Er will ein französischer Dichter werden. Diesen späten Traum lebt er mit aller ihm verfügbaren Imaginationskraft.
KAPITEL I
Anfänge
Prag als dunkler Traum
Im Herbst 1895 – kurz vor Weihnachten – erscheint der Gedichtband »Larenopfer«. Die Laren sind Schutzgötter des Hauses, die man rituell beschwören muss. Der Schutz, den sie gewähren, ist nicht umsonst, wie der Jungdichter bereits ahnt – man muss ihnen ein Opfer bringen. Was für eines, das scheint jedoch erst nach und nach klar zu werden.
Hier ist Prag ständig präsent, Rilkes Gefühls- und Vorstellungswelt wird beherrscht vom Gegenüber dieser alten und dunklen Stadt, die er zunehmend als feindlich empfindet. Da heißt es dann: Alte Häuser, steilgegiebelt, / hohe Türme voll Gebimmel, – / in die engen Höfe liebelt / nur ein winzig Stückchen Himmel. (»Auf der Kleinseite«)
Oder auch ganz direkt im Anspracheton: Gern steh ich vor dem alten Dom; / wie Moder weht es dort, wie Fäule, / und jedes Fenster, jede Säule / spricht noch ihr eigenes Idiom. (»Bei St. Veit«)
Obwohl der Grundton ein sentimentaler ist, blitzt doch ab und zu bereits seine hier noch unentwickelte Fähigkeit auf, Gesehenes in jene Denk-Bilder zu bringen, die eine eigene Realität behaupten: Die Stadt verschwimmt wie hinter Glas. (»Im alten Hause«)
Prag bleibt ständiger Hintergrund seiner frühen Dichtung. Seine Kindheit war keine glückliche, so jedenfalls wird er es später darstellen. Wenn sie unglücklich war, dann jedoch auf komfortable Weise. Denn die Familie Entz, aus der seine Mutter stammt, gehörte zur deutschsprachigen Oberschicht der Stadt. Nur ein Adelstitel fehlt – lange Zeit – noch zum vollendeten Prestige. Jedoch, seine Eltern blieben einander fremd (beide hatten sich offenbar ineinander getäuscht) – und trennten sich 1884, da war Rilke gerade acht Jahre alt.
Geboren am 4. Dezember 1875 in der Heinrichsgasse 19 (das Haus wurde 1924 abgerissen), war er ein schwächliches Siebenmonatskind. Zwei Wochen später fand die Taufe statt. Das Kind erhält die Namen René Karl Wilhelm Johann Josef Maria. Der Mädchenname, der manchen später irritieren wird, steht für die Jungfrau Maria, denn Rilke erscheint seiner Mutter Sophie (»Phia«) als »Marienkind«. Sie war bei seiner Geburt vierundzwanzig Jahre alt, Tochter des Fabrikanten und Kaiserlichen Rats Carl Entz. Sie genoss eine sorglose Kindheit in einer der wohlhabendsten und anerkanntesten Prager Familien, wuchs in einem Barockpalais in der Herrengasse 8 auf – auch dieses Gebäude wurde später abgerissen.
Sophie war gewiss verwöhnt und egozentrisch, mit Hang zur Dichtung und starkem Drang zur Unabhängigkeit. Gegen ihre komfortable Kindheit kam ihr die Ehe mit Josef Rilke wie ein gesellschaftlicher Abstieg vor, den sie ihrem Mann nie verziehen hat.
Als sie 1873 heirateten, war der fünfunddreißigjährige Josef ein militärisch – in der Schlacht von Solferino – erprobter Kadett. Phia, der ihr Sohn Oberflächlichkeit in allen Dingen attestieren wird, hatte sich vielleicht mehr in den attraktiven Uniformträger verliebt als in den Mann. Als Josef Rilke zwei Jahre später auf eigenes Ersuchen aus dem Militärdienst ausschied, nahm Phia das als persönliche Demütigung.
Vater Josef hatte jahrelang unter einer chronischen Halserkrankung gelitten, musste darum immer wieder auf Genesungsurlaub fahren; aber die Genesung blieb aus. Vielleicht gelang ihm deswegen der Sprung in die Offiziersränge nicht. Aus Enttäuschung über die ausbleibende Beförderung quittierte er schließlich seinen Dienst.
Josef (1838–1906) und Sophie (Phia) Rilke (1851–1931), geb. Entz. Das Foto zeigt René Rilkes Eltern als Brautpaar. © DLA Marbach/Fotostudio Joh. Hassel
Sein Bruder Jaroslav war gesellschaftlich als Jurist erfolgreicher und wurde vom Kaiser als Ritter von Rüliken in den Adelsstand erhoben – aber davon blieb, zu Phias Leidwesen, der Rest der Familie ausgeschlossen.
Doch auch Onkel Jaroslav musste mehrere Schicksalsschläge hinnehmen. Seine Söhne starben – und darum setzte er als Nachfolger seiner Kanzlei auf den Sohn seines Bruders, dessen Ausbildung er mit zweihundert Gulden im Monat förderte, was Rilke dann – der nie die Absicht hatte, Jurist zu werden – bis zu seinem sechsundzwanzigsten Lebensjahr finanziell über Wasser halten würde. Auch seinem aus der Armee ausgeschiedenen Bruder Josef hatte Jaroslav noch eine Stelle verschafft – bei der expandierenden k. u. k. Turnau-Kralup-Prager Eisenbahngesellschaft, wo jener es immerhin zum Inspektor brachte. Aber eine Karriere bei der Bahn galt in den Augen seiner Frau nichts – und das ließ sie ihn spüren. Vielleicht auch darum, so lässt sich jedenfalls aus Andeutungen Rilkes schließen, begann der Vater immer mehr zu trinken.
Dennoch sind die Sympathien des Kindes – und auch noch des Mannes – klar verteilt. Als er bereits auf die fünfzig zugeht, schreibt Rilke am 6. Januar 1923 an die Gräfin Sizzo: Wenn ich mich recht erinnere, wie ich – oft bei äußerster Schwierigkeit, einander zu verstehen und gelten zu lassen – meinen Vater geliebt habe! Oft, in der Kindheit, verwirrten sich meine Gedanken, und auch das Herz erstarrte mir über die bloße Vorstellung, er könnte einmal nicht mehr sein; mein Dasein schien mir so völlig durch ihn bedingt (mein von vornherein doch so anders gerichtetes Dasein!), daß sein Fortgehen meiner innersten Natur gleichbedeutend war mit meinem eigenen Untergang …[1]
Tatsächlich wird der Vater bereits 1906 sterben, als Rilke erst dreißig Jahre alt ist – seine Mutter Phia und sogar seine Großmutter Entz jedoch werden Rainer Maria Rilke überleben. Womit auch gesagt ist, wer in der Familie Rilke lebensstark bis zur Dominanz war: die Frauen.
Rilke haftete lebenslang ein Makel an: Er war kein Mädchen geworden! Seine ältere Schwester Zesa war ein Jahr vor seiner Geburt gestorben, gerade einmal eine Woche alt. Der dann geborene Sohn René (ihr einziges Kind) blieb für Phia im Grunde immer nur ein nie ganz vollwertiger Ersatz für jene Tochter, deren Verlust die junge Mutter so schwer getroffen hatte. Umso aufmerksamer die Sorge um den Zweitgeborenen, den sie verzärtelte und – bis er fünf Jahre alt war – Mädchenkleider tragen ließ. Herzensnah waren sich Sohn und Mutter nie. Doch liest man die Briefe Rilkes an seine Mutter, dann erstaunt die beharrliche, oft sehr ausführliche und immer höfliche Aufmerksamkeit, mit der sich der Sohn den Angelegenheiten seiner Mutter widmet. Phia zog nach der Trennung von ihrem Mann erst nach Wien und lebte dann vor allem auf Reisen (was Rilke ihr später gleichzutun begann).
Er bemühte sich um Freundlichkeit, half aus der Ferne per Brief in praktischen Dingen, wo er konnte – Hauptsache, sie kam ihm nicht zu nah. Denn ihre Nähe – aber das durfte sie nicht erfahren – ertrug er nicht. Sohnesliebe also war da nicht – aber einige Verhaltensmuster seiner Mutter sollte Rilke kopieren. So etwa die Neigung, sich zu verkleiden, eine Rolle für andere zu spielen. Äußerlichkeiten wie Kleidung und Wohnungseinrichtung blieben für Rilke eben nie bloße Äußerlichkeiten, sie wurden gleichsam zum Echoraum seiner ritualisierten Innerlichkeit.
Eigentlich hätte ihm die Mutter näher sein müssen als der Vater, doch das Gegenteil war der Fall. Vor allem Lou gegenüber, die auch nach der Trennung eine Art Ersatzmutter für ihn sein wird, der er seine verborgensten Gedanken und Gefühle beichtet, spricht er in drastischen Tönen von seiner Mutter. So auch 1904, als sie ihn in Rom besucht. Jede Begegnung mit ihr sei eine Art Rückfall. Nein, alles in ihm rebelliert gegen seine Mutter. Phia wirkt auf Männer immer noch jugendlich, ist selbstbewusst, literarisch ambitioniert und darin Lou durchaus ähnlich. Ihr selbst wird er nicht ansatzweise wagen zu sagen, was er Lou schreibt: Wenn ich diese verlorene, mit nichts zusammenhängende Frau, die nicht altwerden kann, sehen muß, dann fühle ich wie ich schon als Kind von ihr fortgestrebt habe und fürchte tief in mir, daß ich nach Jahren und Jahren Laufens und Gehens, immer noch nicht fern genug von ihr bin, daß ich innerlich noch irgendwo Bewegungen habe, die die andere Hälfte ihrer verkümmerten Gebärden sind, Stücke von Erinnerungen, die sie zerschlagen in sich herumträgt; dann graut mir vor ihrer zerstreuten Frömmigkeit, vor ihrem eigensinnigen Glauben, vor allem diesen Verzerrten und Entstellten, daran sie sich gehängt hat, selber leer wie ein Kleid, gespenstisch und schrecklich.
Noch ein schrecklicher Engel, der in Rilke wohnt? Niemals wird er der Mutter gegenüber sich mit dem Namen nennen, den ihm seine ersatzmütterliche Geliebte bereits 1897 gab: Rainer. Die Briefe an seine Mutter unterzeichnet er immer mit René, nicht selten auch Dein alter René.
Nein, der Aufstand, der nach außen geht, die Rebellion bleibt aus. Keine Explosion folgt, nur ab und zu eine Implosion, wie im gerade angeführten Brief, wohl wissend, dass sie auch eine Art Kapitulation ist. Oder doch auch eine höhere Einsicht, die sich keine offen ausgestellte Selbstgerechtigkeit leisten will? Denn, wie er Lou Andreas-Salomé 1904 gesteht, an einer Tatsache kann er doch nichts ändern: Und daß ich doch ihr Kind bin; daß in dieser zu nichts gehörenden, verwaschenen Wand irgend eine kaum erkennbare Tapetenthür mein Eingang in die Welt war – (wenn anders ein solcher Eingang überhaupt in die Welt führen kann …)![2]
Rilke, der ewige Sohn auf der Suche nach einer Mutter, die diesen Namen verdient. Seinem Vater billigt er das zu – obwohl dieser ihn zum Offizier machen wollte und auf die Kadettenanstalt nach St. Pölten schickte und vehement gegen den Einfluss der Mutter ankämpfte, die in ihrem verzärtelten Sohn früh den Dichter erblickte? Nein, konsequent ist es nicht, was Rilke gegen seine Mutter sagt, vermutlich auch nicht gerecht. Und wenn er seinen gesellschaftlich gescheiterten, trunksüchtigen Vater so vehement verteidigt, der ihm ein wirklicher Vater gewesen sei, was denkt er dann über seine eigene Rolle als – ständig abwesender – Vater einer dreijährigen Tochter? Aber daran denkt er eben nicht, er ist hier der ewige Sohn und nicht der Vater – diese Rolle kann und will er nicht spielen.
Der fünfjährige René Rilke 1880 in Mädchenkleidern. Rilke fühlte sich als Kind von der Mutter ausstaffiert, ausgestellt und ungeliebt. Doch der Blick verrät auch frühes Selbstbewusstsein, das sich bald zum Sendungsbewusstsein steigern wird.© Schweizerisches Literaturarchiv, Bern
Mit Dichtung vertraut macht ihn jedoch seine Mutter, nicht sein Vater, der von solch verblasenen Dingen nichts wissen wollte. Dennoch wirft Rilke ihr vor, sie habe mit ihm wie mit einer Puppe gespielt. Dabei las Phia auch Schiller, den sie bewunderte, rezitierte ihn laut bei der Hausarbeit, las ihrem Sohn früh – noch bevor er selbst lesen konnte – Gedichte vor, die ihm so zu etwas Selbstverständlichem wurden. Als er sieben war, begann Rilke Gedichte abzuschreiben und lernte Schillers Balladen auswendig.
Phia selbst fühlte sich zur Schriftstellerei berufen, und ihr Sohn wird sich später eifrig um den Druck der »Ephemeriden« – zumeist konventionelle Sentenzen und Aphorismen – bemühen. Immerhin waren sie dem Insel Verlag noch 2002 eine Ausgabe wert. Da lesen wir dann etwa: »Das ganze Mineralreich genügt oft den Menschen nicht, um eine unglückliche Frau zu steinigen.« Oder auch: »Die Sünde braucht Sekunden, die Buße fordert Jahre.« Ebenso: »Man bewundert die Tugend und wählt das Laster.«[3] Das ist nicht gerade Weltliteratur, aber auch nicht ausgesprochen peinlich. Nur, es bleibt durch und durch ausrechenbar – und das lässt Rilke so gegen die Weltsicht seiner Mutter revoltieren.
Woher kam bei diesen dennoch vielen Gemeinsamkeiten (ein Leben auf Reisen, manischer Wille zur Unabhängigkeit, dabei lesen und schreiben) die mitunter bis zum Hass gesteigerte Ablehnung der Mutter? Diese ist offenbar eine Schutzbehauptung Rilkes, ein forciertes: Ich bin anders! Und wenn ich seelisch deformiert worden bin, dann ist dies Schuld meiner Mutter, die mir keine richtige Mutter war!
Vielleicht lag die von ihm empfundene Fremdheit zwischen ihnen daran, dass ihm die Mutter mit ihrer ausgestellten Neigung zu Kunst und Dichtung, die sie ihm früh vermittelt hat, nah sein sollte (und auch wollte), es aber nicht sein konnte.
Während es ihm ernst mit den Worten ist, tödlich ernst sogar, kokettiert Phia in seinen Augen bloß damit. Ein Sakrileg für ihn. Diese Kluft ließ sich nicht überwinden. Und am schlimmsten für ein Kind: Rilke erfuhr, dass die Mutter mehr für Fremde als für ihn da war. Immerhin vermochte Phia andere mit ihrem Charme und Geist durchaus zu bezaubern.
Ralph Freedman wird über Phia schreiben, ihr »fruchtloser Feminismus« sei an ihrer »pseudoreligiösen Sentimentalität«[4] gescheitert. Aber man lese die zwei umfangreichen Bände mit Briefen Rilkes an seine Mutter. Sie beginnen 1896 mit dem jungen Mann von zwanzig Jahren und enden mit dem sterbenden Fünfzigjährigen 1926 in Muzot. Das ist nicht nur äußerlich, nicht bloß briefliche Konversation, sondern der Versuch des jungen Mannes, der Mutter per Brief nah zu sein. Rilke lässt Phia an seinem Leben, das ihm selbst immer unbegreiflicher wird – aus der Distanz – teilhaben. Er will diese Verbindung zur Herkunftswelt, die ihm suspekt bleiben muss, unter keinen Umständen ganz kappen! Darum entstehen diese lesenswerten Briefe über ein Vierteljahrhundert lang in dichter Folge.
Seiner Jugendliebe Valerie von David-Rhonfeld, der der Siebzehnjährige übermütig-pubertäre Liebesbriefe schreibt, in denen er sie mit »Schatzi« und »Piepmatz« anspricht und selbst als »Hidigeigei« unterzeichnet, wird er an seinem neunzehnten Geburtstag, am 4. Dezember 1894, einen bekenntnishaften Brief ganz anderen Tons schreiben. Hier bricht es aus ihm heraus: Du kennst die lichtarme Geschichte meiner verfehlten Kindheit und Du kennst diejenigen Personen, welche die Schuld daran tragen, dass ich nichts oder wenig Freudiges aus jenen Werdetagen zu merken vermag. Du weißt, dass ich einen großen Theil des Tages einer gewissensarmen und sittenlosen Dienstmagd überlassen war, und dass diejenige Frau, deren erste und nächstliegende Sorge ich hätte sein sollen, mich nur liebte, wo es galt, mich in einem neuen Kleidchen vor ein paar staunenden Bekannten aufzuführen.[5]
Sophie (Phia) Rilke als junge Frau. Nach der Trennung der Eltern 1886 lebt die Mutter zumeist auf Reisen. Phia verbindet starkes Unabhängigkeitsbewusstsein mit strengem Katholizismus – eine Mischung, die Rilke unangenehm bleiben wird.© DLA Marbach
Das klingt ungerecht – so ungerecht, wie die Verteilung von Liebe in der Welt nun einmal ist. Sogar im Gedicht wählt er sich die Mutter zum Feind. So selten wie möglich versucht er Phia zu treffen, und nach einer letzten Begegnung 1915 in München geht er ihr ganz aus dem Wege – elf Jahre lang. Im Anschluss an diese Begegnung notierte er in seinem Mutter-Hassgedicht »Ach wehe, meine Mutter reißt mich ein«: Von ihr zum mir war nie ein warmer Wind. / Sie lebt nicht dorten, wo die Lüfte sind. / Sie liegt in einem hohen Herz-Verschlag / und Christus kommt und wäscht sie jeden Tag.
Angesichts seiner Mutter ist er wieder der kleine Junge im Mädchenkleid, der um Aufmerksamkeit bettelt. Sie ist und bleibt stärker als er – und das verzeiht er ihr nicht.
Doch nicht nur die Dichtung ist es, die bereits das Kind in Bann schlägt, das nun wie selbstverständlich anfängt, ebenfalls zu dichten – ein auf den ersten Blick verblüffender Gegensatz bestimmt sein Denken und Fühlen ebenso stark und andauernd.
Dieser Anstoß kommt vom Vater, der ihn zum Soldaten machen will – nein, zum Offizier natürlich, etwas, das ihm selbst verwehrt blieb. Und das Seltsame passiert: Das Kind ist begeistert – und ganz hört Rilke nie auf, von Uniformen und militärischen Heldentaten zu träumen. Der Vater, um der Verweichlichung durch die Mutter etwas entgegenzusetzen, schenkt ihm Zinnsoldaten und Hanteln. Sein Sohn soll ein ganzer Mann, ein Held werden!
Die Zinnsoldaten sind willkommen, die Hanteln nicht. Sosehr sich Rilke auch – nicht zuletzt unter dem Einfluss von Lou Andreas-Salomé und ihres Mannes Friedrich Andreas – zu einer gesunden, naturnahen Lebensweise bekannte, mit Barfußgehen, viel frischer Luft und vegetarischer Kost – Sport ist ihm in jeder Gestalt verhasst. Auf der Kadettenanstalt in St. Pölten hat der Zögling in allen Fächern sehr gute und gute Noten – nur in Sport erhält er beständig ein Ungenügend.
Die ersten beiden Schuljahre verbringt René bei den Piaristen (ein katholischer Orden, der sich auf die Erziehung von Kindern spezialisiert hat): Es sind Priester, die hier unterrichten. Diese Schule gilt der gutbürgerlichen deutschen Minderheit in Prag als die eleganteste, in die man seine Kinder schicken kann. Mit fünf Jahren kommt Rilke hierher, immer von Phia hingebracht und auch wieder abgeholt. Manche nennen ihn unverblümt ein Muttersöhnchen.
Mit tschechischen Kindern zu spielen, erlaubt ihm die Mutter nicht, für sie sind Slawen minderwertig. Das ist ein Dünkel, der desto stärker wird, je mehr die eigene gesellschaftliche Stellung infrage steht. Phias Nationalismus wächst in dem Maße, wie sie an der Seite ihres Mannes Josef, des Bahnangestellten, ins Kleinbürgertum absinkt.
Umso wichtiger für die Mutter, den vornehmen Schein nach außen aufrechtzuerhalten. Sie trägt sorgfältig ausgesuchte schwarze Kleider – und René, ernst wie ein kleiner Erwachsener neben ihr schreitend, betreibt auf seinem täglichen Schulweg Konversation mit ihr, bald schon auf Französisch.
Es ist eine absurde Szenerie, die auf den Dauerdruck Phias zurückgeht: Als man René in der Schule fragt, ob er nicht auch Tschechisch lernen will, verneint er das überaus förmlich – auf Französisch.
Der spätere Sprachphilosoph Fritz Mauthner, der wohl kaum zufällig ein umfängliches Lexikon des Atheismus veröffentlichen wird, erinnert sich wie der ebenfalls in Prag aufgewachsene Franz Werfel an die Piaristenschule – und eine immer provinzieller werdende deutsche Oberschicht: »Piaristen, schlechte Christen!«, so riefen die Prager Gassenjungen den vorbeistelzenden Piaristen-Schülern hinterher.
Peter Demetz beschreibt in seinem Buch »René Rilkes Prager Jahre« überaus drastisch die »Atmosphäre aus Talmi und Unmut«, in der das Kind lebt. Aufgewachsen war Phia in einem vornehmen, mit wertvollen Antiquitäten ausgestatteten Palais. Die Ehe mit Josef empfindet sie auch darum als demütigend, weil sie sich hier bei der Einrichtung mit lauter Ersatzstoffen begnügen musste. Billige Nippesfiguren, ein Bambuswandschirm mit Goldvögeln und Serien mit italienischen Ansichten können den sozialen Abstieg kaum kaschieren.
In dieser Atmosphäre von Zerfall und falschem Schein lernt Rilke vor allem eins: genau zu beobachten. Gesten und Worte, auch jene, die nicht ausgesprochen, sondern zurückgehalten werden, dieses Alphabet der Lüge hat Rilke ständig vor Augen. Demetz schreibt: »Am Rande einer zerstörten Ehe fand sich René früh erregt von einer fast pathologischen Empfänglichkeit für die Nuancen einer makellosen Ersatzwelt, die er als Ritter oder Dichter beherrschte. In einer schäbigen Mietswohnung, in der ›alles so unecht und trügerisch war, von den Bronzetellern aus Papiermaché bis zu dem Wein in den Flaschen, die so teure Etiketts trugen‹, begann René die Welt allzu früh in Außen und Innen zu zerfallen.«[6]
Als Rilke 1884 in die dritte Klasse kommt, ändert sich in der Familie alles. Die Eltern haben beschlossen, sich zu trennen, Phia nimmt sich eine eigene Wohnung, fährt auch immer häufiger nach Wien, wo sie bald darauf wohnen wird – und das Kind bleibt in Prag bei einer Dienstmagd zurück, selbiger, die Rilke Valerie von David-Rhonfeld gegenüber »gewissensarm« nennen wird. Im Sommer 1885, ein Jahr nach der Trennung der Eltern, verbringt René den Sommer mit der Mutter (noch als junger Mann wird er sie nicht selten auf ihren Reisen begleiten, mehrmals besucht er sie auch in Arco, ihrem bevorzugten Urlaubsort am Gardasee). Von unterwegs schreibt er jubilierend an den Vater, er übe sich fleißig im Dichten und werde, wenn es so weitergehe, gekrönt mit dem Lorbeerkranze nach Prag zurückkehren. Der Vater vernimmt es mit Missfallen.
Was sollte aus dem Scheidungskind werden? Für solche Fälle war die Kadettenschule St. Pölten prädestiniert. Sie galt als Kaderschmiede des k. u. k. Offiziersmilieus. Tatsächlich war die Schulform eine militärische, die Schüler bekamen Uniformen, die Lehrer trugen größtenteils Uniformen – aber eine bloße Drillmaschine war St. Pölten nicht. Man vermittelte ein solides Wissen, respektierte die Persönlichkeit der Schüler. René war anfangs von der Aussicht, Offizier zu werden, begeistert. Offiziere sind Aristokraten! Diese Verbindung wird sich zeitlebens in seiner auf den Adel fixierten Vorstellungswelt erhalten.
Aber es dauert noch zwei Jahre, bis er – da ist er zehn – 1886 tatsächlich nach St. Pölten kommt. Er folgt damit dem Willen seines Vaters, der darunter leidet, ein verhinderter Offizier zu sein. Die Mutter ist alles andere als davon begeistert, dass ihr Dichter-Sohn auf eine Kadettenschule gehen soll. Aber sosehr dann Rilke, der einerseits den Offizier als Aristokraten verklärt und andererseits unter der militärischen Erziehung leidet, die Zeit im Rückblick eine Hölle nennt, so wenig wird er diese negative Erfahrung – die Atmosphäre einer tristen Kaserne – seinem Vater anlasten. Für ihn ist immer die Mutter schuld, Phia, der er in seinen vielen Briefen nie ein böses Wort sagen wird. Die Mutter leidet mit ihrem Sohn in St. Pölten – für Rilke aber ist auch dieses Mitgefühl bloße Maskerade. Erhalten haben sich Fotos von Rilke als Kadett, auf deren Rückseite die Mutter notierte, dies sei das »Gefängnis« ihres armen Sohnes.
Das verwöhnte Kind René aber wird nicht, wie zu befürchten war, das Opfer einer grausamen Kadettenclique. Schon hier verbreitet Rilke eine Aura der Distanz, die ihn schützt. Er schreibt sogar ganz offen seine Gedichte und legt sie dem Deutschlehrer zu Beginn des Unterrichts auf den Tisch. Der liest sie der Klasse vor – diese schweigt, wohl eher irritiert als voller Ehrfurcht, aber zu lachen wagt niemand. Rilkes Haltung ist so konsequent, dass niemand der Mitschüler die Rolle, die er hier spielt, in Zweifel ziehen will: Rilke, schon hier so ganz und gar ein Dichter, den sogar gröbere Naturen bereit sind gelten zu lassen.
Als Kadett in St. Pölten (1886–1890). Rilke wird dies später eine traumatische Zeit nennen. Trotz seiner Ablehnung des Militärischen bleibt sein Faible für Uniformen und eine Romantisierung militärischer Aktion, wie sie sich im »Cornet« zeigt.© Schweizerisches Literaturarchiv, Bern
Dennoch, obwohl es sich auf seine Art zu behaupten vermag, leidet das Kind, das hier den Erwachsenen spielen soll – und reagiert mit permanenten Krankheitszuständen. Wenn René krank ist, dann eilt die Mutter herbei, ist bei ihm und tröstet ihn. Bestärkt ihn auch darin, dass er hier am falschen Ort sei. Diese Gemeinsamkeit, das Sprechen über Krankheiten und ihre Vermeidung, wird dann für Rilke, als er längst erwachsen ist, zu einer der wenigen gangbaren Brücken, die ihn noch zu seiner Mutter führen, wenigstens per Brief.
An seine Jugendliebe Vally wird der neunzehnjährige René über dieses Martyrium schreiben: Meine Freiheit aus der Militärschule! Ich habe sie errungen! Aber damals – noch in der Schule, da lag ich einmal vor dem Bilde des Jesukindes, das die Schafe weidete, auf den Knien, da betete ich einmal, tausendmal, sterben zu dürfen. … Das Fieber kam, das Fieber ging. Mein Körper war ein viel zu festes Gefängnis für die lichtdurstige Seele. Ich stieg nachts aus dem Bett, trat, wie ich war auf den Gang und stellte meine noch warme entblößte Brust dem Winterwinde bloß, der durchs geöffnete Fenster mit schneidiger Schärfe hereinblies. Die Kälte zog mir durch Mark und Bein … und den nächsten Tage schrieb ich an eine Person, die ich damals Mutter nannte: »Ich bin sehr zufrieden und glücklich in der Anstalt.«[7]
Das Zeugnis, das Rilke 1887 erhält, nach einem Jahr St. Pölten, ist positiv, ihm wird bescheinigt »still, zaghaft, gutmütig« zu sein. Ein unscheinbarer Zögling. In deutscher und französischer Sprache erhält er die Noten Sehr gut und Gut. Sein Klassenrang ist im hinteren Mittelfeld, als 35. unter 51 Zöglingen. In den kommenden beiden Jahren verbessert er sich und liegt auf Platz 7 und 8 in seiner Klasse. Nur in Turnen bleibt er ein Totalausfall mit Note Ungenügend. Aber auch hier gibt es einen Lichtblick. 1890 wird neben Fechten (da erhält er ein Genügend) das Fach »Zimmergewehr-Scheibenschießen« eingeführt. Das gefällt Rilke – hierin erhält er dann auch ein Sehr gut. Seiner Mutter schreibt er launige Briefe, in denen es heißt, er sei gesund, heiter und froh. Offenbar gibt es zwei Zöglinge mit Namen Rilke in St. Pölten – einer ist bei Mitschülern und Lehrern respektiert und behauptet sich in der Masse der Gleichaltrigen, und der andere leidet, aber das still in sich hinein. Im letzten Schuljahr der Unterrealschule (da ist er vierzehn) beginnt er eine »Geschichte des dreißigjährigen Krieges« zu schreiben (achtzig Seiten davon haben sich erhalten).
Auch die Aufnahme in die Militär-Oberrealschule in Mährisch-Weißkirchen besteht er 1890 – und landet im vorderen Mittelfeld. Doch ab Ende 1890 ist er fast ständig krank, bekommt eine Lungenentzündung – und wird beurlaubt. Hat er das Ziel aufgegeben, Offizier zu werden? Nein, hat er nicht. Irgendetwas fasziniert ihn an dieser Berufsaussicht – die militärische Realität, die er unter den Zöglingen erlebt, kann es nicht sein. Der Vater gibt offenbar Phia die Schuld am labilen Zustand seines Sohnes und schreibt an die Mutter: »Bitte fasse Dich kurz in den Briefen, rege René durch ja nichts auf, ebenso lasse ja das Dichten bei René nicht aufkommen.«[8] Ist es das, was in ihm gärt, das Wissen, dass kein Offizier, sondern ein Dichter in ihm steckt?
Schwer zu sagen, gehört doch einer seiner frühen Lieblingsdichter, Detlev von Liliencron (den er wenige Jahre darauf in Vorträgen und Aufsätzen rühmen wird), beiden Sphären an, als Offizier und Dichter. Später wird Rilke schreiben, dass es ihm im Jahre 1891 gelang, den Austritt aus der Militärerziehung zu erzwingen. Der Vater gibt am 3. Juni 1891 die Genehmigung, dass Rilke wegen »dauernder Kränklichkeit« die Militärschule in Mährisch-Weißkirchen – ohne Abschluss – verlassen kann. Die nächsten Monate hält Rilke sich in Prag auf, geht viel spazieren – in seiner Uniform, die er liebt.
Einige Zeit lang trägt Rilke später das Projekt eines »Militärromans« mit sich herum, der jedoch ungeschrieben bleibt. In nächtlichen Tagebuchaufzeichnungen von November 1899 notiert er dazu: Seltsam, nachts wurde mir plötzlich der Militärroman so dringend, daß ich glaubte, ich würde, wenn nicht sofort, so doch wenigstens heute, beginnen müssen, ihn zu schreiben. Was ist das, was ihn dazu hinzieht und zugleich wieder abstößt? Auch scheint mir der Stoff, je mehr ich mich an ihn verliere, immer noch unmöglich und grob; noch fühle ich nicht die Geschicklichkeit, diese Gesellschaft von Knaben in ihrer ganzen Rohheit und Entartung, in dieser hoffnungslosen und traurigen Heiterkeit zu zeigen … diese ganze Masse beständig als solche wirken zu lassen, erscheint mir ebenso wichtig wie schwer.[9]
Die Masse der Zöglinge tritt ihm als »gefährliches Wesen« entgegen, aber jeder Einzelne von ihnen sei doch eben auch ein Kind. Ein Widerspruch, der für Rilke nur schwer auflösbar ist.
Als einziges Kapitel des geplanten Romans entsteht in diesen Nächten »Die Turnstunde«, Rilkes schwache Stelle seiner Zöglingsexistenz offenlegend. In diesem Karl Gruber, dem blassen Mondsüchtigen mit der flachen Brust und der im Speichel watenden Stimme,porträtiert er sich selbst. In dieser sehr bekannt gewordenen Erzählung stellt sich Rilke mit vierundzwanzig Jahren auch als starkes Prosatalent vor. Der Zögling Gruber, ein notorisch schlechter Sportler, dem es bislang noch niemals gelang, beim Stangenklettern überhaupt nur um ein Winziges in die Höhe zu kommen, ist plötzlich von einem wilden Furor getrieben, er ist schnell wie nie und klettert an der Stange bis nach oben.
Das erstaunt alle, einen Moment lang steht er im Mittelpunkt, vereinzelt kommen Bravo-Rufe, verbunden mit der Bemerkung, er wolle es wohl von der letzten in die erste Riege (die mit den besten Turnern) schaffen. Dann ist die Aufmerksamkeit für die plötzliche Energieleistung des Jungen auch schon wieder vorbei, und Karl Gruber wirkt ganz plötzlich sehr erschöpft, zieht sich leise in die Nische zurück, setzt sich nieder, schaut ängstlich um sich und holt Atem, zweimal rasch, und lacht wieder und will etwas sagen … aber schon achtet niemand mehr seiner. Er driftet weg, mitten in der geschäftigen Masse wird er zum Einzelnen. Aber um welchen Preis? Der Aufsicht führende Unteroffizier ruft ihm zu, wieder mitzuturnen. Aber es ist, als hätte Gruber nicht gehört; er schaut geradeaus in den Saal hinein, aber so, als sähe er etwas Unbestimmtes, vielleicht nicht im Saal, draußen vielleicht, vor den Fenstern, obwohl es dunkel ist, spät und Herbst.[10]
Plötzlich rutscht Karl Gruber von der Bank, rührt sich nicht mehr. Ein Arzt wird gerufen, der Junge in einen Nebenraum getragen. Inzwischen geht der Sportunterricht weiter: Aber doch sind alle Bewegungen anders als vorher; als hätte ein Horchen sich über sie gelegt. Und dann werden die Zöglinge zum Antreten gerufen. Der Oberleutnant tritt hinzu. Und jetzt das Kommando: »Achtung!« Pause und dann, trocken und hart: »Euer Kamerad Gruber ist soeben gestorben. Herzschlag. Abmarsch!‹«[11]
Wie sollen die Kinderseelen die Dimension der Mitteilung verstehen? Gar nicht, die meisten flüchten in derbe Spaßmacherei. Man versucht einen Blick auf den Toten zu werfen. Einem gelingt es, und er schüttelt sich vor Lachen: Er kann kaum weiter: »Ganz nackt ist er und eingefallen und ganz lang. Und an den Fußsohlen ist er versiegelt …« Und dann kichert er, spitz und kitzlich … Das ist es, was Rilke an der Masse so zuwider ist: ihre Seelenlosigkeit und Brutalität.
»Die Turnstunde« gilt – in ihrer frühen stilistischen Vollkommenheit – vor allem als ein Dokument des Pazifismus, der Ablehnung jenes auf Heldentum und Heldentod programmierten Soldat-Seins. Das ist aber nur die eine Seite von Rilkes Verhältnis zum Militärischen. Die andere, die bejahende, geradezu das Soldatische verklärende Seite, wie sie sich etwa im »Cornet« zeigen wird, bleibt jedoch präsent.
Aber vielleicht war Rilkes Abschied aus Weißkirchen noch von etwas anderem getrieben, einem Verdacht gegen ihn, der zu der Zeit zerstörerisch wirken konnte. Er selbst wird davon seiner Jugendliebe Vally berichten. Nur einmal habe er sich, der sich unter den Zöglingen als Einzelgänger fühlte, an jemand anderen angeschlossen: Diesmal sollte mein Herz nicht leer ausgehen. Es entwickelte sich eine auf gegenseitiger Übereinstimmung beruhende wahrhaft brüderliche Neigung, und wir schlossen mit Kuss und Handschlag einen Bund – fürs Leben.
Ist das hier Rilkes Coming-out? Wohl eher nicht, obwohl er genau um die weibliche Seite seiner selbst weiß – Frauen zogen ihn, wie sein weiteres Leben zeigen wird, immer stark an. Männer waren ihm eher suspekt. Doch hier fand er den höheren Freundschaftsbund, vereint im Geiste jenes Eros, der von Platon kommt, oder wie Rilke es formuliert: … ich lebte förmlich auf in dem Bewusstsein, dass die abwechslungsarmen Ereignisse meiner Seele in der gleichgestimmten Saite im Freunde forttönen und hinklingen. Der Freund bewundert in ihm den Dichter, und Rilke ermutigt ihn, sich ebenso als solcher zu versuchen. Man ist eifersüchtig gegen jeden, der diesen Kreis stören könnte. Dann muss der Freund für einige Tage zur Beisetzung seiner Großmutter reisen, und Rilke gesteht, er habe zwei thränenvolle, sorggequälte Nächte, den geliebten Freund ferne wissend,verbracht.
Als der Freund nach Tagen zurückkommt, ist er völlig verwandelt, behandelt Rilke kalt und abweisend. Was ist geschehen? Jemand hatte den Freundschaftsbund als homoerotisch verdächtigt, und der Freund, der nun keiner mehr ist, wurde von seiner Familie ultimativ aufgefordert, den Umgang mit diesem »Narren« abzubrechen. Rilke endet: Nachher schloss sich nimmer mein Herz an jemand.[12]
Die Folge der homoerotischen Gerüchte ist, dass die Schulleitung dem Vater nahelegt, Rilke wegen seiner »Krankheitszustände« von der Schule zu nehmen. Er ist tatsächlich hochgradig nervös.
Nach einigen Monaten Müßiggang zur Erholung in Prag besucht Rilke ab Herbst 1891 in Linz die Handelsakademie. Drei Jahre soll die Ausbildung dauern – und hat zum Ziel, dass er danach immer noch Offizier wird, was dieser Ausbildungsweg ihm ausdrücklich erlaubt. Der Mutter, die ihr Leben lang von ihrem Sohn nur wohlgelaunt-positive Nachrichten erhält (obwohl sie diese vermutlich nicht für eine hält), schreibt er am 26. November 1891: Ich habe nur den Rock des Kaisers ausgezogen, um ihn in kurzer Zeit wieder anzuziehen – für immer.[13]
Doch in Linz, gänzlich frei vom militärischen Korsett, begreift er sehr schnell, was er werden will: kein Offizier, auch kein dichtender Offizier, sondern nur noch Dichter. Er schreibt hier einen Großteil der in »Leben und Lieder« versammelten Gedichte und bricht die Ausbildung an der Handelsakademie Linz nach nicht einmal einem Jahr entschlossen ab.
Ein Grund ist sicherlich seine Unlust am »Handel«, zum Anlass aber wird eine Frau. Genauer, eine Affäre, die zum Skandal zu werden droht. Denn der Fünfzehnjährige verliebt sich in ein deutlich älteres Kindermädchen namens Olga Blumauer aus Linz. Im Frühjahr 1892 eskaliert die Situation, da sein Verhältnis ruchbar geworden ist. Der Vater wird von Rilkes Wirtsleuten nach Linz gerufen – der Sohn verspricht, die Beziehung abzubrechen. Aber kaum ist Josef Rilke abgereist, geht alles weiter wie bisher.
Höhepunkt dieser wilden ersten Liebe des jungen Dichters ist die Flucht des Paares nach Wien. Dort werden sie von der alarmierten Polizei schließlich in einem Gasthaus gefunden, wo sie Unterschlupf gesucht hatten.
Damit endet Rilkes Zeit in Linz – in Prag nimmt ihn die Familie nun bereits wie einen Problemfall auf. Der junge Dichter lässt sich von Augenblicksgefühlen überwältigen, seine Phantasie scheint krankhaft erregt, das ist hinderlich, wenn man einen bürgerlichen Lebensweg vor sich hat.
In diesem Jahr 1892 beschließt der reiche Onkel Jaroslav, etwas für seinen unsteten Neffen zu tun. Er bringt ihn bei seiner (und des Vaters) Schwester Gabriele unter, die von ihrem Mann getrennt lebt und überaus misanthropisch gestimmt ist, setzt ihm darüber hinaus zweihundert Gulden im Monat als Ausbildungsunterstützung aus – damit soll er Jura studieren und später in seine Kanzlei eintreten, sie vielleicht sogar übernehmen.
Rilke hasst die seelisch ausgedörrte Tante geradezu, wie er auch Prag hasst. Das Zimmer, das er bei der Tante bekommt, die eine dunkle, triste Wohnung bewohnt, hat Aussicht auf eine Brandmauer. Den ganzen Tag über fällt kein Strahl Sonne hinein. Aber dennoch hat Rilke Glück, dass der Onkel auf rettende Weise eingreift, im buchstäblich letzten Moment – denn kurz darauf, im Dezember 1892, stirbt er. Seine beiden Töchter, Rilkes Cousinen, verpflichten sich – widerwillig –, das Stipendium, wie von Jaroslav vorgesehen, zu zahlen.
Zurück in Prag, beginnt Rilke sich nun mittels Privatunterricht auf das Abitur an einem Gymnasium vorzubereiten. Sein Vater, der in den Literaturgeschmack Phias offenbar kein Vertrauen hat, schenkt ihm die Werke Shakespeares und Schopenhauers. Und Rilke gelüstet es danach, mit seinen Dichtungen veröffentlicht zu werden. Einen ersten Erfolg in diesem Streben erlangte er bereits im Sommer zuvor. Am 6. August 1891 (da ist er fünfzehn!) veröffentlicht »Das interessante Blatt« in Wien ein Gedicht von ihm. Rilke hatte an einem Preisausschreiben zum Thema »Mit oder ohne Schleppe?« erfolgreich teilgenommen. Und so kann man von ihm die Zeilen lesen: Die Schleppe ist nun Mode …Noch nicht ganz auf der Höhe seiner späteren Texte, aber immerhin etwas Zählbares: seine erste Veröffentlichung!
Die Schüler-Liebe zu Valerie von David-Rhonfeld, erste Gedichte
1895 steht die Abiturprüfung an, auf die sich Rilke nun als Externer vorbereitet. Zwar war der Unterricht in St. Pölten und Weißkirchen kein schlechter, aber Latein und Griechisch standen nicht auf dem Lehrplan. Doch an einem zivilen Gymnasium muss er sich zum Abitur in beiden Fächern einer Prüfung unterziehen.
Rilke ist schnell entflammbar, das betrifft auch seinen Lerneifer, aber die Geduld verlässt ihn ebenso schnell wieder. Da scheint es ein Glück, dass er ein junges strebsames Mädchen aus gutem Haus (Prager Provinzadel) trifft, zumal aus einer Familie, die auch mit der seinen (den Großeltern Entz) verkehrt. Valerie von David-Rhonfeld hilft ihm bei seinem Abiturvorbereitungen – und er verliebt sich sofort in sie.
Der Briefwechsel zwischen beiden hat sich erhalten, auch Rilkes erste Dichtungen, die schließlich in die Bände »Leben und Lieder« und »Larenopfer« einflossen, die der Neunzehnjährige veröffentlichen wird – mit Valeries Hilfe, sprich ihrem Geld, das als Druckkostenzuschuss willkommen ist. Valerie, die Rilke bald nur noch »meine göttliche Vally« nennen wird, ist ein menschgewordenes Kunstgewerbeprodukt der Zeit. Am 9. Januar 1893 schreibt er ihr – gleich nach ihrer ersten Begegnung – einen Brief, in einem so gekünstelten Ton, wie er zu einem drittklassigen Handelsvertreter passen würde: Des gestrigen Abends, der wie alles Schöne allzurasch entfloh, gedenke ich immerdar. Die Frist bis Samstag däucht mir zwar endlos, allein meine angestrengte Beschäftigung gestattet mir nicht einen anderen, früheren Tag festzusetzen. Dessenungeachtet harre ich jenes Samstags sehnsuchtsvoll, der mir Eintritt in Ihr Künstlerparadies, und ein schönes Plauderstündchen mit Ihnen, hochverehrtes Fräulein, gewähren soll.[14]
Wenn etwas – zwischen zwei jungen Leuten – schon so verdreht beginnt, lässt sich dann wieder ein natürlicher Ton finden? Nein, Rilke ist gefangen in einem gezierten Kunstgewerbegestus, in lauter falschen Ekstasen – und kommt bis zum Ende seiner Beziehung zu Vally da nicht heraus. Diese erste Liebe dauert bis zum »mit Auszeichnung« bestandenen Abitur (Vally kontrolliert seine Lektionen) und dem Druck seiner zwei Erstlingswerke, immerhin fast drei Jahre. Man könnte denken, dass er in dieser Zeit all seine falschen Gefühle und nicht gefühlten Worte, sein ganzes rasendes Liebesklischee, aufgebraucht hat – und beginnt zu sich zu kommen –, indem er Prag für immer verlässt.
Aber so weit ist er noch nicht. Das erste von drei Gedichten, die er Vally schickt, hebt an: Äuglein hell und klar / Zähnlein so fein, Rosenmund … Rilke preist Schönheit in den Grenzen des bloß Hübschen. Aber das hat Gründe. Denn er selbst fühlt sich hässlich. Zumindest wird sich Vally – die nie heiratete und sich noch ein Vierteljahrhundert später für seine einzige große Liebe halten würde – später in Gedanken an die abstoßende Physis des Jungdichters nur so schütteln.
1927 verkauft sie die Briefe Rilkes samt der ihr verehrten Gedichte (meistbietend) und erweist sich dabei als knallharte Geschäftsfrau, die sich in einem unscheinbaren Prager Neubau in eine Art Puppenstube mitsamt ihren Katzen zurückgezogen hat. Sehr lange Briefe teilt sie auf und verkauft sie zum Preis von mehreren, da lässt sie nicht mit sich handeln. Nebenbei gibt sie Auskunft über ihre große Liebe, die in ihren Worten jämmerlich einschrumpft: René war ein schwer nervenkranker im Studium unbeständiger Mensch und stand ganz verlassen da, denn seine Verwandten liebten ihn nicht und erklärten ihn kurz als »Narren«. Er ging sogar mit Selbstmordabsichten um, und ich nahm mich seiner aus Mitleid an …[15]
Klar wird, der Dünkel sitzt tief bei diesem Prager Provinzadel, für den nur Konvention und Tradition zählen. Hier, so empfindet es Rilke, lebt nichts mehr, hier gespenstert es nur noch wie in Gustav Meyrinks »Der Golem«.
Niemand habe mit ihm zusammen sein wollen, »jeder mied ihn wie einen räudigen Hund«. Da Rilke magenkrank gewesen sei und Hausmannskost nicht vertrug, habe er ständig an schweren Magenverstimmungen gelitten. Und jetzt ergeht sich Vally in ihrer Erinnerung in erstaunlichen Verismen: »… sein Gesicht war von Finnen und Eiterpusteln maßlos entstellt, zumal seine Züge von abstoßender gemeiner Häßlichkeit waren, und sein Atem unerträglich war.«[16]
Bevor sie ihn das erste Mal traf, habe sie – bei seinem Namen! – einen »eleganten Franzosen« erwartet, und dann sei sie »bei seinem Anblick einfach starr vor Schrecken« gewesen. Dann habe sie sich an sein abstoßendes Äußeres gewöhnt und sei »von seinem Geist« gefesselt gewesen. Rilke habe auch als Verehrer kein Maß halten können und ihr mitunter vier, fünf Liebesbriefe am Tag geschrieben, die er mit Hidigeigei unterzeichnete. Diese unerwünschte Nähe ruft den Zorn der Eltern Vallys hervor, die anfangs in Rilke bloß einen zurückgebliebenen Schüler aus einer ihnen bekannten Familie gesehen hatten.
Doch bevor es zu Ende geht mit Rilke und der göttlichen Vally, stellt sich die Frage: War er wirklich so abstoßend in seinem Äußeren? Auch später werden jene, die ihn kannten, vom melancholischen Blick seiner großen Augen gefesselt, über seinen Mund und das Kinn sprechen sie eher nicht (die meisten finden die untere Gesichtshälfte abstoßend).
Marie von Thurn und Taxis erinnert sich an ihre erste Begegnung mit Rilke am 13. Dezember 1909: »Ich war angenehm überrascht, zugleich aber auch ein wenig enttäuscht, denn ich hatte ihn mir ganz anders vorgestellt – nicht diesen ganz jungen Menschen, der fast wie ein Kind aussah; er erschien mir im ersten Augenblick sehr häßlich, zugleich aber sehr sympathisch. Äußerst schüchtern, aber von ausgezeichneten Umgangsformen und einer seltenen Vornehmheit.«[17] Das ist der Blick der Seelenverwandten (die Valerie nie war) auf Rilke.
Auch in den Jahren des Reisens, als er seiner Mutter, die ebenfalls unterwegs durch Europa ist, Briefe schreibt, geht es immer wieder um seine schlechten Zähne. Aufwendige und teure Zahnarztbesuche werden nötig, im Kiefer hat er tiefe Löcher, die schwer zu behandeln sind, seine Lippen sind auf unförmige Weise wulstig. Vielleicht erklärt das den merkwürdigen Gedichtanfang seines Vally-Liebesgedichts mit Zähnlein so fein, Rosenmund?
Was Rilke hier schreibt, klingt wie ein schlechter Schlager, eine Schnulze: Du bist ja mein Leben, mein Sein mein Hoffen – alles bist Du. Du bist die Göttin, zu der ich bete, Deine schönen Augen sind die Triebfedern meiner Handlungen – und Deine Worte sind mein Geschick. … Mein Herzchen – ich weiß Du bist nicht böse – sonst weint sich Dein Kater die großen Augen aus![18]
Man kann in dieser sentimentalen Reimerei der Jahre 1892 bis 1895 eine Vorübung im Poetischen sehen, mehr ist es kaum. Immerhin, Rilke probt hier die Kunst des Ansprechens, des Rühmens – später wird er sie unter anderem Vorzeichen, in eine kühle Distanz gebracht, zur Vollendung bringen. In einem Aufsatz zu Goethes »Der Wanderer«, den Rilke am 7. Dezember 1893 (drei Tage nach seinem 18. Geburtstag) niederschreibt, zeigt sich die naiv-unmittelbare Auffassung von Dichtung, die ihn in den Anfangsjahren prägt, wenn er diesen Text über Goethe quasi mit einem eigenen Bekenntnis als Dichter beginnt: Das ist des Dichters wahre, erhabene Kunst, dem Leser die Begebnisse, die er erzählt, so lebhaft vor Augen zu führen, – daß ihm die Gegenwart und seine ganze Umgebung zu entfliehen scheint und daß er nicht nur ein Kunstwerk empfindet, sondern über dessen klarer Natürlichkeit die Kunst vergißt und die Begebenheit – miterlebt.[19]
Am schlimmsten erscheint es ihm, ein völliges Versagen gar, wenn sein Urteil kalt wird. In der Zeit seiner »Ding«-Gedichte nach 1900 wird sich das geradezu gegenteilig anhören – und am Anfang des »Malte Laurids Brigge« lesen wir das geradezu manifestartig pointiert. Aber bis dahin ist es für Rilke noch ein weiter Weg – jedoch einer, auf dem er den kalt-distanzierten Blick beständig erproben und perfektionieren wird.
Dieses merkwürdige Zugleich von unübersehbar starkem Talent und formloser Seichtheit des Geschriebenen des jungen Rilke verweist auch auf das Problem der provinziellen Gemütsart der Prager Deutschen. Eine Insel ist das, wo man sich in katholischer Gewohnheit und bürgerlichem Komfort eingerichtet hat. Eine lebendige Kulturszene besitzt Prag nicht, auch Rilke werden nur der »Dilettanten-Verein« und der »Verein der bildenden Künstler« bleiben, um Vorträge zu hören – und später auch selbst welche zu halten. Prag gehört zwar zum k. u. k. Imperium, aber von einer Kunstszene, wie sie etwa in Wien im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts entstanden ist, spürt man in Prag nichts. Kein Arthur Schnitzler oder Hugo von Hofmannsthal zeigen sich hier. Erst recht kein Klimt in der Malerei oder ein Ernst Mach in der Philosophie, kein Adolf Loos in der Architektur oder ein Arnold Schönberg in der Musik. Und in Deutschland erobert Gerhart Hauptmann mit seinen sozialkritischen Dramen wie »Vor Sonnenaufgang« oder »Die Weber« die Bühnen. Welch Durchbruch zu neuen Formen und neuen Gedanken über die Zukunft!
In Prag dagegen liebt man die Tradition und die falschen Gefühle. Dass das, was er in diesen ersten Jahren so hastig produzierte, ohne wirkliche Erfahrung blieb, es den Worten an Wahrheit fehlte, wird Rilke später selbst konstatieren und – da ist er dann allerdings ungerecht gegen sich selbst – sein gesamtes Frühwerk verwerfen. Rilke ist bereits zwanzig und soeben in München angekommen, als er mit Tschechow und Dostojewski oder auch mit Maeterlinck und Hauptmann in Berührung kommt. Spät, aber nicht zu spät für eine Horizonterweiterung.
Noch in Prag hat er 1896 Kontakt mit dem Tiroler Schriftsteller Rudolf Christoph Jenny aufgenommen. Dieser vereinigt das, was René Rilke am meisten bewundert, in seiner Person: Offizier, Schauspieler und Schriftsteller! Als Rilke ihn kennenlernt, studiert er Philosophie in Prag. Rilke schwärmt für Jenny, den er für den größten Dramatiker weit und breit hält. Denn dieser hatte soeben das Stück »Not kennt kein Gebot« geschrieben. Wie verbildet die Maßstäbe Rilkes sind, der hier in Prag immer nur unter dem Einfluss von Zweit- und Drittklassigem steht, zeigt sich in dieser Hingabe an Jenny. Was sei schon Arthur Schnitzler, der mit seinen Stücken gerade große Erfolge feierte? In ein oder zwei Jahren, so Rilke, werde dieser im Vorzimmer des bekannten Dramatikers Jenny … demütig warten.[20] René Rilke hat schlicht keine Ahnung von der Welt und auch nicht von der Kunst. Er kennt nur die Insel Prag mit ihrem zurückgebliebenen Insel-Deutsch.
Noch ist er René Rilke, der den siebzehn Jahre älteren Kollegen mit verehrter Meister anspricht. Jenny versucht sein Theaterstück »Not kennt kein Gebot« irgendwo unterzubringen, Rilke sein »Im Frühfrost«. Aus Budapest, wo er einen Onkel besucht, schreibt Rilke am 31. Mai 1896 an den verehrten Meister, er hoffe bald schon wieder in Prag zu sein, denn dieses Budapest sei ihm zu eng: Diese Leute mit dem Kirchturmhorizont, mit den kleinen Interessen und Sorgen widern mich fast ebenso an wie meine Prager Verwandtschaft …[21]
Es ist ein eher unbestimmtes Unbehagen, das Rilke hier beherrscht, denn schon in einem der nächsten Sätze fragt Rilke Jenny geradezu treuherzig: War letzten Donnerstag ein Vereinsabend?
Immerhin, Emil Orlik, den Rilke in München wiedertreffen wird, kommt aus Prag – aber noch ist hier kein Kafka in Sicht, der das Unheimliche dieser uralten, gruftartigen Stadt als einen modernen Albtraum zu schildern vermag. Niemand kenne ihn doch so bis auf den tiefsten Dämmerwinkel seiner Seele, ruft er Jenny entgegen, gesteht: Meine Nerven sind hin.