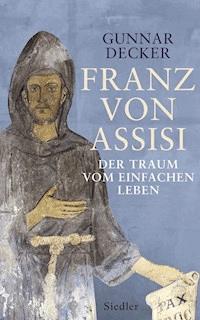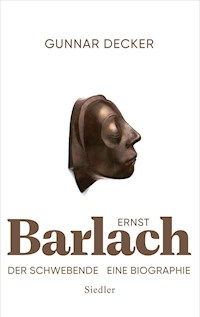18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Blick auf die DDR der 80er Jahre.
Die Biermann-Ausbürgerung hatte die DDR-Gesellschaft 1976 in eine Melancholie gestürzt, aus der sie 1985 mit Michail Gorbatschow erwachte. Jetzt kehrte die Utopie zurück. Vor allem Intellektuelle, Künstler und Aussteiger aller Art lebten sie. Dem westlichen Siegerblick nach 1990, der die Geschichte der Ostdeutschen bis heute dominiert, entgeht zumeist dieser Emanzipationsprozess, der lange vor 1989 einsetzte. Umso mehr scheint hier eine Korrektur nötig: die Aneignung der eigenen – höchst widersprüchlichen – Geschichte durch die Akteure dieser Geschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Ein neuer Blick auf die DDR der 80er Jahre.
Die Biermann-Ausbürgerung hatte die DDR-Gesellschaft 1976 in eine Melancholie gestürzt, aus der sie 1985 mit Michail Gorbatschow erwachte. Jetzt kehrte die Utopie zurück. Vor allem Intellektuelle, Künstler und Aussteiger aller Art lebten sie. Dem westlichen Siegerblick nach 1990, der die Geschichte der Ostdeutschen bis heute dominiert, entgeht zumeist dieser Emanzipationsprozess, der lange vor 1989 einsetzte. Umso mehr scheint hier eine Korrektur nötig: die Aneignung der eigenen – höchst widersprüchlichen – Geschichte durch die Akteure dieser Geschichte.
»Brilliant und unterhaltsam erzählt.«, FAZ über »1965. Der kurze Sommer der DDR«
Über Gunnar Decker
Gunnar Decker, 1965 in Kühlungsborn geboren, wurde in Religionsphilosophie promoviert. Er lebt als Autor in Berlin, veröffentlichte vielfach gelobte Biographien unter anderem zu Hermann Hesse, Gottfried Benn und Franz Fühmann sowie das Geschichtsbuch »1965. Der kurze Sommer der DDR«. 2016 wurde er mit dem von der Berliner Akademie der Künste verliehenen Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet. Zuletzt erschien »Ernst Barlach – Der Schwebende. Eine Biographie.«
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Gunnar Decker
Zwischen den Zeiten
Die späten Jahre der DDR
Meiner Frau Kerstin, der besten Ratgeberin
»… wir alle hatten uns an diesen Zustand zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit gewöhnt.«
Christa Wolf Sommerstück
Der Jahrhundertschritt, Wolfgang Mattheuer
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Die Zeit der großen Beerdigungen
Dostoprimetschatelnosti
Drei tote Generalsekretäre
Ungeliebte Ökonomie
Der preußische Ikarus
Der Beginn vom Ende: Die Biermann-Ausbürgerung im November 1976
Erwin Strittmatters WundertäterIII als »Sprengstoff«
Maxie Wander interviewt zweifelnde Frauen: Guten Morgen, du Schöne
Monika Marons Flugasche über Bitterfeld
Ingrid Mittenzwei, Bernhard Heisig und Stephan Hermlin gehen auf die Suche nach der sozialistischen Nation und rückversichern sich bei Luther, Friedrich II. und Bismarck
Der Laie und der Professor: Günter de Bruyns Märkische Forschungen
Eine Autonomieerklärung: Christine Wolters Die Alleinseglerin
Schwarzsehen und Weitblick
Die Ausschlüsse aus dem Berliner Schriftstellerverband von 1979
Kassandra als Schwester im Geiste
Der rettende Teufel in Bulgakows Der Meister und Margarita
Romantik als Fluchtweg? Christa Wolfs Kein Ort. Nirgends und Sommerstück, Peter Hacks versus Franz Fühmann und Stephan Hermlin
Bonjour Tristesse: Sergej Dowlatows Der Koffer als Spiegel der Breschnew-Ära
Jurek Becker im Niemandsland: Schlaflose Tage und Aller Welt Freund
Die Frage nach der Wahrheit im eigenen Leben und in der Geschichte: Der fremde Freund und Horns Ende von Christoph Hein
Vorgezogenes Resümee: Christa Wolfs Was bleibt
Wolfgang Mattheuers negative Inselutopie Was nun?
Andrej Tarkowski trifft Ulrich Weiß. Meditationen über die »Zone«
Reue und Renitenz
»Schwerter zu Pflugscharen.« Vom Umschmieden
Gorbatschow ist anders
Familiäre Urszenen der Perestroika: Woher Gorbatschow kam
Die große Chance, dem Ekel vor der Politik zu entkommen
Prohibition als falsches Signal
Gorbatschow – Realist und Utopist zugleich
Die Katastrophe von Tschernobyl
Tengis Abuladses Film Die Reue als mythisches Herz der Perestroika
Keine »Reue« in der SED-Führung
Daniil Granin über das Drama der Genetik in der Sowjetunion: Sie nannten ihn Ur
Tschingis Aitmatow zwischen Mythos und Science-Fiction: Der Tag zieht den Jahrhundertweg
Prometheus verlässt den Raum
Perestroika-Folgen in der DDR. Christoph Heins Rede gegen die Zensur auf dem X. Schriftstellerkongress 1987
Die Katastrophen der Welt rücken näher: Christa Wolfs Störfall
Dean Reed – Ein Amerikaner in der DDR
Die Kunst der Erinnerung: Granins Die Spur ist sichtbar noch und Das Gemälde
Volker Braun oder die Frage des Übergangs: Der Hinze-Kunze-Roman
Christoph Hein probt die Aussteigerperspektive: Der Tango-spieler
Die Helden von gestern in Christoph Heins Drama Die Ritter der Tafelrunde
Umkämpfte Utopie. Wie der Streit um Ernst Bloch und Friedrich Nietzsche in der Sinn und Form ausgetragen wurde
Flüstern und Schreien
Reformer und Verweigerer. Rudolf Bahros Die Alternative, das »Sozialismusprojekt« und die »Umweltbibliotheken«
Magie des einfachen Lebens: Andreas Dresens Film Gundermann
Gegen den Industrialisierungswahn: Valentin Rasputins Abschied von Matjora und Der Brand
Klaus Gysi – Dandy und Funktionär
Ein Abgesang. Alfred Wellms Morisco, der wohl unbekannteste große Roman der späten DDR
Frank Castorf und Alexander Lang blicken in die Schatten der Revolution
Georg Seidel demoliert den Mythos vom herrschenden Arbeiter
Helga Paris zum Beispiel. Fotos aus den späten Jahren der DDR
Werner Tübke verschwindet im »Welttheater«
Der Fotograf Roger Melis. Von Friedrichshagen nach Paris
Michail Schatrows Weiter, weiter, weiter und der Aufstand der Orthodoxie
Thomas Heise auf der Suche nach Heimat
Underground: Die Punkszene oder der Wille zum Augenblick
Konrad Wolfs Solo Sunny und Markus Wolfs Die Troika
Mit der Einheit endet eine Freundschaft: Sarah Kirsch und Christa Wolf entzweien sich
Franz Fühmann streitet für junge Poeten und sitzt im Bergwerk fest
Walter Jankas Schwierigkeiten mit der Wahrheit als geistiges Signal der Wende
Heiner Müllers letzte Szenen zur DDR: Wolokolamsker Chaussee
Epilog
Anmerkungen
Verzeichnis der verwendeten Literatur (Auswahl)
Personenregister
Impressum
Prolog
Jahrhundertschritt trifft Wendegeist von 1985
»›Vielleicht lohnt es nicht‹, sagte ich. ›Wozu die bösen Geister wecken?‹ – ›Wir wollen sie wecken‹, sagte sie fest. ›Sonst bleibt alles nutzlos. Wozu wäre ich denn hergekommen? Ich muss doch meine Reise rechtfertigen.‹«
Daniil Granin, Die Spur ist sichtbar noch
Gehen wir im Folgenden auf eine Zeitreise durch die späte DDR. Die Biermann-Ausbürgerung hatte 1976 die Gesellschaft in wütende Melancholie gestürzt, aus der sie mit dem weltpolitischen Auftritt Michail Gorbatschows 1985 erwachte, sich gleichsam erstaunt die Augen reibend. War das möglich?
Jetzt kehrte auch die Utopie zurück. Vor allem Intellektuelle, Künstler und Aussteiger aller Art lebten sie und stritten dabei mit der eigenen Skepsis. War dieser Sozialismus überhaupt noch reformfähig?
Aus der Sowjetunion kam ein neuer Geist, der nicht nur in Werke der Literatur, des Films, des Theaters und der Bildenden Kunst einzog, sondern auch eine neue Haltung bei nicht wenigen prägte – jene Einübung in den aufrechten Gang, von der Ernst Bloch sprach.
Dem westlichen Siegerblick nach 1990, der die Geschichte der Ostdeutschen bis heute dominiert, entgeht zumeist dieser Emanzipationsprozess, der lange vor 1989 einsetzte. Umso mehr scheint hier eine Korrektur nötig: die Aneignung der eigenen – höchst widersprüchlichen – Geschichte durch die Akteure dieser Geschichte.
Mit seiner Skulptur Der Jahrhundertschritt zeigt Wolfgang Mattheuer das 20.Jahrhundert einer immensen Gefahr ausgesetzt. Wie der von Max Ernst geschaffene Hausengel (ein übles Trampeltier) alles niedertritt, was zu seinen Füßen wächst, so hinterlässt auch dieser im Stechschrittmodus voranstürmende Bewegungsautomat eine Schneise der Verwüstung.
Entstanden 1984, wurde er auf der X. (und letzten) Kunstausstellung der DDR in Dresden von Oktober 1987 bis April 1988 gezeigt. Es gibt Fotos vom Ausstellungsbesuch der SED-Parteispitze um Erich Honecker – auffallend, dass sie gleichsam einen Sicherheitsabstand zum Jahrhundertschritt beibehielten, ihn nur aus der Distanz betrachteten.
Tatsächlich geht von der Skulptur eine Gefahr aus, denn sie scheint nur aus Extremitäten zu bestehen. Das stechschrittartig nach vorn geworfene rechte Bein wird zur Waffe, der man sich besser nicht in den Weg stellt. Dazu kommt der rechte nach vorn oben gereckte Arm.
Ein Mensch geht so nicht. Welch aggressiver Ausfall der Extremitäten, hier wird nur blindwütig voranmarschiert. Doch wozu und mit welchem Ziel? Die Hand spitz wie ein Dolch – das hat man als Hitlergruß interpretiert. Mit dem linken, rechtwinklig gebeugten Bein verbindet sich der linke, ebenfalls rechtwinklig gebeugte Arm, dessen Hand zur Faust geballt ist. Zeigt er den Rotfrontkämpfergruß?
Man kann den Jahrhundertschritt auf diese Weise ansehen, faschistische Ideologie trifft auf kommunistische Ideologie. In einem überaus reduzierten (ausgelaugten) Körper gehen sie ineinander über – nur ein kaum wahrnehmbarer, fast spinnenartiger Kopf sitzt stecknadelgleich auf dem Rumpf. Welch Inbegriff des Totalitären, das alle Kultur, jeden Humanismus mit seiner Militanz von innen heraus zerrissen hat.
Mir erscheint diese Sichtweise allein jedoch nicht ausreichend. Denn dieses gehetzt wirkende Wesen ist auch ein Fluchttier, jedoch ein aggressives. Es ähnelt Graf Dracula in Murnaus Stummfilmadaption. Ein »Nosferatu«, ein Untoter, der, einem Zwischenreich aus Leben und Tod entsteigend, sein Unwesen treibt. Über sein Handeln bestimmt er längst nicht mehr selbst. Niemand ist unfreier als er, der flüchtend immer nur angreift.
Die gegensätzlichen Ideologien, die ihn okkupieren, machen ihn zum kopflosen Gespenst im Vernichtungsfuror. Eine jener Furien der Vernichtung, wie sie durch die Geschichte rasen – ein mythologisches Untier.
Hier geht es um den Verlust jener Mitte, die den Menschen erst zum Träger der Geschichte, zum Gestalter der eigenen Zukunft qualifiziert. Mattheuer selbst sah in dieser Albtraumfigur die Absurdität verkörpert, die im »Zwiespalt zwischen sehnsüchtigem Geist und enttäuschender Welt« (Albert Camus) liegt. Dies hier ist also eine Endzeitfigur, Sinnbild einer aus den Fugen geratenen Welt. In den Schützengräben des Klassenkampfes wurde diese aggressive Kreatur erzeugt. Ein liebloser, geistloser, seelenloser Feindbildfetischist. Mattheuers bitteres Fazit: »Kein Versuch der Selbstfindung gelingt mehr.«1
Ist das von dem Anspruch der DDR in ihrer Frühzeit übriggeblieben, den Abgrund, der zwischen einem barbarischen Gestern und einer lichtvollen Zukunft liege, nicht mit vielen kleinen, sondern mit einem einzigen großen – einem Jahrhundertschritt! – zu übersteigen?
Vergleiche ich Mattheuers grotesken Jahrhundertschritt von Mitte der achtziger Jahre, entstanden in einer Zeit wahnsinniger atomarer Hochrüstung zwischen den feindlichen Militärblöcken, mit Fritz Cremers Der Aufsteigende von Mitte der sechziger Jahre, dann fällt mir auf, dass die innere Dynamik des halb steigenden, halb fallenden Aufsteigenden sich in geradezu hysterisch übersteigerter Form im Jahrhundertschritt wiederfindet. Doch nun von jeder menschlichen Substanz entleert, eine hochtourig arbeitende Maschine.
Da ist keine Hoffnung mehr in Szene gesetzt, es droht vielmehr das Ende der menschlichen Zivilisation. Gibt es noch Rettung, ein befriedendes Ende der atomaren Hochrüstungsspirale zwischen Ost und West?, so fragte nicht nur ich mich damals. Im Ganzen schienen die Sinnzusammenhänge zerbrochen, die scharfkantigen Splitter aber blieben dem Einzelnen zur weiteren Verwendung überlassen.
Ein Satz aus Fernando Pessoas Das Buch der Unruhe lässt mich nicht los: »Ich wurde zu einer Zeit geboren, in der die Mehrheit der jungen Leute den Glauben an Gott aus dem gleichen Grund verloren hatte, aus welchem ihre Vorfahren ihn hatten – ohne zu wissen warum.« Warum verliert man einen Glauben aus den gleichen Gründen, aus denen dieser sich – bei einer anderen Generation – einst speiste?
Natürlich braucht der Glaube, woran auch immer, keine plausiblen Gründe. Es ist wie mit der Liebe, entweder ist sie da oder nicht. Diese immer wieder neu herzustellende Balance von Glaube und Skepsis in uns konstituiert das, was man Biographie nennt. Sie bleibt dabei ein Teil der Jahrhundertgeschichte, die sie gleichermaßen trägt und bedroht. Eine paradoxe Situation, der der Einzelne nicht entkommt.
Man darf nicht vergessen, dass die Sowjetunion und ihre sogenannten Satellitenstaaten, darunter auch die DDR, Realisierungen einer großen humanistischen Idee waren, die letztlich im Christentum wurzelt. Alle folgenden großen Emanzipationstheorien der Neuzeit, von den französischen Enzyklopädisten über die utopischen Sozialisten, den klassischen Idealismus bis hin zu den Junghegelianern, führten geradewegs zu Karl Marx und Friedrich Engels und von da zu Lenin und der Oktoberrevolution. Das Muster christlicher Heilsgeschichte, der vorbestimmte Weg zum Reich Gottes (der über das Jüngste Gericht führt) kehrte in der Theorie des Kommunismus wieder: Der Weg ins Reich der Freiheit führt durch eine Reihe von Klassenkämpfen. Bevor es für immer schön und friedlich ist, wird es noch mal richtig hässlich und militant. Die Idee verwandelt sich auf diesem Weg durch das »dunkle Loch der Praxis«, wie es Ernst Bloch formulierte, unweigerlich in Ideologie – nach Marx einem verkehrten Bewusstsein.
Die Märchen, so hatte der kluge Franz Fühmann in den fünfziger Jahre in aller unschuldigen Euphorie geglaubt, würden im Kommunismus wahr werden. Aber die Bindungskräfte dieser Heilsgeschichte, der Glaube an den verheißenen »neuen Menschen«, an die glückselige Zukunft vor uns, für die man das Elend der Gegenwart erdulden muss, ließen immer mehr nach.
Auf die Frage: Lohnen die Opfer, die wir einer ungewissen Zukunft bringen, denn überhaupt?, begannen in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre nicht nur immer mehr Künstler und Intellektuelle, sondern auch eine jüngere Generation immer häufiger mit »Nein« zu antworten.
Von der Utopie eines herrschaftsfreien Raumes, in dem man ebenso demokratisch wie sozialistisch miteinander umgeht, schreibt Stefan Heym 1984 in Schwarzenberg, einem Buch, das in der DDR nicht erscheinen durfte. Es nimmt eine tatsächliche Begebenheit vom Mai 1945 zum Anlass. Der um das erzgebirgische Aue gelegene Landkreis Schwarzenberg ist für einige Wochen ohne Besatzungsmacht. Russen und Amerikaner habe ihn offenbar vergessen, ahnen nichts vom hier verborgenen Uran, wegen dem dann bald ein anderer Staat im Staate, die »Wismut«-AG, unter sowjetischer Aufsicht entstehen sollte. Unmittelbar nach der Befreiung gründen hier Antifaschisten verschiedenster Couleur in Eigenregie die »Republik Schwarzenberg«, ein Gebilde jenseits der Großmächte und ihrer Machtpolitik.
Der Roman wirkt wie ein visionärer Fingerzeig auf jene 89er-Herbstwochen in der DDR, als die Utopie eines demokratischen Sozialismus Gestalt annahm. Aber dann war der Augenblick gelebter Freiheit auch hier – wie in Schwarzenberg 1945 – schon wieder vorbei, zum »Nicht-Ereignis« degradiert: »Die Republik Schwarzenberg ist nicht mehr auffindbar. Selbst das Gebiet, das einst zu ihr gehörte, ist aufgeteilt worden. Fast scheint es, als hätten gewisse Personen ein Interesse daran gehabt, alles Gedenken an sie auszulöschen, so als wäre diese Republik, geleitet von wohlmeinenden und ehrlichen Leuten, keiner von ihnen hat sich in jenen Hungertagen auch nur um eine Krume Brot bereichert, etwas Schlimmes gewesen, ein Art Krankheit, eine Pestbeule, die man ausbrennt.«2
Oder gab es in den gesamten achtziger Jahren in der DDR mehrere solcher verborgenen Schwarzenberg-Republiken? »Stirb nicht im Wartesaal der Zukunft« hieß ein Slogan der Punkbewegung der achtziger Jahre, die sich für den DDR-Sozialismus als solchen nicht mehr interessierte. Sie wollte selbsteroberte Freiräume mit Leben erfüllen, egal womit, aber hier und jetzt: mit Musik, Malerei, Töpferei, Modedesign oder Kommune-Experimenten. Es war die Stunde der »genialen Dilettanten«, die für sich das im Kleinen lebten, woran sie im Großen nicht mehr glaubten: das Versprechen einer nichtentfremdeten Existenz. Und auch nicht in dieser Szene beheimateten Künstlern und Intellektuellen war Nietzsches Vision eines »Klosters für freie Geister« nah – die Autonomie des Geistes, die gemeinsam zu verteidigen (oder auch erst zu erlangen) als höchstes Ziel erschien. Geist traf auf Ideologie, manchmal sogar in einer einzigen Person, die dann schmerzhafte Metamorphosen durchlief. Ganz am Ende der DDR, als der Anschluss an die Bundesrepublik kurz bevorstand und die D-Mark bereits Zahlungsmittel geworden war, wurde – in diesem Geiste, aber auch schon als postmoderne Spielmarke – in Dresden Neustadt die »Bunte Republik Neustadt« gegründet. In der Parodie auf Modrow- und de-Maiziere-Regierung lebte ein echter Utopie-Funke weiter. Schilder markierten das Territorium: »Hier beginnt die freie Republik Neustadt.« In der »ordentlichen provisorischen Regierung«, die gegründet wurde, gab es einen »Monarchen ohne Geschäftsbereich«, Minister für Wehrkraftzersetzung und »Pfuinanzen und andere Kirchenfragen«, »Unkultur und Unterseeboote«. Währung war die »Neustadtmark«. Man forderte den Anschluss an den Vatikan. In dieser Burleske auf den 89er-Herbst und den darauf folgenden Vereinigungsprozess lebte eine Volkssouveränität weiter, die provokant mit erfahrenen Kränkungen und Ohnmachtsgefühlen angesichts der neuen Realitäten – die sie nicht gewollt hatten – spielte.
Im Folgenden also geht es um eine Zeitreise, in der sich Persönliches der Weltgeschichte aussetzt. Genauer, um die achtziger Jahre in der DDR und der Sowjetunion. Eine Endzeit, in der meine Generation den Glauben an den Sozialismus verlor, um ihn 1985 mit Gorbatschows »Perestroika« auf andere, sehr viel klarer blickende Weise für kurze Zeit wiederzufinden. Dann dominierte erneut die Skepsis. Wohin ging die Reise? Pessoa warnt: »Wenn das Herz denken könnte, stünde es still.«3 Vielleicht aber steht es ja nur für den Bruchteil einer Sekunde still, stolpert über etwas, von dem man erst noch herausfinden muss, was es ist.
Der Versuch, das sich anbahnende Ende der DDR zu verhindern, misslang. Gewiss aber gehören die Korrekturversuche Einzelner mit zu dieser Geschichte, auch wenn sie deren Verlauf im Ganzen nicht mehr ändern konnten. Der Zeitpunkt dafür war längst verpasst. Dennoch scheint vieles von dem, was sich in den letzten Jahren der DDR in allen Lebensbereichen vollzog, mit dem Begriff Agonie nur unzureichend beschrieben.
Die Verhältnisse wurden unübersichtlicher. Es gab viele Milieus (mehr als bloße Nischen), in denen man unter sich das lebte, was in der Gesellschaft blockiert schien. Die Utopie machte sich klein, war aber immer noch da.
Vieles wurde mit dem Ende der DDR an Entwicklungslinien mitsamt Gedanken, Ängsten und Träumen gekappt und vom sich siegreich globalisierenden Kapitalismus, der sogleich das »Ende der Geschichte« ausrief (so der Titel eines 1992 erschienenen Buches von Francis Fukuyama), aus dem eigenen Kanon aussortiert und zu wertlosem Abfall erklärt. Doch die Geschichte hat die Angewohnheit, lang zu sein. Der Westen hatte den Kalten Krieg, der Anfang der achtziger Jahre an der Schwelle zum heißen (Atom-)Krieg stand, zweifellos gewonnen, er war der Sieger der Geschichte.
Selbst linksliberale Köpfe wie Jürgen Habermas gerieten angesichts dieses Befundes in einen Zustand trunkener Hybris und sprachen gleichzeitig von der ungerechten »Unterwerfung« und der »nachholenden Revolution« des Ostens, von dem sie – wie sie gern und offen zugaben – keine Ahnung hatten, für den sie sich nie interessierten. Aber eines war für sie fraglos: Das aufklärerisch-liberale Denken komme allein aus dem Westen, im Osten wohne die Despotie, die gesellschaftliche Rückständigkeit!
Das wurde dann auch zur intellektuellen Nachwendeprogrammatik. Für den Widerspruch einiger Ost-Intellektueller wie Christa Wolf, Volker Braun, Heiner Müller oder Friedrich Dieckmann zeigte man sich taub. Die Antwort von Christa Wolf am 7.Dezember 1991 auf einen Brief von Jürgen Habermas vom 26.November 1991, der im Grunde nur wieder eine demütigende Maßregelung mehr war, klingt bis heute nach. Habermas hatte in seinem Brief an Christa Wolf geschrieben: »Diese Westorientierung hat keine Verkrümmung der deutschen Seele bedeutet, sondern die Einübung in den aufrechten Gang.«4
Des Weiteren wiederholte er seine Einschätzung, dass die Zerstörung der fortschrittlichen Idee des Sozialismus durch den real existierenden Sozialismus »für die geistige Hygiene in Deutschland« fataler gewesen sei als das Erbe des Nationalsozialismus. In dieser Optik war der Osten somit wiederum im Zustand der Unmündigkeit angelangt, ein Objekt der Beaufsichtigung und der Umerziehung. Und das keine zwei Jahre nach dem Aufstand des mündigen Bürgers im Herbst 89!
Folgt man dieser Logik heute, dann muss man den »aufgeklärten« Westen nur immer weiter in den Osten ausdehnen, derzeit ist er bis an die Ostgrenze der Ukraine gekommen. Aber ist das klug, ist es erfahrungstief? Christa Wolfs eher freundlich-moderat formulierter Einspruch gegen diese pauschale Gleichsetzung von Westen und Freiheit verhallte ungehört: »Dabei berufen Sie sich auf die geistigen Anstöße, die Sie aus dem Westen, aus dem Geist der Aufklärung erfahren haben. Der Osten hat auch geistig für Sie keine Rolle gespielt: Könnte darin doch auch eine Verengung liegen?«5 Fortan glich der Osten dem Igel, an dem sich die Schlange verschluckt hat.
Klaus Schlesinger (neben Ulrich Plenzdorf und Jurek Becker 1976 einer der energischsten Protestierer der jüngeren Generation gegen die Biermann-Ausbürgerung), der ab 1980 mit einem Dauervisum in Westberlin lebte, schrieb 1993 in dem Aufsatz »Sehnsucht nach der DDR?«: »Die Wahl zwischen BRD und DDR war mir immer schon vorgekommen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Oder zwischen der luxuriösen und der gemütlichen Grube. Was soll ich für einen Grund haben, der einen nachzuweinen oder die andere zu feiern? In beiden Ländern ist es mir bekleckert genug gegangen, und ich sehe nicht ein, warum ich die paar Freuden, die ich natürlich auch hatte, den Systemen zuschlagen soll. Am besten ging es mir, wenn ich den beiden deutsche Staaten den Rücken kehrte, ob nun Richtung Krakow, Budapest oder Paris.«6
Nur der Trotz sei es, der ihn dazu herausfordern könne, »ein paar Sätze über die verschwundene DDR zu sagen«. Trotz all jener westlichen Bescheidwisser, von denen die Ehrlicheren immerhin zugeben würden, dass die Sahara sie mehr beschäftigt habe als der Osten Deutschlands, die Einheit Deutschlands sei eine »Geldheirat« gewesen, mehr nicht. Der »Tatbestand der Vergewaltigung in der Ehe« scheine ihm erfüllt. Was jetzt allein noch helfen könne? Dass der Westen die moralische Größe aufbringe, die DDR noch einmal völkerrechtlich anzuerkennen: »Sozusagen postum, und mit allen Konsequenzen. Das könnte den Leuten, die im Osten geblieben sind, vielleicht das wiedergeben, was ihnen tagtäglich genommen wird: ihre Geschichte.«7
Auch darum will sich dieses Buch dem voreilig Begrabenen, das auf unheilvolle Weise umhergespenstert, wieder zuwenden. Denn vielleicht ist auch ein Stück Zukunft mit begraben worden? Geschichte, wusste Walter Benjamin, verheißt nicht eine bessere Zukunft, sondern die Erlösung von der Vergangenheit. Damit beginnt Christa Wolf, einen Satz von William Faulkner aufnehmend, ihre Kindheitsmuster: »Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen. Wir trennen es von uns ab und stellen uns fremd.«8 Aber das geht eben nie auf Dauer. Irgendwann bricht das lang Zurückgestaute wieder hervor.
Wer kommt zu früh, wer zu spät? Und wann ist er da, der richtige Augenblick? Die dem Staatsuntergang atmosphärisch vorauseilende Melancholie der Vergeblichkeit, die Erosion der Verhältnisse, war in den achtziger Jahren der DDR unter Autoren, Malern und Regisseuren stilprägend geworden.
Doch 1985 passierte das Unerhörte. Die dämmrig-romantische Untergangsszenerie wurde plötzlich von jenem hellen Hoffnungsfunken erleuchtet, der von dem weltpolitischen Auftritt Michail Gorbatschows und den beginnenden Reformen in der Sowjetunion ausging. Plötzlich stritt man wieder über den Sozialismus, darüber, wie er sein könnte, wenn man ihn reformierte. All die bis dahin gültigen Bannsprüche der Dogmatiker versagten, angefangen von »Revisionismus«, »Reformismus«, »Trotzkismus«, »Titoismus« bis zu »Eurokommunismus« – plötzlich waren dies stumpfe Waffen im Kampf gegen »Abweichler«, die ihre »Plattformen« (eine in ihrer Gefährlichkeit heute kaum mehr begreifbare Vokabel) bildeten.
Nun betrieb die KPdSU selbst als wichtigstes Ziel einen »Reformismus«, genannt »Perestroika« (»Umbau«) und »Glasnost« (»Offenheit«). Darauf konnte man, von der Sowjetunion beharrlich lernend, auch in Kontroversen mit SED-Funktionären bauen. Die eigentliche »Wende« in der DDR fand somit – vier Jahre vor dem Herbst 89 – bereits 1985 statt!
Seltsamerweise, so stellte ich nach dem Putsch gegen Gorbatschow fest, mit dem die Sowjetunion 1991 auseinanderbrach, waren die Sowjetbürger nicht annähernd so von Michail Gorbatschow begeistert gewesen wie die Menschen in der DDR. Den Ursachen dafür wird im Detail nachzugehen sein, aber gewiss scheint, dass das, was die meisten Ostdeutschen an ihm faszinierte – seine Intellektualität, seine Belesenheit, seine Rhetorik, sein Mut zum freiwilligen Machtverlust –, ihn den Russen (außer einem kleinen Kreis von Intellektuellen der mittleren Generation) eher suspekt machte.
Ein seltsamer Effekt stellte sich ein: Stalin schien persönlich für nichts verantwortlich, was an Gräuel während seiner Herrschaft passiert war, aber Gorbatschow machte man persönlich für alles verantwortlich, was im Lande nicht funktionierte. An erster Stelle natürlich für den – politisch gewollten – Mangel an Alkohol. Von einem Mann an der Spitze erwarten die Russen – bis heute, wie der Erfolg Putins zeigt – Stärke und Durchsetzungskraft und auch die gleichen geteilten Vorurteile, mit denen die Bevölkerung lebt. Gorbatschow jedoch war wie ein weißer Rabe, eine schillernde Figur, aber eben auch ein Außenseiter, dem man misstraute, der nicht richtig dazugehörte. Die Ostdeutschen dagegen hätten sich, des graumäusig-dogmatischen SED-Politbüros bis zum Ekel überdrüssig, niemanden so sehr wie Gorbatschow an der Spitze der DDR gewünscht – ein klassischer Fall von unerfüllbarer Fernstenliebe.
Auch die Nähe zu den deutschen Intellektuellen suchte Gorbatschow, vor und auch nach seinem Sturz 1991. Sein Nachkriegs-Deutschlandbild war, wie er bekannte, geprägt von Christa Wolfs Der geteilte Himmel aus dem Jahr 1962, der Geschichte einer Liebe, die an der Berliner Mauer zerbricht. Dieses Bild einer unnatürlichen Teilung Deutschlands trug Gorbatschow mit sich – und es war keine revisionistische Geschichte, sondern eine des sozialistischen Realismus im besten Sinne.
Nicht allein als Ermöglicher der deutschen Einheit, als den man ihn vor allem im Westen anerkennt, bewundern ihn die Ostdeutschen, sondern mehr noch als Reformer eines schier nicht-reformierbaren Gesellschaftssystems und als Visionär jenes »europäischen Hauses«, das selbstverständlich auch ein Zimmer für Russland bereithalten sollte. Denn in ihrer geistigen Tradition haben die Russen seit Dostojewski beständig den Widerstreit zwischen Slawophilen und Westlern thematisiert – und damit eine Brücke zwischen Europa und Asien gebaut.
Heiner Müller, der letzte Präsident der Akademie der Künste der DDR vor ihrer Vereinigung mit der Westberliner Akademie 1993, wurde für Gorbatschow Anfang der neunziger Jahre zu einem wichtigen Bezugspunkt in der deutschen Nachwende-Kultur. In seinem weltpolitischen Auftritt hatte Müller Mitte der achtziger Jahre zum letzten Mal das Flügelschlagen des »Engels der Geschichte« vernommen, über den Walter Benjamin in seinen Thesen »Über den Begriff der Geschichte« schreibt.
Michael Gaißmayer, der Gorbatschow bei seinem Deutschlandbesuch 1993 begleitet hatte, erinnert sich: »Für Gorbatschow war es wichtig, deutsche Intellektuelle kennen zu lernen. Er ist ans Berliner Ensemble gekommen, weil Müller eine feste Größe in der deutschen Kultur war. … Ich hatte ihm sehr viel von Müller und seiner Theaterarbeit erzählt, die er nicht kannte, auch, dass Müller vieles aufgenommen hatte, was in Russland vernichtet worden ist: Anregungen von Gladkow, Tretjakow, Scholochow, die transformiert in sein Werk eingingen.«9
Wegen Müller fuhr Gorbatschow dann auch nach Bayreuth, wo dieser Tristan und Isolde inszeniert hatte. »Müller war für ihn auch der Inbegriff einer nichtamerikanischen Kultur.«10 Am 30.Dezember 1992 schickt Müller einen Neujahrsgruß an Gorbatschow nach Moskau mit folgendem Inhalt: »Ein Bekannter von mir, der Chefredakteur der Akademiezeitschrift SINN + FORM, traf in New York einen sehr alten + berühmten Wissenschaftler aus der Schule Sigmund Freuds, der wichtige Bücher z.B. über Goethe + Leonardo da Vinci geschrieben hat. Der alte Mann sagte ihm: Sie haben New York gesehn, dieses System funktioniert nicht und wird nie funktionieren. Ich bedaure, daß ich es nicht erleben werde, aber ich bin sicher, daß es in 50 Jahren eine Renaissance des Sozialismus geben wird.«11 Gorbatschow also interessierte sich für Heiner Müller, aber das war keine Selbstverständlichkeit. Als der nach Bayreuth gereiste Gast aus Moskau vom Bayrischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber empfangen wurde und Müller hinter ihm ging, wurde dieser von Stoiber gefragt: »Sprechen Sie Deutsch?« Das waren dann wieder jene deutsch-deutschen Realitäten, für die man im Osten einst den Namen »Mühen der Ebene« erfunden hatte.
Man sollte in diesem Zusammenhang nicht vergessen: Die DDR war der westlichste Vorposten des sowjetischen Imperiums – was für uns bis heute einiges an Widersprüchen wie an Besonderheiten gewärtig hält, die dem angelsächsisch geprägten Westen ganz und gar unbekannt geblieben sind.
Dieses Buch will keine soziologische Studie sein, auch keine Politik-, nicht einmal eine Kulturgeschichte, obwohl diese Bezeichnung das Folgende noch am ehesten träfe. Ich suchte nach Bildern für die Schlussphase der DDR – und damit korrespondierend immer auch für jene der Sowjetunion. Da geht es um hochfliegende Menschheitshoffnungen, die von tiefen Ängsten begleitet werden, um mühsame Versuche Einzelner, den Widerspruch zwischen Anspruch und Realität, Wahrheit und Lüge auszuhalten. Es geht auch um Verrat und Verbrechen.
Das Paradox jener Situation, die man – gegen die universalistischen Großlogiken von Jürgen Habermas, der die Tragödie der Geschichte in einer »Theorie des kommunikativen Handelns« geheilt wissen wollte – eine postmoderne nennen kann, bezeichnet wie kein zweiter Text im deutsch-deutschen Kontext Heiner Müllers Hamletmaschine von 1977. In diesem Hamlet-Kommentar wird die Tragödie in der Farce aufgehoben. Nicht ausgeschlossen ist, das sie blutig wird. Realpolitisch bedeutet dies, dass auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges sich der Gegensatz der Systeme aufzulösen beginnt.
Die Konvergenztheorie (das langsame Ineinander-Übergehen der Systeme) hatte vermutlich im Osten mehr heimliche Anhänger als im Westen bekennende. Denn im Befund, dass beide Systeme immer stärker nach den gleichen Gesetzen moderner Gesellschaften funktionierten, steckte die eigentliche Utopie. Willy Brandt und Egon Bahr machten aus ebendieser Einsicht die SPD-Politik des »Wandels durch Annäherung«.
So ist auch Heiner Müllers Ortsbestimmung in Hamletmaschine zu verstehen: »Mein Platz, wenn mein Drama noch stattfinden würde, wäre auf beiden Seiten der Front, zwischen den Fronten, darüber.« Den Konjunktiv in diesem Satz sollte man nicht überhören – wenn Hamlets Drama, das Drama des jungen Intellektuellen vor der Macht – noch stattfinden würde, dann wäre sein Platz auf beiden Seiten der Front. Aber findet es denn noch statt? Ein Hoffnungsfunke als Platzhalter.
In Krieg ohne Schlacht hat Müller das Thema des jungen Intellektuellen Hamlet noch einmal aufgenommen und für zentral erklärt. In seiner Argumentation schließt er interessanterweise an Ernst Jüngers Adnoten zum »Arbeiter« an, wenn er über die Transformation des »Banausentums der Revolutionäre in Kunstfragen« notiert: »Die Kraft für die notwendigen Säuberungen reicht höchstens bis in die zweite Generation. Schon die dritte Generation fängt an, musische Neigungen zu entwickeln. Von da ab wird ein neuer Tanz gefährlicher als eine Armee. Der Riss zwischen den Generationen in der Führungsschicht war die Initialzündung für die Implosion des Systems.«12 Dieses Buch ist aus der Perspektive der dritten Generation geschrieben.
Daniil Granin hat 1997 in seinem Buch Das Jahrhundert der Angst darüber geschrieben. Er verknüpft auf eindringliche Weise Lebenserinnerung mit Essay, sieht nicht nur sein Leben, sondern das ganzer Generationen in der vom Stalinismus vergifteten Sowjetunion im Zeichen der Angst: »Das Leben in Angst währte bei vielen Menschen Jahre, vergiftete ihre beste Zeit. Alle Kraft war auf den Kampf gegen eingebildete Gefahren gerichtet, die nicht zu bannen waren. Das ist ja das Furchtbare: Sie sind unbesiegbar.«13
Die Angst selbst ist nicht zu sehen, nicht zu messen, sie bleibt unsichtbar – aber beherrscht im schlimmsten Falle nicht nur das Leben Einzelner, sondern eine ganze Gesellschaft. Nach einer Filmvorführung, so berichtet Granin, fragte der anwesende Stalin, wer der Regisseur sei. Dieser fiel, als er die Frage hörte, ohnmächtig vom Stuhl. Stalin gefiel das offenbar, sah darin die größtmögliche Unterwerfung.
Ein Leben ohne Angst, so Granin, sei nicht möglich, denn sie helfe Gefahren zu erkennen und zu überleben – aber was, wenn sie übermächtig, gar allmächtig wird? »Wer an einen Abgrund tritt, sagte Sartre, fürchtet nicht, daß er hineinfallen, sondern daß er sich hinunterstürzen könnte.«14
Das Großartige, was sich mit Gorbatschows Erscheinen 1985 ereignete, war das Aufhören dieser übermächtigen Angst, das Aufleuchten von Hoffnung. Den Einfluss der sowjetischen Kultur der Perestroika-Phase auf das Selbstbewusstsein von Künstlern und Intellektuellen in der DDR kann man nur gewaltig nennen. Friedrich Schorlemmer dazu: »Wir, die Opposition in der DDR, konnten uns in den Folgejahren mit unserer Systemkritik und dem neuen Problembewusstsein auf Gorbatschow berufen. Die Apparatschiks mussten schlucken, was ihr oberster Genosse in die Debatte warf.«15
Klaus Schlesinger erinnert an subversiven Einfluss sowjetischer Kunst auf kritische DDR-Intellektuelle seit der Chruschtschow-Ära: »Fortan war unser Blick auf die Sowjetunion nur von einem Interesse bestimmt: Was ändert sich in ihr, und ist es für uns von Vorteil? Die Botschaft brachte wiederum die Kultur, brachten die Filme, die Literatur, brachten Jewtuschenko, Wosnessenski, Solschenizyn über die Grenzen.«16
Die ökonomischen Perspektiven dieser achtziger Jahre in der DDR waren schlecht, aber nicht völlig desaströs. Denn die Wirtschaft erwies sich, mitten in einer Dauerkrise, als unerwartet erfindungsreiche Überlebenskünstlerin – und auch Erich Honecker, der Ulbricht einst wegen seiner marktwirtschaftlich orientierten Wirtschaftspolitik und des angestrebten deutschen Sonderweges gestürzt hatte, begann Anfang der achtziger Jahre ebendiese Politik wieder aufzunehmen – nach mehr als zehnjähriger Pause. Zwei Milliardenkredite, durch den Bayrischen Ministerpräsidenten Franz Joseph Strauß 1983 und 1984 vermittelt, machten die DDR in Sachen Devisen wieder handlungsfähig, also auf dem Weltmarkt kreditwürdig.
Die nun auch von Honecker angestrebte Verzahnung von ostdeutscher und westdeutscher Wirtschaft war für Moskau jedoch ein Dorn im Auge: Man sah am Horizont bereits den Bündnisverrat, die deutsch-deutsche Konföderation.
Unter diesem Blickwinkel wird dann das politische System der DDR, das Volker Braun in seinem Theaterstück »Die Übergangsgesellschaft« beschrieb (Übergang wohin?, so fragte nicht nur ich mich), dann doch wieder interessant. Bemerkenswert, dass auch der westdeutsche Publizist – und Weggefährte Egon Bahrs – Peter Bender 1992 über diese achtziger Jahre der DDR sagte, in ihrem letzten Jahrzehnt habe die DDR versucht, etwas Drittes zu werden, ein europäischer Staat zwischen Moskau und Bonn.
Wenn Geist und Macht aufeinanderprallen, passieren ungeahnte Dinge – großartige ebenso wie schreckliche. Für diese Gemengelage – die man auch die Utopie vom Anderswerden nennen kann – suchte ich keine strenge Chronologie, sondern symbolische Kreise, die für die späten Jahre der DDR stehen. Der eine hört nicht auf, wenn der andere beginnt, vieles bleibt paradox – dennoch verändern sich Atmosphären.
Wann war nun Schluss mit allen hochfliegenden Träumen vom Anderswerden? Der Anschluss der DDR an die Bundesrepublik gelang dem Wahlsieger von 1990, der »Allianz für Deutschland«, mit dem Slogan: »Keine Experimente!« Das klang bereits nach Pyrrhussieg. Hans Mayer schrieb 1991 in Der Turm zu Babel: »Die Deutsche Demokratische Republik war stets eine deutsche Wunde. Sie wird es bleiben und nicht heilen, solange man nicht erkennt, daß hier eine deutsche Möglichkeit zugrunde ging. Vielleicht gar verspielt wurde.«17
Es ist diese Sieger-Versuchung, über die Heiner Müller 1993 urteilte: »Auf den toten Gegner kann man jedes Feindbild projizieren, das vom Blick in den Spiegel abhält.«18
Die Zeit der großen Beerdigungen
Dostoprimetschatelnosti
Diese für nicht im Russischen Trainierte schier unaussprechbare Vokabel – Dostoprimetschatelnosti – heißt: Sehenswürdigkeiten. Jeder, der in der DDR eine zehnklassige Polytechnische Oberschule besuchte, kannte sie. Denn in jeder Stadt, gleich ob in der Sowjetunion oder der DDR, gab es solche Sehenswürdigkeiten, die es aufzuzählen und mit neuen Vokabeln zu verbinden galt. Der Russischunterricht dauerte lange. Sechs Jahre auf der Polytechnischen Oberschule, acht Jahre auf der zwölfklassigen Erweiterten Oberschule – und wer dann an der Universität studierte, bekam noch mal zwei weitere, macht zehn Jahre. Doch für diese immense Unterrichtsdauer war unser aktives russisches Sprachvermögen gering.
Ein Stück antirussischer Sprachverweigerung scheint immer im Spiel gewesen zu sein, denn die russischen Freunde waren schließlich auch die Besatzer. Doch ein Zungenbrecher war das Wort Dostoprimetschatelnosti für uns nun nicht gerade. Und immerhin, zehn Jahre Russisch reichten, dass ich als Richtschütze bei den NVA-Panzertruppen in Eggesin/Torgelow alle ausschließlich auf Russisch (mit kyrillischen Buchstaben) beschrifteten Bedienungs- und Warnhinweise samt dazugehöriger Knöpfe, Schalter und Hebel des ziemlich modernen T-72 drücken lernte, ohne größere Katastrophen zu verursachen – was durchaus im Bereich des Möglichen gelegen hätte.
So also begleitete uns nicht nur die russische Sprache wohl oder übel durch den Alltag der DDR, auch das Denken und Fühlen der Russen sickerte mit den Jahren in uns ein – obwohl nicht jeder die passiven Neigungen von Gontscharows Gesellschaftsverweigerer Oblomow in sich fühlte.
Das Prinzip »Zeit ist Geld« haben wir jedenfalls nicht erfunden. Chef sein war eine Strafe und Karriere ein Schimpfwort.
Aitmatows, Granins, Bulgakows, Schatrows oder Rasputins Bücher, Michalkows, Abuladses, Tarkowskis oder Klimows Filme prägten uns. Aber es waren auch politische Koordinaten (der potenzielle Feind stand nun mal im Westen), mit denen wir aufwuchsen – aber gegen deren Indoktrination fanden wir reichlich westliche Korrektive, von Radio Luxemburg bis zur »Tagesschau«, nur nicht bei der NVA, da war das mediale Auswandern auf Zeit strikt verboten. Außerhalb derartiger kaderschmiedender Sicherheitszonen war es in den achtziger Jahren längst so normal geworden wie Westgeld im Portemonnaie und der Besuch im Intershop.
Doch die – sichtbare wie unsichtbare – Daueranwesenheit der Russen hatte nicht nur einen freundlichen folkloristischen Aspekt, wir waren – als Teilstaat des östlichen Imperiums – auch ein Teil der osteuropäischen Geschichte geworden, mit Stalin, dem Gulag, der Wolokolamsker Chaussee, die ebenso zu uns gehörten wie Chruschtschows Entstalinisierungsversuche oder die bleierne Zeit unter Breschnew, dann der Hoffnungsfunke 1985 mit Gorbatschow und seiner Politik der Umgestaltung.
Die aber sollte, was uns als Studenten geradezu umstürzlerisch stimmte, laut SED-Spitze in der DDR gar nicht (niemals!) stattfinden, denn so SED-Propagandachef Kurt Hager am 9.April 1987 im Interview mit dem Stern: »Würden Sie, wenn Ihr Nachbar seine Wohnung neu tapeziert, sich verpflichtet fühlen, ihre Wohnung ebenfalls neu zu tapezieren?«
Solche Dostoprimetschatelnosti aller Art gehören zum östlichen deutschen Teilvolk, das ohne sie und die – komisch-grotesken, aber auch tragischen – Schatten, die sie warfen, nicht zu verstehen ist.
Darum blickten wir, anders als es der gegenwärtige Zeitgeist suggeriert, nicht bloß nach Westen, sondern immer auch nach Osten.
Erwin Strittmatter, anfänglich ein politisch eher konformistischer Schriftsteller, der erst durch die heftigen Reaktionen, die einige seiner Bücher erfuhren, vor allem Ole Bienkopp von 1963 und WundertäterIIIvon 1980, immer stärker auf Distanz zur herrschenden SED-Politik ging, registriert in seinen Tagebüchern diesen Wandlungsprozess, der wesentlich von sowjetischen Autoren angestoßen wurde. Am 27.November 1979 sieht er im Deutschen Theater in Berlin Majakowskis Schwitzbad von 1929 in der Regie von Friedo Solter, mit Dieter Franke in der Hauptrolle als Koprochef, der sich im selbst geschaffenen bürokratischen System gefangen gesetzt hat. Diese Inszenierung steht viele Jahre auf dem Spielplan, in 131 Aufführungen sind die Reaktionen des Publikums von überbordender Begeisterung. Strittmatter notiert: »Es war ein kräftiger Spaß. Der größte Teil des Publikums amüsiert sich. Funktionäre, zumindest etwas höhere, besuchen, vermute ich, die Vorstellungen nicht, sonst wären sie durch die tosenden Zuschauer, ihren Nebenleuten, in die Lage versetzt, über ihre Dummheiten zu lachen und sie auszuklatschen.«
Aber dann erinnert er sich, dass er das Stück 1960 schon einmal an der Volksbühne gesehen hatte, von einem sowjetischen Regisseur inszeniert – und da war er selbst, als Sekretär des Schriftstellerverbandes, noch ein Funktionär und reagierte beleidigt: »Ich hielt das Stück politisch für gefährlich und verließ meine Loge vor dem Schluss-Applaus. In einer anderen Loge saß Lotte Ulbricht. Im Foyer sprach sie mich an. Sie wollte wissen, was ich ›vom Stück‹ halte. ›Es richtet ich gegen uns‹, sagte ich, L.U. atmete auf: ›Gottseidank‹, sagte sie, ›ich dachte schon, ich wär’s allein, die so denkt.‹«
Knapp zwanzig Jahre später fällt Strittmatters Urteil vernichtend aus: »Damals wagte ich noch nicht zu erkennen, dass die Parteibürokratie, die Majakowski schon erkannte und aufs Korn nahm, keine behebbare Unart oder Schwäche war, sondern dem marxistischen System inhärent ist.«19
Reisen gen Westen waren bekanntlich für die allermeisten DDR-Bürger, vor allem die jüngeren, unmöglich. Es blieben nur wenige Ziele im Ausland, die man auch individuell bereisen konnte. Offiziell konnte man sich um Auslandsreisen bei Intourist oder Jugendtourist (dem Reisebüro der FDJ) bewerben, aber deren Reisen waren »geleitet«, also auch immer überwacht. Der visafreie Verkehr nach Polen wurde schon 1980, wenige Jahre nach seiner Einführung, bei Ausrufung des Kriegsrechts im Nachbarland im Zusammenhang mit den Solidarność-Protesten, wieder ausgesetzt – ein herber Schlag. Es blieb als visafreies Ziel so nur noch die Tschechoslowakei – und als im Frühherbst 1989 auch hier die Visafreiheit auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurde, fühlten wir uns endgültig gefangen gesetzt.
Der Protest gegen diese Aufhebung jeglichen visafreien Reisens (und nicht nur der Wille, auch einmal in die Bundesrepublik zu kommen) war dann auch einer der Antriebskräfte des 89er-Wendeherbstes. Wer ein Visum nach Bulgarien oder Rumänien hatte, fuhr zumeist per Transit durch Ungarn. Aber es gab auch die Möglichkeit eines Transitvisums durch die Sowjetunion, das in der Regel nur zwei oder drei Tage gültig war. In den siebziger und achtziger Jahren entwickelte sich, vor allem in der alternativen Szene, eine Art Sport, mit diesen Transitvisa wochen- oder monatelang die Sowjetunion zu durchstreifen, bis zum Kaukasus oder dem Mittleren Osten. Die Strafen für derartigen Transitvisamissbrauch, die bei der Ausreise aus der Sowjetunion fällig wurden, waren in der Regel so milde, dass dies niemanden abhielt.
Der spätere SPD-Politiker Thomas Krüger kolportiert in dem Buch Unerkannt durch Freundesland: »Es geht die Legende von einem Transitnik um, der mit einem DDR-Sozialversicherungsausweis, in den er ein Passfoto geklebt und dann mit einem geliehenen Stempel der Betriebsgewerkschaftsleitung zu einem noch offizielleren Dokument veredelt hat, zunächst die sowjetisch-mongolische Grenze, in weiteren Legenden sogar auch die Innere Mongolei in China erreicht haben soll.«20 Krüger selbst fuhr mittels Transitvisum in den Kaukasus und sah dies als »Trainingslager für die Freiheit«. Ein ebenso offizielle Stellen verwirrendes Phänomen wie die Freejazz-Szene, die Modeszene, oder Super-8-Film-Szene – von der Punkszene mit z.B. »Feeling B« nicht zu reden.
Der Protest des Undergrounds war längst nicht mehr klar politisch definiert, sondern entsprach einem – oft diffusen – alternativen Lebensgefühl: »Wie sollte der Stasi-Offizier den politischen Widerstand der Autoperforationsartisten beschreiben und die Zersetzungskraft der Punkband ›Demokratischer Konsum‹ erfassen?«21
Auch Ekkehard Maaß, dessen Wohnküche im Prenzlauer Berg ein legendärer Szene-Treffpunkt war, reiste mehrfach unerkannt in die Sowjetunion. Halb war es auch eine Flucht, »weil meine Frau sich in einen Stasi-Spitzel [Sascha Anderson, Anm. G.D.] verliebt und von mir getrennt hatte«.22 Seine Reisen werden zu ambitionierten Exkursionen, bei denen er gezielt Autoren wie Tschingis Aitmatow oder den Sänger Bulat Okudshawa aufsucht. Okudshawa, von dem Wolf Biermann das Lied »Ach die erste Liebe« übersetzte (ein Lied über den Verrat), kommt am 2.Dezember 1976 zu seinem ersten Konzert nach Ostberlin in den Palast der Republik – keinen Monat, nachdem Wolf Biermann ausgebürgt worden war.
Verboten, aber stark gesucht und in zuverlässigen Freundeskreisen kursierend, war nicht nur Solschenizyns Archipel Gulag, sondern auch Doktor Schiwago von Boris Pasternak. Fritz Mierau erinnert sich in Mein russisches Jahrhundert daran, dass es selbst für Slawisten gefährlich war, sich darauf einzulassen.
Nach Osten blickt auch der britische Historiker Timothy Garton Ash, der 1980 als Doktorand aus Oxford für neun Monate an die Humboldt-Universität nach Ostberlin kam. Das studentische Wohnungsbüro besorgte ihm ein Zimmer im Prenzlauer Berg, in einer der als nicht vermietbar eingestuften Wohnungen, die an Studenten vergeben wurden. Seine Wohnung teilte er mit einem Tierpräparator aus Angola, der ihn morgens, mittags und abends mit »Good night« begrüßte: »Mein Zimmer hatte einen Balkon, dessen Absturz unmittelbar bevorzustehen schien, und eine riesige, dunkle Anrichte.«23
In den Kneipen des damaligen Arme-Leute-Bezirks wurde er zwischen Bier und Korn examiniert: »›Na gut, Sie behaupten also, dass Sie Historiker sind‹, schnauzte ein junger Arbeiter. ›Dann sagen Sie mir, wo wurde Karl Marx geboren?‹ Glücklicherweise wusste ich die Antwort.«24 Zwischen der Staatsbibliothek Unter den Linden, dem legendären Ballhaus mit Tischtelefonen (die selten funktionierten) und Eckkneipen lernt er den Alltag in der DDR kennen.
Sein Dissertationsthema ist Berlin unter Hitler, aber die DDR unter Honecker interessiert ihn bald viel mehr (darüber wird er dann auch ein Buch schreiben, aufgrund dessen ihm die weitere Einreise in die DDR verweigert wird). Die neue Gewerkschaftsbewegung Solidarność in Polen fasziniert ihn ebenso wie die Friedensaktivitäten der evangelischen Kirche in Ostberlin.
Aber auch an den Aktivitäten seiner »Hausgemeinschaft« hat er teil und lernt dabei Sein und Schein im Sozialismus zu unterscheiden. Als an der Wandzeitung eine »Mach-mit-Aktion« angekündigt wird, ein anderes Wort für den sowjetischen »Subotnik«, Sonnabend um 11 Uhr, steht er pünktlich bereit zum Arbeitseinsatz auf dem Hof. Aber außer ihm ist keiner gekommen. So erfährt er etwas über die »Konterrevolution der Realität«. Der Dreck im Hof jedenfalls bleibt liegen.
Für ihn ist das ein Indiz für eine Art »Doppelleben« der DDR-Bewohner, ihre »innere Emigration« – vor allem verbreitet unter Intellektuellen. Diese Art »kulturelle Abstinenz vom politischen Leben« habe, so notiert Ash, »unter der heutigen DDR-Intelligenz überlebt«. Dem britischen Pragmatiker Ash ist der Rückzug aus der öden Tagesaktualität auf Geist und Kunst offenbar suspekt. Eine romantische Ausweichbewegung vor den eigentlichen Notwendigkeiten zur Kritik?
Die achtziger Jahre in der DDR bestätigen das, was Ernst Jünger einmal als Wesenszug des Stoizismus charakterisiert hatte: Beibehaltung der äußeren Rituale bei Verweigerung der inneren Anteilnahme.
Ash ist gewiss niemand, der sich für Details alternativer Sozialismus-Modelle interessiert. Dennoch liest man in seinem 2019 erschienenen Buch Ein Jahrhundert wird abgewählt, dem er seine Notizen von 1988 voranstellt, Unerwartetes: »Heimweh ist ein Gefühl, das für gewöhnlich kaum jemanden mit der DDR verbindet. Doch hier in Oxford, beim Betrachten kurzer Fernsehspots aus Dresden und Ost-Berlin, fühle ich einen seltsamen Stich im Herzen.«25
Immerhin, diese nicht eindeutige Gefühlslage, verbunden mit der Irritation des vegetativen Nervensystems bei einem ansonsten kühl-pragmatischen Angelsachsen, lässt erstaunen. Solcherart zwiespältigem inneren Zustand zu folgen, heißt nach Marcel Proust, sich auf die »Suche nach der verlorenen Zeit« zu begeben: ein unweigerlich tief melancholisches Unternehmen, das nichts mit Beschönigung hässlicher Zustände zu tun hat.
Drei tote Generalsekretäre
Drei tote Generalsekretäre der KPdSU in nicht einmal zweieinhalb Jahren! Das sprengte jeden kommunistischen Zeitbegriff, der ja immer nah an der Ewigkeit angesiedelt war. Immerhin war es so etwas wie Bewegung, die sich da in der Sowjetunion zwischen dem 10.November 1982 und dem 10.März 1985 ereignete. Wenn auch in negativer Hinsicht. Starben im Mutterland des Sozialismus etwa die Kommunisten aus? Drei tote Generalsekretäre der KPdSU in so kurzer Zeit wogen schwer.
Breschnews sich lange ankündigender Tod war so vorhersehbar gewesen, dass es eher erstaunte, dass der jahrelang Siechende nun tatsächlich starb. Außer an eine eilige Aktualisierung der Wandzeitung am Eingang der Erweiterten Goethe-Oberschule in Bad Doberan, an der wir Schüler in frühmorgendlicher Schlaftrunkenheit vorbeiströmten, ohne den Blick zu wenden (die Nachricht kannten wir bereits, zuallererst natürlich aus den Westnachrichten), erinnere ich nichts. Nachrichten aus der Sowjetunion hatten für uns nicht gerade Priorität, genauso wenig wie wir uns für einen Mosfilm (oder für die DEFA) interessierten, wobei uns allerdings einiges entging, worauf noch zurückzukommen sein wird.
Als Leonid Breschnew am 10.November 1982 starb, war dies das Ende einer Ära. Eine Zeit der Stagnation seien seine achtzehn Amtsjahre gewesen, heißt es gemeinhin. Breschnew beendete nach Chruschtschows Sturz Ende 1964 dessen Reformen, was auch fatale Auswirkungen auf Ulbrichts Reformbestrebungen in der DDR nach dem VI. SED-Parteitag von 1963 hatte.
Stagnation ist einerseits eine richtige Zustandsbeschreibung. Der Versuch Ulbrichts, mittels tiefgreifender Reform der Ökonomie mehr Dynamik zu verleihen, mit marktwirtschaftlichen Elementen auch mehr individuelle Freiheiten zuzulassen, wurde von Breschnew im Dezember 1965 gebremst – jedoch weniger aus eigenem Antrieb als auf Drängen einer Gruppe von SED-Funktionären um Politbüro-Sicherheitschef Erich Honecker, die Moskau genötigt hatten, den marktwirtschaftlichen Experimenten in der DDR ein Ende zu setzen. Mit Breschnews Machtübernahme war die unmittelbare Phase des Tauwetters beendet, die mit Chruschtschows Geheimrede über Stalins Verbrechen auf dem XX. KPdSU-Parteitag 1956 begonnen hatte.
Mit Breschnew verbunden ist auch eine Phase der Stabilität und alltäglichen Normalität. Die Menschen im Lande brauchten nach Stalins Terrorherrschaft und Chruschtschows Entstalinisierungsversuchen dringend eine Atempause. Zeit für das private Leben, für Familie, Freizeit und Konsum. Mit Breschnews Kurs begann sich der Alltag im Osten dem des Westens langsam anzugleichen, wenn auch auf niedrigerem Niveau.
Die ersten Jahre unter Breschnew waren dann auch durchaus erfolgreich. Das Lebensniveau der Menschen im Lande stieg, es ging ziviler zu in der Gesellschaft. Aber nicht nur der Konsum blühte auf, auch die Bürokratie. Und in Fragen von Kunst und Literatur blieb es widersprüchlich. Der Reformer Chruschtschow war wegen seines bäurisch groben Wesens bei Intellektuellen und Künstlern im Lande unbeliebt. Allerdings erschien 1962 – als sichtbares Zeichen der Entstalinisierung im Lande – auch Alexander Solschenizyns Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch.
Der dagegen in seinen Anfangsjahren recht machohaft auftrumpfende Breschnew (dem eine Nähe zum militärisch-industriellen Komplex des Donezk-Beckens nachgesagt wird) kümmerte sich offenbar um viele Dinge einfach nicht. So konnte dann auch ein Roman wie Bulgakows Der Meister und Margarita, der bislang verboten gewesen war, 1966 erscheinen. Boris Pasternaks Doktor Schiwago (der außer Landes geschmuggelt zuerst bei Feltrinelli in Italien herauskam), für den der Autor 1958 den Literaturnobelpreis erhalten hatte, durfte jedoch erstmals 1987 zur Zeit der Perestroika in der Sowjetunion erscheinen.
Breschnew war ein Mann der Gremien, der Alleingänge mied (was heilsam war angesichts seiner autoritären Vorgänger) und sich gern auf kollektive Beschlüsse berief. Die Weisheit des Kollektivs wurde neu entdeckt, nun unter kleinbürgerlichem Vorzeichen – das »Wir« wurde dabei jedoch mehr und mehr zum Deckmantel für kollektive Verantwortungsflucht. Wenn etwas anhob mit: »Wir sind einstimmig der Meinung …«, war es auch schon egal, was für einer Meinung.
Warum ist hier so viel vom innenpolitischen Klima der Sowjetunion, den Machtverhältnissen in der KPdSU die Rede? Weil diese beständig direkte Auswirkungen auch auf die DDR hatten. Wir lebten schließlich an der Peripherie des sowjetischen Großreiches, auf der östlichen Seite des Eisernen Vorhangs. Die Breschnew-Zeit mit ihren neuen zivilgesellschaftlichen Standards, ein bisschen mehr an bürgerlichen Freiheiten und Wohlstand im Rahmen der herrschenden Funktionärs-Apathie, fand im gebürtigen Saarländer Erich Honecker, an der Spitze der SED stehend, ihr ideales Pendant.
Diese Grundstimmung prägte dann auch das politische Klima in der DDR der siebziger und frühen achtziger Jahre. Die Gesellschaft war nicht mehr annähernd so militant, wie es eine »Diktatur des Proletariats« vermuten ließ und wie sie es bis weit in die fünfziger Jahre gewesen war. Die neuen Apparatschiks waren keine Kommissare mehr mit Pistole im Gürtel, sie waren blasse und konfliktscheue Angestellte von Staat und Partei, vermieden jede offene Diskussion, die das Risiko von Kritik barg. Sie wollten ihre Ruhe und sich vor allem nicht entscheiden müssen. Alles sollte immer weiter irgendwie seinen sozialistischen Gang gehen, jedenfalls noch eine Weile und noch eine. Man war sich der eigenen Macht längst nicht mehr sicher. Also bloß keine Veränderung!
Staatsbegräbnisse von Generalsekretären der KPdSU waren lange nicht mehr vorgekommen. So lange nicht, dass sie Neuigkeitswert hatten. Das letzte war das von Stalin gewesen, denn Chruschtschow, der trotz seiner Bauernschläue Opfer einer Machtintrige seiner Genossen geworden war, hatte keines bekommen. Und der berüchtigte Geheimdienstchef Berija unter Stalin – und sein potenzieller Nachfolger – war noch Ende 1953 hingerichtet worden. Das war dann ein Staatsbegräbnis der anderen Art. Obwohl einige Historiker heute der Meinung sind, man tue Geheimdienstchef Berija Unrecht – dieser sei zwar zweifellos ein Massenmörder gewesen, jedoch habe er nach Stalins Tod ebenfalls Reformen im Lande geplant, vor allem eine andere Deutschland-Politik gewollt. Berija sei, die Politik der Stalin-Noten von 1952 forcierend, schon 1953 bereit gewesen, sich aus der DDR militärisch zurückzuziehen und so den Weg zur Wiedervereinigung – im Rahmen einer Neutralität Deutschlands – freizumachen. Solchen für deutsche Ohren (ausgenommen die für ostelbische Belange tauben eines Konrad Adenauers) durchaus verheißungsvoll klingenden Plänen bereitete die Berija beseitigende Fronde ganz nebenbei ein schnelles Ende. Auch weil Adenauer kein Interesse an diesem Angebot zeigte und lieber die bürgerlichen Reste der Gesellschaft in der DDR den Sowjets opferte, als die eigenen NATO-Ambitionen aufzugeben. 1955 trat die Bundesrepublik – nach der durch die Pariser Verträge von 1954 beschlossenen Wiederbewaffnung – schließlich der NATO bei, gegen den Widerstand der SPD. Die DDR wurde daraufhin Mitglied des neu gegründeten Warschauer Paktes. So standen sich beide deutsche Staaten plötzlich auf gegnerischen Seiten im Kalten Krieg gegenüber.
Die DDR hatte nichts einem byzantinischen Totenkult wie der Stalin-Beisetzung Vergleichbares zu bieten. Der Tod Walter Ulbrichts während der X.Weltfestspiele der Jugend und Studenten im Sommer 1973 in Berlin glich eher einer irgendwie zu managenden Verlegenheit. Honecker hätte seinen zwei Jahre zuvor eigenhändig gestürzten Vorgänger überhaupt am liebsten still und heimlich begraben lassen. Ganz so ging es zwar nicht, aber für einen kommunistischen Parteiführer war es dann doch nur ein Begräbnis zweiter Klasse. Daran kann ich mich dann auch gar nicht erinnern, obwohl ich mit meinen acht Jahren durchaus beeindruckt war, als der Chefsprecher der »Aktuellen Kamera« Klaus Feldmann den angeblich letzten Wunsch Ulbrichts verlas, die feiernde Jugend der Welt solle sich keinesfalls durch seinen Tod die Laune verderben lassen. Tat sie auch nicht.
Es gibt einen kurzen inoffiziellen Film, am 17.September 1973 vom Straßenrand aus gedreht, der einen Kovoi zeigt, unterwegs mit Ulbrichts Sarg zur Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin Friedrichsfelde. In ungebührlicher Eile fährt dieser, fast rast er, die Straße entlang. Zuerst einige Armee-Lastkraftwagen der Marke W50, auf denen Kränze, Soldaten und Ulbrichts Sarg transportiert werden. Das hat wenig Schauwert und wenig Würde. Aber was danach kommt, ist umso erstaunlicher: eine lange Doppelreihe von schwarzen Staatslimousinen sämtlich östlicher Bauart zieht vorbei – eine Selbstfeier der Hofschranzen. Mitte der siebziger Jahre wird Honecker dann bereits einen Peugeot 604 fahren, andere Funktionäre steigen auf Volvo um, die russischen Benzin-Säufer werden während der Ölkrise schrittweise ausgemustert.
Aber jetzt fahren sie noch alle. Erst kommen die wie amerikanische Packard-Straßenkreuzer der fünfziger Jahre über die Straße wippenden chromglänzenden Tschaikas (im Russischen: »Möwe«) für die Politbüromitglieder. Es folgen die tschechischen Tatras, das ist der fast schon schnittig zu nennende Wagen für mittlere Funktionäre des Zentralkomitees, unter die sich einige russische Wolgas mischen. Viel zu weich gefedert und mit hohem Kraftstoffverbrauch war dieser Wagen bis zur Wende auch als Taxi für Jedermann im Einsatz. Wolgas nutzten Betriebsdirektoren und Funktionäre der Kreisebene.
In Moskau fuhr die oberste Parteiprominenz den SIL, eine Art Rolls-Royce russischer Bauart – eine riesige Luxuslimousine, gefertigt in Einzelstücken im gleichnamigen Traktorenwerk. Willy Stoph, heißt es, habe als Ministerpräsident jenen SIL geerbt, den einst Chruschtschow Walter Ulbricht geschenkt hatte. Ein museales Einzelstück.
Leonid Breschnew also war am 15.November 1982 der erste von drei Generalsekretären, der seit 1953 wieder ein Begräbnis byzantinischen Ausmaßes erhielt. Die Feierlichkeiten dauerten zwar lange, aber mehr wegen des ornamentalen Drumherums – es folgte die Aufbahrung des offenen Sargs in der Säulenhalle des Hauses der Gewerkschaften, mitsamt langer Pausen. Aber die Fernsehbilder zeigen Unerhörtes. Sicherheitsleute und Mitarbeiter des Organisatorenteams laufen lässig durchs Bild oder stehen desinteressiert herum. Die Reden, die auf Breschnew gehalten werden, vor allem die seines Nachfolgers Juri Andropow, sind kurz und unpersönlich. Kein Vergleich mit dem schweren Pathos, das über Stalins Beisetzung lag. Nein, diese Veranstaltung lief überaus schnöde ab, von Schmerz und Trauer war, außer bei der Witwe, wenig zu spüren. Aber dafür etwas anderes: Der Ablauf schien schlecht organisiert, alles wirkte irgendwie schlampig.
Das Pathos war noch da, aber auf eine merkwürdige Art: als ungewollte Parodie auf dieses Pathos! Die äußeren Abläufe stammten noch aus dem Drehbuch der Stalin-Beisetzung. Der Sarg des toten Generalsekretärs wurde auf einer Geschützlafette transportiert, was ich zugleich ungewöhnlich und eindrucksvoll fand. Es war allerdings nicht das erste Mal seit Stalins Tod, dass der Staat sich wieder in Totenkult erging, auch Politbüromitglieder wurden mit Pomp beerdigt, allerdings ohne hochrangige ausländische Gäste. Kreml-Kenner meinen, die Begräbnisse von Ministerpräsident Kossygin (1980) und Michail Suslow (1982), dem dogmatischen Chefideologen, seien feierlicher gewesen, die Reden länger.
Kommunistische Herrscher lassen sich offenbar nicht wie normale Menschen beerdigen. Das hatte sich bereits bei Lenins Tod 1924 gezeigt. Die Leiche des Staatsgründers wurde bis heute nicht beerdigt, sondern ist im Geiste des Ägyptizismus auf dem Roten Platz der öffentlichen Besichtigung im eigens errichteten Mausoleum preisgegeben. Dieses vorherbestimmte Schicksal einer Mumie ereilte anfangs auch Stalin, der ebenfalls einbalsamiert wurde und in einem Glas-Sarg neben Lenin zu liegen kam. 1961 brachte man ihn dann ohne viel Aufhebens an der Kremlmauer unter die Erde.
Die Kamera zeigt die holprige Inszenierung dieses Breschnew-Staatsbegräbnisses, die offenbar vom Militär einstudiert wurde. Uniformierte Protokollführer dirigieren die Politbüromitglieder wie Schuljungen, bis sie endlich auf den ihnen angewiesenen Plätzen stehen. Deren Gesichter sind sorgenvoll – offenbar denkt hier jeder an seine eigene Zukunft, so er denn noch eine haben sollte.
Höhepunkt der verunglückten Zeremonie ist das Herablassen des Sargs ins Grab, das man seltsamerweise nur zwei Trägern, die wie simple Friedhofsangestellte wirken, überlassen hat. Diese scheinen damit kräftemäßig überfordert, zumal sie – einer am Kopf-, der andere am Fußende – den Sarg noch eine viel zu lange Zeit über dem offenen Grab halten müssen. Offenbar ist nicht klar, wer das Signal zum Herablassen geben soll. Doch dann verlassen einen der Träger die Kräfte, ihm rutscht das Seil aus der Hand, der Sarg kippt gleichsam kopfüber in die Grube. Es knallt laut – unklar ist, ob dieses Geräusch vom Aufschlag kommt oder vom ersten eilig abgefeuerten Salutschuss. Während die Witwe herbei wankt, stürzen die Politbüromitglieder an ihr vorbei zum daneben aufgeschütteten Sand, den sie händeweise ins Grab befördern, so hastig, als gelte es den dort Liegenden zu bewerfen. Mehrere Totengräber drängen sich dazwischen und schaufeln Erde – während die lange Reihe von Trauergästen aus aller Welt Schlange steht. Die Grabstätte ähnelt so bereits nach Sekunden einer Baustelle. Offenbar hat der Sarg den Absturz nicht heil verkraftet, und der sich bietende Anblick soll nun möglichst schnell kaschiert werden.
Das wird zum Symbol für die späte Breschnew-Ära: Man kaschiert die Pannen, aber eher leidenschaftslos, voller Gleichgültigkeit. Die Sowjetunion ist ein an allen Ecken und Enden bröckelndes Imperium, das man besser vor den Augen der Welt verbirgt.
Innerhalb kurzer Zeit gleich drei tote Generalsekretäre, die – immerhin – eines natürlichen Todes im Amt gestorben sind. Der sieche Breschnew hatte den Anfang gemacht. Seit langem war der in seinen besseren Jahren Wein, Weib und Gesang zugewandte Generalsekretär, der nicht zuletzt aufgrund dieser freudvollen Lebensführung sofort einen Draht zu dem ihm darin verwandten SPD-Hedonisten Willy Brandt hatte, krank und wurde auf offener Bühne immer kränker. Als ich ihn Anfang der achtziger Jahre im Fernsehen auf einer Tribüne stehen sah, wirkte er bereits wie ein Scheintoter, mehr Maske als Mensch. Manchmal verschwand er dann sogar während einer Liveübertragung – vermutlich unter einem Sauerstoffzelt.
Keine zwei Wochen vor seinem Tod hatte er seinen letzten öffentlichen Auftritt – stand dabei im eisigen Wind auf einer Tribüne wie erstarrt irgendeinem Vorbeimarsch beiwohnend, wenn auch vollkommen abwesend. Dieses zugleich Anwesend-und-abwesend-Sein war typisch für die späte Breschnew-Zeit.
Mit der im November 1982 beginnenden Generalsekretärs-Begräbnis-Orgie in drei Teilen und immer der gleichen melodramatischen Regie, den Trauermärschen aus Beethovens Eroica und Chopins b-moll-Sonate begann so etwas wie die Götterdämmerung der allein herrschenden Partei. Wenn man nicht einen, sondern kurz nacheinander gleich drei Führer des Volkes beerdigt wie Pharaos, dann öffnet man dadurch ungewollt dem Prinzip Pluralismus Tür und Tor.
Dem erst halbtoten, dann toten Breschnew folgte im November 1982 der vormalige KGB-Chef Juri Andropow – 1964 der Hauptrivale Breschnews. Dass man nun – fast zwanzig Jahre nach dem verlorenen Machtkampf – auf ihn setzte, spricht für ein gewisses träges Element von ausgleichender Gerechtigkeit im greisen Politbüro. Der wollte mal große Dinge bewirken, nun soll er es doch beweisen. Leider zwanzig Jahre zu spät. Andropow galt als der wohl fähigste Kopf im Kreml.
Möglich, dass er Mitte der sechziger Jahre die Weichen der Entwicklung in der Sowjetunion, und damit auch in den Satellitenstaaten, anders gestellt hätte, als dies unter dem auf die Groß- und Rüstungsindustrie orientierten Breschnew passierte. Vor allem, was eine Neuauflage der Neuen Ökonomischen Politik der frühen zwanziger Jahre betraf, deren Ideengeber Bucharin 1929 von Stalin als »rechter Abweichler« stigmatisiert und – nach Schauprozess – 1938 während der großen »Säuberung« hingerichtet wurde. Chruschtschow hatte diesen von dem sowjetischen Ökonomen Jewsei Liberman erneut angestoßenen Reformen nicht ablehnend gegenübergestanden, und Andropow nahm sie als Modellversuch in mehreren Großbetrieben wieder auf, mit Erfolg, wie es hieß.
Üben wir uns in »kontrafaktischer« Geschichtsbetrachtung. Hätte Andropow und nicht Breschnew 1964 den Machtkampf im Kreml gewonnen – vielleicht wäre dann die Marktwirtschaft in der Sowjetunion möglich geworden, gleichsam ein vorgezogener chinesischer Weg? Der erzwungene Abbruch der von Ulbricht begonnenen Wirtschaftsreformen in der DDR Ende 1965 geht jedenfalls auf Breschnews Intervention zurück, zu deren sichtbarem Zeichen der Tod Erich Apels, des Chefs der Staatlichen Plankommission, gehört. Offiziell wurde auf Selbstmord befunden.
Breschnews Nachfolger Andropow galt als eher kalter Intellektueller, der gar nicht erst versuchte, volkstümlich zu wirken. Sogar der Westen brachte ihm Respekt entgegen, denn er hatte das nicht geringe Kunststück fertiggebracht, den ihm unterstellten KGB als seine eigene Machtbasis zu stärken und gleichzeitig die Mordmaschine stillzulegen. Für kurze Zeit änderte sich nach seinem Amtsantritt Ende 1982 bereits das Klima in der Sowjetunion. Von Breschnew war eine Anekdote im Umlauf gewesen, die die Apathie im Lande charakterisierte: Nachts klingelt es bei Breschnew, er schlurft zur Tür, zieht umständlich einen Zettel aus der Tasche und liest vor: »Wer ist da?« Das sollte sich jetzt ändern.
Andropow pflegte einen eher westlichen Lebensstil. Er spielte Tennis, solange er gesund genug dafür war, ein in Russland für dekadent gehaltener Sport, sprach frei und wenn nötig auch Englisch. Er war auch eigentlich noch nicht alt, als er an die Macht kam, 68 Jahre – sein schneller körperlicher Verfall ist auf ein Nierenversagen Anfang 1983 zurückzuführen. Der neue Generalsekretär machte sich sofort unbeliebt beim Parteiapparat und allen, denen der Schlendrian zur Heimat geworden war. Er erklärte der Korruption im Land den Kampf, scheute auch vor spektakulären Großaktionen nicht zurück wie dem Absperren des Moskauer Kaufhauses GUM für eine Großrazzia. All die wie gewohnt in ihrer Arbeitszeit ungestört einkaufenden Bürger der Hauptstadt standen nun am Pranger.
Am schlimmsten erschien vielen, dass Andropow im Alkoholismus kein angestammtes Recht der Russen, sondern ein Symptom der Degeneration erblickte – und ihn entsprechend bekämpfte (vor vierzehn Uhr durfte Alkohol weder verkauft noch in Gaststätten ausgeschenkt werden).
Der Tod Juri Andropows im Februar 1984 traf mich während meines Grundwehrdienstes bei der NVA. Ich war zu der Zeit Soldat im ersten Diensthalbjahr an der Unteroffiziersschule in Eggesin, wo auch die Richtschützen des relativ neuen Panzers T-72 (die Ziffer verweist auf das Konstruktionsjahr) ausgebildet wurden. Gegenüber dem T-54 war der tatsächlich neu – hatte statt eines Ladeschützen ein automatisches Ladekarussell, das Granaten zur waagerecht stillgestellten Kanone beförderte. Mittels eines Kolbens stieß die Maschine die ausgewählte Granate (Splitter-Spreng, Hohlladung oder Unterkaliber) ins offene Rohr. Hauptsache, der Verschluss des Rohrs war wirklich offen, denn sonst hätten die Panzertruppen der NVA einen hochmodernen Kampfpanzer samt Besatzung weniger gehabt. 332 dieser T-72 besaß die NVA (Nachwendestückpreis 1,8 Millionen Dollar). Sie waren unter der Führung von Generalmajor Erdmann in der 9.Panzerdivision vereinigt, die aus drei Panzerregimentern bestand. Der T-72 war bereits mit einem Laser-Entfernungsmesser ausgestattet. Der rote Punkt musste aufs Ziel – mehr als abdrücken war nicht zu tun.
»Raubtiere bekämpft man mit Waffen des Sieges« stand als Losung auf einem Plakat im Panzerregiment 21 »Walter Empacher« in Torgelow-Spechtberg, darauf war ein Leopard-Panzer der NATO