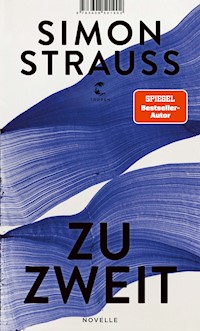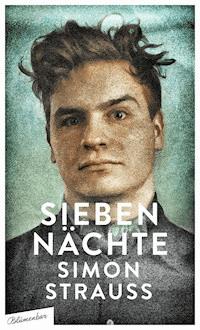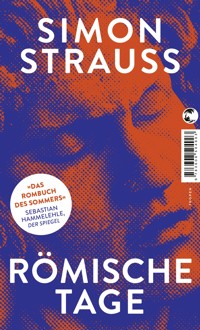
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Sommer in Rom Ein junger Mann kommt in die ewige Stadt, um die Gegenwart abzuschütteln. Er sucht einen eigenen Weg, fühlt fremde Zeiten in sich leben. In Rom erinnert er sich. In Rom verliebt er sich. In Rom trauert er. Er trifft auf außergewöhnliche Menschen und findet seine Aufgabe: Alles wahrnehmen, nichts auslassen. Römische Tage führt zu den vielen Anfängen und Enden unserer Welt und fragt, was wir morgen daraus machen. Der Erzähler zieht in eine Wohnung schräg gegenüber der Casa di Goethe und die Stadt wird ihm zur Geliebten. Ihre Geschichten spielen vor seinem Auge: Der Mord an Caesar am Largo Argentina ist ihm genauso lebendig wie das Gerangel der Sonnenbrillenverkäufer auf dem Corso. Er taucht ein in eine Welt voller Gegensätze: die Verlorenheit der jungen Italienerinnen und die schwindende Bedeutung der alten Intellektuellen. Antike und moderne Ideale, leuchtende Paläste, ausgelassene Partys und vergehende Kunst. Einheimische, Migranten, Gläubige, Touristen, Bettler. Zwischendrin Müll, viel Müll. Und immer wieder das Stechen in seiner Brust, das die Ärzte nicht ernst nehmen wollen. Begeistert und melancholisch, leichtfüßig und ergreifend erzählt Simon Strauß, warum Gegenwart nicht ohne Vergangenheit auskommt. Die Presse über Simon Strauss »Die Stimme einer Generation« Maria Wallner, Die Presse »Strauß hat einen schönen eigenen Tonfall, der das Zeitgenössische in sich trägt, ohne damit protzen zu wollen, der aber dennoch auch den Sound der Väter kennt, der aus großen Bildungstiefen kommt und sich dafür auch manchmal selbst verachtet und dann zu großer Lakonie und schlichter Sinnlichkeit findet.« Florian Illies, Die Zeit »Strauß ist eine der größten feuilletonistischen Begabungen seiner Generation, und so bildstark und imaginativ er hier schreibt, hat er ein genuin literarisches Talent.« Gregor Dotzauer, Tagesspiegel »Die Kraft mit der Simon Strauß sprachliche Bilder zeigt, ist hin- und damit auch mitreißend!« ZDF aspekte »Simon Strauß trifft die Realität einer gebildeten, privilegierten, jungen Generation, durch die sich Schmerz und Zweifel ziehen, obwohl oder gerade weil es ihr an nichts fehlt«. Sara Maria Behbehani, Stuttgarter Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 130
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Simon Strauss
Römische Tage
Tropen
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Tropen
www.tropen.de
© 2019, 2021 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München unter Verwendung eines Fotos von © (Sala Age) F1online
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-50490-3
E-Book: ISBN 978-3-608-19144-8
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Für Dich, Rom
I.
ANKUNFT IN ROM. Am ersten Juli. Zweihunderteinunddreißig Jahre und acht Monate nach Goethe. Im verspäteten Flieger spielte die Klimaanlage verrückt, über den Alpen zitterten alle und zogen sich die T-Shirts übereinander an. Zumindest eine Ahnung von Beschwerlichkeit also, nicht zu vergleichen mit dem, was der Weg hierher einst bedeutet haben muss. Wie viel gefroren und gelitten wurde auf den Pilgerreisen früher. Gestorben auch auf den engen Bergpässen ohne Kletterseil. Manche blieben schon nach wenigen Tagen erschöpft im Schnee sitzen und hielten ihre eisigen Zehen ins Feuer.
Romfahrer denken an Romfahrer. Sonst würden sie sich gar nicht erst aufmachen. Und dann? Dann setzen sie darauf, dass sich auch ihr Geist durch den Aufenthalt reinigt und neu bestimmt, dass er von Schönheit gestreift, wiederbelebt, zumindest durchgelüftet wird. Rom als Heilanstalt – der Traum hält sich. Geht durch die Jahrhunderte. Genauso wie das harsche Erwachen aus ihm: Warteschlangen am Taxistand, stinkendes Chlorwasser im Bernini-Brunnen, Einsamkeit bei Pizza und Plastikflasche.
Ich sitze in einem Restaurant über der Piazza Navona und mache das nach, was schon so viele vor mir gemacht haben: In Rom sein und hoffen, dass jemand es merkt. Sich vorstellen, dass der Aufenthalt wichtig wird. Vor mir liegt die Kuppel von Sant’Agnese, Möwen sind vom Meer herübergeflogen und sitzen über den schwitzenden Menschen auf den Dächern, schlagen mit den Flügeln und kühlen sich an der Luft, die durch die schlecht verklebte Dachpappe dringt.
Kein Tag im vergangenen Jahr, an dem ich alleine war. Immer in Begleitung, ständig außer Haus gewesen. Abends aus fremden Fenstern geschaut, morgens beim Frühstück die falschen Menschen getroffen. Ich bin geflohen nach Rom. Um die Gegenwart abzuschütteln, das Schnipsen im Ohr loszuwerden: Mach das, zeig her, geh hin. Ich kreise und kreise und flattere dabei. Es ist noch etwas anderes: Seit ein paar Wochen schmerzt mich das Herz. Es ist kein innerer, sondern ein äußerer Herzschmerz, wie der Kardiologe gesagt hat, rührt also von der Entzündung eines Muskels oder einer Sehne her, aber es sticht und fühlt sich echt an. Geredet habe ich darüber selten. Wenn man aufs Herz zu sprechen kommt, nur in die Richtung zeigt, schauen die Menschen gleich so betrübt. Nichts mehr zu machen, denken sie mit heimlicher Erleichterung darüber, dass es sie nicht selbst getroffen hat. Mein Rhythmus stimmt nicht mehr, durch das Stechen setzt das Herz manchmal aus, fängt dann wie aus dem Nichts wieder an zu schlagen und beschleunigt, als müsste es die versäumten Schläge nachholen.
Mit der Plastikflasche in der Hand stelle ich mich an die Brüstung. An meinen Tisch setzen sich gleich die Nächsten, schlagen die Karte auf, senken den Kopf und strecken die Zeigefinger. Vor mir die Piazza Navona. Hunderttausende drängen sich die Treppen hinauf zur Tribüne, schwitzen, gaffen, grölen. Gleich tritt Domitian aus seiner Loge, der einsame Kaiser, den sein Haarausfall so plagte, dass er ein Buch über die richtige Haarpflege schrieb. Das hier ist sein Stadion, er hat es bauen lassen, nach griechischem Vorbild. Sollen die anderen ihn doch verrückt nennen, hier findet er Ruhe. Wenn unten die Pferdewagen aufeinanderkrachen, schließt er die Augen und genießt seine Macht.
Jetzt sitzen da unten die Kellner müde in der Sonne und versuchen, Passanten durch ein Schnalzen in ihre Restaurants zu locken. Die meisten von ihnen sind schon abgebrüht, halten es für besonders geschickt, so wenig wie nötig zu arbeiten, ganz wie die römischen Müllmänner, über die in der Zeitung steht, dass sie nachts ihre eigenen Abfuhrwagen anzünden – je weniger Fahrzeuge, desto weniger Arbeit. Einer von den Kellnern ist noch nicht so weit. Er sucht noch ernsthaft nach neuen Gästen. Seit einer Weile beobachtet er eine junge Frau, die auf einer Bank vor dem Mohrenbrunnen sitzt und eine dünne Zigarette raucht. Ihr weißes Kleid flattert im Mittagswind, die Sonnenbrille ist auf dem Nasenbein weit hinuntergerutscht. Als sie sich die zweite Zigarette zwischen die Lippen schiebt, stürmt der junge Kellner auf sie zu, spricht sie scherzend an, wirbt, gestikuliert, ein bisschen zu wild vielleicht, wie aus einem Lehrbuch des italienischen Umgangs, setzt sich zu ihr, berührt beim Erzählen wie aus Versehen ihr Knie, legt den Kopf schief. Sie will nicht aufstehen, scheint ihn zu mögen. Die Beine übereinandergeschlagen, lässt sie den rechten Fuß aus der Sandale gleiten, damit er ahnt, was er verpasst. Ein paarmal noch sieht es so aus, als würde er sie um ihre Nummer bitten, sie von einem Wiedersehen überzeugen können, dann steht er enttäuscht auf, stößt Schleim aus dem linken Nasenloch und setzt sich zurück zu den anderen.
Ich wohne in der Via del Corso. Ein Zimmer schräg gegenüber von der Casa di Goethe, Goethes Haus. Im Hochsommer fahren die Römer ans Meer und vermieten ihre Wohnungen, weil es zu heiß ist in der Stadt. Ein Bekannter hat mir einen Hinweis gegeben, also bin ich hier, für zwei Monate. Ich stehe am kleinen Fenster und stelle mir vor, wie Goethe sich drüben nach einem langen Tag die Füße gewaschen hat, wie er sein Bettzeug aufschüttelte und am Tisch ein paar Zeilen schrieb. Ich bin kein Kenner, die Italienische Reise habe ich erst vor ein paar Tagen zu lesen begonnen. Zu Freunden habe ich gesagt: »wieder zu lesen«, aber das stimmt nicht, ich lese das Buch zum ersten Mal.
Vielleicht kann mir das Zimmer hier helfen. Sein ruhiges Rauschen, das Knacken der Rohre, die Stimmen draußen, später am Tag. Wenn Gruppen kommen, hört man es immer sofort: Erst wird das Geraune lauter, dann plötzlich Stille und eine Stimme durchs Megafon. Leichte Erklärungen, Antworten auf Fragen, die keiner stellt. Wann, wo, aber nie: warum. Man könnte ihnen alles zeigen, alles sagen, aber ihre Hände blieben doch immer lässig in den Hosentaschen. Und trotzdem: Insgeheim träume ich noch immer von jener Busfahrt unter freiem Himmel durch die fremde Stadt, als Kind, ich wollte nie laufen. Der Fahrer erzählte Tierwitze, und um mich herum nahmen die Gäste die Kopfhörer ab. Aber ich hörte weiter, ließ mich fahren. Nie fühlte ich mich sicherer.
Jetzt, hier, am frühen Morgen, läuten die Glocken. Nach dem Aufstehen solle ich mich gleich an die Türklinke stellen, hat der Arzt gesagt, mit dem Gummiband Übungen machen, Zug um Zug den Herzmuskel dehnen. Er hat mir einen Zettel mit Piktogrammen mitgegeben, der mir Mut machen soll. Aber ich lasse ihn im Koffer und setze mich auf den Balkon. Die Palme vom Hof hat ihre Wedel zum Ausruhen auf die Brüstung gelegt, noch scheint niemand auf zu sein. Im ersten Stock ist ein Hotel, über mir wohnt ein gefragter Architekt, aus dem Hof strömt süßlicher Seifenduft. Eine Kosmetikkette ist ins Erdgeschoss gezogen und stört die Andacht. Dicke Seifenblasen stehen starr in der Luft und zerplatzen an der alten Mauer, brechen die Aura, behaupten, Vorzeichen zu sein.
Nichts scheint uns Modernen moderner als die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Das Zusammenspiel von Alt und Neu. Und doch treibt mich die Frage: In welche Zeit gehöre ich? Welche Zeiten leben in mir? Oft fühle ich mich wie ein Befallener, zerfressen von vergangenen Idealen, getrieben von unbefriedigtem Ehrgeiz. Wer zu spät auf die Welt gekommen ist, wird seine Zeit nie finden, sagt man.
Über die Palmenblätter laufen die Ameisen auf das Fensterbrett und in die Küche. Bis zum Brotkorb haben sie eine Kette gebildet und reichen sich mit ihren Zangen vorsichtig die Krumen weiter. Wer etwas fallen lässt, wird von den Nachbarn sofort zur Königin eskortiert und muss auf dem Rücken liegend ein letztes Gebet sprechen.
Meine Sprachlehrerin heißt Francesca. Sie hat lockiges Haar und jeden Tag ein anderes Kleid an. Frühmorgens muss sie zwei Stunden mit dem verspäteten Regionalzug in die Stadt fahren, aber schlecht gelaunt ist sie nie. Wenn ich zum dritten Mal eine Präposition falsch betone, schlägt sie mir lachend mit dem zusammengerollten Übungsheft auf den Kopf. Sie ist so alt wie ich. Sie könnte meine Freundin sein. Sogar meine Frau. Wir könnten ein Kind bekommen. Ich ziehe zu ihr, in die Vorstadt, gehe mit dem Vater ins Fußballstadion, schiebe ihrem Neffen das Fahrrad hinterher. Abends sitzen wir in ihrem Zimmer auf dem Bett und werfen mit Kissen, während unten vor der schlafenden Großmutter der Fernseher läuft. Wir planen den Urlaub, duschen die Kinder, bauen ein Haus auf dem Berg und streiten über den Staub hinter der Waschmaschine. Die Tage vergehen, und die Zweifel kommen. Kleine Sprünge zur Seite erst und dann der große Bruch. Die meisten sprechen vom Leben, als wäre das alles so einfach. Als gäbe es keine anderen Möglichkeiten, als würden wir das Entscheidende schon sehen. So ist es nicht. So war es nie. So wird es immer bleiben.
Im Palazzo Altemps, auf dem Ludovisischen Thron, ist Aphrodites Geburt aus dem Meeresschaum dargestellt. Zarte Damenhände heben sie aus dem Wasser, Schleier wehen, Füße treten vorsichtig auf den Boden. Rechts hält eine Flötenspielerin Wache, schützt die Geburt. Ihren linken Fuß hat sie leicht nach außen gestellt wie zum Plié, so dass man ihre Zehen bewundern und – Rationalist, der man ist – auch nachzählen kann. Sechs kleine Zehen wölben sich aus dem hellen Stein und zeigen an, dass es hier um Höheres geht.
Den Innenhof des Palazzo bewacht Marco. Stolz zeigt er seinen Dienstausweis. Er hat schlechte Zähne, aber ein helles Leinenjackett und einen festen Händedruck. Jeden Tag steht er hier im Hof, je nach Sonnenstand und Schatten in einer anderen Ecke, und gibt acht darauf, dass die Besucher kein blitzendes Licht benutzen. Hinter ihm steht ein junger Athlet in Stein, seine schöne Hüfte will Marco nicht den falschen Blicken ausliefern. Die beiden haben eine Abmachung: Nur junge Frauen mit Leberfleck an der Wange dürfen ihn fotografieren, alle anderen müssen auf Abstand gehalten werden. Und so mustert Marco jeden, der seinen Innenhof betritt, mit großer Genauigkeit.
Als ich von der Sonne geblendet ins Freie trete, sehe ich auf der gegenüberliegenden Seite den Saum eines weißen Kleides im Ausgang verschwinden. Es könnte das vom Vortag sein, von der Schönen am Mohrenbrunnen. Ein Rest Zigarettenasche weht im Wind und legt sich behutsam vor meine linke Fußspitze. Ich will ihr nachlaufen, beuge den Rücken nach hinten und falte die Hände dabei. Dann zieht eine Wolke vor die Sonne, und ich spüre mein Herz zu schnell schlagen. Ich halte inne und messe den Puls. Marco beobachtet mich skeptisch, unter seinem Blick nehme ich Haltung an, verwandelt sich mein langsamer Gang über den Hof zum Auftritt auf einer Bühne. Weder drinnen noch draußen fühle ich mich in diesem Innenhof, der ja eigentlich nichts anderes ist als ein Durchgangsraum, eine Passage.
Mein Blick geht nach oben, will die Fassade fassen, sehen, wer womöglich gerade auf die Terrasse tritt, die Hände auf die Balustrade legt, den Kopf zur Sonne streckt und die Fidelio-Arie summt: »O welche Lust in freier Luft, den Atem leicht zu heben«. Die Augen streben nach oben, die Ohren zieht es herab. Hin zum Brunnenbecken. Von früh bis spät spielen Wasser und Luft da Fangen, sprudelt es aus unterirdischen Quellen. Es gibt für unseren kurzen Aufenthalt auf Erden eigentlich kein besseres Hintergrundgeräusch als dieses Plätschern, diese Ahnung von Meeresstille und glücklicher Fahrt.
Ich setze mich an den Brunnenrand und schaufle mir Wasser in die schwitzenden Achseln. Marco sitzt gegenüber im Schatten, dreht an einem knisternden Radio. Lächelt. Wir tauschen noch einmal Blicke. Wer ist er? Ein Mann ohne Absichten, mit einer Tochter, die im Ausland studiert? Oder ein ehemaliger Koch, den man aus seinem Restaurant geschmissen hat, weil er betrunken Zucker und Salz vertauschte? Vielleicht aber auch ein Bildhauer, ein Künstler, der die Nähe der Klassiker sucht, um abends dann in seinem Atelier Gegenmodelle zu entwerfen. Welche Bedeutung hat das eigene Tun schon für die Gegenwart? Viel wichtiger ist ja, wie man von der Zukunft erinnert wird. Und an Marco werde ich mich erinnern. Wie er im Schatten sitzt, mit seinem Leinenjackett. Das Radio zwischen den Beinen, mit schlechtem Empfang.
Am Abend bin ich mit einem deutschen General im Ruhestand verabredet, der seit den neunziger Jahren in Rom wohnt. Seine Wohnung geht direkt auf den Vatikan, und wenn man im Stehen pinkelt, kann man vom Toilettenfenster aus direkt auf den Petersdom sehen. Achtzig ist er geworden im letzten Jahr, und je älter er wird, desto genauer erinnert er sich an seine Kindheit. Das Restaurant, in das wir gehen, gehört einer braungebrannten ehemaligen Springreiterin, die Nero für den größten Römer aller Zeiten hält. »Alle Italiener sind im Grunde Faschisten«, sagt sie und schwärmt vom Duce, der mit den Problemen des Landes schnell fertig geworden wäre. Ein Mann mit einer Gitarre tritt an den Tisch, aber anstatt zu spielen, hält er mit geschlossenen Augen ein kleines Schild hoch: Ich spiele nicht, um Sie nicht zu belästigen. Über eine kleine Entschädigung würde ich mich freuen.
»Hau ab«, murmelt die Wirtin und zeigt ein Video von ihrem 12-Zylinder-Jeep. Als Hintergrundmusik hat sie den »Walkürenritt« ausgewählt, von »Bella Ciao« will sie nichts wissen. Garibaldi und Konsorten seien Nichtskönner, die Neuen Rechten allesamt Schlappschwänze und Straßenschilder allein dafür da, um Löcher hineinzuschießen. Zum Abschied zieht sie mich noch kurz hinter den Tresen und zeigt mir einen Ledergürtel mit Hakenkreuz. »Il permesso per l’inferno« – »Mein Passierschein zur Hölle«, murmelt sie.
Ich zahle die Rechnung und suche das Weite. In den engen Gassen zischen die Motorroller vorbei, das Licht ihrer Scheinwerfer spiegelt sich in den Schaufenstern. Hunderte Geigen hängen da an der Wand und warten. Seltsam die Vorstellung, dass die Hände von heute noch immer dasselbe tun, was sie schon vor vierhundert Jahren taten – bauen und spielen. »Ich habe hier in Rom«, schreibt Goethe, »keinen ganz neuen Gedanken gehabt, nichts ganz fremd gefunden, aber die alten sind so bestimmt, so lebendig, so zusammenhängend geworden, dass sie für neu gelten können.«
Also los: das Alte neu denken. Wo, wenn nicht hier, könnte das gelingen? In dieser Stadt. In diesem Zimmer. Das Kissen ist weich, eine Decke braucht man nicht. Ich schaue ins Dunkel, vertage die Frage. Und messe lieber noch mal den Blutdruck. 130 zu 85. Kein Grund zur Sorge.
Die Italiener sagen als Erstes »Ich«, wenn sie etwas aufzählen. Io e il mio amico. Io e la mia patria. Das lässt sich als eine Metapher für die Gemütsverfassung des Landes verstehen: Ich komme zuerst, dann die anderen und irgendwann auch das große Ganze. Man gibt nichts auf Rom, auf seine überbezahlten Politiker und seine korrupte Bürokratie. Zu viele Familienbetriebe sind schon pleitegegangen, weil die öffentliche Hand nicht zahlte. Man liebt das Land, aber hasst den Staat, so lautet die Faustformel in Italien.
Und Deutschland dagegen? Atmet durch zwei unterschiedliche Masken. Herzrhythmusstörungen auch hier. Ost und West sind nach wie vor wegweisende Kategorien, die Steuer schreibt die Geschichte. Vor der Nation zucken die Verwalter zusammen, reden lieber von Menschen als von Bürgern und halten bei Auschwitz den Atem nicht mehr an. Strategien machen die Ordnung, Beratung ersetzt das Gespräch, behauptete Eigenheit übertrumpft kritische Empfindung. War Deutschland am besten nicht immer das: Eine Pflanzschule für Bewusstsein und Fühlvertrauen, Kant und Novalis. Heute ist es ein Land, dem die ganze Welt begegnet. Dem so viel passiert, das aber nichts davon hält. Es fehlt die Verarbeitung, das Einmachen der Erfahrung. »Für schlechte Zeiten«, hat meine Oma immer gesagt, aber wir können uns gar nicht mehr vorstellen, dass sich je wieder etwas grundlegend ändert.