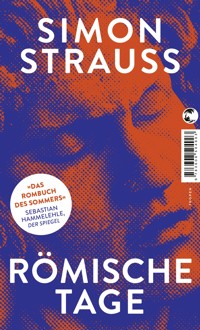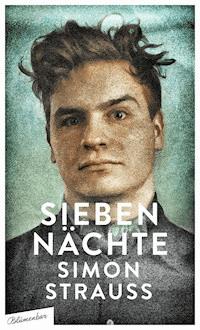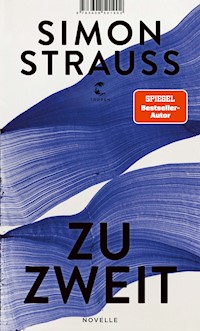
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tropen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Diese Geschichte tut schön weh«Lars Eidinger Ein stiller Teppichhändler, der sich ganz den Häusern und Dingen verschrieben hat. Eine junge Frau, die sich auf ihr Talent zur Improvisation und ihr heiteres Wesen verlässt. Eine alte Stadt, die über Nacht von einer alptraumhaften Flut heimgesucht wird. Zwei Fremde, die das Schicksal in einer Nacht zusammenführt und die herausfinden müssen, was es heißt, zu zweit zu sein. Es ist Nacht und er kann nicht einschlafen. Auf das Dach schlägt der Regen. Irgendwann steht er auf und geht die Treppe hinunter. Kniehoch steht das Wasser im unteren Stock. Schuhe, Kleider, Schüsseln, Kissen schwimmen darin. Ein Hubschrauber ist dann und wann zu hören. Er zieht sich Stiefel an und geht hinaus, um Hilfe zu suchen. Eine Frau hat sich auf ein Floß gerettet. Sie treibt auf dem wilden Fluss, die Ufer gezeichnet von der Zerstörung. Alles, was sie ausgemacht hat, hilft ihr jetzt nicht mehr. Sie ist auf sich allein gestellt. Das Floß lässt sich nicht steuern, genauso wenig wie ihre Angst … Diese feine Novelle erzählt von einem Ausnahmezustand, einer Welt ohne festen Boden. Und sie fragt, wie zwei Fremde, die unterschiedlicher nicht sein könnten, doch zusammenfinden. Eine außergewöhnliche Liebesgeschichte mit einem besonderen Blick für all das, was unsere Welt im Verborgenen ausmacht. »Strauß hat einen schönen eigenen Tonfall, der das Zeitgenössische in sich trägt, aber dennoch auch den Sound der Väter kennt, (...) und zu schlichter Sinnlichkeit findet.« Florian Illies, Die Zeit »Erzählen bedeutet für Simon Strauß gelebten Essayismus im Stil eines Robert Musils.« Björn Hayer, Die Presse
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Simon Strauß
Zu Zweit
Novelle
Tropen
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Tropen
www.tropen.de
© 2023 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Zero-Media.net, München
unter Verwendung eines Kunstwerks von © Thomas Müller, Ohne Titel, 2021, Kugelschreiber auf Papier, 29,7 × 21 cm
© Thomas Müller, Foto: Frank Kleinbach
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von CPI – Clausen & Bosse, Leck
ISBN 978-3-608-50190-2
E-Book ISBN 978-3-608-12143-8
Für Erika&Für Jacob
»So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsre Augen sie nicht sehen.«
Matthias Claudius
Jede Begegnung – ein kleines Wunder: Bei all den unzähligen, die man verpasst, weil man doch noch die Fenster geputzt oder zu früh die Straßenseite gewechselt hat, einen Anruf bekommt oder seinen Schal verliert – winzige Unpässlichkeiten, die einen Lebenslauf entscheiden. Darüber, ob man sich trifft oder ausweicht, sich kennenlernt oder fremd bleibt.
Die vielen Menschen, an denen man vorbeigeht und weiß, man sieht sie nie wieder – die junge Frau in der Warteschlange, der Busfahrer an der Ampel, das Kind am Gartenzaun, man schaut und weiß: Es wird nur das eine Mal gewesen sein. Das wäre die Chance gewesen, jetzt hätte man den Blick erwidern, ein Wort wechseln können – vielleicht hätte das etwas bedeutet, vielleicht hätte man sich verstanden. Aber dann führt der Weg einen doch knapp aneinander vorbei.
Gar nicht leicht zu erklären, warum zwei zusammenkommen. Wie es sein kann, dass am Ende Namen von zweien auf einem Stein stehen, die am Anfang gar nichts voneinander wussten.
Keine Königin, kein Riese kann das alleine schaffen: zu zweit zu sein.
I.
DAS ZIMMER
Er liegt da und weiß, es wird wieder nicht gehen. Der Schlaf wird nicht kommen. Er liegt auf dem Rücken, die Arme unter der Decke dicht am Körper, die Augen geschlossen. Er atmet nur durch die Nase und drückt dabei seine Fingerkuppen gegeneinander, Zeigefinger auf Daumen, Mittelfinger auf Daumen, Ringfinger auf Daumen, kleiner Finger auf Daumen. Erst die linke, dann die rechte Hand, immer im Wechsel. Zehnmal, dann ändert er die Reihenfolge. Er hofft, dass die Nerven sich so beruhigen lassen.
Helikopter kreisen über ihm – das Schlagen ihrer Rotorblätter ist bis in seine Dachkammer zu hören.
Er rollt sich auf die Seite. Legt die rechte Armbeuge so über den Kopf, dass sie ihm als Hörschutz dient. Für ein paar Minuten verharrt er regungslos und hört nur den rauschenden Schlag seines Pulses. Er faltet das Kissen, zieht die Knie an, spürt, wie er zu schwitzen beginnt.
Draußen klatscht der Regen gegen das Dach. Ohrfeigt die Ziegel, als wären sie ungehorsame Internatsjungen auf einem Schulhof. Mitten in der Nacht stehen sie im gleißenden Scheinwerferlicht in einer Reihe und warten, bis der Präfekt aus der Tür tritt, sich mit der Hand über die glatt rasierte Wange fährt und dann langsam, sehr langsam an ihnen vorbeischreitet. Hin und her, vor und zurück. Plötzlich schlägt er mit der Rückseite seiner rechten Hand einem von ihnen ins Gesicht. Der Junge zuckt kurz zusammen, lässt die Gewalt aber sonst widerstandslos über sich ergehen. Wie der Ziegel den Regen.
Er liegt in seinem Zimmer. Sicher und geborgen. Nur ein paar Meter entfernt vom Geschehen draußen, von der Nässe, dem Unwetter, dem Lärm. Nur ein paar Meter …
Sind es nicht immer nur ein paar Meter? Nur ein paar Meter entfernt vom glücklichen Liebespaar torkelt ein Betrunkener und schlägt mit dem Gesicht auf den Asphalt. Nur ein paar Meter hinter der Wand, an die sich gerade eine Lachende lehnt, kauert ein verschuldeter Investor am Boden. Nur ein paar Meter weiter von dem hüpfenden Kleinkind sitzt eine einsame Frau. Nur ein paar Meter entfernt von der Limousine steht ein Junge unbeachtet am Straßenrand und lässt seine Bälle über Schultern und Arme laufen, macht kleine Drehungen, stellt sich auf ein Bein, jongliert weiter, wirft den Kopf nach hinten, schließt die Augen – nur ein paar Meter …
Der Regen wird heftiger. Er greift nach zwei kleinen Wachskügelchen, die auf seinem Nachttisch bereitliegen, und drückt sie tief in beide Ohrmuscheln. Aber die plötzlich einsetzende Stille macht ihn nur noch unruhiger.
Inzwischen geht es wahrscheinlich schon auf Mitternacht zu. Die Hoffnung auf den erholsamen Tiefschlaf hat er längst verloren. Seit zwei Stunden liegt er da und drückt sich selbst die Daumen, zählt rückwärts von siebenundneunzig. Ihm hilft die Vorstellung nicht, dass es unzähligen anderen gerade ebenso geht, dass auch sie schlaflos sind, ihre Bettdecken alle fünf Minuten umdrehen, Kräutertees kochen, den Verschluss der Rollos überprüfen, bevor sie sich wieder auf ihre Matratzen werfen und von einer beruhigenden Automatenstimme den richtigen Atemrhythmus vorgeben lassen.
»Eine Insel wird nicht weniger einsam dadurch, dass sie bewohnt ist« – den Satz, irgendwo auf einer Bahnhofstoilette gelesen, hat er sich eingeprägt.
Natürlich: Er könnte aufstehen, ans Dachfenster treten, vielleicht sogar kurz den Kopf hinausstrecken – aber wozu? Wäre das nicht nur die hilflose Wiederholung einer Bewegung, die er schon unzählige Male genauso ausgeführt hat?
Wie oft war er schon vom Bett aufgestanden und durch sein Zimmer gelaufen, wie oft hatte er schon seinen Blick auf dieselbe Stelle an der Decke geworfen: schräg links von der Lampe, dorthin, wo der Putz sich leicht verfärbt und das allgegenwärtige Weiß eine dunkle Trübung annimmt.
Der Gedanke an die Wiederkehr des Immergleichen bedrückt ihn. Dass es nichts Neues, nichts Unverhofftes in seinem Leben gibt. Dass Schubladen bei ihm immer geschlossen und Striche immer gerade gezogen sein müssen.
Wenn bislang in seinem Leben etwas Unvorhergesehenes geschehen war – ein Auffahrunfall etwa oder eine Schlägerei auf der Straße –, legte er stets einen Schritt zu, damit schnell wieder alles wurde wie immer.
Stets tat er so, als ob das Plötzliche ihn nichts anginge. Als ob er Abweichungen von dem, was er erwartete, nicht beachten müsse. Wenn er nur stur genug nach vorne schaute, würde die alte Ordnung schon wieder auftauchen.
Jetzt liegt er da und starrt ins Dunkel.
Im Grunde gibt es in seinem Zimmer keinen Gang, keinen Griff, den er nicht genau so bereits hundertfach getan, keine Blicke, die er nicht genau so schon zigmal von einer in die andere Ecke geworfen hat. Die Wahrheit ist: Fast alles, was es in seiner Umgebung zu sehen gibt, hat er gesehen. Jede Fläche gefühlt, jede Unregelmäßigkeit auf dem Boden betastet. Er hat den Grundriss seines Zimmers Mal um Mal berechnet und seine Einrichtung bis ins kleinste Detail arrangiert: Rechts neben der Tür steht gleich das Bett. Am rechten Kopfende gibt es zwei Steckdosen, die er mit schwarzem Tape abgeklebt hat, aus Angst, er könnte sie im Schlaf versehentlich mit schweißnasser Hand berühren. Gegenüber dem Bett: ein hoher Holzschrank mit mehreren Regalen. Auf dem Weg dorthin rechts ein gurgelnder Heizkörper und eben das Fenster im Schrägdach, durch das hin und wieder Sterne zu sehen sind. Links, zwei Schritte von der Tür entfernt, ein Waschbecken. Daneben ein kleiner Hocker, um beim Rasieren den Fuß abzustellen.
Nichts in seiner Kammer steht einfach da oder liegt herum. Im Schrank warten die Kleidungsstücke in genau der Reihenfolge, in der er sie anzieht. Im obersten Regal die Unterwäsche, dann die Socken, T-Shirts, Hemden, Hosen und Pullover. Die Verlässlichkeit der Gegenstände gibt ihm Halt. Wenn er sich nachts von einer Seite auf die andere dreht und dabei von einem Gedanken zum nächsten springt, dann beruhigt ihn die Vorstellung, dass die Dinge um ihn herum stillstehen und Wache halten.
≈
Plötzlich dringt ein leises Quietschen an sein Ohr. Erst vermutet er eine Tür irgendwo in der Ferne, die vom Wind auf- und zugeschoben wird, aber als das Geräusch nicht aufhören will, pult er sich die Wachskugeln heraus und hört genauer hin: Deutlich vernimmt er jetzt ein mehrstimmiges Maunzen, das ein paar Sekunden anhält, dann abbricht und nach kurzer Zeit von Neuem beginnt.
Die Katzen müssen in unmittelbarer Nähe sein.
Unwillig schiebt er seinen Körper nach links über die Matratze, stützt sich auf der Bettkante ab und wirft einen Blick auf seinen Wecker: Tatsächlich schon kurz nach zwölf.
Er sucht mit der Hand nach dem Lichtschalter, aber die Nachttischlampe versagt den Dienst. Ratlos greift er unter das Bett nach einer Taschenlampe.
Von der Anwältin, die ihm die Dachkammer vermietet, können die Katzen nicht kommen. Sie verabscheut Tiere. Sie hält Menschen, die ihre Nachmittage damit verbringen, Hundedecken zu säubern und Leckerlis vorzusortieren, für gestört. Nachbarn, die ihr bestürzt von einem entflogenen Wellensittich berichten, lacht sie aus, Klienten, die voller Stolz Fotos von ihren Terrarien zeigen, gibt sie gleich an Kollegen weiter. Sie, der die Zeit das kostbarste Gut ist, verachtet alle, die ihre Stunden mit Haustieren verschwenden – er hat den Satz in immer neuen Varianten von ihr gehört: »Tiere sind zum Essen da, nicht zum Streicheln.«
Das Maunzen draußen vor der Tür wird lauter. Bald schreien die Katzen nicht nur, sondern lassen auch ihre Krallen über den Holzboden fahren – ein Geräusch wie brüchige Fingernägel auf einer Kreidetafel.
Jetzt springen sie sogar dagegen: Eine nach der anderen nimmt Anlauf und wirft ihren Körper gegen das knackende Holz.
Er steht auf und geht ein paar unsichere Schritte in Richtung Tür. Wieder donnert ein Katzenkörper dagegen.
Im nächsten Moment sitzt er schon wieder auf seiner Bettkante und hält die Füße still. Seine Gedanken kreisen um die Anwältin. Für gewöhnlich arbeitet sie unten in ihrem Zimmer bis spät in die Nacht, kauert an ihrem Schreibtisch und wühlt sich durch die Akten. Gestört werden darf sie dabei nicht. Auch sonst ist sie kaum auf Begegnungen aus. Weder mit den Nachbarn noch mit ihm. Die wenigen Gespräche, die sie führen, drehen sich um praktische Fragen. Frühmorgens verlässt sie vor ihm das Haus, abends kommt sie lange nach ihm zurück.