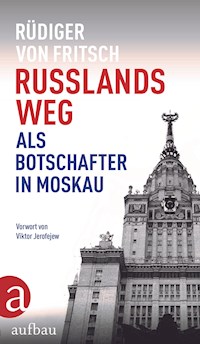
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»2014 kam Rüdiger von Fritsch als Botschafter nach Moskau, in einem für die russisch-europäischen Beziehungen höchst tragischen Jahr. Damals traten die verborgenen Absichten des Kremls, der von einem Wiederaufstieg zur Großmacht träumte, deutlich zutage. Im politischen Nebel zeichneten sich vage die Konturen des alten russischen Reiches als Zukunftsvision ab – endgültig untergegangen mit der Sowjetunion und wie diese angeblich Opfer westlicher Verschwörung. Moskau präsentierte den Zuschauern rund um den Globus eine Überraschung: eine geschickte Spezialoperation zur Angliederung der Krim an Russland. Und anschließend löste es einen ganz realen Krieg mitten in Europa aus, im Südosten der Ukraine.
›Russlands Weg‹ bietet eine ausführliche und fundierte Analyse dieser Geschehnisse, der Gründe und Ziele, und geht auch darauf ein, wie sich die Situation weiterhin entwickelt, denn die Tragödie ist noch nicht zu Ende.« Viktor Jerofejew
»Ein ebenso anschaulicher wie tiefenscharfer Bericht aus dem Russland Wladimir Putins. Das Buch des langjährigen deutschen Botschafters in Moskau sollte zur Pflichtlektüre für alle Politiker werden.« Heinrich-August Winkler
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Innenansichten der russischen Macht.
März 2014: Die Annexion der Krim ist gerade vollzogen, als Rüdiger von Fritsch seine Arbeit als Botschafter in Moskau aufnimmt. Danach geht es Schlag auf Schlag: Donbas, Abschuss von MH17, Syrien, Skripal. Trotz russischer Aggressionen sieht von Fritsch zu guten deutsch-russischen Beziehungen keine Alternative - und setzt konsequent auf Entschlossenheit und die Stärke der Diplomatie: den Dialog.
Fünf Jahre stand er als Botschafter im oft schwierigen Austausch mit den Machthabern in Russland – und hat dabei Haltung bewahrt. Sein Buch ist die hellsichtige Analyse eines kritischen Russlandverstehers, der eine neue Perspektive für die deutsch-russischen Beziehungen aufzeigt.
Über Rüdiger von Fritsch
Rüdiger von Fritsch, geboren 1953, bereitete die EU-Osterweiterung als Unterhändler in Brüssel vor, er war Leiter des Planungsstabes des Bundespräsidenten und Vizepräsident des BND. Von 2010–2014 war er Botschafter in Warschau und von 2014–2019 Botschafter in Moskau. 2009 veröffentlichte Rüdiger von Fritsch das Buch »Die Sache mit Tom«, in dem er davon berichtet, wie er 1974 gemeinsam mit seinem Bruder seinem Vetter Thomas und dessen Freunden zur Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik verhalf.
Viktor Jerofejew wurde 1947 in Moskau geboren und zählt zu den wichtigsten zeitgenössischen Schriftstellern Rußlands. Sein Roman »Die Moskauer Schönheit« wurde in 27 Sprachen übersetzt. Für »Fluß«, eine deutsch-russische »Koproduktion« Viktor Jerofejews mit Gabriele Riedle, bereisten die Autoren gemeinsam den Rhein, die Wolga, den Ganges, den Mississippi und den Niger.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Rüdiger von Fritsch
Russlands Weg
Als Botschafter in Moskau
Mit einem Vorwort von Viktor Jerofejew
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorwort
Prolog
Teil I – Der Bruch
Russland und wir – ein Blick zurück
»Krim nasch!« – »Die Krim gehört uns!«
Der Konflikt im Donbas
Russland in Syrien
Eure und unsere Wahrheit
Die Gefahr eines neuen Wettrüstens
Teil II – Die Gegenwart der Vergangenheit
Mensch und Macht
Zivilgesellschaft und Opposition
Der lange Schatten der Geschichte
Armes, reiches Russland
Russische Gläubigkeit
Gehört Russland zu Europa?
Teil III – Quo Vadis Russland?
Die Zukunft in Russland
Die Zukunft mit Russland
Epilog – Abschied von Russland
Zeittafel
Dank
Impressum
Für Huberta, in großer Dankbarkeit
für 35 gemeinsame Jahre im Auswärtigen Dienst
»Ich weiß sehr gut, dass man Politik nicht mit dem Herzen macht, und trotzdem denke ich, dass man der Politik keinen Schaden zufügen kann, wenn das Herz ein wenig beteiligt ist. Die Gemeinsamkeit unserer Schicksale und die gemeinsamen Interessen haben mich zu dieser Überzeugung gebracht, mit der ich hier meinen Dienst geleistet habe.«
Ulrich Graf Brockdorff-Rantzau, deutscher Botschafter in Sowjetrussland und der UdSSR 1922 bis 1928
Vorwort
Wozu Putins Zarenreich fähig ist
Dieses Buch, wohl eine der interessantesten Publikationen über das gegenwärtige Russland, besticht mit seiner eleganten, zurückhaltenden Erzählweise, die die Klugheit und literarische Fähigkeit des Autors reflektiert.
Die heutigen Botschafter schreiben selten Bücher, schon gar keine gescheiten. Entweder sie haben nichts zu sagen, oder es mangelt ihnen an schriftstellerischem Talent. Rüdiger von Fritsch ist da eine Ausnahme von der Regel. Der charmante und stets sehr sachlich argumentierende deutsche Botschafter, der erst kürzlich nach mehreren Dienstjahren Moskau verlassen hat, gesteht weder seine wahnsinnige Liebe zu meinem Land, wie das häufig bei Autoren der Fall ist, die über Russland schreiben, noch zeigt er sich furchtbar enttäuscht von seinen Erfahrungen als Diplomat in Moskau.
Ganz konkret schreibt er über seine Einsichten, zu denen er nach gründlichem Nachdenken gelangt ist. Seine Erkenntnisse setzte er bei seiner Arbeit ein und diskutierte mit vielen Menschen darüber. Als Botschafter Deutschlands vertrat er in Moskau nicht nur die politischen Interessen seines Landes, sondern auch europäische Werte, die über Jahrhunderte gewachsen sind und deren Eigenheiten vor allem im Vergleich zu anderen, in diesem Fall russischen Werten, besonders deutlich hervortreten. Der Autor schildert seine Erfahrungen aus drei verschiedenen Perspektiven. Als Botschafter. Als Literat. Als Europäer. Nein, Moment mal, es gibt noch eine vierte Perspektive. Die des Menschen, der das Russland der Kultur und der unabhängigen Meinungen schätzen und lieben gelernt hat. Ein solches Russland existiert glücklicherweise.
2014 kam Rüdiger von Fritsch als Botschafter nach Moskau, in einem für die russisch-europäischen Beziehungen höchst tragischen Jahr. Damals traten die verborgenen Absichten des Kremls, der von einem Wiederaufstieg zur Supermacht träumte, deutlich zutage. Im politischen Nebel zeichneten sich vage die Konturen der ehemaligen Sowjetunion – angeblich Opfer westlicher Verschwörung – als Zukunftsvision ab. Das Moskauer Polittheater präsentierte den Zuschauern rund um den Globus eine Überraschung: eine geschickte Spezialoperation zur Angliederung der Krim an Russland. Und anschließend befleckte es sich mit dem Blut eines ganz realen Krieges in Europa, im Südosten der Ukraine.
Das Buch bietet eine ausführliche und fundierte Analyse dieser Geschehnisse, der Gründe und Ziele, und geht auch darauf ein, wie sich die Situation weiterhin entwickelt, denn die Tragödie ist noch nicht zu Ende.
Das Wesentliche an dem Buch ist, dass es als politische Geschichte beginnt und übergeht in eine philosophische Reflexion der Unterschiede zwischen den russischen und westlichen Lebenseinstellungen. Dabei idealisiert der Autor den Westen durchaus nicht, obwohl er ganz und gar zu den westlichen Werten steht, und er dämonisiert auch nicht Russland, das sich unterdessen mehr und mehr in ein feudalistisches Lehnsgut seines unabsetzbaren Präsidenten verwandelt.
Der Autor sieht die russische Mentalität im Grunde als kognitive Dissonanz, als ein Aufeinanderprallen gegensätzlicher Tendenzen, als ein Bündel unvereinbarer Ideologien, historischer Verflechtungen und nicht zuletzt persönlicher Ambitionen des ersten Mannes im Staate. Im Buch wird eine amüsante Parallele zwischen den identischen Zielen des reaktionären Zaren Alexander III. und des jetzigen Präsidenten gezogen, der aus den bescheidenen Verhältnissen einer sowjetischen Leningrader Familie stammt, und der anlässlich der Einweihung eines Denkmals für den Zaren auf der Krim diesen unlängst in den höchsten Tönen lobte.
In der russischen Außenpolitik, so lesen wir, zeigen sich die Stimmungen der Ideologen, die davon träumen, wie man Europa schwächen und zugleich sein ökonomisches Potenzial nutzen kann. Irritiert ob der Festigkeit seiner Positionen, weisen russische Kollegen aus dem Außenministerium den Botschafter mal harsch zurecht (»Herr Botschafter, Sie sind hier nicht in Warschau!« – in Anspielung auf seine Arbeit als Botschafter in Polen), mal wird ihr Blick milder, und sie sind bereit, ihn während einer kurzzeitigen »Waffenruhe« des Kremls mit ihrem Wohlwollen einzuwickeln. Sogar Putin bringt beim letzten Vieraugengespräch gegenüber dem künftigen Autor dieses Buches seine persönliche Sympathie zum Ausdruck.
Ob er wohl mit von Fritschs Buch zufrieden sein wird? Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird er vermutlich beeindruckt sein von der scharfen Beobachtungsgabe und dem Erinnerungsvermögen, mit dem von Fritsch die vor offiziöser Geschmacklosigkeit strotzenden Empfangssäle im Kreml beschreibt und die kurzen formalen Treffen ganz im Stil des »Kalten Krieges«, bei denen weder Tee noch Kaffee und nicht einmal Mineralwasser gereicht wird. Eine wunderbare Szene spielte sich in der palmenbestandenen Residenz des Präsidenten in Sotschi ab: Einer der deutschen Gäste schiebt die schweren Stores zur Seite und scherzt, er wolle nur überprüfen, ob das Meer denn noch da sei. Putin quittiert den Scherz mit einem huldvollen Lächeln. Er freut sich über das Lob für seine Deutschkenntnisse, seinen reichen Wortschatz und die Fähigkeit zur verbalen Improvisation. Bedenkt man, dass das Buch treffend den militärischen und politischen Konflikt zwischen dem Westen und Putins Russland beschreibt, muss man konstatieren, dass von Fritschs Aufrichtigkeit zweifellos künftigen Geschichtsbetrachtern unserer Zeit zugutekommen wird.
Natürlich wirft die Konfrontation zweier Zivilisationen, der westlichen und der russischen, wieder einmal die Frage auf, ob Russland geistig zu Europa gehört. Und es ist gut, dass der Autor darauf nicht voreilig die Antwort »ja« oder »nein« parat hat. Russland geht, wie schon der Titel des Buches verrät, seinen eigenen Weg, womit viele unserer großen Philosophen vom Beginn des 20.Jahrhunderts einverstanden wären. Heutige hochgestellte Gesprächspartner erzählten dem Autor von einem stolzen Russland, dem man keine Bedingungen für sein Verhalten auf der internationalen Bühne vorschreiben dürfe. Andererseits beansprucht dieses stolze Land für sich, anderen die Bedingungen von Krieg und Frieden zu diktieren. Der Kult der Stärke, der in Russland auf staatlicher und privater Ebene existiert, schockiert die Europäer in seiner finsteren Archaik. Im Grunde gehen die Probleme meines Landes zurück auf ein nationales Unterbewusstsein. Sie bestehen nicht nur darin, dass wir leicht zu kränken sind und uns Wunder was auf uns einbilden, sondern auch darin, dass wir uns – herrje! – für besser als alle anderen halten, besser als die Amerikaner, die Europäer, die Türken und die Chinesen, denn wir haben die richtigste aller Religionen, wir sind Rechtgläubige, wir sind die Spirituellsten und dabei die Fröhlichsten und Abgefahrensten, kurzum, etwas ganz anderes als die Einwohner dieses langweiligen Europas! Und unsere Machthaber können nicht begreifen, warum die ehemaligen Sowjetrepubliken es so eilig hatten, das Heil in der Europäischen Union zu suchen und nicht bei uns bleiben wollen, wo wir doch die Allerbesten sind! Auf der diplomatischen und politischen Ebene aber wird es so dargestellt, als seien die Ukrainer und die Belarussen unsere kleinen Brüder und liefen vor uns nur davon, weil sie der Westen verführt. Das ist die Falle des politischen Denkens im heutigen Russland, das aus dem Mund des Präsidenten und im Staatsfernsehen gebetsmühlenartig ein und dasselbe wiederholt: Der Westen will uns in Stücke reißen.
Doch es gibt auch tiefere Schichten dieses Denkens, über die der Autor schreibt. Sich offen zu den Besten zu erklären, funktioniert nicht, im Ausland versteht man das möglicherweise nicht. Aber man kann die Idee ausbauen, dass man die »Landsleute« im Ausland verteidigen muss, und das bedeutet, dass die Fürsorge für die russische Welt keine Grenzen kennt. Im Grunde ist das eine neue Version der Weltrevolution, nur dass sie nicht auf Klassenkampf und kommunistischen Idealen beruht, sondern auf national-religiöser Einmaligkeit, wobei das offene Gespräch darüber in Russland eher das Privileg orthodoxer Geistlicher ist. Politische Phantasmen geistern herum. In den Jahren 2014 bis 2015 drehten sie sich um die Idee, auf ukrainischem Territorium einen eigenen prorussischen Staat zu gründen, »Neurussland«, von Charkow bis Moldawien. Doch offenbar überschätzten die Geheimdienste, wie der Autor schreibt, den Wunsch der Einwohner dieser ukrainischen Gebiete, in so einem Staat zu leben, und die Utopie scheiterte. Jetzt ranken sich die utopischen Ideen um den Gedanken einer neuen Jalta-Konferenz, bei der die Großmächte Amerika, China, Russland, Frankreich und Großbritannien sich an einen Verhandlungstisch setzen und ihre Einflusssphären bestimmen. Die Welt präsentiert sich als riesige Torte, die bloß in die richtigen Stücke geteilt werden muss. Deutschland ist zu diesem Festmahl nicht geladen, und Polen gegenüber hegt der Kremlherr ein besonders feindseliges Gefühl, da dieses Land sich mehr als alle anderen allein schon dem theoretischen Gedanken an ein neues Jalta widersetzt.
Russland ist ein Land mit explosivem Bewusstsein. In ferner Vergangenheit musste es das Joch der tatarisch-mongolischen Eroberung erdulden und war faktisch eine Kolonie des orientalischen Khanats. Die Folgen dieses kolonialen Jochs spürten die Russen beinahe bis zur Zeit Peters des Großen und errichteten ihre politische Struktur nach dem Muster einer orientalischen Despotie. Ungeachtet der Atempause einer Europäisierung vom 18. bis zum Ende des 19.Jahrhunderts, geißelte uns erneut eine grausame Diktatur in Gestalt der Bolschewiki. Im Ergebnis ist das Problem Russlands nicht nur die Tradition des Autoritarismus, sondern auch die politische Ignoranz weiter Teile der Bevölkerung, die sich leicht manipulieren lassen.
Als Putin an die Macht kam, stand er vor einem Dilemma. Was tun? Das Land nach dem Beispiel Peters des Großen modernisieren und nach Europa führen oder es im Angesicht eines äußeren Feindes mobilisieren und nach stalinschem Muster in eine uneinnehmbare Festung verwandeln? Mit der Modernisierung klappte es nicht. »Wir sind keine Chinesen«, gestand mir einmal ein Kremlfunktionär, der in diesem Buch erwähnt wird. Und wen sich als Feind wählen? Für den Kreml gibt es eine Hierarchie von drei erfundenen Feinden Russlands: An erster Stelle steht das Böse an sich, die NATO, schlimmer als der Leibhaftige. Gleich danach kommen die USA. Und an dritter Stelle steht die Europäische Union (mit ihren gleichgeschlechtlichen Ehen – was die Propagandisten nicht müde werden zu betonen). Deshalb ist die Annexion der Krim aus Sicht des Kremls nicht nur die Wiederherstellung von Gerechtigkeit, sondern auch eine notgedrungene Maßnahme zur Wahrung der Integrität des Landes selbst, denn sonst wären NATO-Schiffe in Sewastopol eingelaufen. Nun aber der Sieg: Die-Krim-ist-unser! Für immer! Das ganze Land hüpft vor Glück auf den Kühlerhauben seiner Autos auf und ab! Russland eilt in der Propaganda des Kremls von Sieg zu Sieg, andere ideologische Ressourcen funktionieren schlecht. Das ist auch der Grund dafür, wie im Buch gezeigt wird, dass die Vorstellung von Gerechtigkeit in der russischen Politik (der subjektive Faktor) über dem Begriff des Völkerrechts rangiert. Und für den Triumph der Gerechtigkeit und um den Gegner um den Finger zu wickeln, ist Putin jede Finte recht. Gleichzeitig muss man natürlich mit den Waffen rasseln – sonst gibt es ja nichts, womit man rasseln könnte – und wie im Zirkus übers Seil balancieren und den Absturz in einen globalen Krieg riskieren.
Vorsichtig kritisiert Rüdiger von Fritsch auch den Westen, der im Grunde die Möglichkeit eines fruchtbaren Dialogs auf der Ebene ökonomischer und politischer Beziehungen mit dem frühen Putin verpasst hat. Der hatte nämlich damals noch keinen Weg für Russland gewählt. Außerdem vertritt von Fritsch nachdrücklich die Ansicht, nicht der Westen habe die Ukraine an sich gezogen und sich gegen Russland gestellt, sondern die Ukraine selbst habe sich für den Westen entschieden. Das Gerede, »Faschisten« hätten die Macht in Kiew ergriffen, wird durch die freien Wahlen in der Ukraine widerlegt, bei denen die Rechtsextremen nicht mehr als drei Prozent der Stimmen erhielten.
Natürlich lässt sich schwerlich mit Sicherheit feststellen, wie viel Prozent der Krimbewohner heute zur Ukraine zurückkehren wollten. Viele werden es wohl kaum sein. Ukrainische Reisepässe zu bekommen, mit denen man visafrei nach Europa reisen kann – das bitte gern! Nicht einmal im Donbas, auch nicht nach sechs Jahren eines schändlichen Krieges, wird die gesamte Bevölkerung davon träumen, zur Ukraine zurückzukehren. Hierin liegt auch die bittere Realität der Territorialfrage: Nach internationalem Recht gehörten und gehören die Gebiete selbstverständlich zur Ukraine. Nicht einmal Armenien und Belarus, treue Verbündete Russlands, haben die Angliederung der Krim an Russland juristisch anerkannt.
Liest man von Fritschs Buch, wird einem klar, dass er eine außergewöhnliche Geduld aufbringen musste, um den europäischen Standpunkt zum militärischen Konflikt in der Ukraine zu vertreten. Mutig musste er gegen die Lügen Stellung beziehen, die im Zusammenhang mit dem Absturz der malaysischen Passagiermaschine im Jahr 2015 verbreitet wurden. Doch der Botschafter weist auch darauf hin, dass in Deutschland selbst viele verschiedene Menschen – Geschäftsleute, Schriftsteller, Künstler, Journalisten – fordern, man solle sich nicht weiter mit den Russen »bekriegen« und stattdessen die Sanktionen aufheben, die als Protest gegen das Vorgehen des Kremls verhängt wurden. Besonders eindringlich und mit Einfühlungsvermögen beschreibt der Botschafter die russischen Gegensanktionen. Diese zielten darauf ab, die westliche Wirtschaft zu untergraben, und gipfelten in der Vernichtung von »illegalen« polnischen Äpfeln und französischem Käse durch Bulldozer an der belarussisch-russischen Grenze. Statt diese Lebensmittel der Kirche zur Verteilung unter den Notleidenden zu übergeben, zeigte man voller Stolz wiederholt die Vernichtungsaktionen im Staatsfernsehen.
Das Material für das Buch stammt aus unterschiedlichen Quellen. Der Botschafter betont die Bedeutung der Informationen, die er von seinen Kollegen in der Botschaft erhielt. Zweifellos haben auch zahlreiche Konferenzen, Treffen, Reisen durch Russland, das Buch mit konkreten Landeskenntnissen bereichert. Schließlich waren da noch die vielen Empfänge, Abendessen und andere Veranstaltungen in der deutschen Botschaft und in der Residenz des Botschafters, an denen auch Huberta aktiv beteiligt war, die bezaubernde Gattin des Botschafters. Ich war nicht selten bei ihnen in der Residenz zu Gast. Ich erinnere mich an einen wunderschönen Abend, der dem Werk des russischen Schriftstellers und Liedermachers Bulat Okudschawa gewidmet war, organisiert an einem der letzten Moskauer Tage von Fritschs. Tatsächlich war unter anderem dieser Abend ein Beweis für die Existenz eines anderen Russlands, eines Landes mit großer und mutiger Kultur, die sowohl oppositionelle als auch existenzielle Bedeutung besitzt. Beim Okudschawa-Gedenkkonzert und dann beim großen Abschiedsempfang traf man praktisch tout Moscou – Kremlfunktionäre, unabhängige Journalisten, Oppositionelle – man musste schon ein sehr gastfreundlicher Hausherr und herausragender Diplomat sein, um so viele unterschiedliche Menschen bei sich zu versammeln.
Aus dem gleichen Geist wie die fruchtbaren Empfänge ist auch dieses aufrichtige Buch mit seinen vielfältigen Eindrücken von der schwierigen Zeit im heutigen Russland entstanden. Das Buch von Rüdiger von Fritsch wird, wie ich glaube, als Zeugnis sensibler Diplomatie von bleibendem Wert sein.
Viktor Jerofejew
Prolog
»Und, Herr Botschafter, was werden Sie machen im Ruhestand? Ein Buch schreiben?«
Es war ein intensives Gespräch gewesen mit Wladimir Putin, das sich nun dem Ende zuneigte: offen, kontrovers – aber auf eine bestimmte Art auch vertraut. Dass diese Begegnung im Juni 2019, am Ende meiner fünfjährigen Zeit als Botschafter in Moskau, überhaupt zustande gekommen war, war mehr als ungewöhnlich. Staatsoberhäupter empfangen keine Botschafter zu Gesprächen oder Abschiedsbesuchen, schon gar nicht sogenannte »exekutive Staatsoberhäupter« wie die Präsidenten in Frankreich, den USA – oder eben Russland. Offizielle Ansprechpartner der Botschafter sind die Außenminister und deren Vertreter, die Fachminister einer Regierung, die Berater des Präsidenten. In einem großen Land erhält ein Botschafter ein Abschiedsessen, gegeben von einem Staatssekretär oder Vizeaußenminister. In Deutschland ist das nicht anders. Auch für mich hatte der für Deutschland zuständige russische Vizeaußenminister ein solches Essen ausgerichtet, mit seinen und meinen engsten Mitarbeitern als weiteren Gästen.
So sagte ich Wladimir Putin zu Beginn unserer Begegnung das Naheliegende: dass ich dieses Gespräch als eine Geste gegenüber meinem Land empfinde und dem stetigen Bemühen meiner Regierung, selbst für schwierige Fragen eine Lösung zu finden, so sehr sie uns auch trennen mögen. Um diese strittigen Fragen ging es dann auch in unserem Gespräch: um die Ukraine und Syrien, um Russland, Deutschland und Europa, um Menschenrechte und Pressefreiheit. Zu zweit unterhielten wir uns, ohne Dolmetscher oder Berater – denn Wladimir Putin spricht gerne und vorzüglich Deutsch, überlegt bestenfalls einmal, ob es nun »erhalten« oder »verhalten« heißt.
»Ein Buch schreiben – ja, Herr Präsident, das würde ich gerne versuchen. Es besorgt mich, dass wir uns so sehr voneinander entfernt haben und dass unsere Narrative zunehmend auseinanderlaufen. Jeder richtet sich in seiner Wahrheit ein, keiner hört dem anderen zu oder versucht, ihn zu verstehen. Wir müssen ja nicht einer Meinung sein, aber versuchen, einander zu verstehen, das sollten wir.« Wladimir Putin nickte zustimmend, lebhaft. »Davon sollte das Buch handeln,« fügte ich hinzu. »Was Deutsche und Russen trennt und verbindet und wie es uns immer wieder gelungen ist, gute Beziehungen aufzubauen – bis es 2014 zum Bruch kam. Es soll klären, warum es dazu gekommen ist – und vor allem: wie es nun weitergehen könnte.« – »Ja, das ist eine gute Idee. Tun Sie das! Wir müssen versuchen, uns besser zu verstehen.« Ein Händedruck, gute Wünsche, ein gemeinsames Foto.
Einander zu verstehen – darum war es bereits Anfang 2014 in Berlin gegangen, als ich mich darauf vorbereitete, als Botschafter nach Moskau zu gehen. Seit wenigen Wochen eskalierte die Ukraine-Krise. Die Wogen schlugen hoch und die Meinungen lagen immer weiter auseinander. So war es auch gar nicht weiter verwunderlich, dass ein führender Politiker einer Regierungspartei – in Berlin – mir kurz vor meiner Abreise nach Russland die Frage stellte: »Sind Sie auch so ein Russland-Versteher?!?« Nun, die Bundesregierung wäre schlecht beraten gewesen, hätte sie jemanden nach Moskau geschickt, der nicht zumindest versuchen wollte, Russland zu verstehen. Verstehen heißt nicht billigen, aber den anderen zu verstehen und seine Motive zu begreifen – das ist die Voraussetzung erfolgreichen Handelns.
In den mehr als fünf Jahren, die ich Deutschland in Russland habe vertreten dürfen, haben mich zwei Tendenzen zunehmend besorgt, weil sie sich verstärkten: zum einen eine Neigung, der russischen Politik langfristig nur schlechte und aggressive Absichten zu unterstellen und ›dem Putin‹ alles Böse zuzutrauen. Jeder Versuch, Gesprächspartnern, die in diese Richtung argumentierten, Hintergründe und Bedingungen russischen Handelns zu erklären und es einzuordnen, geriet unmittelbar in den Verdacht gefährlicher Verwässerung oder zumindest naiver Schönfärberei, der Blauäugigkeit.
Aber auch die Tendenz zu alles verzeihendem Verständnis irritierte mich. Nicht wenige Deutsche mahnten ständig zu besonderer Rücksichtnahme auf Russland und relativierten jeden noch so groben Regelbruch mit Verweis auf vermeintliches Fehlverhalten anderer. Wie oft ist mir die argumentative Trias begegnet: »Ja, aber – eigentlich – irgendwie.« »Ja, aber eigentlich war die Krim doch irgendwie immer russisch, oder?« Jeder hat sich in seiner Wahrheit eingerichtet, ein Dialog findet nicht mehr statt. Hier will das Buch ansetzen – im Bemühen, beiden Seiten Erklärungen anzubieten.
Bei allem Trachten nach Fairness ist sein Autor allerdings kein distanzierter, wägender Beobachter, sondern Partei: Wo fundamentale Regeln eines friedlichen Miteinanders verletzt sind, gibt es nichts zu rechtfertigen oder zu beschönigen.
Rücksicht auf die Interessen unseres Landes gebietet es, dass manches ungesagt bleibt, Gesprächspartner zitiert, aber nicht immer benannt werden. Zu kurz liegt das Erlebte zurück, zu sehr spielt es in gegenwärtige Politik hinein. Die Bundesregierung braucht Handlungsfreiheit für ihr Bemühen, das Verhältnis zu Russland auf einen guten Weg zu bringen. Auch manche russische Gesprächspartner, deren Offenheit ich sehr geschätzt habe, werden zitiert, ohne genannt zu werden.
Es geht nicht darum, Zensuren zu verteilen. Im Rückblick haben wir bekanntlich alle immer Recht gehabt und alles kommen sehen. Die Wahrheit ist: Aus konträren Sichtweisen sind zunehmend Weltanschauungen geworden. Vor dem Hintergrund einer sich grundlegend ändernden internationalen Lage scheint es immer schwieriger, überhaupt noch zueinander zu kommen. Die Rückkehr eines Systems großer Mächte, die die Dinge unter sich ausmachen, der machtvolle Aufstieg Chinas und die Neuausrichtung der amerikanischen Außenpolitik, die Preisgabe bewährter Prinzipien und Regelwerke – einschließlich wichtiger Errungenschaften im Bereich von Rüstungskontrolle und Abrüstung: All das stellt die Welt vor Herausforderungen ganz neuer Art.
Ganz zu schweigen vom tiefen Einschnitt, den die Corona-Pandemie für das globale Geschehen bedeutet: Welche Folgen wird sie für die internationale politische Ordnung haben? In Russland offenbarte sie ein vernachlässigtes Gesundheitssystem und die Schwächen eines zwar reichen, aber doch ganz auf den Export seiner Rohstoffe setzenden Landes. Der Eindruck der Stagnation verstärkte sich: Zugleich kam es vermehrt zu Protesten, die sich nicht nur gegen konkrete Missstände, sondern gegen die politischen Verhältnisse insgesamt wendeten. Als in dieser Situation auf Russlands bekanntesten Oppositionellen, Alexej Nawalny, ein Anschlag mit einem chemischen Nervenkampfstoff verübt wurde, erschütterte dies nicht nur Russland, sondern führte zu einer erneuten schweren Belastung des Verhältnisses mit dem Westen, vor allem auch zu Deutschland, wohin er zur Behandlung gebracht worden war. Wie ein Wetterleuchten schienen die Proteste im benachbarten Weißrussland zu sein, wo die Menschen im Sommer 2020 nach offensichtlich gefälschten Präsidentsschaftswahlen zu Zehntausenden auf die Straße gingen.
Wie kann es weitergehen in den deutsch-russischen Beziehungen, diesem besonderen Verhältnis, dessen Funktionieren unabdingbar ist für ein gedeihliches Miteinander auf dieser großen eurasischen Landmasse? Und wie kann dauerhaft der Frieden bewahrt bleiben in einem Europa, zu dem auch Russland gehört? Denn zumindest in einem besteht über den Streit der »Russland-Fraktionen« hinweg in Deutschland Konsens: Zu guten deutsch-russischen Beziehungen gibt es letztlich keine Alternative. In meinen Jahren als Botschafter in Moskau ist dies die wichtigste Richtschnur meines Handelns gewesen.
Nein, Russland macht es einem nicht leicht. Das große, stolze Land sperrt sich gegen den Fremden, ja es wehrt sich fast. Es gibt sich gar keine Mühe, verstanden zu werden. Es ist, wie es ist – ist einfach da, wie es immer war. Andere haben sich an ihm auszurichten. Und es schätzt, als Rätsel wahrgenommen zu werden. Je kleiner ein Land, desto intensiver und geschickter sind die Bemühungen seiner Bewohner, es in gutem Licht erscheinen zu lassen, attraktiv und interessant. »Wussten Sie, dass ein Landsmann von uns die elektrische Nähmaschine mit automatischem Fadenwechsel erfunden hat?«, heißt es dann, oder: »Bei uns gab es schon 1537 …« Und oft gibt es dann auch einen Komponisten oder Maler, der dauerhaft über seine wahre Bedeutung hinaus in den Olymp nationalen Glanzes erhoben wird. Nichts von alledem in Russland. Russland ist groß und bedeutend, darauf muss nicht erst hingewiesen werden. Es hat so viel Geschichte, so viel Glanz und Schrecken, so viele grandiose Maler, Schriftsteller und Komponisten hervorgebracht, besitzt so viel Raum und Vielfalt, Wasser und Wälder, Öl und Gas, Gold und Diamanten, dass es sich nicht zu erklären braucht. Russen erwarten, dass man ihr Land und seine Größe kennt und respektiert. Natürlich würde man gerne geliebt werden, aber das ist das Letzte, was man zugeben würde. Man ist stolz – und abweisend.
Besonders schwer ist es, ein Land sympathisch zu finden, trifft man dort zu Zeiten schwerster politischer Unwetter ein. Monatelang gingen Hagel und Sturmschauer nieder, schlugen Blitze ein und rollte der Donner – am 18.März 2014 war die Annexion der Krim vollzogen worden. Am 23. März landete ich in Moskau. Ich hatte gar keine Gelegenheit, das Land näher kennenzulernen, persönliche Beziehungen aufzubauen. Es war Konfrontation pur, von Anfang an. Nun gehört so etwas zum diplomatischen Geschäft – dafür sind wir da: Zu verstehen und zu vermitteln, Positionen dialogbereit, aber mit Festigkeit zu vertreten und Konfrontation auszuhalten. Die Position meiner Regierung zu vertreten fiel mir nicht schwer: Aus tiefster innerer Überzeugung hielt ich sie für richtig, war ich empört über das, was russische Politik mitten im Frieden anrichtete.
Doch dauerhaft kann man seine Aufgabe als Diplomat nicht erfolgreich ausüben, hegt man nicht Sympathie für das Land, in dem man arbeitet. Ich hatte das Glück, dass mir in frühen Jahren eine große Zuneigung zu Russland, seinen Menschen und seiner Kultur mit auf den Weg gegeben worden war. Durch Schule und Studium kam Respekt vor dem schweren Schicksal seiner Menschen im 20.Jahrhundert hinzu, an dem Deutschland einen so großen Anteil hatte.
Meine Mutter war eine Baltendeutsche, wie man jene Gruppe vor langer Zeit in das Gebiet des heutigen Estlands und Lettlands ausgewanderter Deutscher nannte. Nach einer wechselvollen Geschichte war die Region am nordöstlichen Rande Mitteleuropas im 18.Jahrhundert unter russische Herrschaft gekommen, bis die baltischen Staaten als Folge des Ersten Weltkrieges erstmals ihre Unabhängigkeit erlangten. Die Erzählungen meiner Großeltern waren geprägt von Erinnerungen an das versunkene Zarenreich, in dessen Diensten ihre Familien gestanden hatten. Mein Urgroßvater war vor dem Ersten Weltkrieg Abgeordneter beider Kammern des russischen Parlaments gewesen, der Duma und des Reichsrates. Seine Tochter, meine Großmutter, hatte 1916, während des Krieges, in Moskau die Schule abgeschlossen. In ihren Erzählungen erstand eine wundersame Welt: der Zarenhof in Sankt Petersburg, das Moskau jener Zeit mit seiner reichen Kultur, die Revolutionen von 1905 und 1917. Und schließlich, 1944, die Flucht aus der baltischen Heimat nach Deutschland vor der heranrückenden Roten Armee. Bei allem Schrecken, der für diese Generation von der Sowjetunion ausgegangen war, vermittelten uns unsere Großeltern eine tiefe Zuneigung zu Russland und seinen Menschen, zu seiner Kultur und Sprache. Die Großmutter rezitierte Lermontow-Gedichte und liebte die Musik Rachmaninows, der Großvater ließ mich die Schönheit russischer Volkslieder verstehen. Zu Ostern kochte meine Mutter die traditionelle Süßspeise Pas’cha; kamen Freunde in größerer Zahl zu Besuch, buk sie Piroggen und heizte den Samowar an. Die enge Verbindung mit Russland hatte das Leben der Baltendeutschen über Jahrhunderte geprägt. Der Schrecken der Revolutionen, der kommunistischen Herrschaft und der Roten Armee war in ihren Augen nicht russisch, sondern sowjetisch gewesen.
In dieser Spannung mochte auch mein eigenes wachsendes Interesse, ja meine Faszination ihren Ursprung genommen haben: für Russland, für die russische Kultur, aber zugleich auch für die Sowjetunion und die sozialistische Lehre und für die Frage, warum der totalitäre Zugriff der leninistischen Machtapparate auf Millionen von Menschen dauerhaft zu gelingen schien. Als ich während der Schulzeit begann, Russisch zu lernen, diente mir für meine Leseübungen ein Band mit Gedichten von Anna Achmatowa, den mir meine alte Lehrerin gegeben hatte, »Fräulein Gendel«. Sie entstammte, so erzählte sie, einem Zweig der Familie des großen deutschen Komponisten, der nach Russland ausgewandert und nach der Revolution zurückgekehrt war. Das Russische kennt weder ›h‹ noch ›ä‹ – so war aus »Händel« eben »Gendel« geworden. Ich liebte die melancholischen Lieder Bulat Okudschawas und las, auf Deutsch, seine satirisch-subversiven Bücher, die die politischen Zustände im alten Russland kritisierten und in Wahrheit die Sowjetunion meinten. In Alexander Solschenizyns eindrucksvollem Bericht »Ein Tag im Leben des Iwan Denissowitsch« begegnete mir erstmals der Schrecken des sowjetischen Totalitarismus. Als die Staaten des Warschauer Vertrages 1968 unter Führung der Sowjetunion in die Tschechoslowakei einmarschierten, um den »Reformkommunismus« zu unterdrücken, nahm ich an einem Schweigemarsch teil, der an meinem Urlaubsort in Wyk auf Föhr organisiert wurde – was in der ČSSR geschah, war Unrecht, das konnte auch ein Vierzehnjähriger empfinden.
Wirklich kennengelernt habe ich das riesige Land erst, als ich dort gelebt habe. Meine Frau und ich haben versucht, so weit wie möglich einzutauchen in die russische Wirklichkeit, wir haben Industriebetriebe besucht und Hochschulen, Wohnsiedlungen und Märkte. Vom Weißen Meer im Norden bis zur Wolga-Mündung haben wir Russland durchreist, von den Kriegsgräbern bei Rschew bis nach Wladiwostok und Chabarowsk, der hoch über dem Amur gelegenen Stadt im Fernen Osten, von der Jamal-Halbinsel ganz im Norden bis zu den blumenübersäten Hängen des Altai-Gebirges. Grandiose Ballett-, Konzert- und Opernaufführungen haben unseren Alltag bereichert; wir haben uns faszinieren lassen vom Licht der Gemälde bei uns zu wenig bekannter Maler wie Archip Kuindschi oder Wassili Wereschtschagin, die wunderbare Lyrik Marina Zwetajews und Sergej Jessenins lieben gelernt und großartige moderne Literatur gelesen – von Sergej Lebedew und Wladimir Sorokin, von Gusel Jachina und Alissa Ganijewa. In den trostlos-bedrückenden Erzählungen Warlam Schalamows, der achtzehn Jahre seines Lebens in der Hölle des Stalinschen Lagersystems verbrachte, ist mir der Terror der sowjetischen Repression noch einmal vor Augen geführt worden.
Vor allem sind wir wunderbaren Menschen begegnet, überall und oft ganz unvermittelt. Mutigen Intellektuellen und Schriftstellern mit einem unerschöpflichen Vorrat an Geschichten – wie Viktor Jerofejew, der uns zum Freund wurde. Der Blumenverkäuferin am Straßenrand, die sich als ehemalige Universitätsdozentin erwies; der altgedienten Friseurin, die nach zehn Minuten den Busen über meine Schulter legte, um mir auf ihrem Handy die Tomaten auf ihrer Datscha zu zeigen; der Kellner-Köchin im Zugrestaurant, die mich anpfiff, als ich nach 45 Minuten in ihre Richtung schaute, da unser Essen ausblieb. Sie sei allein, wie ich mir das eigentlich vorstellte?! Dann nahm sie mich mit in ihre Küche und zeigte mir ihre selbstgemachten Würste. Die Frauen in Russland – sie tragen dieses Land. Sie lassen die Männer im Vordergrund wichtig sein, sorgen aber mit drei Arbeitsstellen dafür, dass alle durchkommen. Das Leben so vieler Menschen ist ungleich schwerer als bei uns, zumal in den abgelegenen Dörfern dieses unendlich weiten Landes.
Als ich vielleicht zwölf war, kannte ich die Namen dreier Russen, die mich besonders beeindruckten: Juri Gagarin – der erste Mann im All, Valentina Tereschkowa – die erste Frau im All – und Lew Jaschin. Lew Jaschin war der Torhüter der sowjetischen Fußballnationalmannschaft, legendär in seiner vorausdenkenden Spielweise und schließlich zum »Welt-Torwart des 20.Jahrhunderts« gewählt. Von meiner jugendlichen Begeisterung für den »fliegenden Russen« sprach ich bei der Eröffnung eines Abends über deutsch-russische Fußballgeschichte. In der ersten Reihe strahlte mich eine alte Frau an: Lew Jaschins Witwe. Dass der deutsche Botschafter von ihrem Mann sprach! Es wurde ein wunderbarer Abend im Kreis russischer Fußballlegenden.
Als der deutsche Astronaut Alexander Gerst und seine Crew Anfang 2019 aus dem All zurückgekehrt waren, veranstalteten wir in der Botschaft eine große Party, auf der russische, deutsche und amerikanische Raumfahrtpioniere bis in den Morgen feierten. Als einer der Letzten ging Maxim Surajew, Kosmonaut, ›Held Russlands‹ und Duma-Abgeordneter. Es sei einfach ›duschewno‹ gewesen, meinte er, als er mir zum Abschied um den Hals fiel – seelenvoll, menschlich, herzlich. So ruppig es manchmal zugeht – wenn man dieses Gefühl, dieses Bedürfnis, nicht respektiert, ihm keinen Platz einräumt, ist es schwer in Russland. »Die Deutschen fangen immer gleich an zu verhandeln«, fasste es ein deutscher Geschäftsmann einmal zusammen. »Die Russen fragen erst einmal, wie es geht, wo man herkommt, was die Familie macht und ob man nicht einen Tee zusammen trinken will.«
Alles Erlebte, alle Begegnungen haben meine Zuneigung zu Russland, seiner Kultur und seinen Menschen verstärkt, meinen Respekt, und sie haben es mir leicht gemacht, einen festen Grundsatz durchzuhalten: mich von den Zeitläuften nicht beirren zu lassen in meiner Sympathie für Russland.
Haben meine Frau und ich das Land und seine Menschen in diesen Jahren besser zu verstehen gelernt? Es war ein langes Mittagessen mit einem der »ganz Reichen« im Lande – »reich und machtnah« –, einem aus der Gruppe jener, die man früher ›Oligarchen‹ nannte. Vor unserem Haus parkten seine große deutsche Limousine und zwei Geländewagen mit Personenschutz. Irgendwann drehte sich auch dieses Gespräch um die unvermeidliche Frage: Was ist Russland für ein Land? »Wissen Sie, Herr Botschafter«, sagte mein Gesprächspartner schließlich, »ich bin ein Russe, ich bin hier geboren, aufgewachsen, und ich liebe mein Land. Ich werde es immer in Schutz nehmen. Aber manchmal würde ich es auch gern verstehen.«
Teil I – Der Bruch
Russland und wir – ein Blick zurück
»In den Westen gezerrt«
»Hätten wir nicht wissen müssen, dass Russland nicht alles mit sich machen lässt, dass es sich zur Wehr setzen wird? War Putin nicht deutlich genug in seiner berühmten Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, als er davor warnte, das Weltgeschehen dem Gutdünken einer einzigen Macht zu überlassen, den USA?« Oft habe ich dieses Argument in Diskussionen in Deutschland gehört: »Man muss die Russen doch verstehen!«, heißt es dann, häufig mehr billigend denn verständnisvoll. »Wir sind ihnen immer näher gerückt, haben die NATO immer weiter ausgedehnt! Wir haben Russland regelrecht eingekreist und umstellt – das konnten sie sich doch auf Dauer nicht gefallen lassen!«
Das bedrängte Russland setzt sich zur Wehr. Nach dieser Logik rechtfertigte die russische Politik 2014 auch die Annexion der Krim (die in Russland vorzugsweise »Heimholung« oder »Rückkehr« der Krim genannt wird). Hier wird deutlich, warum wir uns fundamental missverstehen: Wir haben einen unterschiedlichen Blick auf die Welt. Insbesondere beurteilen wir das Weltgeschehen seit dem Ende des Kalten Krieges grundverschieden. Für uns im Westen geschah zu diesem Zeitpunkt etwas ganz und gar Staunenswertes: Geschichte schien uns zu gelingen. Alle, die alt genug sind, sich an das Lebensgefühl in den Jahren des Kalten Krieges zu erinnern, spüren noch heute die Hoffnungslosigkeit der Jahre vor 1989. Der Griff der sowjetischen Machthaber auf das eigene Land und die Länder ihres Machtbereiches war eisern. Unvorstellbar schien, dass die sozialistische Herrschaft je enden könnte.
Immer wieder hatte es in Ostmitteleuropa Versuche gegeben, sich gegen das Diktat Moskaus aufzulehnen: der Volksaufstand in der DDR von 1953, die Posener Unruhen und der Ungarn-Aufstand von 1956, der »Prager Frühling«, der mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Paktes im August 1968 ein gewaltsames Ende fand. Nationale Versuche, die sowjetische Herrschaft abzuschütteln, waren ebenso zum Scheitern verurteilt wie der mutige Versuch der Kämpfer für Menschen- und Bürgerrechte, »der Dissidenten«, in der Sowjetunion selbst die Verhältnisse zu ändern.
Und doch lehnten sich die Menschen in einem Land noch einmal auf, diesmal in großer Zahl, Ende der siebziger Jahre in Polen. Der regierenden Machtelite, die auch hier vorgab, die »Partei der Arbeiter« zu sein, stellten sie selbstbewusst eine eigene Arbeiterorganisation entgegen, die nach kurzer Zeit zur größten Gewerkschaft der Welt wurde und die große Einmütigkeit der Menschen im Namen trug: »Solidarność« – »Solidarität«. Das Aufbegehren von elf Millionen Mitgliedern, Arbeiterinteressen durchzusetzen und die ökonomischen und sozialen Bedingungen im Land zu ändern, endete, zweifellos unter sowjetischem Druck, mit der Verhängung des Kriegsrechts durch die polnische Regierung.
Mitte der achtziger Jahre schienen sich plötzlich Veränderungen anzubahnen, ausgerechnet in Moskau selbst. Ein neuer, jugendlich wirkender Parteiführer ging neue Wege. Die Wahl von Michail Gorbatschow zeigte, dass man im Politbüro offenbar zu dem Schluss gekommen war, das System könnte an seinen inneren Widersprüchen und Unzulänglichkeiten scheitern, würde man nicht im wirtschaftlichen und sozialen Bereich tiefgreifende Änderungen vornehmen. Auch aus der weltweiten Überdehnung des sowjetischen Imperiums zog Moskau Konsequenzen. War man bislang stets bestrebt gewesen, die sowjetische Ideologie auch in die letzten Winkel Angolas, Kambodschas und Nicaraguas zu exportieren und schwächelnde »Brudernationen« zu stützen, so wurde den Partnern nun signalisiert: Ihr habt euer Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Moskau hielt nicht länger seine schützende Hand über alles.
Als junger Diplomat hatte ich diese Entwicklung aus nächster Nähe miterlebt. Von 1986 bis 1989 war mein erster Posten Polen gewesen. Russisch hatte ich zuvor gelernt und den Wunsch geäußert, in einem Land des sozialistischen Machtbereichs eingesetzt zu werden. »Polnische Innenpolitik« lautete mein Aufgabenbereich an der westdeutschen Botschaft in Warschau, wo die Verhältnisse im Sommer 1988 in Bewegung gerieten. Niemand konnte sich recht vorstellen, wie in einem zweiten Anlauf gelingen sollte, was wenige Jahre zuvor bereits einmal gescheitert war. Doch der entscheidende Unterschied bestand darin, dass sich die Haltung Moskaus grundlegend geändert hatte. Die Wirtschaft des Landes war ruiniert, die polnische sozialistische Führung auf sich allein gestellt und die katholische Kirche weit mächtiger als die Einheitspartei. Eine wachsende Oppositionsbewegung kanalisierte die Unzufriedenheit der Millionen. Und sie besaß in dem Danziger Elektriker Lech Wałęsa eine charismatische Führungspersönlichkeit.
In Verhandlungen am »Runden Tisch«, auf noch nie beschrittenen Wegen, wurde die Macht neu ausgehandelt. Erstmals war es für die Opposition mehr als nur ein Glasperlenspiel, sich über die Frage Gedanken zu machen, wo Polens Ort in Zukunft sein sollte. Die Intellektuellen, die Wałęsa berieten, waren sich rasch einig. Polen, so ihre Vision, sollte ein freies, demokratisches Land mit einer marktwirtschaftlichen Ordnung werden. Man wollte sich an den erfolgreichen Modellen im Westen Europas orientieren und hoffte darauf, dass eine Einbindung in die Strukturen der Europäischen Gemeinschaft und eine Mitgliedschaft in der NATO beides bringen würde: Wohlstand und nationale Sicherheit.
In den Gesprächen, die ich damals mit Vertretern der Opposition führte, kam niemand auf die Idee, für eine Alternative zu plädieren, etwa Neutralität oder gar eine Fortsetzung der Ostbindung. Die Sowjetunion hatte sich 1939 mit Deutschland darüber verständigt, Polen zu teilen und sich hierfür nie entschuldigt. »Wiedergutmachen kann man das Geschehene nicht«, so wurde mir oft gesagt, »aber Ihr Deutschen versucht wenigstens, mit der Geschichte umzugehen, und steht zu Eurer Verantwortung.« Anders als die Sowjetunion, deren offizielle Geschichtsschreibung bis Ende der achtziger Jahre bestritt, dass jene Massaker, bei denen weit mehr als zwanzigtausend polnische Offiziere und Vertreter des Bürgertums hingerichtet wurden und die sich mit dem Namen Katyn verbinden, vom sowjetischen Geheimdienst verübt worden waren.
Die Diskussionen im polnischen Untergrund drehten sich daher um die Frage, wie es gelingen könnte, Polen an die westlichen Strukturen heranzuführen. Zwischen Polen und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, wie die EU bis 1993 hieß, befand sich die DDR. Von daher lag nach Überzeugung der polnischen Opposition nicht nur eine demokratische Entwicklung in der DDR in Polens Interesse, sondern auch eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten. Würde Polen diesen Prozess befürworten, würde man nicht allein die Gunst der Deutschen und ihre Unterstützung bei der Integration in die westlichen Bündnisse gewinnen, sondern auch erreichen, dass die Deutschen die Zugehörigkeit der früheren deutschen Ostgebiete zu Polen auch rechtlich bestätigten. Selbst innerhalb der regierenden Partei, der PVAP, begann man neu und in eine ähnliche Richtung über die deutsche Frage nachzudenken – für eine Zukunft, die Polen weitgehend würde selbst gestalten können. Wie weit war man in Deutschland von solchen Gedankengängen entfernt! Noch im Juni 1989 formulierte einer der angesehensten Journalisten der Bundesrepublik, der Chefredakteur der »Zeit«, Theo Sommer, in einem Artikel: »Wer heute das Gerippe der deutschen Einheit aus dem Schrank holt, kann alle anderen nur in Angst und Schrecken versetzen.« Jahre später räumte er reumütig ein: »Man soll die Zukunft nicht durch einen Mangel an Phantasie beleidigen.«
Festzuhalten bleibt: Der Wunsch der überwältigend großen Zahl der Menschen in den Ländern Ostmitteleuropas in jenen Jahren war es, die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in ihren Ländern nach westlichen Vorbildern und Ideen umzugestalten. Es bedurfte keines Drucks und keiner »Karotten«, damit sie in Demokratie und Marktwirtschaft, Meinungspluralismus, Reisefreiheit und Wohlstand ihre Zukunft sahen. Einen Zwang, sich einem Bündnis anzuschließen, gab und gibt es nicht. Schweden, Finnland und Österreich gehören bis heute nicht der NATO an, Norwegen und die Schweiz nicht der EU. Niemand muss – aber viele wollen in die Bündnisse, wie z.B. auf dem Balkan unverändert zu beobachten ist.
Die Wirklichkeit jener Umbruchjahre in den Ländern Ostmitteleuropas habe ich in Diskussionen in Russland oft in Erinnerung gerufen, wenn behauptet wurde, Polen oder Rumänien, Lettland oder die Slowakei seien quasi »in den Westen gezerrt worden«. Diese Behauptung wird gerne geglaubt, bedient sie doch die beliebte Vorstellung einer gegen Russland gerichteten Verschwörung. Gewundert hat mich bisweilen, wie leichtfertig auch manch einer im Westen dieser Erzählung folgte, die den Freiheitswillen und den Mut der Menschen in Riga und Leipzig, in Danzig und Budapest ignoriert, ja beleidigt und ihre freie, selbstbestimmte Entscheidung bestreitet. Die streikenden Arbeiter der polnischen Werften, die Montagsdemonstranten in Leipzig und die hunderttausenden Teilnehmer der singenden Revolution in den baltischen Ländern brauchten weder Ermutigung noch Verführung, sie handelten aus ehrlicher Empörung, wirklicher Verzweiflung und tiefer Überzeugung, sie folgten ihrem eigenen Urteil und dem Wunsch nach Freiheit.
»Die größte geopolitische Katastrophe des 20.Jahrhunderts«
Die Menschen in der Sowjetunion und dann Russland haben das, was seit dem Ende der achtziger Jahre im bis dahin sozialistischen Machtbereich geschah, völlig anders erlebt als wir. Anfang der neunziger Jahre begaben sich ja nicht nur die Satellitenstaaten der Sowjetunion einer nach dem anderen auf eigene Wege. Die Ränder des Imperiums brachen weg und sagten sich von Moskaus Herrschaft los, schließlich sogar das »Fleisch vom eigenen Fleische«, Weißrussland und die Ukraine. Russland blieb mit sich allein.
Was diese Entwicklung für das russische Selbstverständnis bedeutete, wird in einer Äußerung Wladimir Putins deutlich, der den Zerfall der Sowjetunion »die größte geopolitische Katastrophe des 20.Jahrhunderts« genannt hat. Sie zeigt auch, was an Russland für Wladimir Putin – und viele andere – am wichtigsten ist: Eine Großmacht zu sein. Der Zerfall der Sowjetunion war ein ungeheurer Gewichtsverlust, ein Verlust an realer Macht, ein tiefes Trauma. Kaum je in meiner 35-jährigen Berufstätigkeit als Diplomat bin ich so nachhaltig von Vertretern meines Gastlandes darauf hingewiesen worden, Entwicklungen und Ereignisse doch bitte unter psychologischen Aspekten zu betrachten. »Russland leidet unter Phantomschmerz«, hat Henry Kissinger einmal gesagt. Ja, so sei es wohl, räumte ein machtnaher russischer Gesprächspartner mir gegenüber einmal ein. »Zumindest unter Phantomgefühlen leiden wir.«
Um die russische Sicht zu verstehen – es ist nicht nur die des Präsidenten –, gilt es sich vor Augen zu führen, dass mit dem Zerfall der Sowjetunion nicht allein die kommunistische Herrschaft zu Ende ging, sondern auch das alte Russische Reich zerbrach. Mag die Sowjetunion auch ein ideologisch neu ausgerichtetes Land gewesen sein – geographisch wie machtpolitisch war sie identisch mit dem Russischen Reich. Mit dem Zerfall schrumpfte nicht nur das Territorium einer Weltmacht: Von einem Tag auf den anderen befanden sich wichtige wirtschaftliche und industrielle Zentren jenseits neuer Grenzen in neuen Staaten, lagen Streitkräfte und ihre Basen im Ausland. Betroffen waren nicht zuletzt auch verwandtschaftliche Verbindungen und persönliche Erinnerungen.
An der Vorstellung, dass die Sowjetunion und Russland irgendwie identisch gewesen seien, arbeitet Wladimir Putin kontinuierlich und gezielt. In exakten Zahlen deklinierte er in seiner Rede an die Nation im März 2018 die Verluste durch, die das Ende der Sowjetunion brachte, und setzte sie mit russischen Verlusten gleich: »Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verlor Russland, das zu Sowjetzeiten als Sowjetunion bezeichnet wurde – sie nannten es im Ausland Sowjetrussland –, in Bezug auf unsere Landesgrenzen 23,8 Prozent des Territoriums, 48,5 Prozent der Bevölkerung und 41 Prozent des Bruttosozialprodukts, 39,4 Prozent des industriellen Potenzials (also fast die Hälfte), 44,6 Prozent des militärischen Potenzials im Zusammenhang mit der Aufteilung der Streitkräfte der UdSSR zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken.«
»25 Millionen Russen lebten plötzlich im Ausland«, hat Wladimir Putin bei anderer Gelegenheit gesagt.
Es trifft zu: Millionen von Russen (die tatsächliche Zahl ist umstritten) lebten plötzlich in Turkmenistan und Estland, in Kirgisistan, Georgien und Lettland und hatten häufig einen schweren Stand. Dass die meisten ihrer Vorfahren nicht freiwillig dort hingegangen sind, sondern von Stalin angesiedelt wurden, macht die Sache nicht einfacher. Weil Russen es in manchen dieser Länder nicht leicht haben, haben russische Politiker, der Präsident eingeschlossen, auch wiederholt angedeutet, sie seien willens, deren Interessen zu schützen. Was genau das im Einzelfall bedeutet bleibt unklar. Schaut man nach Transnistrien, das eigentlich zur Republik Moldau gehört und bis heute von russischen Truppen »geschützt« wird, in das von Russland »unterstützte« Abchasien, eigentlich ein Teil Georgiens, auf die Krim oder in den Donbas, dann vermag man sich eine Vorstellung davon zu machen, wie weit die Bereitschaft Russlands »zum Schutz« gehen mag und wie groß die Sorge in Ländern wie Estland oder eben der Ukraine ist. Kasachstan, Russlands großer südlicher Nachbar und bis 1991 Teil der UdSSR, sei eigentlich nie ein eigener Staat gewesen, meinte Wladimir Putin im August 2014. Im gemeinsamen eurasischen Raum biete sich dem Land jedoch die Chance, Teil der »großen russischen Welt« zu bleiben. Eine Aussage auf dem Höhepunkt der Ukraine-Krise, die in Kasachstan hohe politische Wellen schlug.
Die Tatsache, dass Russen unter schwierigen Bedingungen im Ausland leben müssen, macht es vielen Russen leicht, in eine Opferrolle zu schlüpfen. »Wir sind heute das größte geteilte Volk der Welt«, so Putin in rhetorischer Emphase. Diese Perspektive lässt außer Acht, dass mancher Unmut der Mehrheitsbevölkerung in den neu entstandenen Staaten darin gründet, allzu lange von einer russischen Minderheit gelenkt, kontrolliert und auch kujoniert worden zu sein. Russen blenden in ihrer Sicht auf den Zerfall der Sowjetunion gerne aus, dass es sich dabei um nichts anderes als das Auseinanderbrechen des letzten großen Kolonialreiches auf Erden handelte, mochte die Sowjetunion auch den Versuch unternommen haben, aus dem Kolonialreich einen »multiethnischen Staat« zu machen. Denken wir an Kolonialreiche, so haben wir in erster Linie das britische Weltreich vor Augen. Aber ein Kolonialreich kann sich auch auf dem Landweg ausdehnen. Es war kein Geringerer als Lenin selbst, der Russland vor Beginn des Ersten Weltkrieges als die nach Großbritannien bedeutendste Kolonialmacht bezeichnete. National gesinnte Russen reagieren auf die Feststellung, das Russische Reich sei eine Kolonialmacht gewesen, üblicherweise mit Empörung. Die Völker des Zarenreiches hätten sich mehr oder minder freiwillig unter die Herrschaft Moskaus gestellt, wird dann gesagt, und im Übrigen seien sie sehr gut behandelt worden. Das Argument ist nicht unbekannt.
Wer Schuld trägt am Zusammenbruch
Warum ist das alte Reich zerfallen, wer trägt die Schuld? »Es waren dunkle Kräfte aus dem Ausland, die es zerstörten. Im Übrigen aber: Gorbatschow natürlich! Gorbatschow ist an der ganzen Misere schuld, er ist schuld, dass die Sowjetunion untergegangen ist – denn so schlecht war ja doch alles nicht und vielleicht hätte man sie reformieren können. Er aber hat sie in den Ruin geführt, er ist schuld an ihrer Auflösung.« Darin sind sich die Menschen in Russland weitgehend einig. Dabei ist die Sowjetunion an ihren eigenen Widersprüchen gescheitert, ihr Wirtschaftssystem war nicht konkurrenzfähig und ihr politisches System so repressiv, dass es jede Eigeninitiative im Keim erstickte und Veränderung unmöglich war. Dass die Sowjetunion nicht zu reformieren war, das ist die Wahrheit über Gorbatschows Herrschaft, und es ist seine Tragödie. Denn Michail Gorbatschow ist in Russland heute eine Unperson. Er kommt schlicht nicht vor – es sei denn, er meldet sich einmal zu Wort, um die Politik des jetzigen Präsidenten zu unterstützen. Oder eben, wenn es darum geht, einen Schuldigen für den Untergang der Sowjetunion zu benennen. Die politische Führung aber ignoriert ihn.
Als Michail Gorbatschow im März 2016 85 Jahre alt wurde, organisierten Getreue im traditionsreichen Moskauer Hotel ›Ukraina‹ eine Geburtstagsfeier mit Freunden und Weggefährten, einige wenige Ausländer waren eingeladen. Ich hatte Glückwünsche dabei, des Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin. Die russische Führung glänzte durch Abwesenheit – ranghöchste Vertreterin war die Sprecherin des Ministerpräsidenten: ein Zufall, Gorbatschow und sie kannten sich aus früheren Zeiten.
Gorbatschow mag Fehler gemacht haben – aber er hatte auch einfach keine Chance. Boris Jelzin war es, der Präsident der russischen Teilrepublik der UdSSR, der erkannte, dass der Versuch zum Scheitern verurteilt war, die Sowjetunion zu reformieren. Er ließ die kommunistische Partei verbieten und beschloss, gemeinsam mit den Präsidenten der Teilrepubliken Weißrussland und Ukraine die Sowjetunion aufzulösen. Gorbatschow, immer noch Präsident des gesamten Landes, wurde hiervon am 08.12.1991 lapidar per Telefon in Kenntnis gesetzt. Immer wieder habe ich mich mit Michail Gorbatschow zum Gespräch getroffen, jede Begegnung war von langen Ausführungen über seine damalige Rolle und die Verantwortung Boris Jelzins geprägt. Er leidet unter den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden.
Interessanterweise werden »Die schrecklichen neunziger Jahre«, in denen Jelzin das Land führte, weniger mit dem Präsidenten jener Zeit in Verbindung gebracht als mit dessen Regierung. Der Zusammenbruch des Wirtschaftssystems, der Kollaps der Währung, Arbeitslosigkeit, Armut, Orientierungslosigkeit – all dies wird den verantwortlichen Ministerpräsidenten und Ministern der Zeit angelastet. Sie führten einen Titanenkampf, um mit dem Erbe des kollabierten Sowjetsystems fertigzuwerden, mit dem Ergebnis, dass ihre Zeit eben auch von Verarmung, Verunsicherung, Unordnung geprägt war – so wie die Anfangszeit Präsident Putins von einer Rückkehr zu gesellschaftlicher Ordnung, wirtschaftlicher Stabilität und Aufschwung. Weitgehend erntete Wladimir Putin die Früchte der Arbeit jener bis heute gescholtenen Regierungen der neunziger Jahre – und er profitierte vom rasant steigenden Ölpreis.
Wie dramatisch die Situation Anfang der neunziger Jahre war, schilderte mir sehr anschaulich einmal Pjotr Awen, heute Chef von Russlands größter privater Bank und international angesehener Wirtschaftsfachmann. »Ich war 36 und plötzlich Außenhandelsminister, als ich 1991 mit den westlichen Regierungen und Finanzinstitutionen über die Schulden der UdSSR verhandelte. Die Sowjetunion wankte, nein, stürzte eigentlich schon ein, und zu Hause drohte eine Hungerkatastrophe. Das waren die Dimensionen. Das hält man nur in einem solchen Alter aus – schon mit 50 führt so etwas unweigerlich zu einem Herzinfarkt.« Seine besten Erfahrungen habe er damals mit den historisch-politisch umsichtigen Deutschen gemacht, dem Team um Theo Waigel, mit Horst Köhler und anderen – obwohl die Verschuldung bei den Deutschen viel größer gewesen sei »als bei den hartleibigen Amerikanern«.
Seit wann denn die Überzeugung in ihm gewachsen sei, habe ich Michail Gorbatschow einmal gefragt, dass das sowjetische Modell möglicherweise nicht zukunftsfähig sei? Eigentlich schon sehr früh, sagte er, als er Chef der kommunistischen Jugendorganisation im Nordkaukasus gewesen sei. Bei einem privaten Treffen habe sein Pendant im Südkaukasus, Eduard Schewardnadse, späterer sowjetischer Außenminister und schließlich Präsident seines Heimatlandes Georgien, zu ihm gesagt: »Michail Sergejewitsch, das kann doch so nicht weitergehen! Alles verfällt!« Das sei auch seine Auffassung gewesen, und so hätten sie gemeinsam begonnen, Zukunftspläne zu schmieden.
Zum ersten Mal begegnete ich Michail Gorbatschow im Sommer 2014. Ich fragte ihn als Sohn eines Russen und einer Ukrainerin nach seiner Meinung zum Konflikt im Nachbarland. Doch die Außenpolitik des aktuellen Präsidenten mochte er nicht bewerten. Er habe Putin, so sagte er lediglich, in dessen erster Amtszeit durchaus unterstützt – inzwischen tue er dies nicht mehr vorbehaltlos. Aber Putin sei im Moment wohl der beste Führer für das Land – es gelinge ihm, das Volk hinter sich zu scharen.
Über Deutschland sprach Gorbatschow stets nur positiv, kramte auch Kindheitserinnerungen heraus. Sicher war dies auch Höflichkeit, denn seine Heimat war im Zweiten Weltkrieg mehrere Monate lang von der Wehrmacht besetzt. Doch immer wieder wurde deutlich, wie durch die intensive Zeit der deutschen Vereinigung, zu der er so viel beigetragen hat, eine tatsächliche, enge Bindung entstanden ist. Als ich ihn einlud, an Feierlichkeiten teilzunehmen, die wir in Moskau aus Anlass des 25.Jahrestags des Mauerfalls veranstalteten, berichtete er lebhaft von jenen Tagen. Er erinnerte sich genau. Ob er vom Beschluss der DDR-Führung gewusst habe, Reisefreiheit zu gewähren? – »Nein!« Aber überrascht habe damals nur noch wenig. Kurz zuvor sei er ja zum 40.Gründungstag der DDR in Berlin gewesen. Abends dann dieser gespenstische Fackelzug, den sie aus Anlass des Jubiläums abgenommen hätten. Deutlich habe man aus dem Hintergrund die Sprechchöre der oppositionellen Demonstranten herüberhallen hören. Neben ihm habe der Vorsitzende der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei gestanden, Mieczysław Rakowski: »Michail Sergejewitsch«, habe dieser zu ihm gesagt, »das ist doch das Ende!« Etwas anders erinnerte sich Rakowski, den ich aus meiner Zeit in Polen kannte. Als bei jener Jubiläumsfeier in Ost-Berlin Rufe zu hören gewesen seien »Gorbi, hilf!«, habe er, Rakowski zu Gorbatschow gesagt: »Michail Sergejewitsch, es scheint, als wollten sie ein zweites Mal von Euch befreit werden!«. Das habe Gorbatschow sichtlich amüsiert.
In den Jahren, die ich in Moskau war, machten Beschwerden des Alters Michail Gorbatschow zunehmend zu schaffen. Doch er blieb stets ein lebendiger, sehr liebenswürdiger und – wie könnte es anders sein – hoch interessanter Gesprächspartner. Das Gespräch führte er mit wachen Augen und einer unverändert wohlklingenden Stimme. Im April 2019 trafen wir uns zu einer letzten Begegnung. »Je älter ich werde, desto mehr glaube ich an Gott«, meinte der ehemalige Vorsitzende der größten kommunistischen Partei der Welt zum Abschied.
Ein sehr kurzer Blick in Russlands Geschichte
Das Reich zerfiel. Wie war es entstanden? Den Beginn des historischen Selbstverständnisses von Russen, Ukrainern und Weißrussen bildet die »Kiewer Rus«, gern auch »die alte Rus« genannt, mehr ein dynastischer Herrschaftsverband denn ein Nationalstaat mit fest umrissenen Grenzen, der sich um die Wende vom ersten zum zweiten Jahrtausend zwischen dem östlichen Polen und dem heutigen Finnland erstreckte. Mit dem Vordringen der Mongolen begann Anfang des 13.Jahrhunderts eine 300-jährige Fremdherrschaft, die bis heute tief in das russische Selbstbewusstsein eingegraben ist. »Weder die Europäer noch die Russen haben verstanden, dass Russland anders ist. Zwar ein Land mit einer europäischen Kultur, aber sozial und politisch Erbe des Reichs von Dschingis Khan«, urteilt hierzu Sergej Karaganow, führender Politikwissenschaftler und streitbarer Anwalt des gegenwärtigen Russlands. Ja, räumt der Philosoph Wladimir Kantor ein, die Willkür der Macht, das mangelnde Verständnis für Privateigentum, das »Fehlen der selbsttätigen autonomen Persönlichkeit«, das sei ein Erbe aus jener Zeit. Russland habe in der Tat einen eigenen, besonderen Weg. Doch zu diesem gehöre eben vor allem »das ständige Sich-Beziehen auf den Westen«. Kantor verweist darauf, dass »das Volk sich … sogar in Zeiten der Entfernung von Europa, wenn es sich von diesem durch einen »Eisernen Vorhang« verbarg, … an die Ursprünge seines historischen Lebens erinnerte … Und jedes Mal kam es zu einer grundsätzlichen Korrektur des russischen Weges nach westlichem Muster. Ob geglückt oder nicht – das ist eine andere Frage …«
Die Christianisierung hat Russland viel nachhaltiger geprägt als die Zeit unter mongolischer Herrschaft. Als mit der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen 1453 das oströmische Reich, das »zweite Rom«, unterging, hat Russland, in seinem Selbstverständnis, das Erbe von Byzanz angetreten. Eine Nichte des letzten byzantinischen Kaisers heiratete den russischen Großfürsten, der sich seither des Titels Zar – Kaiser – bediente. Russland übernahm das Wappen der byzantinischen Kaiser, den doppelten, nach Ost und West schauenden Adler. Seither – und im Verständnis vieler Russen bis heute – gilt Russland als »drittes Rom«. Nachdem Hammer und Sichel verschwunden sind, erhebt nun wieder der Adler sein gekröntes Doppelhaupt – auf den Farben der niederländischen Flagge, die Peter der Große aus Holland mitbrachte.
Anders als im Westen Europas entstanden zur Mongolenzeit keine starken, regionalen Herrschaften, keine mächtigen Städte mit selbstbewusstem Bürgertum und Handwerkerzünften. Nur im Norden wirkte sich der Einfluss der Hanse begrenzt aus. Während im Westen Europas die Renaissance ihre kulturelle und geistesgeschichtliche Blüte entfaltete, rangen die russischen Fürsten nach dem Niedergang der mongolischen Macht um die Vorherrschaft. Mit der Wende zum 16.Jahrhundert ging sie an das Moskauer Großfürstentum.
Russland blieb ein Land ohne natürliche Grenzen. Katharina die Große, eine deutsche Prinzessin, die das Land seit 1762 regierte, erklärte das außenpolitische Dilemma zur Strategie. Ihr wird der Satz zugeschrieben: »Der einzige Weg, Russland zu schützen, ist es, seine Grenzen beständig auszuweiten«. Sie und ihre Nachfolger haben diesen Grundsatz fleißig beherzigt. Im 18. Jahrhundert kam das Gebiet der späteren baltischen Staaten zum Russischen Reich; nur kurz konnten sie sich nach dem Zweiten Weltkrieg vom Russischen Reich lossagen, bis die Sowjetunion sie 1939 mit Hitlers Hilfe erneut annektierte. 1783 wurde die Krim dem Osmanischen Reich abgenommen, um die Wende vom 18. zum 19.Jahrhundert kam der südliche Kaukasus mit Georgien, Armenien und Aserbaidschan hinzu, im gleichen Jahrhundert in langen Kriegen Zentralasien. 1860 zwang Russland das geschwächte chinesische Reich, ihm Gebiete jenseits Sibiriens abzutreten, und baute das Fischerdorf Haishen-wie zum eisfreien Hafen aus. Sein neuer Name: »Beherrsche den Osten« – Wladiwostok.
Wurde mir in Russland entgegengehalten, die Krim gehöre »eigentlich« zu Russland, habe ich gerne zurückgefragt, ob nicht die äußere Mandschurei – einschließlich Wladiwostoks – »eigentlich« zu China gehöre. Wie mir überhaupt viele historische Beispiele einfielen, welches Territorium »eigentlich« wem gehöre. Ob es daher nicht sinnvoller sei, jeder halte sich an Regeln und Verträge, statt sich zu nehmen, was ihm aus Gründen vermeintlicher Gerechtigkeit angeblich zustehe.
Russland griff aus – und erlebte immer wieder Invasionen: 1610 besetzten Adlige unter polnischer Führung für drei Jahre die Hauptstadt, 1812 nahm Napoleon Moskau ein. 1917, nachdem die junge Sowjetmacht mit dem Deutschen Reich den Frieden von Brest-Litowsk abgeschlossen hatte, landeten britische, französische und japanische Truppen im Norden, Süden und Osten des Russischen Reiches. 1941 schließlich erfolgte die furchtbarste und folgenreichste der Invasionen: Die Truppen des nationalsozialistischen Deutschlands drangen innerhalb weniger Monate weit in die Sowjetunion vor, vernichteten und verheerten große Teile des Landes, Millionen von Soldaten und Zivilisten kamen zu Tode, und es fehlte nicht viel, dass es zum dritten Mal einer ausländischen Macht – nach Polen und Franzosen – gelungen wäre, Moskau einzunehmen.
»Russland, umstellt und bedrängt«
All das rief Präsident Putin in Erinnerung, als er am 18.





























