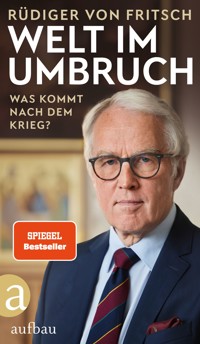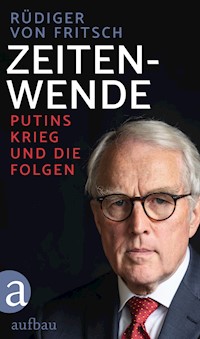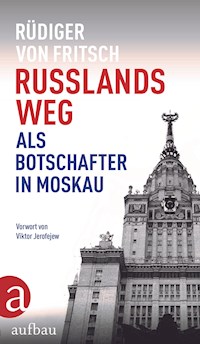16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein bestechendes Zeugnis gesamtdeutscher Alltagsgeschichte. 7. Juli 1974: Die Welt schaut nach München, wo das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Dieser Zeitpunkt scheint Rüdiger von Fritsch und seinem Bruder Burkhard ideal, um ihrem Vetter Thomas und dessen Freunden zur Flucht aus der DDR zu verhelfen. Fast ein Jahr haben sie auf die Vorbereitungen verwandt. Doch im letzten Augenblick droht ihr Plan zu scheitern … Vor dem Hintergrund angespannter deutsch-deutscher Beziehungen und der Zypernkrise erzählt Bestsellerautor Rüdiger von Fritsch packend vom Fälschen von Pässen, von der Erstellung von Fluchtrouten und konspirativen Treffen – und von einer spektakulären Flucht, während ein Krieg zwischen Griechenland und der Türkei droht. Ein bestechendes Zeugnis gesamtdeutscher Alltagsgeschichte in einer überarbeiteten Neuausgabe zum 50. Jahrestag. »Ich habe selten ein Buch gelesen, dem es so gut wie diesem gelingt, einen Einzelfall, der für sich alleine schon aufregend genug ist, in ein großes historisches Panorama einzufügen.« Heinrich August Winkler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Ein bestechendes Zeugnis gesamtdeutscher Alltagsgeschichte.
7. Juli 1974: Die Welt schaut nach München, wo das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft stattfindet. Dieser Zeitpunkt scheint Rüdiger von Fritsch und seinem Bruder Burkhard ideal, um ihrem Vetter Thomas und dessen Freunden zur Flucht aus der DDR zu verhelfen. Fast ein Jahr haben sie auf die Vorbereitungen verwandt. Doch im letzten Augenblick droht ihr Plan zu scheitern …
Vor dem Hintergrund angespannter deutsch-deutscher Beziehungen und der Zypernkrise erzählt Bestsellerautor Rüdiger von Fritsch packend vom Fälschen von Pässen, von der Erstellung von Fluchtrouten und konspirativen Treffen – und von einer spektakulären Flucht, während ein Krieg zwischen Griechenland und der Türkei droht. Ein bestechendes Zeugnis gesamtdeutscher Alltagsgeschichte in einer überarbeiteten Neuausgabe zum 50. Jahrestag.
»Ich habe selten ein Buch gelesen, dem es so gut wie diesem gelingt, einen Einzelfall, der für sich alleine schon aufregend genug ist, in ein großes historisches Panorama einzufügen.« Heinrich August Winkler.
Über Rüdiger von Fritsch
Rüdiger von Fritsch, geboren 1953, bereitete die EU-Osterweiterung als Unterhändler in Brüssel vor, er war Leiter des Planungsstabes des Bundespräsidenten und Vizepräsident des BND. Von 2010 bis 2014 war er Botschafter in Warschau und von 2014 bis 2019 Botschafter in Moskau. Seine Bücher »Russlands Weg«, »Zeitenwende« und »Welt im Umbruch« wurden zu SPIEGEL-Bestsellern.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Rüdiger von Fritsch
Endspiel 1974 – Eine Flucht in Deutschland
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
50 Jahre danach
Europa 1974
1: Kalotina, 6. Juli 1974
2: Thomas
3: »… aber bitte erschrick nicht!«
4: Was zusammengehört
5: Ein fatales Missverständnis
6: Freundschaft
7: Abschiedsbrief
8: Treffen in Karlsbad
9: Burkhard
10: Ein kreativer Briefträger, ein konspiratives Treffen und der Rücktritt Willy Brandts
11: Abschied von der Hangweide
12: »Komm’ Se mal mit!«
13: Millimeterarbeit
14: Nessebar
15: Rhodamin B
16: Krieg auf dem Balkan?
17: Neubeginn
Tausend Meter westlich von Kalotina …
Impressum
Für Tom, Bernd, Thomas und Burkhard
50 Jahre danach
7. Juli 1974. Untrennbar ist »die Sache mit Tom« mit dem Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft und den Wochen um sie herum verbunden. Denn genau an jenem Tag sollte sie stattfinden, die von meinem Bruder und mir organisierte Flucht unseres Vetters Thomas und seiner beiden Freunde aus der DDR in die Bundesrepublik. Weil Endspiel war und wir uns weniger argwöhnisch beobachtet glaubten als an anderen Tagen– von bulgarischen Grenzbeamten, die doch eben so fußballbegeistert waren wie wir – so unsere Vermutung. 50 Jahre sind die Weltmeisterschaft und der Fluchtversuch 2024 her. Doch jeder Moment jener wohl aufregendsten Wochen meines Lebens bleibt eingebrannt in die Erinnerung – die angespannten Stunden immer neuer Versuche, Pässe für Tom und seine Freunde zu fälschen, die wachsende Beklemmung auf der Fahrt durch Österreich und Jugoslawien zu ihnen, die in Bulgarien auf uns warteten, die furchtbare Enttäuschung der drei, als unser Versuch am 7. Juli 1974 im ersten Anlauf scheitert.
Unter dem Titel »Die Sache mit Tom« ist dieses Buch bereits einmal erschienen. Seither ist es ins Polnische, Bulgarische und ins Russische übersetzt worden. Die vorliegende Ausgabe stellt eine überarbeitete und aktualisierte Fassung jener Erzählung dar, über unser Endspiel 1974: eine Flucht in Deutschland.
Europa 1974
6. Mai 1974. Seit Mitternacht meldet der »Norddeutsche Rundfunk«: Bundeskanzler Willy Brandt ist zurückgetreten. Sein persönlicher Referent ist der Spionage für die DDR überführt worden, und Willy Brandt zieht die Konsequenzen. Er hätte sich, so erklärt er kurz darauf im Fernsehen, »für einen Teil der Politik – hier meine ich unser Verhältnis zur DDR und zum Warschauer Pakt – zeitweilig nicht mehr unbefangen genug gefühlt.« Für diese Politik – seine Ostpolitik – hatte er 1971 den Friedensnobelpreis erhalten. Mit ihr hatte er versucht, die Teilung Deutschlands und Europas als Wirklichkeit zu akzeptieren und sie erträglicher zu machen.
7. Juli 1974. »Deutschland wird Fußballweltmeister!« Deutschland? Nur der westliche Teil – die Bundesrepublik Deutschland. Ein einziges Spiel hat sie während des Turniers verloren – ausgerechnet gegen den anderen deutschen Staat. 1:0 für die DDR. Jürgen Sparwasser, der Schütze des Siegtreffers, setzt sich später in den Westen ab. Die Wirklichkeit der deutschen Teilung ist vielfältig.
Seit bald dreißig Jahren ist Europa 1974 geteilt, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs – in Ost und West, in gegnerische Militärbündnisse und in unterschiedliche Wirtschaftszonen, in Staatsdiktaturen unter der Herrschaft einer Einheitspartei und in freiheitliche Demokratien, die in Griechenland, Portugal und Spanien ihrerseits Diktaturen als Verbündete akzeptieren.
Und seit bald dreißig Jahren ist Deutschland geteilt – erst in die Besatzungszonen und Verwaltungsgebiete der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, dann in DDR und Bundesrepublik und in die »Ostgebiete«, um deren Zukunft seit 1969 in der Bundesrepublik erbittert gerungen wird: Die sozialliberale Regierung unter Bundeskanzler Willy Brandt hat in der Außen- und Sicherheitspolitik neue Wege beschritten.
Ihren ursprünglichen Traum der frühen fünfziger Jahre hatte die SPD unter dem Druck der politischen Realitäten aufgegeben: Deutschlands Zukunft sollte durch eine möglichst große Unabhängigkeit von den großen Mächten in der Schwebe gehalten werden. Zu diesen Realitäten zählte auch der Erfolg der Politik des ersten Bundeskanzlers Konrad Adenauer. Sein Ziel, Deutschland eng an den Westen zu binden, stieß in der Bevölkerung auf breite Zustimmung, die sich in Wahlerfolgen niederschlug.
Auch in der DDR war die Einheit Deutschlands – natürlich unter staatssozialistischen Vorzeichen – zunächst das vorrangige Ziel der Politik gewesen. Doch wie die Bundesrepublik sich im Westen einrichtete, ordnete die DDR sich in das östliche Bündnissystem ein. »Deutschland einig Vaterland …« – diese Worte der DDR-Hymne sollten nicht länger gelten. Die Teilung vertiefte sich und die Hymne wurde nur noch gespielt, nicht mehr gesungen … Aus einem »sozialistischen Staat deutscher Nation«, von dem die neue DDR-Verfassung von 1968 noch sprach, wurde in der überarbeiteten Fassung von 1974 ein »sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern«.
In den ersten Jahren nach dem Krieg war es noch vergleichsweise einfach gewesen, von der sowjetischen in eine der westlichen Besatzungszonen zu gelangen, von der DDR in die Bundesrepublik. Immer mehr Menschen machten davon Gebrauch und flohen in den Westen, denn im Osten wurden die politischen und bürgerlichen Freiheiten immer stärker eingeschränkt. Im Westen verbesserten sich gleichzeitig die Lebensverhältnisse und eilten jenen im Osten immer weiter davon.
Im Juni 1953 kam es in der DDR zu einem Volksaufstand, spontan und fast im ganzen Land – mehr als eine Million Menschen in mehr als 700 Orten wehrten sich gegen die Diktatur der SED. Mit größter Härte wurde der Aufstand niedergeschlagen, mehr als 330 000 Menschen flohen im selben Jahr in den Westen. Einen solchen Aderlass konnte die DDR nicht verkraften – die Führung begann, das Land systematisch abzuriegeln.
Aus einfachen Zäunen wurden Stacheldrahtsperren und schließlich ein technisch perfekter »Todesstreifen«, eine kahle Schneise durch Deutschland, ausgeleuchtet und vermint, bewacht von Soldaten, denen befohlen war, auf »Grenzverletzer« gezielt und tödlich zu schießen. Auch die anderen sozialistischen Staaten riegelten mehr und mehr ihre Grenzen ab und ließen niemanden nach Westen durch, der sich nach mehr Freiheit oder einfach nach einem besseren Leben sehnte: die Tschechoslowakei – wie der damals noch vereinte Staat hieß – nach Österreich und zur Bundesrepublik hin, Bulgarien zur Türkei und nach Griechenland, Jugoslawien und Ungarn ebenfalls nach Österreich hin.
Nur ein Ort bot schließlich noch die Chance zur Flucht: Berlin. Die deutsche Hauptstadt, vom Gebiet der DDR umschlossen, war in sich wiederum zwischen den vier alliierten Siegermächten aufgeteilt worden und unterlag besonderen alliierten Rechten. Der Osten war sowjetische Zone und wurde zum Sitz der DDR-Regierung, die drei übrigen Zonen – französische, britische und amerikanische – bildeten West-Berlin, den freien Teil der Stadt. Als die innerdeutsche Grenze immer undurchlässiger wurde, nutzten mehr und mehr Menschen, schließlich Tausende, den besonderen Status der Stadt und flohen vom Osten in den Westen. Die meisten bestiegen ganz einfach nur die S‑Bahn, die unverändert die Stadtteile und Sektoren miteinander verband.
So beschlossen die sowjetische und die DDR-Führung 1961, das letzte Schlupfloch von Ost nach West abzudichten. Mit dem Bau der Berliner Mauer ab dem 13. August 1961 senkte sich der »Eiserne Vorhang« endgültig zwischen dem Osten und dem Westen Europas nieder.
1969 trat die sozialliberale Koalition aus SPD und FDP mit dem Ziel und der Zusage an, die Grenzen durchlässiger zu machen. »Wandel durch Annäherung« hieß das Stichwort. Der Einbindung in den Westen sollte der Ausgleich mit dem Osten folgen. In Verträgen mit den sozialistischen Staaten, schließlich auch mit der DDR, wurden die Nachkriegsrealitäten in Europa mehr oder minder festgeschrieben und es wurden Brücken gebaut – Brücken des kulturellen und des wirtschaftlichen Austauschs und – vorsichtig und zaghaft – auch der menschlichen Begegnung. Dazu trug auch das große Projekt einer internationalen Verabredung zwischen den westlichen und den östlichen Staaten bei, die 1974 in Helsinki besiegelt wurde: die Schlussakte der »Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa«.
Die Politik der Entspannung und der KSZE-Prozess schafften Erleichterungen – doch es zeigte sich, dass die Teilung Europas und Deutschlands sich allein auf diesem Wege nicht würde überwinden lassen. Ja, in vieler Hinsicht verfestigten sich die Verhältnisse, wurde die Wirklichkeit zweier deutscher Staaten zur immer mehr akzeptierten – und von nicht wenigen in Europa als segensreich empfundenen – Normalität. Mauer und Grenzanlagen verloren zugleich nichts von ihrem tödlichen Schrecken. Erst der Mut und der Freiheitswille der Menschen in den sozialistischen Ländern – in Danzig und Prag, in Riga und Moskau, in Budapest und Leipzig – brachte die Mauer zum Einsturz, überwand seit 1989 die Teilung und vereinte Deutschland.
Doch die Ereignisse der späten achtziger und frühen neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts waren fern und unvorstellbar in jenen Monaten zwischen dem Herbst 1973 und dem Sommer 1974, der Zeit der Fußballweltmeisterschaft, als es sich ereignete: unser persönliches Endspiel 1974.
Europa 1974
1
Kalotina, 6. Juli 1974
Ruhig, nur ruhig bleiben. Du fährst nicht zum ersten Mal über diese Grenze. Warum sollten sie Verdacht schöpfen?
Kein loser Spruch kommt uns mehr über die Lippen, kein Witz, der die Spannung erträglich machen könnte. Die Spannung, die sich während der letzten Monate aufgebaut hat, die uns seit gestern immer mehr die Kehle schnürt, seit Burkhard, mein älterer Bruder, und ich in München losgefahren sind. Burkhard, der neben mir am Steuer sitzt, der auch jetzt die besseren Nerven hat. In dem es aber wohl genauso aussieht wie in mir. Der sich jetzt genauso wie ich den Zufallskontrollen bulgarischer Grenzbeamter ausliefert.
Hinter uns liegen 1300 Kilometer ermüdender Fahrt durch Österreich und über die enge, überlastete und mit Schlaglöchern übersäte Strecke des jugoslawischen »Autoput«. Burkhard hat etwas Fahrpraxis, ich kaum. Einen Tag sind wir jetzt unterwegs, die Nacht im Schlafsack im Auto war unruhig, kurz und keine Erholung. Immer wieder bin ich aus beklemmenden Träumen aufgeschreckt. Doch jetzt sind wir beide hellwach, unsere Aufmerksamkeit ist aufs Höchste gespannt.
Nur langsam bewegt sich die Schlange der Autos auf die jugoslawisch-bulgarischen Grenzkontrollen zwischen Dimitrovgrad und Kalotina zu. Fernlaster, altersschwache Studentenautos, überladene Ford-Transit-Busse auf dem Weg in die türkische Heimat ihrer Fahrer.
Unser Wagen – einer unter vielen. Zwei junge Männer, Jungen eigentlich, 20 und 22 Jahre alt. Unterwegs in einem kleinen roten Opel »Kadett«, vermeintlich auf dem Weg in den Urlaub in die Türkei oder zu noch ferneren Zielen. Nichts Besonderes in jenen Jahren, in denen eine ganze Generation den Rucksack packt und per Anhalter Richtung Kathmandu aufbricht oder mit dem Zug quer durch Europa reist – oder eben in die Türkei. Im Auto die übliche Unordnung aus Schlafsäcken und Lebensmittelvorräten, aus Werkzeug und Ersatzteilen, aus Karten und Kleidern.
Wenn man genauer hinschaut, scheint es etwas viel Gepäck für zwei. Drei Seesäcke, erstaunlich viele Hosen und Hemden, mehr Schlafsäcke als nötig. Natürlich, das lässt sich alles erklären: Verschenken, es könnte kalt werden, wer weiß, alte Sachen, könnten kaputtgehen. Das kann man uns noch glauben.
Was sich nicht erklären lässt, sind die drei Pässe, die wir im Wagen versteckt haben. Drei grüne Pässe: einen für Tom und je einen für seine Freunde. Grüne Pässe für Tom und Bernd und Thomas, die nicht aus München nach Bulgarien reisen, sondern aus Thüringen, aus der Altmark und aus Leipzig. Die, wenn alles geklappt hat, seit zwei Tagen an der Schwarzmeerküste auf uns warten. Die zwar Pässe haben – aber keine grünen, sondern blaue: DDR, nicht Bundesrepublik. Die auf diese drei grünen Pässe warten, um mit uns morgen aus Bulgarien in die Türkei auszureisen, aus der Diktatur des einen in die Freiheit des anderen Deutschlands.
Burkhard und ich wissen, dass wir gar nicht erst versuchen müssten, etwas zu erklären, wenn die Pässe gefunden werden. Alles ist zu offensichtlich. Drei Pässe, die nicht die unseren sind und in denen der bulgarische Einreisestempel schon eingetragen ist, den man doch erst an der Grenze erhält. Stempel, die gut aussehen – aber nur auf den ersten Blick. Die eben nicht perfekt geschnitten sind und die nicht fluoreszieren, wenn man sie bei ultraviolettem Licht betrachtet. Pässe, denen man bei genauerer Prüfung anmerken kann, dass die Ösen in den Passbildern nicht der Norm entsprechen. Denn ihre Fotos wurden ausgetauscht.
Aber wenn die Pässe nicht gefunden werden, kann alles klappen. Dann werden Burkhard und ich weiterfahren, die Nacht hindurch, bis an die Schwarzmeerküste. Wir werden Tom und Bernd und Thomas treffen, ihnen die Pässe geben, die Seesäcke und das überzählige Gepäck. Wir werden westdeutsche Jugendliche aus ihnen machen, die per Autostopp von der Bundesrepublik Richtung Türkei unterwegs sind. Die drei werden über Nacht die Biographien ihrer Pässe auswendig lernen. Gemeinsam werden wir an die Grenze zur Türkei fahren und dort gemeinsam ausreisen. Morgen Nachmittag, etwa gegen 16 Uhr. Nicht früher, nicht später.
Denn morgen ist Endspiel. Um 16 Uhr wird es in vollem Gange sein.
Sonntag, 7. Juli 1974. Das Datum ist ideal, da sind wir uns sicher. Morgen ist in München Endspiel, Finale der Fußball-Weltmeisterschaft: Deutschland-Holland. Die ganze Welt wird zuschauen oder zuhören, auch bulgarische Grenzbeamte. Sie werden abgelenkt sein und sie werden mit den jungen deutschen Reisenden fiebern, die um diese Zeit an ihre Grenze kommen. Sie werden sie an ihrem Wissen teilhaben lassen wollen und die Spannung des Sports wird die Spannung der Flucht überlagern. Fußball schafft eine Gemeinschaft des Augenblicks, die alle denkbaren Gegensätze verschwinden lässt.
Alles ist bedacht, alles. Das Risiko so gering und die Chance so groß wie möglich zu halten, das war der wichtigste Grundsatz aller Überlegungen gewesen, die wir in der zurückliegenden Zeit angestellt hatten. Neun Monate Vorbereitung liegen hinter uns und nur noch diese beiden Grenzübertritte vor uns: von Jugoslawien nach Bulgarien im Westen hinein, dann durch Bulgarien hindurch und im Osten wieder hinaus, in die Türkei. Danach ist alles egal. Denn ganz im Osten, jenseits der bulgarischen Grenze, sind wir wieder im »Westen« – ausgereist aus dem sozialistischen Bulgarien in den NATO-Mitgliedstaat Türkei. So paradox ist die zweigeteilte Welt.
Die Grenze rückt immer näher. Unausweichlich und quälend langsam.
Und wenn wir erwischt werden? »Beihilfe zur Republikflucht«, »staatsfeindlicher Menschenhandel«, so lauten die einschlägigen Delikte im DDR-Jargon. Bulgarisches Gefängnis oder Auslieferung an die DDR? Welches Strafmaß? Es gibt Dinge, die kann man niemanden fragen, die kann man nur auf sich zukommen lassen. Zu neun Jahren Haft hat das DDR-Bezirksgericht Schwerin den West-Berliner Peter Strauch wegen Fluchthilfe verurteilt, melden die Wochenendausgaben der westdeutschen Tageszeitungen an jenem 6. Juli 1974 – ein besonders hohes Strafmaß im Vergleich zu den drei, vier Jahren, die sonst oft verhängt werden. Die Zeitungen sind in jenen Monaten voll von Berichten über gescheiterte Fluchtversuche und verurteilte Fluchthelfer. Mit einer Welle von Prozessen und harten Urteilen stemmt die DDR-Regierung sich gegen immer neue Versuche ihrer Bürger, das Land zu verlassen.
Wenn man uns erwischt, wird man auch die drei Freunde verhaften, die sich vollständig in unsere Hand begeben haben, die uns blind vertrauen und deren Zukunft vom Gelingen unserer Planung abhängt. Man wird sie ausliefern, aburteilen und einsperren. Und wenn sie Glück haben, werden sie eines Tages freigekauft – denn den wahren Menschenhandel betreibt die DDR-Regierung: Gegen hohe Zahlungen in harter Währung lässt sie inhaftierte politische Häftlinge frei. 33 000 ihrer Bürger verkauft die DDR-Führung bis 1989 an die Bundesrepublik, 3,4 Milliarden DM verdient sie daran.
Also zumindest die Perspektive eines Freikaufs. Doch um welchen Preis?
Ruhig bleiben, nur ruhig bleiben. Unser Wagen rollt in die Grenzanlage. Die jugoslawische Seite zeigt bei der Ausreise kein großes Interesse an uns, die bulgarische bei der Einreise umso mehr. Schlagbäume, Schilder, Wachtposten. Abläufe und Prozeduren, so unausweichlich wie unverständlich, hinter uns und vor uns Sperranlagen. Eine perfekte Falle. »Willkommen in der Volksrepublik Bulgarien!« ruft es uns von großen Tafeln mehrsprachig entgegen; glückliche Arbeiter und Bauern winken uns strahlend von altersgrauen Propagandaplakaten zu, gestaltet im immer gleichen Ostblockstil des sozialistischen Realismus.
Der Grenzbeamte beugt sich in das geöffnete Autofenster, ein ausdrucksloses Gesicht, ein gemurmelter Gruß, die Pässe bitte. Sieht er nicht, dass mir das Herz bis zum Hals schlägt? Die Pässe werden in ein Schalterfenster hineingereicht, verschwinden hinter einem Tresen. Was passiert da? Listen? Suchmeldungen? Quatsch. Niemand kann wissen, was wir vorhaben. Die üblichen Fragen. Wohin. Warum. Routine. Noch ein Blick durch den Wagen. Routine. Die Pässe kommen zurück, der Grenzsoldat winkt den Wagen weiter. Durchschnittsreisende, unauffällig, kein Grund zur Stichprobe.
Ruhig bleiben, nur ruhig bleiben, noch ist die Einreise nicht abgeschlossen. Anhalten, vorgeschriebener Geldwechsel von DM in bulgarische Lewa – eine »Mindestumtausch« genannte Zwangsmaßnahme –, Benzingutscheine kaufen. Weiterfahrt. Die Grenzstation liegt hinter uns. Noch eine Kurve, außer Sichtweite kommen.
Ein Schrei, Erleichterung, Fäuste trommeln auf das Armaturenbrett, als sei die Weltmeisterschaft gewonnen. Spannung entlädt sich im Triumphgeheul. »Wir haben es geschafft!«
Wir halten an, fallen uns in die Arme. Wann haben wir das zuletzt getan – uns umarmt? Diese wiedergewonnene Nähe wird uns bleiben.
Beiläufig blättere ich in meinem Pass, sehe das Transitvisum, das eben eingestempelt wurde – und weiß im selben Moment: Es war alles umsonst.
Alles umsonst. Schluss, aus, die ganze schöne Planung und schlaue Überlegung umsonst. Alles aus.
»Die Schweine haben die Farbe geändert«, brülle ich in ohnmächtigem Zorn. »Guck Dir das an!« Fassungslos blicken wir in unsere Pässe: zwei bulgarische Einreisestempel, im vertrauten Format und Aufbau, mit Datum von heute. Aber: Die linke Hälfte grün, die rechte rot. Und noch vor 14 Tagen, bei der letzten Kontrollfahrt, war es so gewesen, wie seit Monaten: die obere Hälfte blau, die untere lila. Wie in den drei Pässen, die zwischen den Straßenkarten stecken – und die jetzt nichts mehr wert sind. Alles andere stimmt: die Seite und die richtige Stelle im Pass, der Stempelaufbau und das Datum von heute. Alles stimmt, alles – außer der Farbe. Aus, vorbei.
2
Thomas
8. Oktober 1973. Neun Monate zuvor … Dreieinhalb Monate war ich nach dem Abitur durch Nordamerika gereist: Besuch bei den Großeltern und vielen Verwandten im Westen Kanadas, mit dem Bus quer durch die USA und Nordmexiko. Jetzt war es schön, wieder zu Hause zu sein, auf dem Nepperberg, von wo aus der Blick über Schwäbisch Gmünd geht, viele Kilometer weit bis zu den ersten Erhebungen der Schwäbischen Alb.
In meinem Zimmer ein Stapel Post, 40, 50 Briefe. Nach dem Abitur war an die Stelle des intensiven Zusammenlebens im Internat der Briefkontakt getreten. Erste Berichte von Freundinnen und Freunden aus dem Neuland beginnender Selbstständigkeit, Antworten auf meine Briefe von der langen Reise.
Viele vertraute Handschriften … Aber wer war Margret Schaller? Der Brief aus einer kleinen Stadt im Rheinland kam zuunterst. Erst später öffnete ich ihn.
Ich bin eine Freundin von Thomas’ Mutter … Seit ihrer Verheiratung verlebte ich schon mehrmals meinen Urlaub in Bad Blankenburg und bin mit den dortigen Verhältnissen bestens vertraut.
Thomas trägt sich schon seit vorigem Jahr mit Fluchtgedanken. Die bevorstehende Zeit bei der Armee nach dem Abitur bestärkt ihn noch in seinem Vorhaben … Er ist ratlos und weiß nicht, was er tun soll. So setzt er alle seine Hoffnungen auf unsere Hilfe …
Thomas … Zwei Jahre zuvor, im Sommer 1971, hatten wir uns kennen gelernt. Ich war 17 und verbrachte zwei Ferienwochen bei den Verwandten in Thüringen, in Bad Blankenburg. Das war ganz selbstverständlich: Vor mir waren meine älteren Geschwister dort gewesen, Heidi und Burkhard, und natürlich immer wieder die Eltern. Zu Weihnachten wurden aus dem Westen die Zutaten für den Weihnachtsstollen geschickt und Schönes und Nützliches, was es in der DDR nicht oder nur selten oder nicht in dieser Qualität zu kaufen gab, jeweils in den erlaubten Mengen. Meist kamen die Pakete an, oft waren sie durchsucht, manchmal zerwühlt. Zerrissenes Geschenkpapier, zerzauste Wollknäuel, Fingerspuren in der Niveacreme.
Das Reisen vom Osten in den Westen war so gut wie unmöglich – allein Rentner ließ man ziehen, sie kosteten schließlich nur Geld –, und vom Westen in den Osten war es schwierig. Doch hatte man in der DDR Verwandte, durften diese einen einmal jährlich bis zu vier Wochen einladen. Und immer wieder äußerten die Verwandten den Wunsch, besucht zu werden: »Rüdiger wird doch jetzt 16. Mag er nicht nächsten Sommer zu uns kommen?«
Zwei Wochen Thüringen statt zwei Wochen Adria oder Südfrankreich – ein Opfergang aus verwandtschaftlicher Anhänglichkeit, auf Drängen der Familie? Gewiss, der Anstoß zu unseren Reisen kam von meinem Vater, der aus Dresden stammte, und von den Familien seiner Vettern. Doch ich fuhr gerne »in die Zone«. Ich wollte nicht nur die Verwandten kennenlernen – andere Vettern oder Cousinen gleichen Alters hatte ich nicht –, ich war auch neugierig, die DDR zu erleben. Sie war so nah und doch so fern, so viel Erstaunliches und Befremdliches wurde von dort berichtet. Die deutsch-deutschen Beziehungen, das war ein Thema, das in der politischen Debatte ständig eine Rolle spielte. Und da es viele persönliche Bezüge und Beziehungen gab, hatte es mich früh interessiert. Der Regierungswechsel von 1969, hin zur sozialliberalen Koalition, hatte der Diskussion um »die Zukunft der deutschen Frage« eine neue Richtung gegeben. »Ostpolitik«, »Wandel durch Annäherung«, »Entspannung«, das waren nicht nur Themen in den Medien oder im Bundestag, sondern auch im Gemeinschaftskundeunterricht oder in der »PAS«, der »Politischen Arbeitsgemeinschaft Schulen«, die es auch bei uns im Internat gab.
So hatte ich nun also alles, was erforderlich war, beieinander: eine Einladung, eine Einreisegenehmigung, eine Besuchserlaubnis. Beim Friseur auf dem Nürnberger Bahnhof fielen die langen Haare – sah man seinem Passbild nicht ähnlich, konnte es Schwierigkeiten geben. Lange Haare waren Anfang der siebziger Jahre ein Muss unter Jugendlichen im Westen, wer sie zu kurz trug, grenzte sich aus. Und mit der Haartracht ließ sich bei manchem in der älteren Generation eine Empörung auslösen, die guttat. Auch ich hatte mir die Haare wachsen lassen, bis es zu einem Mittelscheitel mit Stirnband reichte. Meine Mutter fand, es sehe nicht schön aus (womit sie angesichts meiner Lockenpracht recht hatte), nahm es aber hin; mein Vater meinte, es sei eine gute Idee, das mal auszuprobieren. Das nahm der Sache bereits ein Stück weit ihren Reiz, jedenfalls fiel es mir nicht schwer, mich im Hochsommer von der wärmenden Kopfbedeckung bis auf eine Länge zu trennen, die sowohl für die DDR-Grenzbeamten als auch für mich akzeptabel war.
An der innerdeutschen Grenze durfte ich einem DDR-Kontrolleur »Die Zeit« abtreten – »die lassen wir mal lieber hier«. Die Mitnahme jeglicher Druckerzeugnisse in die DDR, die auch nur entfernt an freie Meinungsäußerung erinnerten, war streng untersagt. Man durfte Zeitungen nicht einmal als Verpackungsmaterial verwenden. »Für die äußere und innere Verpackung sollte wegen des in der DDR bestehenden Verbots der ›Einfuhr von Druckerzeugnissen, die nicht in der Zeitungsliste der DDR enthalten sind‹, nur unbedrucktes Papier verwendet werden. (Pack- und Geschenkpapier mit Farb- und Schmuckmustern wird nicht beanstandet.)« So war es dem mehrseitigen Faltblatt: »Hinweise für Geschenksendungen in die DDR und nach Berlin (Ost)« zu entnehmen, das die Bundesregierung zur Verfügung stellte.
Ich war erstaunt, wie bald ich im thüringischen Saalfeld war, wo ich umstieg. Erster Eindruck: keine Reklametafeln im Bahnhof. Stattdessen kleine, fast verschämte Schilder, die im Graphik-Stil der Vorkriegszeit über die Sparkasse oder »modische« Schuhe informierten. Wie unbeholfen waren die Sprüche, wie blass, ja fast schmuddelig die Farben der Plakate im Vergleich zu den grellen Botschaften im Westen, die in jener Zeit von Flower-Power und Pop-Art beeinflusst waren. Wozu auch werben in einer Wirtschaft, die keinen Wettbewerb der Produkte kannte?
Überhaupt die Farben: alles wirkte wie unter einem Grauschleier: der Putz der Häuser, das schale Ocker oder Blassblau der Trabbis, die Verpackungen der Waren in den Geschäften. Selbst die Menschen wirkten grau. Ganz ungewohnt: die riesigen Tafeln der politischen Propaganda. Das war mir so neu, so unbekannt, in seiner Sprache so fremd, dass ich es gleich im Foto festhielt: »Der VIII. Parteitag der SED ist ein weiterer Meilenstein beim Aufbau des Sozialismus in der DDR« – alle verfügbare Farbe schien im leuchtenden Rot der Parolen konzentriert.
Vor der Reise in die DDR fielen meine langen Haare
Thomas 1971
Thomas, mein ein Jahr jüngerer Vetter, lag im Krankenhaus, als ich in Bad Blankenburg ankam – Blinddarm. Seine Mutter erklärte mir den Weg und ich lief durch den kleinen Ort, in der Hand das mitgebrachte Obst. Ungewohntes Erlebnis: Ständig wurde ich angesprochen, weil ich etwas Besonderes bei mir trug. »Wo gibt’s’n die Banaan’n?!?!« Im Schwimmbad dann später das Gleiche: »Wo hast’n die Stiefel her und die Nietenhosen? Ach sooo – Du bist aus’m Westen …!«
Thomas’ Eltern waren nach dem Kriegsende in Thüringen geblieben. Sein Vater, Onkel Wilhelm, konnte und wollte seine Mutter weder allein lassen noch verpflanzen, und in Bad Blankenburg hatte er ein schönes Haus mit großem Garten geerbt, das er nicht ohne Weiteres aufgeben wollte. Die Familie hatte es dann auch behalten dürfen – doch wie sah es inzwischen aus! Die Sanitäreinrichtungen stammten aus der Vorkriegszeit, die Holzbalkone des im Schweizer Stil erbauten Hauses vermittelten den Eindruck, sie würden jeden Moment einstürzen. Dabei bemühte die Familie sich nach Kräften, das Haus zu erhalten. Doch in der DDR, in der die Versorgung mit Dingen des alltäglichen Bedarfs sowieso schwierig war und in der es mit Ersatzteilen an allen Ecken und Enden haperte, war ein Hausbesitzer besonders schlecht gestellt. Die Zeitungen waren voll von Tauschanzeigen – dies Ventil wurde geduldet, solange nichts zu deutlich ausgesprochen wurde. Auffällig: Immer wieder wurden »blaue Fliesen« angeboten, im Tausch für »Wartburg«-Reifen, Kaninchenställe, Wasserhähne – westdeutsche 100‑DM-Scheine.
Thomas’ Familie besaß keine »blauen Fliesen«, wie es ihr überhaupt nicht sehr gut ging. Die alte Mutter war zu versorgen; und die Tante, die auch im Haus lebte, bestritt ihren Lebensunterhalt im Wesentlichen mit dem Verkauf von Obst und Gemüse, das sie in ihrem Garten anbaute, und von den Kaninchen, die sie hielt. Jeden Pfennig musste sie umdrehen. Wenig half es ihr da, dass sie jede ihrer Pflanzen mit dem lateinischen Namen benennen konnte – Spuren einer klassischen Bildung der Vorkriegszeit.
Es war ein sehr schöner Urlaub – ganz anders als sonst. Einfach, aber herzlich und persönlich. Die langen Gespräche mit Onkel Wilhelm, Thomas’ Vater: ein feiner, kluger und gebildeter Mann, geradeheraus. Und voller Trauer, weil alles so war, wie es nun mal war: auf der falschen Seite der Grenze, in der »Zone«. Als Hausbesitzer und Nachfahre einer »Junker-Familie«, der seine Kinder taufen und konfirmieren ließ, der über seine Kriegserlebnisse sprach, als hätten sie sich gestern erst zugetragen. Gelernt hatte er Landwirtschaft. 1950 war er aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt und hatte sich gemeldet, um Arbeit zu bekommen. »Freiherr von Fritsch? Landwirtschaft?? Nee, nee, daraus wird nichts.« So wurde er Heizer in der Sporthalle. Und auch dort wurde ihm gelegentlich, eher beiläufig bedeutet: »Sei froh, dass Du die Arbeit hier hast, Willi!« Nicht, dass die Familie sich sehr viel mehr schikaniert gefühlt hätte als andere, die nicht ins sozialistische Raster passten. Aber es war gut, seine Grenzen zu kennen. »Du darfst Deine Bäume nicht in den Himmel wachsen lassen«, pflegte Onkel Wilhelm zu sagen. Adel an sich war kein Stigma, ja zum Teil waren auf eine überkommene Art Erwartungen damit verbunden. Thomas merkte das später in der Schule, wenn die Klassenkameraden hofften, er würde vielleicht eher als andere Paroli bieten.
Gewiss, Wilhelm Fritsch hätte mehr erreichen, weiter kommen können – aber er wollte sich nicht anpassen. So erzog er auch seine Kinder. Konfirmation: auf jeden Fall! Jugendweihe? Nein. Thomas drängte ihn. Alle anderen dürfen! So ein schönes Fest! Schließlich gab der Vater nach. Zur SED-Jugend gehen, »Junger Pionier« werden? Nein. Während die Klassenkameraden ihr rotes Halstuch umbanden und spannende Ausflüge unternahmen, musste Thomas den Schultag in der Parallelklasse verbringen. Doch auch hier ließ der Vater sich eines Tages, wenn auch spät, erweichen. Eisern blieb er nur, als der Druck auf Thomas zunahm, Mitglied der »DSF« zu werden, der »Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft«. Da war jeder drin, sozusagen als gesellschaftliches Minimalengagement. Schließlich kamen sogar die Lehrer ins Haus. Aber nur einmal. Zu gern nutzte Wilhelm Fritsch die Gelegenheit, ihnen aus seiner Zeit in sowjetischer Gefangenschaft zu erzählen. »Die Russen sind prima Leute, wissen Sie, aber …«