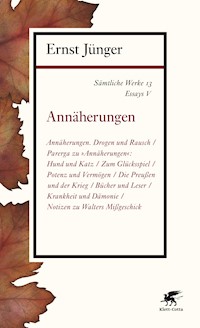
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Die Pflanze als autonome Macht«, »Bier und Wein«, »Opium«: in seinen »Annäherungen« versucht Jünger auch in Selbstversuchen, den Licht- und Schattenseiten der Drogen auf die Spur zu kommen. Der vorliegende Band entspricht Band 11 der gebundenen Ausgabe. Bekanntlich schrieb Jünger aus Erfahrung; die »Annäherungen« an Grenzen der Vorstellung und des Verstandes, die nicht überschritten werden können, sind daher gleichzeitig auch ein Teil der Autobiographie Jüngers. So unternahm er gemeinsam mit dem Chemiker Albert Hofmann LSD-Fahrten – während sich zugleich in den 315 Dosen, die Jünger seinen Lesern verabreicht, Passagen über Thomas de Quincey, Maupassant, oder Baudelaire finden. Zwischen Rauschtagebuch und Traktat – eine (Wieder-)Entdeckung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
ERNST JÜNGER – SÄMTLICHE WERKE
Tagebücher I-VIII
Band 1 Der Erste Weltkrieg
Band 2 Strahlungen I
Band 3 Strahlungen II
Band 4 Strahlungen III
Band 5 Strahlungen IV
Band 6 Strahlungen V
Band 7 Strahlungen VI, VII
Band 8 Reisetagebücher
Essays I-IX
Band 9 Betrachtungen zur Zeit
Band 10 Der Arbeiter
Band 11 Das Abenteuerliche Herz
Band 12 Subtile Jagden
Band 13 Annäherungen
Band 14 Fassungen I
Band 15 Fassungen II
Band 16 Fassungen III
Band 17 Ad hoc
Erzählende Schriften I-IV
Band 18 Erzählungen
Band 19 Heliopolis
Band 20 Eumeswil
Band 21 Die Zwille
Supplement
Band 22 Verstreutes – Aus dem Nachlaß
Ernst Jünger
Sämtliche Werke 13
Essays V
Annäherungen
Klett-Cotta
Die 22 Bände der Sämtlichen Werke, die zwischen 1978 und 2003 bei Klett-Cotta erschienen sind (1–18: 1978–1983; Supplemente 19–22: 1999–2003), enthalten Ernst Jüngers Fassung letzter Hand. Ihr folgt diese Taschenbuchausgabe in Seiten- wie Zeilenumbruch. Offensichtliche Fehler wurden korrigiert, die posthum erschienenen Supplementbände integriert. Der vorliegende Band entspricht Band 11 der gebundenen Ausgabe.
Impressum
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2015 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Reihengestaltung Ingo Offermanns, Hamburg, unter
Verwendung von Illustrationen von Niklas Sagebiel, Berlin
Gesetzt von pagina, Tübingen
Datenkonvertierung: Lumina Datamatics GmbH
Printausgabe: ISBN 978-3-608-96313-7
E-Book: ISBN 978-3-608-10913-9
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
ANNÄHERUNGEN
INHALT
Annäherungen · Drogen und Rausch
Eingang
Schädel und Riffe
Drogen und Rausch
Die Pflanze als autonome Macht
Der Rausch: Heimat und Wanderung
Leitbahnen – Todesbegehungen
Licht über der Mauer
Europa
Dosierungen
Frühe Einstiege
Bier und Wein I
Bücher und Städte
Das große Babylon
Versengte Flügel
Bier und Wein II
Zum Grobianismus
Auf Maupassants Spuren
Betäubungen
Weiße Nächte
Der Orient
Opium
Adnoten zum Opium
Polnischer Karpfen
Fügen und Richten
Zum Haschisch
Übergänge
Figaros Hochzeit
Der Fall Wagner
Optische Modelle
Der surrealistische Vorstoß
Mexiko
Große Pupillen
Surrogate
Chinesische Gärten
Psychonauten
Rückblick auf Godenholm
Ein Pilz-Symposion
Nochmals LSD
Peyotl
Raffinierte Materie
Skepsis nach Bedarf
Parerga zu »Annäherungen«
Hund und Katz
Zum Glücksspiel
Potenz und Vermögen/Umsatz und Kapital
Die Preußen und der Krieg
Bücher und Leser
Krankheit und Dämonie/Notizen zu Walters Mißgeschick
ANNÄHERUNGEN
DROGEN UND RAUSCH
ERSTAUSGABE 1970
EINGANG
SCHÄDEL UND RIFFE
1
»Messer Ludovico, was treibt Ihr für Narrheiten?« So ungefähr fragte der Kardinal Hippolyt von Este, nachdem er dessen »Orlando Furioso« gelesen hatte, seinen Schützling Ariost.
Dieser »Rasende Roland« gehörte neben Byrons Gedichten früh zu meinen Lieblingswerken; ich lernte ihn als Vierzehn- oder Fünfzehnjähriger kennen, und zwar in dem imposanten, von Doré illustrierten Folioband. Die Übersetzung stammte von Hermann Kurz. Weniger behagte mir späterhin die von Gries, die ich in einer Reclamausgabe mitführte. Ich las sie im Frühjahr 1917 in der Siegfried-Stellung und brachte die beiden Bändchen auch wieder heim. Es scheint mir, daß ich in den Kriegen mehr gelesen habe als zu anderen Zeiten; und das geht manchem so.
Die Lektüre des Ariost ist gefährlich; das wußte Cervantes schon. Überhaupt setzt die literarische Bildung Maßstäbe, die in der Realität nicht ausgefüllt werden können; das Spielfeld wird zu weit gesteckt.
Die skeptische Frage des Hippolyt von Este ist nicht nur eine Kardinals-, sondern auch eine Kardinalfrage. Sie hat mich oft beschäftigt, auch während der Arbeit an diesem Text. Man fragt sich immer wieder, warum man dies oder jenes treibt oder getrieben hat – und was man darauf zu hören bekommen wird. Und man fragt sich nach der Verantwortung.
2
Kaum zu befürchten ist, daß, wie man früher sagte, die »Schweine Epikurs« in die Mohn- und Hanfgärten einbrächen. Der Epikuräer neigt nicht zur Übertreibung – sie würde den Genuß beeinträchtigen. Er genießt die Zeit und die Dinge und ist daher eher die Gegenfigur des Süchtigen, der unter der Zeit leidet. Den Typus des Kettenrauchers wird man bei ihm nicht finden – eher den des Gourmets, der ein gutes Mahl mit einer Importe beschließt. Er hat den Genuß in der Hand und weiß ihn zu zügeln – weniger aus Gründen der Disziplin als des Genusses selbst.
Es hat alte Chinesen gegeben, die sich auf ähnliche Weise hin und wieder eine Pfeife Opium gestatteten – und es gibt sie vielleicht noch. Das ist dann, als ob man nach einem Mahl von vielen Gängen nicht nur auf die Terrasse und in den Park hinausträte, sondern darüber hinaus die Gehege der Zeit und des Raumes und damit des Möglichen ein wenig erweiterte. Das gibt mehr als Essen und Trinken, mehr auch als der Wein und die gute Zigarre; es führt weiter hinaus.
In dieser Hinsicht sollte es von einem gewissen, etwa vom pensionsfähigen Alter ab keine Beschränkungen mehr geben – denn für den, der sich dem Grenzenlosen nähert, müssen die Grenzen weit gesteckt werden. Nicht jeder kann hier wie der alte Faust noch bauen, doch im Unvermessenen zu planen, steht jedem frei.
Das gilt insonderheit für jene Spanne, in der die ultima linea rerum dichter heranrückt und bestimmter wird. Es gibt alte Winzer, die dann Monate und Jahre nur noch von Brot und Wein leben. Konrad Weiss hat ihrer gedacht.
Dem Leidenden, dessen Uhr schnell abläuft, den Schmerz zu lindern, ist selbstverständlich, doch nicht genug. Wir sollten an sein einsames Lager noch einmal die Fülle der Welt heranführen.
In der Todesstunde sind nicht Narcotica, sondern eher Gaben, die das Bewußtsein erweitern und schärfen, angebracht. Hat man auch nur im mindesten den Verdacht, daß es weitergehen könnte, und dafür sprechen Gründe, so sollte man wachsam sein. Dem folgt notwendig die Vermutung, daß es Qualitäten des Überganges gibt.
Auch unabhängig davon legt mancher Wert auf sein individuelles Sterben, um das er sich nicht betrügen lassen will. Für den Kapitän ist es Ehrensache, als letzter von Bord zu gehen.
Und endlich ist zu bedenken: nicht nur der Schmerz des Todes könnte fortgenommen werden, sondern auch seine Euphorie. Vielleicht sind in den letzten, verklingenden Akkorden noch wichtige Botschaften – Empfänge, Sendungen. Totenmasken zeigen einen Abglanz davon.
Ein buntes Gefieder hat der Hahn des Asklep.
3
Getrennt vom Genuß ist das geistige Abenteuer zu betrachten, dessen Lockungen sich gerade dem höher und feiner ausgebildeten Bewußtsein aufdrängen. Im Grunde ist jeder Genuß geistig; dort ruht die unerschöpfliche Quelle, die als Begierde aufsteigt, der keine Befriedigung genügt. »Und im Genuß verschmacht ich nach Begierde.«
Jede Werbung kennt den Zusammenhang. Wenn im Winter die Kataloge der Gärtnereien kommen, erwecken ihre Bilder ein lebhafteres Vergnügen als im Sommer die Blumen, die auf den Beeten blühen. Auch in der Natur wird auf die Werbung mehr Kunst und List als auf die Erfüllung gelegt. Die Muster eines Falterflügels oder des Paradiesvogel-Gefieders bezeugen es.
Der geistige Hunger ist unstillbar; der physische ist eng begrenzt. Wenn ein römischer Fresser wie Vitellius drei ungeheure Mahlzeiten am Tage verschlang und sich des Überflusses durch Brechmittel entledigte, so hat er unter dem Mißverhältnis zwischen Augen und Mund gelitten, wenngleich auf primitive Art. Das Mißverhältnis hat seine Skala; auch das Auge ruft den Geist zu Hilfe, wenn ihm die sichtbare Welt nicht genügt.
Mehr als Vitellius und seinesgleichen konnte Antonius genießen – dazu befähigte ihn nicht die stärkere Physis oder größerer Reichtum, sondern die überlegene Geistigkeit. In Flauberts »Versuchung« füllen sich imaginäre Tafeln mit Gerichten, die frischer und farbiger sind, als sie die Gärtner und Köche, ja selbst die Maler hervorbringen. Antonius erblickt in seiner Wüstenhöhle den Überfluß an der Quelle – dort, wo er sich unmittelbar in die Erscheinung kristallisiert. Daher ist der Asket reicher als der im Genuß verschmachtende Cäsar, der Herr der sichtbaren Welt.
4
Den Typus des geistigen Abenteurers habe ich in der Figur des Antonio Peri zu zeichnen versucht:
»Antonio unterschied sich auf den ersten Blick kaum von den Handwerkern, die man überall in Heliopolis ihre Geschäfte treiben sieht. Und doch verbarg sich unter dieser Oberfläche noch etwas anderes – er war ein Traumfänger. Er fing Träume, so wie man andere mit Netzen nach Schmetterlingen jagen sieht. Er fuhr an Sonn- und Feiertagen nicht auf die Inseln und suchte nicht die Schenken am Pagosrande auf. Er schloß sich in sein Kabinett zum Ausflug in die Traumregionen ein. Er sagte, alle Länder und unbekannten Inseln seien dort in die Tapete eingewebt. Die Drogen dienten ihm als Schlüssel zum Eintritt in die Kammern und Höhlen dieser Welt.
Er trank auch Wein, doch war es nie der Genuß, der ihn dazu veranlaßte. Ihn trieb im wesentlichen eine Mischung von Abenteuer- und Erkenntnisdurst. Er reiste nicht, um sich im Unbekannten anzusiedeln, sondern als Geograph. Der Wein war ihm ein Schlüssel unter vielen, eines der Tore zum Labyrinth.
Vielleicht war es nur die Methodik, die ihn an Katastrophen und Delirien vorbeiführte. Sie hatten ihn oft gestreift. Er war der Meinung, daß jede Droge eine Formel enthält, die Zugang zu gewissen Welträtseln gewährt. Er glaubte ferner, daß eine Rangordnung der Formeln zu ermitteln sei. Die höchsten müßten gleich dem Stein der Weisen das Universalgeheimnis aufschließen.
Er suchte den Hauptschlüssel. Muß aber nicht das stärkste Arkanum notwendig tödlich sein?«
Daß die rastlose Suche nach dem Abenteuer, dem Fernen und dem Fremden, etwas anderes meinte, wird erst beim letzten Gange offenbar. Antonio gerät in ein Strahlengitter, wird tödlich verwundet, schwer verbrannt. In diesen Qualen lehnt er das Morphium ab. Es war nicht der Genuß, auch nicht das Abenteuer, was ihn zu seinen Ausflügen bewog. Neugier gewiß, doch Neugier, die sich sublimierte, bis er endlich vor der rechten Pforte stand. Vor ihr bedarf es keines Schlüssels; sie öffnet sich von selbst.
5
Jeder Genuß lebt durch den Geist. Und jedes Abenteuer durch die Nähe des Todes, den es umkreist.
Ich entsinne mich eines Bildes, das ich gesehen habe, als ich kaum lesen gelernt hatte, und das »Der Abenteurer« hieß: ein Seefahrer, ein einsamer Konquistador, der den Fuß auf den Strand einer unbekannten Insel setzt. Vor ihm ein Furcht erweckendes Gebirge, sein Schiff im Hintergrund. Er ist allein.
So etwa wird es gewesen sein. Der »Abenteurer« war damals eins der berühmten Bilder, die man in den Ausstellungen von Bewunderern umlagert sieht. Ein Musterstück der literarischen Malkunst, die kulminierte in der »Toteninsel« von Böcklin (1882).
Der Geschmack an diesem Genre ist abhanden gekommen; das Bild wird heute irgendwo verstauben, falls es sich überhaupt erhalten hat. Sein Charakter war symbolisch: das Schiff, das der Mensch verlassen hat, der Strand, auf den er den Fuß setzt, das Furcht und Erwartung einflößende Kolorit. Böcklin war tiefer, und bereits Munch hätte die Aufgabe anders angefaßt. Heute würde sie wieder anders gelöst werden. Wir besitzen bereits einige große Werke, in denen die Nähe des Todes nicht etwa geschildert wird, sondern die sie durchtränkt.
Von jenem »Abenteurer« haben sich mir nur Einzelheiten schärfer in der Erinnerung erhalten: der Strand war mit Knochen besät, mit Schädeln und Gebeinen der beim gleichen Wagnis Gescheiterten. Das begriff ich und zog auch den Schluß, den der Maler beabsichtigt hatte: daß da hinaufzusteigen zwar lockend, doch gefährlich sei. Das sind die Knochen der Vorgänger, der Väter und endlich auch die eigenen. Der Strand der Zeit ist von ihnen bedeckt. Wenn ihre Wellen uns an ihn herantragen, wenn wir landen, schreiten wir über sie hinweg. Das Abenteuer ist ein Konzentrat des Lebens; wir atmen schneller, der Tod rückt näher heran.
6
Der Totenkopf mit den gekreuzten Knochen war lange ein gültiges Symbol, nicht nur in Grüften und auf Totenäckern, sondern auch in der Kunst. Besonders im Barock war er, zusammen mit der Sanduhr und der Sense, ein beliebtes Motiv. Heut würde es primitiv sein, ihn in diesem Sinne zu verwenden; sein Rang ist eher der eines Verkehrszeichens. Schon als der Maler des »Abenteurers« ihn ins Bild brachte, unterlag er der Versuchung einer literarischen Anspielung.
Wir fragen uns: wie ist es möglich, daß ein Objekt wie hier der Totenkopf einmal als Motiv der hohen Kunst verwendet wird und als solches uns auch heute noch einleuchtet, während dasselbe Objekt, von Zeitgenossen dargeboten, uns nicht mehr befriedigt, ja vielleicht sogar komische Züge gewinnt?
Dazu ist zu bemerken, daß jeder Gegenstand symbolische Kraft gewinnen und auch verlieren kann. Seine Rolle ist die des Korns, über welches das Auge sein Ziel visiert. Ist gut gerichtet, so wird der Glanz des Zieles sich dem Korn mitteilen. Und dieser Glanz erhält sich wie in den alten Bildern, er »leuchtet lange noch zurück«. Nicht nur die Schönheit des Gemeinten hat sich übertragen, sondern auch ein Schimmer der Unvergänglichkeit. Aphrodite war nicht nur gemeint in der Geliebten – sie wurde in der Umarmung auch durch sie vertreten und namenlos gemacht.
Der Totenkopf des alten Meisters erschreckt uns heute noch. Durch ihn hindurch, durch seine Augenhöhlen war der Tod gesehen – das hat sich den Atomen mitgeteilt.
Der Totenkopf des »Abenteurers« dagegen ist reines Requisit. Dort das Symbol und hier das Ornament, dort Mythos, hier Allegorie. Annäherung dort, Entfernung hier.
Dabei ist zu beachten, daß der Zeitgenosse, auch rein malerisch gesehen, die Meisterschaft des Alten nicht erreicht, mag er artistisch auch auf der Höhe sein. Rasch schwindet das Behagen, das Einverständnis des Betrachters mit der Leistung, deren Ruhm der Künstler überlebt. Der Arme war, obwohl er es nicht wußte, Falschmünzer. Die Blüte wird im Vertrauen hingenommen, doch früher oder später spricht sich herum: es fehlt der Gegenwert. Der Schein ist ohne Deckung – hier der papierene Anspruch, dort die Goldreserve, hier die Erscheinung, dort die Wirklichkeit.
Die Blüten sind oft täuschend gelungen; nur wenige Kenner durchschauen das sofort. »Durchschauen« heißt in solchen Fällen: erkennen, daß nichts dahinter steckt.
7
Der Versuch, durch einen Schädel Effekt zu machen, wurde spätestens um jene Spanne herum absurd, in der die Röntgenstrahlen aufkamen. Hier wäre vielleicht auszuführen, was mit dem Satz gemeint ist: eine Bemerkung nicht zur physikalischen, sondern zur fundamentalen Optik – zu einer neuen, quasi instinktiven und seiner Genese entsprechenden Art des Menschen, zu sehen. Dazu stellen die Strahlen sich ein als empirische, durch den Gestaltwandel bedingte Konsequenz.
Dieser fundamentale Wechsel, der sich auch in der Physik und ihrem Instrumentarium geltend macht, hat nicht nur ein Höhenniveau, in dem das Atmen schwieriger, sondern auch Tiefenschichten, in denen die Materie dichter und aufschlußreicher wird. Von beidem profitiert die Physik.
Wichtiger ist jedoch, daß sich damit auch das Verhältnis zum Tode ändert und daß diese Änderung nicht nur im Glauben und Denken, sondern auch in der Kunst nach Ausdruck verlangt. Auch das ist einer der Gründe dafür, daß der Totenkopf, wie so viel anderes, als Symbol nicht mehr »glaubwürdig« ist.
Das sind Fragen der Perspektive, nicht der Substanz. »An sich« bleibt die Macht des Schädels ungebrochen, doch visieren wir nicht mehr über ihn. Darüber hinaus ist zu bemerken, daß wir überhaupt an einem Symbolschwund teilnehmen. Nur wenige Mächte werden dem widerstehen – vielleicht die Mutter allein.
Dem muß die Kunst Rechnung tragen, und sie tut es – zunächst ex negativo, doch mit tastenden Fühlhörnern. Entwertung der klassischen Symbole kennzeichnet jeden Stilwechsel. In einem Großen Übergang indessen geht es nicht mehr um vereinzelte Symbole, sondern um die Symbolwelt überhaupt. Hier sei noch einmal erinnert an das, was in der »Zeitmauer« über die »Weißung« gesagt wurde. Sie ist letzthin nicht als nihilistischer Akt zu begreifen, sondern als retour offensif. Das Weiß ist nicht farblos, sondern die Zuflucht der farbigen Welt.
8
Im Rückblick auf unser Beispiel wollen wir uns eine der herrlichen Kalkwände vorstellen, wie sie über der Azurküste oder den grünen Matten des Donautals aufragen. Es können auch die Kreideklippen an der Küste von Rügen oder Korallenriffe im Stillen Ozean sein.
Dort blendet der Tod nicht mehr als isolierter Schädel, sondern in ungeheurer Auftürmung. Dies alles war ausgeformtes Gerüst des Lebens – Schneckenhäuser und Muschelschalen, Diatomeenpanzer, Korallen, die sich in Jahrtausenden aufstockten, bevor sie in höhere Grade der Versteinerung eintraten. In Vorweltmeeren ausgewebte Formen, die der tellurische Druck noch schärfer ausprägt und vernichtet, wenn er ein wenig stärker wird. Dann wieder Auflösung durch Sturz und Brandung bis zu den Molekülen, die von neuem dem Leben zum Raube fallen und in Kreisen, Spiralen, Symmetrien auferstehen.
Ein Spiel um den Kalkspiegel, eins unter vielen nur. Der Steinkohlenwald versinkt in den Flözen, und was er an Sonne eintrank, atmet er aus in den Feuern der technischen Welt. Das wechselt in Äonen – wie in den Augenblicken die Eiskristalle um den Nullpunkt, die, gleichviel ob sie schmelzen oder anschießen, sich spiegelbildlich ähnlich sind.
Dies alles schlummert in den Kalkwänden und wartet auf Belebung durch die Kunst.
9
Ein neues Verhältnis zum Tode bahnt sich an. Das ist wichtiger als alle Großtaten innerhalb der technischen Welt. Ein Großer Übergang.
Nicht nur die Kalkwand, auch die Wüste lebt. Moses hat es gewußt. Es war die zum Stab gewordene Schlange, mit der er das Wasser aus dem Felsen schlug. Auch in unseren Wüsten ist Durst nach diesem Wasser; sie sind von Dürstenden erfüllt. Und dieser Durst wird stärker, wenn der Mensch gesättigt ist.
Bald scheint der Staat, der »tausendschuppige Drache«, noch das einzige Wesen, das die Wüste bewohnt, die er mit seinen Fata Morganen ausstattet. Das höchste Monopol ist das der Träume; das haben die Priester seit jeher gewußt.
10
Es zählt zu den Privilegien der Götter, daß sie in der Bildwelt verharren und nur selten aus ihr in die Erscheinung hinaustreten. Der Abglanz wird farbig dann.
Unsereinem ist das weniger vergönnt. Wir ahnen die Fülle der Bildwelt im farbigen Abglanz und treten selten, wie in den Träumen, aus der Erscheinung in sie ein.
Als Binnenländer lernte ich das Meer erst aus Berichten kennen, und die Wellen erschienen mir mäßig, als ich es zum ersten Male sah. Nur als das Ertrinken drohte, war die Woge riesig, als ob sie bislang, ob hoch oder nieder, Kulisse gewesen wäre und nun das Spiel anfinge. So hat sie Hokusai gemalt. So muß man die Kalkwand sehen.
Als der »Neger«, von dem ich noch berichten werde, die Freundin entjungfert hatte und dann fragte, wie es gewesen sei, sagte sie: »Ich hatte es mir schöner vorgestellt.« Das war ihm verdrießlich, wird aber die Regel sein.
Auch das Verbrechen hat imaginären Reiz. Ein Bankraub, wie er im Roman oder im Film sich abspielt, kann Intelligenzen anziehen, die Sinn für Finessen haben oder auch für kühne Volten, bei denen ein Programm in Sekunden hineinzupressen ist. In praxi kommt Unerwartetes und durchaus Widriges. Nachdem Raskolnikow die alte Wucherin, die seiner Ansicht nach so wenig wert ist wie eine Wanze, erschlagen hat, taucht deren fromme Schwester im Flur auf, der er das gleiche Schicksal bereiten muß.
Es zählt übrigens zu den genialen Zügen des Romans, daß der imaginäre Teil der Tat von der Schuld abgezogen wird. In Anbetracht des Doppelmordes, der dazu noch auf niedere Weise, »mit dem Beil«, begangen wurde, ist das Urteil mild. Den anderen Sträflingen ist das ein Dorn im Auge; sie meinen, daß »der Herr« zu billig davongekommen sei.
11
Auch beim Rausch kann die Enttäuschung nicht ausbleiben. Sie stellt sich ein – nicht gerade im Verhältnis von Schuld und Sühne, sondern im Rahmen einer erweiterten Anrechnung, in den allerdings auch Schuld und Sühne hineinpassen. Rausch und Verbrechen sind benachbart und manchmal schwer zu isolieren, besonders an den Grenzrainen.
Im Rausch, gleichviel ob er betäubend oder erregend wirkt, wird Zeit vorweggenommen, anders verwaltet, ausgeliehen. Sie wird zurückgefordert; der Flut folgt Ebbe, den Farben Blässe, die Welt wird grau, wird langweilig.
Das läßt sich noch in die Physiologie und in die Psychologie einordnen, obwohl bereits hier Katastrophen drohen. Zugleich kann es zu einem prometheischen Licht- und Bildraub kommen, zum Eindringen in das Göttergehege – auch dort ist Zeit, wenngleich die Schritte weiter und mächtiger sind und gewaltige Fußstapfen zurücklassen. Auch dort sind Gefahren; das »einmal lebt ich wie Götter« muß bezahlt werden.
12
Die Zeit ist abgelaufen, ja überschritten, die ich mir für das Thema gesetzt hatte. Es hat sich einem Essay angesponnen, den ich Mircea Eliade zum 60. Geburtstag widmete (»Drogen und Rausch«, »Antaios« 1968). Ein zweiter Teil sollte spezielle Erfahrungen behandeln; er hat sich nach vielen Richtungen hin ausgedehnt. Ich könnte ihn schärfer ins System bringen und denke daran hinsichtlich einiger wiederkehrender Begriffe; für den Leser ist es günstiger, dem Text zu folgen, wie er Blatt um Blatt ansetzte.
Das Thema ließe sich weiter, doch nicht zu Ende führen – das deutet der Titel an. Er steht für jede, insbesondere für die musische Entwicklung und für das Leben überhaupt. Die eigentliche Arbeit war weniger darauf gerichtet, ein Buch zu schreiben, als einen Apparat zu konstruieren, ein Fahrzeug, das man nicht als derselbe verläßt, der eingestiegen ist. Das gilt vor allem für den Autor – Meditationen ad usum proprium, zur eigenen Ausrichtung. Der Leser mag nach Belieben oder auch nach Bedürfnis daran teilnehmen.
DROGEN UND RAUSCH
Qu’elle soit ramassée pour »le bien« ou pour »le mal«, la mandragore est crainte et respectée comme une plante miraculeuse … En elle sont renfermées des forces extraordinaires, qui peuvent multiplier la vie ou donner la mort. En une certaine mesure donc, la mandragore est »l’herbe de la vie et de la mort«.
Mircea Eliade in »Le culte de la mandragore en Roumanie« (»Zalmoxis«, 1938)
13
Der Einfluß der Droge ist ambivalent; sie wirkt sowohl auf die Aktion wie auf die Kontemplation: auf den Willen wie auf die Anschauung. Diese beiden Kräfte, die sich auszuschließen scheinen, werden oft durch dasselbe Mittel hervorgerufen, wie jeder weiß, der einmal eine zechende Gesellschaft beobachtet hat.
Allerdings ist es fraglich, ob man den Wein zu den Drogen im engeren Sinne rechnen darf. Vielleicht wurde seine ursprüngliche Gewalt in Jahrtausenden des Genusses domestiziert. Mächtigeres, aber auch Unheimlicheres erfahren wir aus den Mythen, in denen Dionysos als Festherr mit seinem Gefolge von Satyrn, Silenen, Mänaden und Raubtieren erscheint.
Der Siegeszug des Gottes geschah in umgekehrter Richtung wie der Alexanders: von Indien über den Vorderen Orient nach Europa, und seine Eroberungen sind nachhaltiger. Dionysos gilt, gleich dem Adonis, als Stifter orgiastischer Feste, deren Periodik sich tief in die Geschichtswelt einflicht und mit denen ein üppiger Phallosdienst verbunden war. Dieser bildete nicht den Inhalt der Dionysien, sondern eine der Offenbarungen, die das Mysterium und seine bindende Kraft bestätigten. Demgegenüber konnten, einem alten Autor zufolge, »die Feste der Aphrodite auf Cythere fromme Kinderspiele genannt werden«.
Diese ursprüngliche Kraft des Weines ist geschwunden; wir sehen sie gemildert wiederkehren in den Herbst- und Frühlingsfesten der Weinländer. Nur selten tritt aus der Steigerung von Lebenslust, von Farben, Melodien, grotesken Bildern noch eine Spur der alten Mysterienwelt mit ihrer unheimlich ansteckenden Gewalt hervor. Archaisches taucht dann in den Gesichtern, den Sprüngen und Tänzen auf. Vor allem die Maske gehört dazu, das Symbolon der »verkehrten Welt«.
Wenn wir die Triumphe von Alexander und Dionysos vergleichen, so berühren wir damit auch den Unterschied von historischer und elementarer Macht. Der Erfolg in der Geschichte, etwa die Eroberung Babylons, ist flüchtig und an Namen geknüpft. Der Augenblick kehrt in dieser Form nicht wieder; er bildet ein Glied in der Kette der historischen Zeit. Für Wandlungen innerhalb der Elementarwelt sind dagegen weder Namen noch Daten wichtig, und doch geschehen sie immer wieder, nicht nur unter-, sondern auch innerhalb der historischen Zeit. Sie brechen wie Magma aus der Kruste hervor.
Um beim Wein zu bleiben: Alexander mußte aus Indien weichen, während Dionysos noch heute als namenloser Festherr regiert. Der Wein hat Europa stärker verändert als das Schwert. Immer noch gilt er als Medium kultischer Wandlungen.
Der Austausch von neuen Giften und Räuschen, auch von Lastern, Fiebern und Krankheiten, entbehrt der festen Daten, mit denen sich eine Krönung oder eine Entscheidungsschlacht dem Gedächtnis einprägen. Das bleibt im Dunkel, im Wurzelgeflecht. Wir können die Vorgänge ahnen, doch weder ihren Umfang ermessen noch in ihre Tiefe eindringen.
Als Cortez 1519 in Mexiko landete, fiel das für die Europäer in die historische, für die Azteken in eine magische Weltordnung. Dort ist der Traum noch mächtiger als das wache Bewußtsein, die Ahnung bindet stärker als das Wort. Bei solchen Kontakten webt ein spiegelbildliches Hin und Her, das bald als Raub und bald als Gabe, dann wieder als Schuld und Sühne begriffen wird – etwa im Opfer: hier Montezuma, dort Maximilian, beide Kaiser von Mexiko. Unter der Oberfläche werden Keime, Bilder, Träume gegeben und empfangen in einem Wechsel, der Stämme vernichtet und andere befruchtet, doch dessen Wirken sich der exakten Beschreibung und Datierung entzieht.
14
Die Statistik kann, auch wo sie präzis ist, aus einem Problem nicht mehr als Ziffern herausholen. Das Problem wird in der Tiefe nicht davon berührt; es bleibt im eigentlichen Sinn des Wortes Streitfrage. Das gilt besonders für Gebiete, die an die Psyche angrenzen, wie für jedes Verhalten, auch das der Tiere, und nicht minder für unser Thema: die Drogen und der Rausch.
So hat man, um in diesem Zusammenhang eines der großen Geschenke Amerikas an Europa, den Tabak, zu erwähnen, ziemlich genaue Ziffern hinsichtlich des Verhältnisses gewonnen, das zwischen dem Nikotin und einer Reihe von Krankheiten besteht. Solche Ermittlungen gehören in das Gebiet der Ökonomie; man muß jedoch, um sie anzuerkennen, bereits den Begriff des »Nutzens« akzeptiert haben, unter dem sie getroffen sind.
Der Nutzen ist in diesem Falle hygienischer Natur. Indessen könnte mit dem Rauchen in anderer Hinsicht auch Gewinn verknüpft sein – schon das Wort »Genuß« deutet es an. Man könnte an die Behaglichkeit im Gespräch denken, an die Verkürzung einer langweiligen und an die Verflüchtigung einer trüben Stunde, an eine Assoziation, die eben auf diese Weise gefördert wird – an einen Augenblick des Glücks schlechthin. Jede Konzentration, aber auch jede Entspannung muß bezahlt werden. Ist der Genuß die Ausgabe wert? Hier ruht das Problem, zu dem die Statistik nur Daten liefern kann. Es taucht im Raucher vor jeder Zigarette auf.
Die Statistik bestätigt nur eine seit jeher bekannte Tatsache: daß die Droge gefährlich ist. Wer sich mit ihr einläßt, geht ein Risiko ein, das um so höher wird, je weniger er kalkuliert. In dieser Hinsicht freilich, zum Vergleich von Gewinn und Einsatz, hat die Statistik ihren Wert.
15
Wenn wir den Wein und den Tabak in die Betrachtung einbeziehen, so deshalb, weil es sich empfiehlt, von möglichst bekannten Größen auszugehen. Zum eigentlichen Thema gehören beide nur am Rand. Sie werden um so weniger davon berührt, je schärfer wir den Begriff der Droge abgrenzen. Für Baudelaire öffnet der Wein die Pforte zu den künstlichen Paradiesen neben dem Haschisch und dem Opium. Mit Recht widerstrebt es dem Freund des Weines, ihn als Droge anzusehen. Es ist ihm auch lieber, daß Winzer und Küfer, als daß Chemiker und Fabrikanten sich mit dem Wein beschäftigen. Immer noch sind ihm vom Anbau der Rebe bis zur Auferstehung der Traube aus dem Keller Sorgfalt und Kunst von Gärtnern und Handwerkern gewidmet; immer noch gilt er als Göttergeschenk von wunderbarer, verwandelnder Kraft. Blut der Erde, Blut der Götter zugleich.
Wollte man den Wein als Droge betrachten, so wäre das eine Feststellung unter anderen, wie etwa jene, daß er Alkohol enthält. Näher scheint jener Welt schon der Tabak zu stehen. Das Nikotin gibt eine Ahnung dessen, was in der Sphäre der Alkaloide möglich ist. In den Rauchopfern, die täglich auf dem Planeten gebracht werden, kündet sich die Leichtigkeit, die geistige Befreiung großer Flugträume an. Sie bringt jedoch, mit der Zauberkraft des Opiums verglichen, nur ein schwaches Anheben, eine gelinde Euphorie.
16
Wie viele etymologische Erklärungen, so ist auch die des Wortes »Droge« unbefriedigend. Es ist obskuren Ursprunges. Wie bei »Alkohol« gibt es Ableitungen aus dem Hispano-Arabischen, auch aus dem mittelalterlichen Latein. Die Herkunft vom niederländischen »drog«, trocken, ist wahrscheinlicher. Drogen waren Stoffe, die aus vielen Ländern über die Kräuterböden, die Drogerien, in den Handel gebracht und von Ärzten, Köchen, Parfümerie- und Spezereihändlern verwandt wurden. Von jeher haftete dem Wort ein Beiklang des Geheimnisvollen, der magischen Verrichtung, speziell auch morgenländischer Herkunft an.
In unserem Zusammenhang ist »Droge« ein Stoff, der Rausch erzeugt. Allerdings muß etwas Spezifisches dazukommen, das diese Stoffe unterscheidet von solchen, die als Medizin oder zum reinen Genuß dienen. Dieses Spezifische ist nicht im Stoff, sondern in der Absicht zu suchen, denn sowohl Medizinen wie Genußmittel können auch in diesem engeren Sinn als berauschende Drogen verwandt werden.
Shakespeare spricht einmal im »Sommernachtstraum« vom »gemeinen« Schlaf, den er unterscheidet vom stärkeren, magischen Bann. Der eine bringt Träume, der andere Visionen und Prophezeiungen. Ähnlich zeigt auch der durch die Droge erzeugte Rausch besondere, schwer zu umschreibende Wirkungen. Wer ihn erstrebt, verfolgt besondere Absichten. Und wer das Wort »Droge« in diesem Sinn verwendet, setzt ein Einverständnis des Hörers oder des Lesers voraus, das sich nicht more geometrico definieren läßt. Er betritt mit ihnen ein Grenzgebiet.
17
Aufgüsse und Konzentrate, Abkochungen und Elixiere, Pulver und Pillen, Salben, Pasten und Harze können in diesem spezifischen Sinn als Drogen verwandt werden. Der Stoff kann fest, flüssig, rauch- oder gasförmig sein; er kann gegessen, getrunken, eingerieben, inhaliert, geraucht, geschnupft, gespritzt werden.
Um den Rausch zu erzeugen, bedarf es nicht nur eines bestimmten Stoffes, sondern auch einer gewissen Menge oder Konzentration. Die Dosis kann zu gering oder zu stark sein – im ersten Fall wird sie nicht über die Nüchternheit hinaus-, im zweiten wird sie in die Bewußtlosigkeit hineinführen. Bei der Gewöhnung an eine Droge fällt es bekanntlich immer schwerer, den Mittelweg zu halten – auf der einen Seite wird die Depression, auf der anderen die Dosis bedrohlicher. Der Preis wird immer höher, der für die Lust gefordert wird. Da heißt es umkehren oder zugrunde gehen.
Wenn die Wirkung der Droge nachläßt, kann entweder die Menge oder die Konzentration erhöht werden. Das ist der Fall des Rauchers oder des Trinkers, der zunächst den gewohnten Konsum steigert und dann zu stärkeren Sorten übergeht. Damit deutet sich zugleich an, daß ihm der reine Genuß nicht mehr genügt. Eine dritte Möglichkeit liegt in der Veränderung der Periodik – im Übergang von der täglichen Gewöhnung zum seltenen, festlichen Exzeß.
In diesem dritten Falle wird nicht die Dosis gesteigert, sondern die Empfänglichkeit. Der Raucher, der die Disziplin aufbringt, sich mit einer Morgenzigarette zu begnügen, wird dennoch insofern auf seine Kosten kommen, als er eine Intensität des Genusses erreicht, die ihm trotz einem viel stärkeren Konsum bislang fremd geblieben war. Das trägt allerdings wiederum zur Versuchung bei.
18
Die Sensibilität kann äußerst stark und entsprechend die Dosis gering, ja minimal werden. Wir wissen seit Hahnemann, daß selbst feinste Spuren von Stoffen wirksam werden können, und die moderne Chemie bestätigt es. Immer muß aber dem Rezept auch eine rezeptive Bereitschaft zur Seite stehen. Daher helfen homöopathische Medizinen nicht jedermann; sie setzen ein homöopathisches Verhalten voraus. Dem Feinfühligen genügt eine Andeutung. Das ist ein allgemeines Gesetz, nicht nur im Rahmen der Hygiene, sondern der Lebensführung überhaupt. Andererseits gilt das Sprichwort: »Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil.«
Die Dosis kann also minimal werden. Auch können unter Umständen Stoffe berauschen, die als neutral gelten, wie die Atemluft. Darauf beruht die »Idee des Doktor Ox« von Jules Verne. Unter der Vorspiegelung, eine Gasanstalt bauen zu wollen, verändert der Doktor Ox in einer Kleinstadt durch Zufuhr von reinem Sauerstoff auf rauschhafte Weise die Mentalität der Einwohner. Durch Konzentration wird also ein Stoff »giftig«, den wir mit jedem Atemzug einholen. Paracelsus: »Sola dosis facit venenum.«
Der Doktor Ox hat die Luft destilliert. Das läßt vermuten, daß sie für sensible Naturen an sich berauschend werden kann. So ist es in der Tat. Es wird wohl wenig Menschen geben, denen sich nicht, wenigstens für Augenblicke, das Goethesche »Jugend ist Trunkenheit ohne Wein« verwirklichte. Gewiß ist dazu die unberührte Bereitschaft nötig, die zu den Kennzeichen der Jugend gehört. Immer aber werden auch äußere Faktoren mitwirken, seien es »höhere Potenzen« bekannter oder unbekannter Stoffe, seien es atmosphärische Einflüsse. In den Romanen finden sich Floskeln wie: »Die Luft war wie Wein«. Die »unerklärliche Heiterkeit« steigt aus fast immateriellen Quellen auf.
Doch kann die »gute Stunde« auch Melancholie bringen. Sie hat oft mahnende, warnende Kraft und ist in dieser Eigenschaft nicht minder günstig, denn oft künden sich drohende Gefahren auf solche Weise an. Neben Wahrnehmungen, die ebenso schwer zu erklären wie zu bestreiten sind, gibt es viele, zu deren Begründung die verfeinerte Empfindsamkeit genügt. Alexander von Humboldt beschäftigt sich in seiner »Reise in die Äquinoktialgegenden« ausführlich mit den Erscheinungen, die den Vulkanausbrüchen und Erdbeben vorausgehen, und in diesem Zusammenhang mit der Beunruhigung von Menschen und Tieren, die man ebenso gut als Ahnung wie als Wahrnehmung bezeichnen kann.
19
Immer wieder bis auf den heutigen Tag hat man Stoffe oder psychogene Kräfte gewissermaßen aus der Atmosphäre zu extrahieren versucht. So Mesmer, der, vom Magnetismus ausgehend, ein »Fluidum« zu erkennen glaubte, das dem menschlichen Körper entströme und in bestimmten Gegenständen wie in Akkumulatoren zu speichern sei. Der Mesmerismus hat in der Heilkunst kaum mehr als eine Mode gemacht, wohl aber leben Einflüsse in der Dichtung nach. Er hat vor allem E. Th. A. Hoffmann fasziniert. Schon Mesmers Dissertation hatte Aufsehen erregt. »De planetarum influxu« könnte als Titel auch über einer Betrachtung von Novalis oder einem Beitrag im »Athenäum« stehen.
Weniger bekannt geworden und doch bedeutender als Mesmer ist Carl-Ludwig von Reichenbach, der sich nicht nur als Naturphilosoph, sondern auch als Geologe, Chemiker und Industrieller auszeichnete. Reichenbach wollte im »Od« einen Stoff erkannt haben, dessen Kraft oder Ausstrahlung sich dem Mesmerschen Fluidum vergleichen läßt. Dieses Od, obwohl überall in der Natur vorhanden, wird nur von zart organisierten Wesen wahrgenommen, die Reichenbach die Sensitiven oder bei besonderer Feinfühligkeit die Hochsensitiven nennt.
Reichenbach, in dem sich die naturphilosophische Begabung mit naturwissenschaftlicher Exaktheit vereinigt, bemühte sich, das Od experimentell nachzuweisen, und bediente sich dazu der Sensitiven, etwa derart, wie ein Kurzsichtiger seine Brille benutzt. Er entwickelte dazu Verfahren, die wir heute als Tests bezeichnen würden, zwar ohne Anwendung von Apparaten, doch mit sehr feinen Differenzierungen. So schied etwa als Sensitiver aus, wer zwischen der spitzen und der stumpfen Seite eines Hühnereies, das er zwischen zwei Fingern halten mußte, keinen Temperaturunterschied fand. Reichenbach unternahm das Wagnis, in Regionen einzudringen, die, obwohl weder fern noch verschlossen, den groben Sinnen unzugänglich sind.
Die Physiker wollten jedoch vom Od ebensowenig wie die Psychiater und Neurologen von den Sensitiven Notiz nehmen. Das bekümmerte Reichenbach als Naturwissenschaftler, als Philosoph konnte er sich darüber hinwegsetzen. Er kam mit seinen Ideen in eine denkbar ungünstige Zeit. Noch stärker gilt das für Fechner, der das mathematisch-physikalische Weltbild als die »Nachtseite« des Universums ansah und für seine »Psychophysik« aus Reichenbachs Schriften den größten Nutzen zog.
Fechners Gedanken über die Beseelung der Himmelskörper und der Pflanzen mußten in einer Zeit verhallen, in der mechanistische Theorien sich mit unerhörter Wucht Bahn brachen. In der Medizin bereitete sich der massive Positivismus vor, aus dessen Hybris heraus ein Chirurg sich rühmte, er habe bei seiner Arbeit noch nie eine Seele erblickt.
Solche Gegensätze innerhalb der Anschauung erwecken den Eindruck, als ob der Geist sich in zwei Flügeln eines Hauses beschäftigte, zwischen denen es keine Türen gibt. Man könnte auch an einen Doppelspiegel denken, dessen Seiten von einer undurchsichtigen Schicht geschieden sind. Immerhin kommen stets wieder Zeiten, die sich der Einheit der Anschauung annähern. Sie kann nie absolut gelingen, denn sowohl das mathematisch-physikalische Weltbild als auch das naturphilosophische der Reichenbach und Fechner sind nur Aspekte des »Innren der Natur«.
20
Die Dosis, die zum Rausch führt, kann also minimal sein, wenn die Bereitschaft genügt. Auch in dieser Hinsicht gibt es Sensitive, die besonders anfällig sind. Die Normen, die der Gesetzgeber aufzustellen sich veranlaßt sieht, etwa im Verkehrsrecht, geben nur einen groben Maßstab ab. Er wird immer strenger werden, weil die empirische Welt täglich neue Beweise dafür bringt, daß in Rausch und Technik zwei Mächte zusammenstoßen, die sich ausschließen. Das gilt freilich nicht für die Droge überhaupt. Vielmehr nehmen die Zahl der Mittel und der Umfang ihrer Anwendung ununterbrochen zu. Es mehren sich die Leistungen, bei denen die angemessene Drogierung nicht nur geboten, sondern unumgänglich ist. Das wird zu einer besonderen Wissenschaft.
Die Bereitschaft, die zum Rausch führt, kann so stark werden, daß reine Verhaltensweisen genügen und Mittel sich erübrigen. Das ist vor allem der Askese vorbehalten; ihr enges Verhältnis zur Ekstase ist seit jeher bekannt. Zur Enthaltsamkeit, zum Wachen und Fasten kommt die Einsamkeit, die auch dem Künstler und dem Gelehrten immer wieder Kraft spendet. Das Anfluten von Bildern in der Thebais: Televisionen, die nicht auf Drogen, geschweige denn auf Apparate angewiesen sind.
Der Denker, der Künstler, der gut in Form ist, kennt solche Phasen, in denen neues Licht zuflutet. Die Welt beginnt zu sprechen und dem Geist mit quellender Kraft zu antworten. Die Dinge scheinen sich aufzuladen; ihre Schönheit, ihre sinnvolle Ordnung tritt auf eine neue Weise hervor. Dieses In-Form-Sein ist vom physischen Wohlbehagen unabhängig; oft steht es in Gegensatz zu ihm, fast als ob im Zustand der Schwächung die Bilder leichter Zugang fänden als sonst. Allerdings hat schon Reichenbach davor gewarnt, Sensitivität und Krankheit zu verwechseln – doch ist es nicht einfach, hier dem Irrtum zu entgehen. Das zeigt sich besonders bei den Disputen, in denen vom Werk her auf die Psyche des Künstlers geschlossen wird. Es ist kein Zufall, daß gerade unsere Zeit reich an solchen Streitfällen ist. Wahrscheinlich gehen nicht nur produktiven Phasen im Leben des Einzelnen, sondern auch dem Stilwandel innerhalb der Kulturen Zustände erhöhter Bereitschaft voraus. Sie zeitigen notwendig eine babylonische Verwirrung sowohl der Formensprache als auch der Sprache überhaupt.
21
Jung-Stilling bezeichnet die Bereitschaft als »Ahnungs-Vermögen« und meint damit eine erhöhte Empfänglichkeit, die durch Lebensführung erreicht werden kann. »Endlich aber kann auch ein reiner gottergebener Mensch durch lange Übungen und im Wandel vor Gott in Entzückungen und in den Zustand magnetischen Schlafs gelangen.« Nach ihm »wirkt die Seele im natürlichen Zustand durch das Gehirn und die Nerven, im magnetischen ohne beide«. Erst nach dem Tode gewinnt der Mensch die volle Kraft des hellsehenden Schlafes, da er sich nun ganz vom Körper getrennt hat, und diese Fähigkeit ist weit vollkommener, als sie im Leben erreicht werden kann.
Jung-Stillings mit Ahnungsvermögen Begabte entsprechen ungefähr den Reichenbachschen Hochsensitiven; nach heutigem Sprachgebrauch könnte man sie als äußerst seltene, doch immer wieder auftretende Mutanten auffassen. Das Ahnungsvermögen kann entwickelt werden, muß aber angeboren sein. Damit erklärt Jung-Stilling unter anderem Fälle, in denen warnende Träume oder Erscheinungen nicht dem Bedrohten, sondern einem Dritten zuteil werden, der für ihn die Rolle des Empfängers spielt. Diese Fähigkeit braucht nicht mit ethischer oder geistiger Begabung gekoppelt zu sein; sie kann sowohl in einer dumpfen wie in einer genialen Existenz auftreten. In der Gestalt des Fürsten Myschkin schildert Dostojewski einen Typ von hochentwickeltem Ahnungsvermögen, der auf seine Umwelt den Eindruck eines Idioten macht.
In alten und neuen Biographien stößt man immer wieder auf die Figur des Sensitiven, der vor einem Feuer, einem Blitzschlag oder einem anderen Unglück, von unbezwinglicher Unruhe oder Atemnot ergriffen, den Raum verläßt, in dem er mit anderen, die sorglos bleiben, beisammen war.
22
Zustände der Exzitation oder der Meditation, die denen des Rausches ähnlich sind, können auch auftreten, ohne daß toxische Mittel verwandt worden sind. Das weist darauf hin, daß durch die Droge Kräfte geweckt werden, die umfassender sind als die einer spezifischen Intoxikation. Sie ist ein Schlüssel zu Reichen, die der normalen Wahrnehmung verschlossen sind, doch nicht der einzige.
Für das, was erstrebt wird, dürfte der Begriff des Rausches nicht ausreichen, falls er nicht auf eine Weise erweitert wird, die mannigfaltige und auch konträre Erscheinungen umgreift. Wir begannen ja mit der Feststellung, daß die Droge sowohl auf den Willen wie auf die Anschauung wirkt. Innerhalb dieser Ambivalenz gibt es eine große Skala, die nach beiden Seiten zur Bewußtlosigkeit führt und endlich zum Tod. Die Drogen können als Exzitantien und Stimulantien, als Somnifera, Narcotica und Phantastica begehrt werden; sie dienen sowohl zur Betäubung wie zur Anregung. Hasan Sabbâh, der Alte vom Berge, war mit dieser Skala in ihrem vollen Umfang vertraut. Er führte die Fedavis, die Geweihten, die später auch die Assassinen genannt wurden, aus der Ruhe künstlicher Paradiese bis zum rasenden Amoklauf gegen Fürsten und Statthalter. Nichts Gleiches, wohl aber Verwandtes findet sich innerhalb der Verstrickung unserer technischen Welt. Zu ihren Tendenzen gehören sowohl die Flucht in die Betäubung wie die Steigerung der Motorik durch Stimulantien.
Der Gesetzgeber muß diese Fülle vereinfachen. Er sieht den Rausch als den »durch Rauschgifte bewirkten Zustand, insbesondere die akute Alkoholvergiftung« an. Ihm liegt es ob, zu entscheiden, wo individuell der Rausch mit einer Tat, auch einem Unterlassen, zu schaffen hatte oder nicht. Zu beurteilen, mit welcher Bewußtseinslage die strafbare Abweichung beginnt, ist schon deshalb schwierig, weil es Drogen gibt, die wenigstens zeitweilig die technische Leistung begünstigen. Die Wettkämpfer haben solche Mittel zu allen Zeiten gekannt, doch die Grenze ist flüssig, die das Doping von der erlaubten Anregung trennt.
Alljährlich kommen neue Drogen in den Handel, deren Gefährlichkeit oft erst erkannt wird, wenn sie bereits Schaden getan haben. Bei anderen ist die Schädigung minimal, doch summiert sie sich in Jahrzehnten der Anwendung auf oft verhängnisvolle Art. Das gilt für anregende Drogen wie den Tabak und auch für betäubende wie die leichten Schlafmittel. Dazu kommt, daß Stimulantia und Narcotica oft nebeneinander oder, besser gesagt, gegeneinander gebraucht werden. Die Säge geht hin und her. Man könnte auch an die Belastung einer Waage denken: zu jedem Gewicht wird ein Gegengewicht auf die Schalen gelegt. So wird ein künstliches Äquilibrium gehalten, bis eines Tages der Waagbalken bricht.
23
Der Unbeteiligte, der Nüchterne, bemerkt am Spektrum des Rausches vor allem jene Seite, auf der Bewegung stattfindet. Dort ist das Anderssein nicht zu ignorieren; es kündet sich weithin den Augen und Ohren an. Die Worte für diesen Zustand beziehen sich, wenigstens in den Bier- und den Weinländern, entweder auf das übermäßige Trinken oder auf die gesteigerte Aktivität. Meist führen sie sich auf das lateinische »bibo« und »ebrius«, auf das althochdeutsche »trinkan« und das gotische »drigkan« zurück.
»Rauschen« dagegen bezeichnet eine lebhafte Bewegung, etwa von Flügeln, die auch akustisch, als »Geräusch«, bemerkbar wird. Die Bewegung kann heftig werden – das angelsächsische »rush« für »stürzen« gehört hierher. Zu denken ist ferner an erhöhte, vibrierende Vitalität. »Rauschzeit« ist Paarungszeit. Vom Eber sagt man, daß er dann »rauschig« wird. Insekten und Vögel versammeln sich zu Schwärmen; gleich nach dem Hochzeitsflug fallen den Termiten die Flügel ab.
Rauschzeit ist Schwarmzeit; Menschen und Tiere versammeln sich. Schon deshalb ist die aktive, willensmäßige Seite des Rausches besser bekannt. Der Berauschte scheut die Gesellschaft nicht; er fühlt sich wohl im festlichen Trubel und sucht nicht die Einsamkeit. Oft benimmt er sich auffällig, doch genießt er hinsichtlich seines Verhaltens eine größere Lizenz als der Nüchterne. Den Lachenden sieht man lieber als den Betrübten; der Angeheiterte wird mit Wohlwollen betrachtet, oft auch als jener, der die Langeweile vertreibt und die Stimmung belebt. Ein Bote des Dionysos tritt ein und öffnet das Tor zur närrischen Welt. Das wirkt selbst auf den Nüchternen ansteckend.
Diese gesteigerte und nicht zu übersehende Aktivität hat dem Wort »Rausch« den Akzent erteilt. Ganz allgemein beansprucht die sichtbare Seite der Dinge auch in der Sprache einen stärkeren Anteil als die verborgene. Ein Beispiel dafür bietet das Wort »Tag«. Wenn wir es aussprechen, umfassen wir damit zugleich die Nacht. Die Lichtseite bezieht also den Schatten mit ein. Wir denken gemeinhin kaum darüber nach. Ganz ähnlich bezieht das Wort »Rausch«, obwohl es die augenfällige Steigerung der Lebenskräfte betont, auch ihre Dämpfung mit ein: die lethargischen und reglosen, dem Schlaf und dem Traum ähnelnden Zustände.
Der Rausch äußert sich in verschiedenen, oft konträren Erscheinungen; die Droge erzeugt ebenso verschiedene Wirkungen. Trotzdem ergänzen sich beide zu einem Komplex von großer Spannweite. Hasan Sabbâh soll seine Assassinen durch ein und dasselbe Mittel, den Haschisch, sowohl in die Welt glückseliger Träume wie in die des Mordes geführt haben.
24
Wer sich betäuben will, verhält sich anders als jener, der sich nach Art der Schwärmer zu berauschen gedenkt. Er sucht nicht die Gesellschaft, sondern die Einsamkeit auf. Er steht der Sucht näher, daher pflegt er sein Tun zu verbergen, dem auch die festliche Periodik fehlt. Der »heimliche Trinker« gilt als bedenklicher Typ.
Wer sich schwer und gewohnheitsmäßig betäubt, ist schon deshalb auf Heimlichkeit angewiesen, weil die Droge fast immer aus dunklen Quellen stammt. Ihr Genuß führt in eine Zone der Illegalität. Es gehört daher zu den Anzeichen beginnender Anarchie, wenn derart Berauschte die Öffentlichkeit nicht mehr scheuen. So konnte man nach dem Ersten Weltkrieg in den Cafés Drogierte beobachten, die dort »Löcher in die Luft starrten«.
Der Betäubte meidet aber nicht nur deshalb die Gesellschaft, weil er sie aus verschiedenen Gründen zu fürchten hat. Er ist seiner Natur nach auf Einsamkeit angewiesen; sein Wesen ist nicht mitteilender, sondern empfangender, rezeptiver Natur. Er sitzt wie vor einem magischen Spiegel, regungslos in sich selbst versunken, und immer ist es dieses Selbst, das er genießt, sei es als reine Euphorie, sei es als Bildwelt, die sein Inneres erzeugt und die auf ihn zurückflutet. So gibt es Lampen, deren fluoreszierendes Licht einen grauen Stein in eine Goldstufe verwandeln kann.
Baudelaire, der den Haschisch »eine Waffe zum Selbstmord« nennt, erwähnt unter anderen Wirkungen die außerordentliche Kälte nach dem Genuß der Droge, den er zur »Klasse der einsamen Freuden« zählt. Dieses Frieren, das auch andere Phantastica erzeugen, ist nicht nur physischer Natur. Es ist auch ein Zeichen der Einsamkeit.
25
Narkissos war der Sohn eines Flußgottes und einer Nymphe, der Liriope. Die Mutter war von seiner Schönheit ebenso entzückt wie durch seine Kaltsinnigkeit erschreckt. Um sein Schicksal besorgt, fragte sie den Seher Teiresias um Rat und hörte von ihm das Orakel: ihrem Sohn werde, falls er sich selbst nicht kennenlernen würde, ein langes Leben beschieden sein. Das rätselhafte Wort ging in Erfüllung, als Narkissos eines Tages, von der Jagd heimkehrend, sich durstig über einen Quell beugte und in ihm sein Spiegelbild sah. Der Jüngling verliebte sich in das Phantom, und er verzehrte sich in ungestillter Sehnsucht nach dem eigenen Bilde, bis er zugrunde ging. Die Götter verwandelten ihn in eine Blume von betäubendem Duft, in die Narzisse, die noch heute seinen Namen trägt und deren Blüte sich gern über stille Gewässer neigt.
Wahrscheinlich haben sich vom Narkissos-Mythos, wie von so vielen anderen, nur Rudimente erhalten; sein großes Thema scheint die Sehnsucht gewesen zu sein. Ihr erlag auch die Nymphe Echo, die sich vergeblich nach der Umarmung des Narkissos sehnte und sich vor Gram verzehrte, bis endlich von ihr nichts mehr als die Stimme blieb.
Narkissos lernte sich kennen, doch er erkannte sich nicht. »Erkenne dich selbst!« stand über dem Apollo-Tempel zu Delphi; Narkissos scheiterte wie so viele andere vor und nach ihm an dieser schwersten der Aufgaben; er suchte vergeblich sein Selbst in seinem Spiegelbild. Das Wort »erkennen« hat doppelte Bedeutung; Narkissos läßt sich auf ein erotisches wie Faust auf ein geistiges Wagnis ein.
Eben diese verzehrende Sehnsucht ist auch ein Kennzeichen der Droge und ihres Genusses; die Begier bleibt immer wieder hinter der Erfüllung zurück. Die Bilder locken wie eine Wüstenspiegelung; der Durst wird brennender. Wir können auch an den Einstieg in eine Grotte denken, die sich in ein Labyrinth von immer engeren und unwegsameren Gängen verzweigt. Dort droht das Schicksal Elis Fröboms, des Helden in Hoffmanns »Bergwerken zu Falun«. Er kommt nicht wieder, ist der Welt verloren, und ähnlich erging es dem Mönch von Heisterbach, der sich im Wald verirrte und erst nach dreihundert Jahren wieder in sein Kloster fand. Dieser Wald ist die Zeit.
26
Wir halten die Stoffe, die den narkotischen Rausch erzeugen, für feiner, ätherischer als jene, die den Willen anspannen. Faust wird nach der großen Beschwörung im nächtlichen Studierzimmer zunächst zu den wüsten Zechern in Auerbachs Keller und dann erst in die Hexenküche geführt.
Wir sprechen vom »narkotischen Duft«. Das Wort stammt vom griechischen ναρκόω, ich betäube, ab. Im Süden gibt es Narzissenarten, deren Duft als gefährlich gilt. Euphorie und Schmerzlosigkeit folgen der Einatmung flüchtiger Substanzen wie der des Lachgases oder des Äthers, der um die Jahrhundertwende auch einmal als Genußmittel in Mode gewesen ist und dem Maupassant eine Studie gewidmet hat. In der klassischen Magie wird immer wieder der Rauch erwähnt, der nicht nur betäubt, sondern auch als feines Medium für die der Betäubung folgenden Visionen dient. Wir finden solche Szenen in »Tausend und einer Nacht«, aber auch noch bei Autoren wie Cazotte, Hoffmann, Poe, Kubin und anderen.
Die Vermutung liegt nahe, daß diese der Anschauung zugewandte Seite des Rausches auch die qualitativ bedeutendere ist. Wenn wir uns darüber ein Urteil bilden wollen, müssen wir auf die gemeinsame Wurzel zurückgreifen, aus der so verschiedenartige Formen der Imagination aufsteigen. Das Wagnis, das wir mit der Droge eingehen, besteht darin, daß wir an einer Grundmacht des Daseins rütteln, nämlich an der Zeit. Das freilich auf verschiedene Weise: je nachdem, ob wir uns betäuben oder stimulieren, dehnen oder komprimieren wir die Zeit. Damit hängt wiederum die Begehung des Raumes zusammen: hier das Bestreben, die Bewegung in ihm zu steigern, dort die Starre der magischen Welt.
Wenn wir die Zeit, wie es von jeher geschehen ist, einem Strom vergleichen, so scheint er sich dem Stimulierten zu verengen, schneller zu fließen, in Wirbeln und Kaskaden zu Tal zu sprühen. Dem folgen die Gedanken, die Mimik und Gestik; der so Berauschte denkt und handelt geschwinder und impulsiver als der Nüchterne, auch weniger berechenbar.
Unter dem Einfluß narkotischer Mittel dagegen verlangsamt sich die Zeit. Der Strom fließt ruhiger; die Ufer treten zurück. Mit der beginnenden Betäubung treibt das Bewußtsein wie in einem Boot auf einem See, dessen Grenzen es nicht mehr erblickt. Die Zeit wird uferlos; sie wird zum Meer.
So kommt es zu den endlosen Opiumträumen, die de Quincey beschreibt. Er wähnt, »für Jahrtausende in den Eingeweiden ewiger Pyramiden bestattet zu sein«. In den »Suspiria de Profundis«, einer Essay-Sammlung, die ein Vierteljahrhundert nach den »Confessions« erschienen ist, blickt er auf diese ungeheure Ausweitung der Zeit zurück und sagt, sie zu schildern, würden astronomische Maßstäbe nicht ausreichen. »Ja, lächerlich wäre es, den Zeitraum, den man während eines Traumes durchlebt, nach Generationen zu bestimmen – oder selbst nach Jahrtausenden.«
Das Gefühl der Entfernung vom menschlichen Zeitbewußtsein überhaupt wird auch von anderen bestätigt, so von Cocteau: »Tout ce qu’on fait dans la vie, même l’amour, on le fait dans le train express qui roule vers la mort. Fumer l’opium, c’est quitter le train en marche; c’est s’occuper d’autre chose que de la vie, de la mort.«
27
Die Zeit läuft schneller am animalischen, langsamer am vegetativen Pol. Von hier aus fällt auch Licht auf das Verhältnis der Narcotica zum Schmerz. Die meisten Menschen werden mit den Narcoticis dank deren anästhetisierenden Eigenschaften bekannt. Zur Gewöhnung führt das damit verbundene Glücksgefühl, die Euphorie. Daß die Depressiven besonders leicht dem Morphium anheimfallen, erklärt sich daraus, daß von ihnen bereits die Existenz an sich als schmerzhaft empfunden wird.
Viele Narcotica sind zugleich Phantastica. Sertürner hat, indem er 1803 das Morphium isolierte, die schmerzstillende Potenz des Opiums von der eidetischen getrennt. Er hat damit zahllosen Leidenden geholfen, aber zugleich dem Mohnsaft, wie ihn Novalis besingt, die Farben geraubt.
Wer der Bildwelt zustrebt, will durch das Narcoticum weder dem Schmerz entgehen noch Euphorie genießen; er sucht das Phantasticum. Ihn bewegt nicht die Furcht vor dem Leiden, sondern höhere Neugier, vielleicht auch Vermessenheit. In das Zauber- und Hexenwesen des Mittelalters spielt immer wieder die Welt der Alkaloide ein: die Beschwörung mit Hilfe von Tränken, Salben und Dünsten, von Mandragora, Stechapfel, Bilsenkraut.
28
Die Beschwörung wurde in jenen Zeiten zu den Kapitalverbrechen gezählt. Die Erscheinungen waren glaubwürdiger als heut. Für Faust ist das Geisterreich, obwohl bereits weithin zur Geisteswelt geworden, noch »nicht verschlossen«, doch ihn bewegt nur noch die Sorge, ob die Beschwörung gelingt. Religiöse oder moralische Bedenken quälen ihn nicht mehr.
Ganz ähnlich stellt sich in unserer Zeit dem geistigen und dem musischen Menschen die Frage, was die Droge gewähren kann. Ihm kann letzthin nicht an der motorischen Steigerung der Kräfte, am Glück oder gar an Schmerzlosigkeit gelegen sein. Ihm geht es nicht einmal um Schärfung und Verfeinerung der Einsicht, sondern wie in Faustens Kabinett um »Eintretendes«.
Dieses Eintreten bedeutet nicht, daß neue Fakten bekannt werden. Nicht die Bereicherung der empirischen Welt ist gemeint. Faust strebt aus dem Studierzimmer hinaus, in dem ein Wagner zeitlebens verharren und sich glücklich fühlen wird. »Zwar weiß ich viel, doch möcht ich alles wissen« – das hat kein Ende, und in diesem Sinne gehört auch die Entdeckung Amerikas zu den Fakten; kein Raumschiff führt aus ihrer Welt hinaus.
Keine Akzeleration, selbst wenn sie bis zu den Sternen trüge, kann das Urwort »Dir kannst du nicht entfliehen« außer Kraft setzen. Das gilt auch für die Steigerung der Lebenskraft. Die Multiplikation und selbst die Potenzierung verändern die Grundzahl nicht. Vom Eintretenden wird anderes erwartet als eine Steigerung dynamischer oder vitaler Art. Zu allen Zeiten erhoffte man von ihm eine Mehrung, eine Ergänzung, eine Hinzufügung. Das bedeutet nicht Potenzierung, sondern Addition.
Bei der Beschwörung, sei es mit Hilfe der Askese oder anderer Mittel, war früher kein Zweifel daran, daß Fremdes hinzuträte. Inzwischen hat das Denken eine Macht gewonnen, der gegenüber diese Überzeugung nur noch durch Nachhuten verteidigt wird. Es bleibt aber nur von spiegelbildlicher Bedeutung, ob ein Hinzutretendes von außen oder von innen kommt, ob es also dem Universum oder der eigenen Tiefe entstammt.
Nicht der Punkt, an dem die Sonde gesetzt wird, entscheidet, sondern jener, den sie erreicht. Dort überzeugt die Erscheinung mit solcher Stärke, daß für die Frage nach ihrer Realität, geschweige denn nach ihrer Herkunft, weder Raum noch Bedürfnis bleibt. Wo Gründe, Autoritäten oder gar Machtmittel nötig sind, um ihre Realität zu sichern, hat die Erscheinung schon die Macht verloren; sie wirkt nun wie ein Schatten oder ein Echo fort. Die Bereitschaft aber muß immer gewahrt bleiben.
DIE PFLANZE ALS AUTONOME MACHT
29
Wenn Säfte vegetativer und tierischer Herkunft sich durchdringen, so entstehen neue Moleküle, es bilden sich Ketten und Ringe verschiedenster Art. Seit kurzem sind wir imstande, in diesen Feinbau ein wenig einzublicken – vermöchten wir es nicht, so änderte sich im Grunde wenig oder nichts. Wahrscheinlich lenkt diese Einsicht, wie manche vermuten und viele ahnen, von Wichtigerem ab.
Daß manche dieser Moleküle den Körper nähren und andere ihn neutral passieren, wird ebensowenig bestritten wie die Tatsache, daß wiederum andere geistige Wirkungen auslösen. Auf diese Wahrnehmung gründet sich die indianische Unterscheidung zwischen alltäglicher und Götternahrung, wie in den höheren Kulturen jene von natürlichen und geweihten Substanzen überhaupt.
Die Frage nun, ob diese Wirkungen nur ausgelöst werden oder ob sie »hinzutreten«, führt über die Probleme der Psychologen und Chemiker hinaus. Wenn wir die Pflanze als autonome Macht erkennen, die eintritt, um Wurzeln und Blüten in uns zu treiben, entfernen wir uns um einige Breitengrade von der schiefen Perspektive, die wähnt, Geist sei das Monopol des Menschen und existiere nicht außer ihm. Ein neues Weltbild muß der planetarischen Nivellierung folgen; das ist die Aufgabe, die das nächste Jahrhundert in Anspruch nehmen wird. Es vorzubereiten, sind die nihilistischen und materialistischen Theorien berufen; von dorther wirkt die ihren Gegnern unbegreifliche Überzeugungskraft. Wir sehen freilich auch im Sturm, der Wälder entwurzelt und Häuser abdeckt, nicht den Sog windstiller Ferne – dasselbe gilt für die Zeit.
Wir bewegen uns hier am Rande der Abendmahlsstreitigkeiten, die tausend Jahre lang die Geister beschäftigten und sich zuzeiten verdichteten. Es geht um Wein und Brot, um Unterschiede zwischen Anwesenheit und Annäherung. Wenn wirklich etwas geschieht, fallen die groben und die feinen Differenzierungen dahin. Sie dringen ja auch nicht ins »Innre der Natur«. Wir können sowohl dem »Das ist« wie dem »Das bedeutet« jeden möglichen Umfang geben, im Grund begegnen sie sich in einem Punkt. Auch am Abend der Stiftung hat das Mahl über seine Wirklichkeit hinaus noch etwas »bedeutet«, wenngleich als hohe Stufe der Annäherung.
Uns plagen heute andere Sorgen, vor allem jene: daß sich auf diesem Wege nicht wieder Götter einschleichen.
30
Die Darstellung des Kokains gelang um 1860 in Wöhlers berühmtem Göttinger Institut, einer der Büchsen der Pandora für unsere Welt. Diese Ausfällung und Konzentrierung wirksamer Stoffe aus organischen Substanzen durchsetzt das ganze 19. Jahrhundert; sie begann mit der Extraktion des Morphins aus dem Mohnsaft durch den zwanzigjährigen Sertürner, der damit das erste Alkaloid entwickelte oder, besser gesagt, auswickelte.
Wie überall bei der Annäherung an die Titanenwelt, nehmen auch hier Ballung und Strahlung zu. In dieser Welt treten Kräfte und Stoffe auf, die zwar aus der Natur gewonnen, doch zu stark, zu vehement für das natürliche Fassungsvermögen sind, so daß der Mensch, will er sich nicht zerstören, auf wachsenden Abstand und größere Vorsicht angewiesen ist. Diese Kräfte und Stoffe sind sichtbare Modifikationen des Eintritts in eine neue Geisteswelt.
Vergärung, Destillation, Ausfällung und endlich Gewinnung strahlender Materie aus organischer Substanz. Mit ihr beginnt das 20. Jahrhundert – 1903 Entdeckung des Radiums und Poloniums, 1911 Nobelpreis an das Ehepaar Curie für Reindarstellung des Radiums aus riesigen Mengen Joachimsthaler Pechblende. Dieses Joachimsthal wurde 1945 von den Amerikanern an die Russen abgetreten, die dort große Mengen von spaltbaren Stoffen ausbeuten.
Jeder Übergang ist zugleich ein Einschnitt, jeder Gewinn auch ein Verlust. Wo das in der Tiefe, wenn nicht begriffen, so doch gefühlt wird, ist der Schmerz besonders groß – vor allem, wo unter dem Rückzug der Götter vor den Titanen noch gelitten wird. Die Urteile unterscheiden sich dort wie Tag und Nacht. Pierre Curie zählt zu den ersten Opfern des motorisierten Verkehrs († 1906). Léon Bloy frohlockte angesichts der Nachricht über »die Zermalmung des infamen Gehirns«.
31
Wie Goethe die Farben als eines der Abenteuer des Lichtes betrachtet, könnten wir den Rausch als einen Siegeszug der Pflanze durch die Psyche ansehen. So nährt die gewaltige Familie der Nachtschatten uns nicht nur physisch, sondern auch im Traum. Zu ihrer Monographie müßte sich die Systematik mit der Schau eines Novalis, eines Fechner vereinigen. Ihr Name »Solanaceen« führt sich vermutlich auf »solamen«, das Trostmittel, zurück.
Wie sich die Pflanze uns nicht nur physisch, sondern auch geistig zuwendet, so hat sie es viel früher erotisch den Tieren gegenüber getan. Um das zu sehen, müssen wir sie freilich als ebenbürtig anerkennen, als stärkeren Partner sogar. Zu den merkwürdigsten Erscheinungen, den wahren Wundern auf unserem Planeten, zählt das Geheimnis der Bienen, das zugleich ein Geheimnis der Blumen ist. Das Liebesduett zwischen zwei in ihrer Bildung und Entwicklung so ungeheuer weit voneinander entfernten Wesen muß einmal wie mit einem Zauberschlage sich bezeugt haben durch unzählige Zuwendungen. Die Blüten bilden sich um zu Geschlechtsorganen, die sich auf wunderliche Weise ganz fremden Wesen anpassen – Fliegen, Schwärmern und Faltern, auch Honigsaugern und Kolibris. Früher hat sie der Wind bestäubt.
Das war einer der Kurzschlüsse durch die Ahnenreihe und ihre Sicherung. Ein Großer Übergang. In solchen Bildern wird der Irisschleier durchsichtig. Der kosmogonische Eros durchbricht die Sonderungen der gebildeten Welt. Wir würden nie auf den Gedanken kommen, daß solches möglich sei – fühlten wir es nicht myriadenfach bestätigt auf jedem Gange durch eine Frühlingswiese, an jedem Blütenhang. Trotzdem hat es bis in unsere Zeit gedauert, ehe ein Mensch das Geheimnis erriet. Wieder ein Rektor: Christian Konrad Sprengel – »Das entdeckte Geheimnis der Natur« (1793). Was wir Geheimnis nennen, sind freilich nur Manifestationen; näher kommen wir ihnen im glockenhaften Summen unter dem blühenden Lindenbaum. Erkenntnis ist Übereinstimmung.
32
Die Pflanze, obwohl selbst kaum beweglich, zwingt das Bewegte in ihren Bann. Novalis hat es in seinen Hymnen gesehen. Ohne die Pflanze wäre kein Leben auf der Welt. Von ihr sind alle Wesen, die atmen und sich ernähren wollen, abhängig. Wie weit ihre geistige Macht reicht, kann nur geahnt werden. Nicht umsonst beruft sich das Gleichnis vor allem auf sie.
Was etwa durch den Tee, den Tabak, das Opium, doch oft schon durch den bloßen Duft von Blumen geweckt wird – diese Skala von Erheiterungen, von unbestimmten Träumen bis zur Betäubung – das ist mehr als eine Palette von Zuständen. Es muß etwas anderes, etwas Neues hinzutreten.
So wie die Pflanze Geschlechtsorgane bildet, um sich mit den Bienen zu begatten, vermählt sie sich auch mit dem Menschen – und die Berührung schenkt ihm Zugang zu Welten, in die er ohne sie nicht eindränge. Hier verbirgt sich auch das Geheimnis aller Süchte – und wer sie heilen will, muß geistiges Äquivalent geben.
DER RAUSCH: HEIMAT UND WANDERUNG
33
Daß Drogen Gebiete unter sich aufteilen und bestimmte Herrschaftsbereiche abgrenzen, ist oft bemerkt worden. Die Lotophagenträume gedeihen im Orient. Der Geist schweift aus, während der Körper auf dem Lager ruht. Die Bilder sind nicht nur schön und heiter; sie können auch schrecklich und grausam sein. Die Droge spielt die Rolle der Scheherazade, die dem Sultan während der Nacht »die wachen Stunden vertreibt«.
Der Abendländer zieht die stimulierenden und aktivierenden Einflüsse vor. Der Unterschied fällt selbst dort auf, wo er sich der gleichen Mittel bedient. Dort der Mann in der Chelabyja, der sich vor einem Café in Damaskus die Wasserpfeife bringen läßt – hier der Typ, der in der Pause zwischen zwei Arbeitsgängen hastig die Zigarette »stößt«.





























