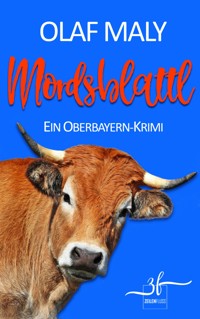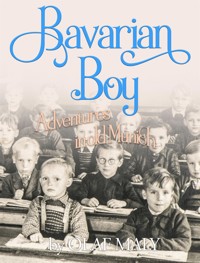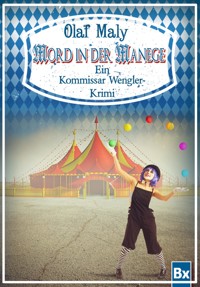4,49 €
Mehr erfahren.
Kommissar Wengler hatte versprochen, in die Oper zu gehen. Mit einer alten Freundin, die ihn nach langer Zeit unerwartet angerufen hatte. Aber es kommt anders. Er trifft auf eine Obdachlose – in Bayern auch „Sandler“ genannt –, die auf der Suche nach ihrer besten Freundin ist. Obwohl nicht für verschwundene Personen zuständig, muss sich der Kommissar in den folgenden Tagen mit der Obdachlosenszene auseinandersetzen – mit all den Beziehungs- und weiteren Problemen dieser Menschen. Auch andere Leute mischen mit. Sie nehmen sich dieser verlorenen Seelen an und versuchen, unter dem Deckmantel der Hilfsbereitschaft von ihnen zu profitieren. Für einige wird dieser Fall nicht gut ausgehen. Auch Kommissar Franz Joseph Bernrieder aus Bad Tölz, der dem Kommissar in einem anderen Fall schon einmal hilfreich zur Seite stand, ist dieses Mal wieder mit dabei. Ein Teil der Geschichte spielt in seinem Wirkungsbereich, was zwangsläufig die oberbayerische Ruhe stört, die ihm so heilig ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sandler
Eine Kommissar Wengler Geschichte
Ich möchte mich an dieser Stelle bei zwei Personen bedanken, ohne deren Hilfe dieses Buch nicht zustande gekommen wäre. Da wäre zuallererst meine langjährige Partnerin Marita Stepe, die es stets auf sich nimmt, die erste Fassung meiner Bücher zu lesen, und mit konstruktiver Kritik auf die Handlung Einfluss nimmt. Und dann noch meine Lektorin, Theresia Riesenhuber, die mit Engelsgeduld meine Fehler ausmerzt.BookRix GmbH & Co. KG81371 München1
Kommissar Wengler saß vor dem Spatenhaus und genehmigte sich ein Bier. Spaten-Bier. Keineswegs seine Lieblingsmarke, aber um diese Zeit – es war schon sehr spät – war es das einzige, was er noch bekommen konnte. Außer Paulaner im Franziskaner, im Lokal nebenan, aber das trank er nur unter Zwang. Falls es wirklich nichts anderes gab. Und irgendwie war ihm das Spatenhaus lieber, da fühlte er sich besser aufgehoben. Unter seinesgleichen. Im Franziskaner, das wusste man, da gab es nur die 'Großkopferten', oder, wie man sagte, die, die meinten 'dazuzugehören'. Auch wenn sie oft die einzigen waren, die das meinten. Das Spatenhaus war genau gegenüber der Oper. Und seitlich neben der Residenz, in der es auch ein Theater gab. Das Residenztheater. Man konnte diesen Platz also fast als ein Kulturzentrum im Zentrum Münchens bezeichnen. Die Münchener Oper, auch Nationaltheater genannt, geht zurück bis ins späte 17. Jahrhundert und gilt als eines der ältesten Opernhäuser der Welt. Seit 1810 ist es im heutigen Bau untergebracht. In der Mitte des Platzes befindet sich ein Denkmal für König Maximilian den Ersten, das den Bereich schwer und gewichtig optisch bestimmt. Heutzutage fährt man mit dem Auto um Maximilian herum, um in die Tiefgarage zu gelangen.
Für den Kommissar war dies allerdings immer mehr ein Platz zum Sitzen, Anschauen und Ausruhen. Die Kultur könnte mit einer Blaskapelle an ihm vorbeirauschen und er würde es nicht einmal wahrnehmen. Weil er es nicht wahrnehmen wollte. Nicht, dass er ignorant und ungebildet sei, nein, beileibe nicht. Er liebte klassische Musik, besonders Wagner, da sie auch die Lieblingsmusik seines geliebten König Ludwigs des Zweiten war, aber er mochte den Wirbel nicht, den die Leute machten, wenn sie der Meinung waren, Kultur „tanken“ zu müssen. Dann zogen sie sich an wie 'dressierte Affen', wie er immer sagte, nur um zu zeigen, was man zu Hause im Schrank hatte. Am liebsten hätte man auch noch das Preisschild dran gelassen, damit auch jeder sah, wo das Prachtstück herkam. Da lobte er sich den bayerischen Thronfolger, der in den siebziger Jahren, angezogen mit seiner alten, gut eingetragenen Lederhose und einer noch älteren Trachtenjacke, im Geländewagen zu den Opernfestspielen vorfuhr. Das war eine Art von Protest, Exzentrizität. Nur wenn der Thronfolger das machte, war es lustig. Es war eine 'Gaudi', wie man das nannte. Dann waren alle Zeitungen Münchens vertreten und machten Bilder, die man sich am nächsten Tag dann ansehen konnte. Sollt er, der Kommissar, das versuchen, verwies man ihn wahrscheinlich der Tür. Oder rief die Ambulanz. Die mit der Zwangsjacke, die man hinten verschließen konnte. Also ließ er es bleiben. Den Protest. Er revoltierte lieber in sich hinein, indem er den Trubel mied. Er ging also eigentlich nicht oft in die Oper, eher ins Konzert, wenn er schon einmal die Kraft aufbrachte, sich dementsprechend zu vergnügen. Die letzte Oper, die er sich angesehen hatte, war Carmen – und das war schon sehr lange her. Er hatte zu dieser Zeit eine Freundin, die ebenso hieß.
Wie schon gesagt, es war sehr lange her. In seiner überschwänglichen Begeisterung für dieses engelhafte Wesen, schlug er ihr begeistert vor, in die Aufführung zu gehen, als er eines Morgens auf dem Weg ins Büro das Plakat auf einer Litfaßsäule gesehen hatte. Es hatte ihm gefallen. Darauf war eine spanische Frau zu sehen, die sich um sich selbst drehte und dabei den weiten, roten Rock mit schwarzer Spitze schwungvoll verwirbelte. So konnte er sich auch seine neue Liebe vorstellen: rassig, mit schwarzen Haaren und feuerroten Lippen. Mit diesem eindringlichem Blick und dem halboffenem Mund, der allen Männern in diesem Alter weiche Knie verursachte. Die Carmen die er kannte, war allerdings blond und relativ klein. Auch nicht so schlank und rassig. Eher auf der runden Seite der Skala. Aber das war nebensächlich. Auch hatte er keine Ahnung, was auf ihn zukam. Aber da er verliebt war, dachte er sich, dass alles, was Carmen hieß, auch unheimlich toll sein müsse. Die Begeisterung hielt allerdings nicht lange an. Weder für die Person, noch für die Oper. Aber, wie gesagt, das war schon viele Jahre her.
Jetzt, an diesem Abend, ging es um seine alte Flamme Gisela Spranger, die er noch aus den Zeiten der Polizeischule kannte. Eines Tages, aus heiterem, blauem Himmel heraus, hatte sie ihn angerufen und gefragt, ob er denn nicht wieder einmal in die Oper gehen wolle. Sie habe eine Karte übrig und es sei doch sehr schade, wenn diese verfiele. Und sie habe gehört, nein, eigentlich sei das ja ein offenes Geheimnis, dass er klassische Musik gerne habe. Schon damals, als sie sich näher gestanden hatten, sozusagen, sei er der Klassik nicht abgeneigt gewesen.
„Musik, Gisela, Musik. Nicht unbedingt Oper. Weil, da versteht man eh nix, was die singen.“
„Aber die schreiben des an eine Tafel, Herbert, da kannst dann immer mitlesen. Ich mein, was die singen, kannst dann auf dem Band da lesen.“
Das war allerdings ein Argument, das seines total niederschmetterte.
„La Bohème, hast g'sagt? Aha. War des nicht die, wo die in Paris stirbt, weil's saukalt is und die kein Geld nicht ham zum Heizen? Dann gehen die auch noch in die kalte Kirch und die kriegt dann a Lungenentzündung. Jetz weiß ich, was du meinst. Ich hab g'lesen davon. Und ich hab da mal eine Arie g'hört, die hat mir ganz gut g'fallen. Also, weil des du bist: Du hast mich überredet. Wann?“
„Heut Abend. 7 Uhr.“
„Heut noch? Ja, aber des is ja eine sehr kurzfristige Einladung.“
„Weil du, wenn du dir des überlegen kannst, sowieso dann immer absagst.“
„Gisela, des stimmt aber nicht so...“
„Doch, Herbert, des stimmt. Weil des letzte Mal hast g'meint, dass du den Termin mit deine Schafkopfbrüder ganz vergessen hätt'st. Und dann hast g'sagt, wenn so was wieder is, sollt ich dich nicht ein paar Tag vorher anrufen, sondern wenn des is. Und des hab ich jetz g'macht. Also, kommst? Um 8 Uhr geht’s los. Solltest aber a bisserl früher da sein. Die lassen keinen rein, der zu spät kommt.“
Also sagte er ja. Eigentlich sagte er 'Ja, vielleicht, wahrscheinlich, werd's versuchen'. In diesem Sinne eben. Er wollte sich nicht hundertprozentig festlegen. Zumindest in dem Ton, in dem er 'ja' sagte, sollte das voll zum Ausdruck kommen. Meinte er.
Es war ein Samstagabend, es war ruhig und noch relativ warm für die Jahreszeit, als er da vor dem Spatenhaus saß und die wenigen Menschen beobachtete, die vorübergingen. Sollten die Menschen am Wochenende ausgehen, taten sie es bestimmt nicht in dieser Gegend. Er ging zwar am Wochenende genauso wenig aus wie unter der Woche, außer seine Freunde wollten Schafkopf spielen, aber der Samstag hatte doch noch etwas Besonderes. Er musste an diesem Tag ausnahmsweise arbeiten, da sie einen Bericht fertigzumachen hatten, der am Montag auf dem Tisch vom Chef zu liegen hatte. Eigentlich kümmerte es ihn nicht sehr, wenn er solche Termine hatte, aber in diesem Fall war sein Chef, der Dr. Erdlinger, so erregt, dass er sich genötigt sah, doch einmal eine Ausnahme zu machen. Nur um des lieben Friedens willen.
„Herbert, jetzt schließt den Fall ab oder ich schließ' was ab mit dir! Dann kannst a paar Jahr in Dauerurlaub gehen“, hatte er gemeint. Und noch viel mehr, was man hier nicht wiedergeben sollte. Also war seine Präsenz vonnöten. Also war es auch für ihn sozusagen ein weiterer Wochentag, an dem man nicht lange wegbleiben sollte. Auch wenn morgen Sonntag war, aber man wusste ja nie.
Nun saß er dort auf dem gelben Lattenstuhl vor dem Lokal, als einziger Gast, der sich dorthin verirrt hatte. Es war äußerst unbequem. Und er gähnte lange und tief. „Die machen die Stühl wahrscheinlich so unbequem, dass ma glei wieder geht, wenn ma des dünne Bier da g'soffen hat“, sagte er leise zu sich selbst. Die Bedienung, die gelangweilt an ihrem kleinen Tresen stand, mit dem Handtuch spielte und ansonsten im höchsten Grade gelangweilt vor sich hin in die Gegend starrte, fragte, ob er etwas gesagt habe.
„Na, nix. Gar nix. Hab nur g'meint.“
„Was ham's denn g'meint?“
„Nix, net so wichtig.“
Sie wunderte sich ohnehin, was er da so machte. Ein kleines Bier nach dem anderen, und das letzte hatte er schon vor fast einer Stunde bestellt. In ein paar Minuten war sowieso Schluss, dachte sie sich, also sollte der 'alte Depp' doch da sitzen und festkleben. Sie stieß sich leicht von der Theke ab, an der sie gelehnt hatte, und fing an, langsam die Stühle zusammenzuklappen. Einen nach dem anderen. Dabei schlug sie gekonnt mit dem Fuß auf das grüne Kreuz, das den unteren Rahmen ausmachte und dem Stuhl Stabilität und Form gab. Dadurch faltete sich das Gestell zusammen und aus einem Stuhl wurde ein flaches Ding, das man stapeln konnte. Dann lehnte sie diese Gestelle gegen die Tische, ordentlich im gleichen Abstand zueinander. Fast mit religiösem Pathos. Andächtig. Immer wieder korrigierend und begutachtend, ob der Abstand auch stimmte. Dann tat sie die Aschenbecher und Salzstreuer auf ein Tablett und brachte sie in das Lokal. Jedes Mal wenn sie wieder herauskam, sah sie Kommissar Wengler fragend an, was so viel hieß wie: 'Wann bist jetz endlich fertig, du Depp?'. Das war dann eher weniger religiös, mehr profan. Und auf keinen Fall pathetisch. Dann schüttelte sie den Kopf und kümmerte sich um die Pfefferstreuer und Bierdeckel, die ordentlich in einem Ständer aufbewahrt wurden.
Das mit der Einladung von der Gisela hatte ihn noch den ganzen Nachmittag beschäftigt. Er hatte schon lange nichts mehr von ihr gehört, also wunderte er sich, warum sie gerade jetzt angerufen hatte. Sogar seinem Assistenten, dem Armin Staller, fiel nach dem Anruf das veränderte Wesen des Kommissars auf. Nicht, dass er den ganzen Tag, gewissermaßen ständig, wenn man so wollte, 'normal' aussah, wie man so sagte. Nein, er hatte seine Mucken, die er auch öffentlich zur Schau trug, da es ihm ziemlich egal war, was die Leute von ihm dachten. Weder seine Einstellungen zu bestimmten Themen, mit denen er manche seiner Kollegen immer wieder vor den Kopf stieß, noch seine mehr als ungewöhnliche Kleidung taten seinem Ruf irgendwie Abbruch. Man wusste, mit wem man es zu tun hatte. Und kümmerte sich nicht sonderlich darum.
„Haben Sie ein Problem, Herr Kommissar?“, fragte Armin vorsichtig, da er untrüglich sah, dass dieser sich sein Hirn zermarterte.
Normalerweise las er am Nachmittag, nachdem er vom Essen zurückkam, immer seine Süddeutsche. Die aktuellen Teile waren am Vormittag dran, die Kommentare dazu am Nachmittag. Daran hielt er sich. Außer, es gab einen Fall, der ihn daran hinderte, eben das zu tun. Gegenwärtig war alles ziemlich ruhig. Die Ruhe vor dem Sturm, wie er zu sagen pflegte, wenn ihn jemand darauf ansprach, dass seine Abteilung wohl die beste im Haus sei. Man arbeitete immer nur, wenn einer auf unnatürliche Art starb. Wenn alle lebten, gäbe es nichts zu tun. Sein Kommentar darauf war immer, dass sie keine Ahnung hätten, wie schwer sie schuften mussten. Tag und Nacht. Nur sähe man das eben nicht, weil sie das so effektiv und professionell machten, dass es eben wie ein Uhrwerk funktionierte. Deswegen sähe es so einfach aus.
„Armin, nix Tragisches. Nur, die Gisela hat ang'rufen, eine alte Liebe aus lang vergangenen Zeiten, und will mit mir in die Oper. Jetz überleg ich schon die ganze Zeit, warum die mit mir in die Oper gehen will. Des hat die seit Jahren nicht von mir verlangt, dass ich mich da martern muss.“
„Wahrscheinlich will sie nicht alleine gehen und wollte Sie nur einfach mal einladen. Frauen gehen nicht gerne alleine aus. Die brauchen immer jemanden, der ihre Hand hält. Und dann wollen die auch allen anderen Frauen zeigen, dass sie jemanden haben. Und die, die keinen haben sind dann neidisch. Und auch das ist Teil des Planes.“
Der Kommissar sah Armin an, als käme er von einem anderen Planeten. Sirius, vielleicht, dachte er sich. Er hatte gerade vor ein paar Wochen so eine Geschichte über ein Depot in den USA gelesen, wo man angeblich solche Wesen aus dem All aufbewahrte. Und einer solle von Sirius kommen, stand dort geschrieben. Irgendwie Gebiet 51, nannte man das. Natürlich war das, wie das in dem Artikel beschrieben wurde, streng geheim und in Wirklichkeit gab es dieses Gebiet 51 überhaupt nicht. Nur, dachte er sich, wenn es so geheim war, warum stand es dann in der Zeitung? Ein Grund konnte natürlich sein, dass es Sommer war und man nichts anders hatte, worüber es sich zu berichten lohnte. Das war auch die Zeit, in der man immer wieder das Monster im Loch Ness erblickte. Oder der älteste Mann der Welt in einem vergessenen Tal im Himalaya gefunden wurde, der sich noch gut an Edmund Hillary erinnerte, als er so Anfang zwanzig mit gerade diesem die größten Berge der Welt bestiegen hatte. Das machte ihn über 110 Jahre alt.
„Ja, des wird’s sein. Die will die andern neidisch machen. Des glaub ich auch. Da zieh ich mir dann extra eine alte Hos'n an, dass die b'sonders livid sind, die andern Frauen.“
Der Kommissar lehnte sich in seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme.
„Armin, eine Weisheit für's Leben: Eine Frau macht nichts, absolut nullkommanichts, nur so aus Vergnügen. Verstehst? Da steckt immer was dahinter. Nur dass wir des halt immer viel zu spät rausfinden, weil wir nicht den entsprechenden Denkapparat ham. Wir denken halt mehr grad aus, verstehst? Gedanklich in einer Einbahnstraße, immer vorwärts. Dann warten wir auf eine Kreuzung und geh'n in die andere Richtung. Wieder grad aus. Nur die Frauen, verstehst, die drehen auf einmal um, einfach so. Ohne Grund. Des haut dich dann immer aus der Bahn. Ein jedes Mal. Dann, wenn die Sach schon nicht mehr zum retten is, dann fällt uns des alles ein, was wir hätten machen sollen, dass wir nicht in diese Situation kommen. Aber dann is des zu spät, verstehst? Und deswegen denk ich nach, was sie von mir will. Damit ich drauf vorbereitet bin.“
Dann versank er wieder in seine Welt.
„Bleiben's noch lang?“
Die Bedienung stand hinter ihm. Der Kommissar drehte sich kurz um, nur um zu sehen, wer ihm diese Frage gestellt hatte. Er hatte nicht bemerkt, wie sie aus dem Lokal gekommen war. Die Türen zum Lokal waren offen, sie machte auf ihren weichen Gummisohlen kein Geräusch, als sie sich ihm näherte.
„Warum? Brauchen's den Stuhl für die andern Gäst, die da rein drängeln?“
Pausenlos fuhren Fahrräder an ihm vorbei. Ein blass roter angemalter Streifen auf dem schwarzen Asphalt bedeutete, das der Weg vor seinem Tisch ein Fahrradweg war. Es hätte aber auch eine Rennstrecke für Motorräder sein können. Jedenfalls der Geschwindigkeit nach, mit der diese Räder an ihm vorbeirauschten.
„Oder wolln's heimgehen?“, fragte der Kommissar, ohne sich nochmals umzudrehen. Er sagte es mehr in die Nacht, als zu jemandem.
„Na, aber wir woll'n da aufräumen, und weil Sie der einzige sind, der da noch sitzt, hamma uns denkt, dass mir amal fragen. Aber Sie können auch da bleiben, weil da räumen wir halt alles um Sie herum auf. Sie können aber auch reingehen, da is eh a bisserl wärmer. Da is auch noch a bisserl länger offen. Und allein sind's da auch nicht. Wenn's kein daheim nicht ham, müssen's halt dann umzieh'n, weil schlafen können's hier nicht.“
Der Kommissar reagierte nicht, verschränkte nur seine Arme und gab der Bedienung und der gesamten Welt damit zu verstehen, dass er sehr wohl nicht daran dachte, sich irgendwo hin zu verlegen. Er wollte draußen sitzen, gerade an diesem Tisch, da er auf die Gisela warten wollte, wenn sie aus der Oper kam. Er war noch am Nachmittag, nach reiflicher Überlegung und gedanklichen Ringkämpfen mit sich selbst, zu dem untrüglichen Schluss gekommen, es nicht zu riskieren. Das Treffen in der Oper. Mit der Gisela Spranger. Aber, da er kein Unmensch war, wollte er vor der Oper auf sie warten und sich dafür entschuldigen, dass er sie hat sitzen lassen. Und fragen, warum sie ihn hatte einladen wollen. Die extra Karte sah er als ziemlich schwache Ausrede an. Er vermutete Schlimmeres.
Er wusste, dass sie die U-Bahn am Marienplatz nehmen würde, um damit nach Forstenried zu fahren, wo sie in einem kleinen Häuschen im Maxhof wohnte. Sie hatte es von einem Onkel geerbt, damals vor vielen Jahren, als sie noch zusammen waren. Als sie ihm dieses Haus gezeigt hatte, waren sie noch sehr innig ineinander verliebt gewesen. Bei der Führung kam man ins Wohnzimmer, dann ins Schlafzimmer und danach ins Kinderzimmer. An diesem Ort hatte sie ihren Arm um Herbert Wengler gelegt und angefangen davon zu reden, wie viele Kinder sie doch gerne haben wollte. Das war das untrügliche und sichere Zeichen für ihn, es langsam aber sicher auslaufen zu lassen. Das mit der Liebe und dem zufriedenen Leben. Der Sicherheit, dem Kindergeschrei und den ständig laufenden Nasen. Den schmutzigen Windeln und dem damit verbundenen Geruch. So viel er wusste, wurde das Kinderzimmer nie als solches benutzt.
Um also dort hin zu gelangen, in ihr Haus, in dem sie immer noch wohnte, musste sie nahe an seinem Tisch vorbeikommen. Nahe genug, dass er sie sehen und nach ihr rufen konnte. Die Bedienung fing wieder an, Stühle an die Tische zu stellen und die Tischdecken zusammenzulegen. Ab und zu warf sie einen fragenden Blick auf den Kommissar, da sie nicht verstand, warum er immer noch da saß.
Taxis kamen und fuhren vor die Treppe, die hinauf zum Eingang der Oper führte. Das war das untrügliche Zeichen, dass die Aufführung in Kürze zu Ende war. Sein Freund und Stammtischbruder, der Ebner Rudi, war Taxifahrer. Daher wusste Wengler, wie das System funktionierte. Es gab eine Quelle im Theater, die die Zentrale anrief und Bescheid gab, dass in wenigen Minuten die Türen aufgingen. Diese Mitteilung wurde als Aufruf an alle Fahrer weitergegeben. Und dann ging das Rennen los. Der Rudi erzählte immer aufregende Geschichten von seinem bewegten Leben, wenn man sich zum Stammtisch traf. Die traurigsten waren die, in denen er nach Mitternacht einsame Frauen abholte. Dann fuhr man in der Stadt herum, sie saßen bei ihm im Wagen und redeten. Sie wollten nirgendwo Bestimmtes hin, nein, sie saßen nur da und sprachen von ihrer Einsamkeit, von der Schlechtigkeit der Männer, die sie verlassen hatten, der beschissenen Welt und wieder ihrer Einsamkeit. Und die Uhr lief. Und der Rudi Ebner hörte zu. Er hatte sogar Stammkundinnen, die nur nach ihm verlangten, wenn sie die Zentrale anriefen. Dann hieß es von der Maria, die dort am Mikrofon saß: „Rudi, Schwanthaler 7, dritter Stock. Weißt eh.“ Und er wusste: Des wird wieder lang werd'n.
Vor dem Theater dauerte es keine fünf Minuten mehr und alle Türen gingen wie auf Kommando auf. Die Menschen strömten wie ein Tsunami nach draußen. Nichts konnte sie aufhalten. Der Stärkere gewann. Es wunderte Wengler, dass man sich nicht gegenseitig niedertrampelte. Aus dem bis dahin ruhigen Platz wurde ein chaotisches Gewimmel von Menschen, Autos, Bussen, Motorrädern und allen möglichen technischem Gerät, das diesen Menschen half, möglichst schnell dem Durcheinander zu entfliehen. Irgendwie konnte man sich des Eindruckes nicht verwehren, dass diese Menschen auf der Flucht waren. Ein weiteres Indiz für Herbert Wengler, die Oper zu meiden. Warum erst hingehen, wenn man dann nicht schnell genug weg kommen konnte? Wengler hielt angestrengt nach seiner Gisela Ausschau. Sie hatte sicher nicht einen dieser Pelze an, die man im Winter trugt, wenn es kalt war, und im Sommer nur, um damit anzugeben. Also konnte er diese Schönen der Nacht schon einmal vergessen. Dann gab es noch die Jungen, die mit zerrissenen Jeans, Ringen an allen möglichen Körperteilen, Tätowierungen und grellfarbenen Jacken in die Oper gingen. Auch dieser Gruppe war Gisela nicht zuzuordnen. Eher der Gruppe von gediegenen Frauen mit karierten Röcken und Trachtenjacken, vielleicht noch einem grünen Hut mit Entenfeder und einem bunten Schal.
Gisela Spranger kam ursprünglich aus dem Bayerischen Wald. Ein kleines Nest, irgendwo zwischen Straubing und Deggendorf. Der Kommissar hatte den Namen des Ortes bereits vor Jahren vergessen. Jedenfalls war ihr Vater dort Bürgermeister und hatte seine Tochter nach München geschickt, damit sie dort etwas lernen könne, was ihr im Wald versagt geblieben wäre. Im Nachhinein musste er diesen Entschluss wahrscheinlich schwer bereut haben, dachte sich Wengler. Herbert Wengler traf sie auf einer Party, als sie gerade einmal ein paar Wochen in der Hauptstadt war. Es war eine dieser Feiern, die sich spontan ergeben hatte. Man traf sich eben, der eine rief den anderen an und man kam zusammen. Dann saß man herum, rauchte alles außer Zigaretten, trank, was eben da war und einem den Kopf zudröhnte, und freute sich ansonsten des Lebens. Dazu gab es kalte Pizza und billigen, italienischen Rotwein aus Fünfliterflaschen. Erst war sie ihm nicht aufgefallen, da er dort einige Mädchen kannte, die ihn zu dieser Zeit stark interessierten. Nur war dieses Interesse eben mehr einseitig. Von seiner Seite aus einseitig. Als er das endlich nach mehreren erfolglosen Versuchen begriffen hatte, sah er sich um und entdeckte jemanden, den er vorher noch nie gesehen hatte. Sie hatte – und das war sehr ungewöhnlich in dieser Zeit der Hippies und Revolutionäre, der weiten Hosen und bunten Hemden – einen großen Dutt am Kopf. So eine Knolle aus Haar, die am Hinterkopf festgemacht war. In München kannte man das nur aus Zeitschriften aus den fünfziger Jahren. Wenn man so eine Zeitschrift einmal zufällig auf dem Flohmarkt aufgeschlagen und sich halb tot gelacht hatte. Dazu hatte sie einen grau karierten Rock, graue Strumpfhosen und schwere schwarze Schuhe an. Doppelt besohlt, damit sie auch lange hielten. Eine graue Jacke mit blauem Rautenmuster vervollständigte die überaus modisch akzentuierte Ausstattung. Diese Frau, dachte er sich, braucht modische Beratung, was die Kleidung anbelangt. Und nicht nur in dieser Hinsicht brauchte sie Aufklärung der Münchener Szene. Obwohl er sicher nicht der richtige war, jemandem in diesen Sachen zur Seite zu stehen, konnte er doch zumindest in diesem schweren Fall auch mit seiner geringen Begabung etwas ausrichten. Und damit Gutes tun. Also ging er zu ihr, die alleine auf einem Stuhl saß, an einem Glas schalem Bier nuckelte und ansonsten in sich versunken war.
„San's neu hier, Fräulein?“, fragte er und setzte sich neben sie.
„Sieht ma des?“
„Na, nicht im Geringsten. Ich hab Sie halt noch nie g'sehn, bin aber auch nicht immer da.“
Dann war Ruhe. Sie widmete sich wieder ihrem Glas und sah in die Runde. 'Schwerer Fall', dachte sich Herbert Wengler. 'Da muss man mit schwereren Geschützen auffahren.' Da sie irgendwie einfach gesellschaftlich zurückgeblieben aussah, dachte er sich, die treuselige, konservative Platte aufzulegen.
„Ich bin der Herbert, angehender Polizist, müssen's wissen. Nicht so einer von dene Studenten, die immer nur so tun, als würden's was lernen. In Wirklichkeit diskutieren die, bis das die nicht mehr können. Dann fallen's um und schlafen ihren Rausch aus. Und am andern Tag geht des wieder von vorn los. Wenn's was wissen woll'n von unserer Stadt, können's mich fragen, weil die kenn ich wie mei Hosentaschen. Ich kann Ihnen alles zeigen. Auch Sachen, die nicht a jeder kennt.“
„Aha.“
Wieder Ruhe. Wieder die Verklemmtheit, die aus all ihren Poren tropfte. Das war wirklich ein kompliziertes Unterfangen. Normalerweise hätte er an diesem Punkt aufgegeben, 'Servus dann' gesagt und wäre gegangen. Aber an diesem Abend hatte er schon so viele Niederlagen erlitten, dass er die Herausforderung annehmen musste, wollte er den kümmerlichen Rest seines angeschlagenen Selbstvertrauens nicht vollständig verlieren. Er sah sie an, lächelte und wartete auf eine Reaktion.
„Ja, dann“, meinte sie auf einmal, „wenn's von da Polizei sind, können's mich ja festnehmen und auf's Präsidium mitnehmen“, stand auf und bewegte sich in Richtung Tür. Damit war das Eis gebrochen. Er folgte ihr. Und der darauf folgende Rest der Nacht war nur der Anfang einer sehr wechselhaften und manchmal auch anstrengenden Beziehung. Sie ging durch alle Höhen und Tiefen, die man sich vorstellen, aber nicht wünschen konnte. Bis eben zu dem verhängnisvollen Tag mit dem Kinderzimmer. Das war dann das Ende.
„Gisela!“, rief Wengler nun, als sie einige Meter entfernt von ihm endlich auftauchte und Richtung Marienplatz ging.
„Gisela!“, rief er noch einmal, da sie nicht reagierte. Da blieb sie auf einmal doch stehen und drehte sich um. Sie schien zu überlegen, wie sie auf den Ruf reagieren sollte. Ihre Blicke trafen sich zwischen Spatenbräu und der ehemaligen Hauptpost. Heute war es ein Gebäude mit überteuerten Geschäften und noch teureren Wohnungen. Die Post hatte man ins Internet verlegt. Es war Gisela anzusehen, dass sie nicht sehr angetan war, ihre geplatzte Verabredung zu sehen.
„Ich hab die ganze Zeit auf dich g'wart. Geh her und setz dich, dann könnt ma mitanander red'n“, rief Wengler durch die Menge und die Fahrradfahrer, die wie Geschosse an ihm vorbei fuhren.
Gisela Spranger war eine gepflegte Frau in den Fünfzigern, der man die Jahre nicht unbedingt ansah. Besonders, wenn sie sich herausgeputzt hatte, Puder auf ihre Wangen stäubte und die Lippen anmalte. Auch ging sie regelmäßig zum Friseur, um sich ihre gerade noch blonden, mittellangen Haare in Dauerwellen legen zu lassen. Ihre Figur war ein wenig mollig, nicht dick. Nur eben ein wenig mehr auf den Hüften, als man vielleicht haben sollte. Rubenssch, nannte man das. Es zeugte von gutem Leben, wie ihre ganze Erscheinung den Eindruck vermittelte, dass es ihr gut ging. Es schien ihr an nichts zu fehlen, wenigstens nicht materiell. Sie hatte den Ruf der bekannten Stimme gehört, wenn sie auch überrascht gewesen war, sie um diese Zeit und an diesem Platz zu vernehmen. Langsam hatte sie sich umgedreht und versucht, durch die Menge Herbert Wengler auszumachen. Nachdem ihre Blicke sich getroffen hatten, ging sie in Richtung seines Tisches, nahm sich einen Stuhl, den sie erst umständlich auseinanderklappen musste, und setzte sich, ohne auch nur ein Wort zu sagen.
„Ja, weißt,“ fing Wengler an zu sprechen, „ich hab mir denkt, dass des nicht so ein guter Gedanke war mit dem Ausgeh'n und so. Aber wissen hätt ich doch wollen, was'd hätt'st wollen von mir. Und sagen wollt ich noch, dass mir des leid tut. Ich hätt dich anrufen soll'n.“
„Herbert, du wirst dich nie ändern. Immer noch der selbe alte Depp, der immer denkt, das ma ihm was will. Wie damals, wie du ganz einfach weg warst. Von einem Moment auf den anderen. Nix hab ich mehr g'hört von dir. Und deine Freund, die ham g'sagt, du wärst auf'm Lehrgang. So viele Lehrgäng' gibt's auf der ganzen Welt nicht, auf dene du warst.“
„Da hab ich einfach Angst g'habt, weil du g'sagt hast, du hätt'st gern mindestens fünf Kinder. Und des war des Letzte, was ich hätt haben woll'n. Da hat's nur eins geben: bisserl Abstand halten. Dann hab ich mir denkt, wenn wir uns a paar Tag nicht sehn, dann geht des vorbei. Ich mein, des mit die Kinder. Und dann is des irgendwie aus dem Ruder g'laufen.“
„Nein, des is des net, Herbert. Die Sabine Redecker, die Schlamp'n, is in deinem Leben an'kommen und dann war ich sehr schnell vergessen. Wenn des wenigstens a G'scheite g'wesen wär, so eine mit a bisserl was im Kopf, aber wenn eine so lange Füß hat bis zum Hals nauf, schalt's ihr Männer ganz einfach des Hirn aus. Und jetz tu net so, als wenn du da nix hätt'st machen können. Warum hast denn nix g'sagt? Des mit dene Kinder, des hätt ma doch diskutier'n können.“
Auf einmal schweifte der Blick von Gisela Spranger ab hinter Herbert Wengler, der nicht bemerkt hatte, dass dort mittlerweile jemand mit einem Fahrrad stand und sie beobachtete. Auch der Kommissar drehte sich nun irritiert um, um zu sehen, was denn los sei. Dann holte er tief Luft. Er ahnte, was auf ihn zukommen würde.
2
Es war ein lauer Sommerabend und Erika Wiesner und Gerhard Schottsprengel gingen langsam an der Isarböschung beim Deutschen Museum Richtung Norden spazieren. Sie waren den ganzen Abend in der Wirtschaft in der Au gewesen, oben am Hang, und wollten noch ein wenig an der Isar flanieren, bevor sie sich auf den getrennten Nachhauseweg machen mussten. Der Mond stand hoch und hell wie eine große, goldene Scheibe am tiefblauen Himmel. Fast hätte man meinen können, es wäre später Nachmittag, so hell war es. Die Geräusche vom Biergarten der Wirtschaft, die Musik der Blaskapelle, das Lachen, Reden, Klirren und Rufen, entfernten sich mit jedem Schritt mehr. Kaum das man sie noch wahrnehmen konnte, von dort unten an der Isar. Nur das leise Rauschen des flachen Flusses war hörbar, wenn das Wasser wie seit Tausenden von Jahren über die abgeschliffenen Steine floss. Um diese Zeit war dies eine einsame Gegend. Die beiden wollten ein bisschen alleine sein, sich ein wenig der Stille hingeben. Und anderen Dingen. Ihre Beziehung war noch jung, zart wie ein kleiner Spross, den man nicht anfassen sollte. Man konnte ihn sich ansehen, ihm gut zureden, ihn aber nicht berühren. Denn es könnte sein, dass man ihn damit zerquetschte und damit etwas kaputt machte, was noch keine Chance hatte zu leben. Man musste vorsichtig sein.
„Des wär a schön's Platzerl, Erika, da könnt ma uns noch a bisserl hinsetzen, was meinst? Ist's dir weich genug? Sonst rupf' ich noch was von dem Gras raus. Schau, das Gras is ganz hoch, da sind wir ungestört.“
„In der Nacht is doch eh niemand nicht da, Gertl, da musst keine Angst ham“, meinte sie leise lächelnd und irgendwie erwartungsvoll. Ihre weißen Zähne glänzten im Mondlicht wie Süßwasserperlen. Dann nahm sie seine Hände und führte ihn noch weiter ins Gebüsch. Sie gingen ein wenig ins Dickicht hinein und setzten sich hin, in die weiche Wiese und unter die Bäume, keine zwei Meter vom Weg entfernt. Es hatte lange nicht geregnet, alles war trocken. Das untere Gras war dicht und verwachsen und fühlte sich an wie ein dicker Teppich. So saßen sie nebeneinander und sahen sich in die Augen. Beide lächelten verliebt, aber weder sie noch er wollten den ersten nächsten Schritt machen. Gerhard lehnte sich schließlich ein wenig nach hinten und stütze sich auf seine Ellenbogen auf. Er hatte einen Grashalm im Mund, auf dem er langsam kaute. Dann ließ er seinen Kopf malerisch nach hinten fallen, wie er glaubte – und schlug auf einen harten Gegenstand auf. Er spang auf.
„Sakra, was war jetz des?“
„Was is denn, Gertl, hast was?“
„Mein Belli hab ich mir ang'haut. Müssen die Deppen jetz schon an der Isar ihren blöden Schrott da liegen lassen?“
Er schaute sich um, um zu sehen, woran er sich gestoßen hatte. Es war ein Fahrrad. Sein Kopf war auf das Pedal eines Fahrrads gestoßen. Er fasste sich an den Hinterkopf, um zu fühlen, ob er blutete.
„Lass sehn“, meinte Erika, die mittlerweile auch aufgestanden war.
„Na, da is nix. Ich seh nix.“
„Wirst nix sehn', is doch dunkel.“
Gerhard faßte sich an die Stelle und betrachtete seine Finger.
„Na, war net so schlimm. Lass amal schaun, was des is.“
Er ging näher an das Gefährt heran. Das Gras war hoch, man sah nur das Pedal, das aus dem Unkraut hervorragte. Der Rest verschwand im Dickicht. Gerhard schob das Dickicht zur Seite. Das Fahrrad war voll bepackt mit allen möglichen Tüten und Paketen, soviel konnte man noch sehen. Dicke Schnüre hielten alles zusammen. Plötzlich erschrak Gerhard:
„Erika, ruf die Polizei. Ich glaub, da liegt jemand unter dem ganzen Zeug da.“
Ein spitzer, schriller Schrei von Erika durchschnitt die ansonsten ruhige Nacht. Vögel schlugen mit den Flügeln, Tiere rannten durch das Gebüsch. Fast hätte man meinen können, dass sogar die Isar für einen winzigen Moment vergessen hatte zu fließen. Erikas Aufschrei hatte die Natur in ihrer Ruhe gestört, sie aufgeweckt. Sie machte einen Schritt zurück und hielt sich die Hand vor den Mund, als wolle sie nicht noch einmal alles durcheinander bringen.
„Was is'n da, Gertl?“, fragte sie nun erschrocken und leise, fast so still, dass man es nicht hören konnte. Als wolle sie nichts aufwecken, was da unter dem Fahrrad lag.
„Erika“, meinte er betroffen, aber dennoch sehr ruhig, da er seine Freundin nicht noch mehr aufregen wollte, „ruf die Polizei.“
Dann nahm er sie bei den Schultern und schob sie weiter weg vom Ort des Geschehens.
„Des brauchst net sehn. Und bleib da, wo'st jetz bist. Des is am besten.“
Erika holte mit zitternden Händen das Telefon aus ihrer Handtasche, wählte 110 und gab es ihrem Freund. Sie war nicht mehr in der Lage, ein vernünftiges Wort herauszubekommen, geschweige denn, ein Gespräch mit der Polizei zu führen. Und außerdem wusste sie auch nicht, was genau da los war und was sie dem Beamten erzählen sollte.
Dann gingen sie auf die Brücke und warteten. Der Polizist am Telefon hatte zwar gemeint, sie sollten warten, wo sie waren, sich nicht vom Fleck weg rühren und nichts anfassen. Nur dort stehen und warten. Die Streife wäre in ein paar Minuten da.
Er wollte oben auf die Brücke gehen, damit er die Polizei kommen sehen konnte, wenn sie kam. Sie jedoch hatte sich standhaft geweigert, dort unten an der Isar alleine zu sein.
„Willst, dass die mich auch noch derschlagen“, hatte sie gemeint, als Gerhard vorschlug, dass sie unten in der Nähe des Fahrrads und er oben an der Brücke warten sollte. Das war natürlich ein Argument, dem er auf die Schnelle nicht widersprechen konnte.
Es verging nicht viel Zeit und ein Polizeiauto kam die Zenneckbrücke entlang und blieb dort stehen.
Die Brücke war eine Verbindung von der Zeppelinstraße, die an der Isar entlangging, und dem Deutschen Museum, das auf einer Insel in der Isar lag. Nachts allerdings wurde diese Brücke nicht befahren, da das Museum um diese Zeit geschlossen war. Langsam und leise, nur mit angeschaltetem Blaulicht und vollen Scheinwerfern, die den Weg taghell erleuchteten, kam das Auto nun den Weg entlang. Gerhard Schottsprengel winkte mit beiden Armen, als er den Wagen kommen sah.
Die Polizisten stiegen aus. Das Licht am Auto ließen sie an. Es machte Gespenster aus normalen Menschen. Als die Lampen von unten in das Gesicht von Gerhard leuchteten, der nun genau vor dem Auto stand, sah er aus wie Nosferatu. Nur etwas jünger.
„Hauptwachtmeister Brettner. Ham Sie an'grufen?“, fragte der Wachtmeister, als er auf ihn zuging.
„Sehn's noch jemanden hier außer uns zwei, Herr Hauptwachtmeister?“
„Jetz werd'ns net frech, junger Mann, sonst reden wir in an andern Ton, der Ihnen net g'fallen wird. Also, was is los?“
„Gehn's mit, dann zeigen wir Ihnen was“, meinte Gerhard und setzte sich in Bewegung. Alle, einschließlich Erika, die sich geweigert hatte, alleine am Tatort zu bleiben, gingen langsam, unter Polizeischutz sozusagen, von der Brücke die Böschung hinunter und in Richtung der Stelle, an der das Fahrrad lag. Gerhard deutete mit der Hand dorthin:
„Da liegt wer. Wir ham nix ang'fasst. Nur mein Kopf hab ich mir ang'haut, wie wir da so im Gras liegen. Dann hamma des Radl g'sehn und wie ich g'schaut hab, seh ich die Person da unter dem Radl.“
Der zweite Polizist, der zwar mitgegangen war, aber bis dahin nichts gesagt hatte und nun neben seinem Kollegen stand, knipste eine große Taschenlampe ein.
„Robert, geh und schau“, trug ihm Wachtmeister Brettner auf.
Langsam und behutsam ging sein Adjutant ins Gras, schob es vorsichtig beiseite, leuchtete ein wenig herum und kam schnell wieder heraus.
„Ja, da liegt wer. Rührt sich nimmer, wie's ausschaut. Direkt unterm Radl. Ich mein, die schnauft nicht mehr.“
„Ja, sauber. Ich glaub, da müss ma die vom Kommissariat anrufen.“
Damit ging der Hauptwachtmeister zurück zum Auto und ließ seinen Kollegen am Tatort zurück. Das Pärchen, das sie dort hingeführt hatten, folgte Hauptwachtmeister Brettner nach oben zum Auto. Dieser nahm sein Funksprechmikrofon in die Hand und sagte:
„Hier Isar 44. Zentrale, bitte kommen.“
„Isar 44, was is?“
„A Leich hamma hier an der Isar. Schickt's amal die SpuSi und die MoKo, dass die sich des anschau'n. Wir lassen des wie's is und warten.“
„Macht's, dass da keiner was anrührt“, kam es aus dem Lautsprecher zurück.
„Der Bereich wird gesichert, rotscher.“
Das 'Roger' hatte er in einem Film gehört, der in Amerika spielte. Er fand das sehr passend und führte es für sich auch bei der Münchener Polizei ein. Mit einem bayerischen Akzent allerdings. Sozusagen.
„Seit's euch sicher, dass des a Leich is?“, kam es noch einmal aus dem Lautsprecher.
„Da liegt wer und der rührt sich nimmer. Des muss a Leich sein, was denn sonst? Wenn des keine Leich nicht wär, würd die Person doch aufstehn.“
„Is ja schon in Ordnung. Hab doch nur sicher sein woll'n, dass des auch stimmt, bevor ich die da raus schick. Weißt eh, wie die sind, um die Zeit. Ich hab euch auf'm Display. Wird gleich jemand kommen. Bleibt's da, bis die eintreffen.“
„Gut, wir warten, rotscher, Isar 44.“
Damit hängte der Hauptwachtmeister das Mikrofon wieder in die dafür vorgesehene Halterung und ging zu den beiden, die noch immer im Scheinwerferlicht standen. Erika hatte sich an Gerhard angelehnt und meinte:
„Des wird a bisserl kalt, Herr Wachtmeister.“
Dabei zitterte sie leicht aber unablässig. Ob es die Kälte war, die ihr langsam in die Knochen fuhr, oder ganz einfach die Aufregung, war nicht eindeutig auszumachen.
„Können wir vielleicht heim gehn?“
„Ja“, stimmte auch Gerhard ein, „wir ham ja nix ang'fasst, sondern nur mit die Augen des g'sehn. Wir können ja nix machen, wenn wir da rumstehn, oder?“
Nachdem er ihre Personalien aufgenommen hatte, ließ Hauptwachtmeister Brettner sie gehen. Er hatte auch noch wissen wollen, warum sie um diese Zeit an der Isar waren, erhielt darauf jedoch nur eine vage Antwort.
„Eine Frag hab ich noch, bevor dass ihr geht’s“, meinte er schließlich, als sie sich schon ein paar Schritte entfernt hatten.
„Ja, Herr Wachtmeister?“
Hauptwachtmeister Brettner stellte sich breitbeinig vor die beiden hin, die sich noch einmal umgedreht hatten.
„Des is aber schon a gewaltiger Zufall, dass ihr euch grad da hinlegt's, wo dass die Person da liegt.“
„Ja, und? Was wollen's damit sagen?“
„Nix, ich mein ja nur, Herr Schottsprengel. Der Kommissar wird sich da schon a bisserl wundern. Überall is nix los und ihr legt's euch grad da hin.“
„Glauben's mir, Herr Wachtmeister, wir hätten uns auch gern zwei Meter woanders hing'legt“, meinte der Gerhard ein wenig konsterniert. Damit drehten sie sich wieder um und gingen zurück in Richtung Wirtschaft. Sie hatten es eilig, von diesem Schauplatz wegzukommen. Der Abend war ohnehin gelaufen, dachte sich Gerhard Schottsprengel. 'Wieder nix g'wesen. So a Sauerei', haderte er mit dem Schicksal, lächelte dabei jedoch seine neue Eroberung an, die allerdings nicht verstand, wie man unter diesen Umständen noch lächeln konnte.