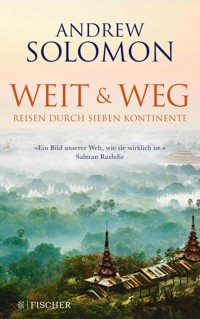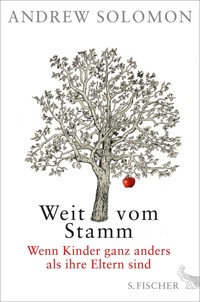9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der New-York-Times-Bestseller über die Volkskrankheit Depression – aktualisiert und mit einem neuen Kapitel über Schwangerschaftsdepression. Seit vielen Jahren ist Saturns Schatten das Standardwerk zum Thema Depression. Andrew Solomon gelingt eine facettenreiche Darstellung dieser weitverbreiteten Erkrankung, indem er sowohl persönliche Erfahrungen als auch theoretisches Wissen einbringt. Das Buch bietet konkrete Hilfe und Informationen für Betroffene und Angehörige und gewährt tiefe Einblicke in eine oft unverstandene Welt. Solomon lässt andere Betroffene zu Wort kommen, erläutert verschiedene Therapieformen und präsentiert die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. In der aktualisierten Auflage geht er zudem auf das Thema Schwangerschaftsdepression ein. »Saturns Schatten ist das ungewöhnliche Zeugnis eines Leidens – Aufrichtigkeit gepaart mit Aufklärung«, so John Berger. Daniel Goleman, Autor von »Emotionale Intelligenz«, lobt: »Andrew Solomon verschafft uns einen faszinierenden Einblick in die dunkle Seite unserer Seele.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1275
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andrew Solomon
Saturns Schatten
Die dunklen Welten der Depression
Über dieses Buch
Andrew Solomon ist gerade auf Lesetour mit seinem gefeierten ersten Roman, als er völlig unerwartet, gerade dreißig Jahre alt, an einer schweren Depression erkrankt. Mit ungewöhnlicher Offenheit schildert er den Verlauf seiner Krankheit. Damit gelingt es ihm, die Welt der Depression auch für Außenstehende erfahrbar zu machen.
Doch Solomon geht über seine eigenen Erfahrungen hinaus, er lässt andere Betroffene zu Wort kommen, erläutert verschiedene Therapieformen und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Andrew Solomon hat in Yale und Cambridge studiert. Unter anderem schreibt er für den »New Yorker«, »Newsweek« und den »Guardian«. Er ist Dozent für Psychiatrie an der Cornell University und beratend für LGBT Affairs am Lehrstuhl für Psychiatrie der Yale University tätig. Sein großes Buch über Depression »Saturns Schatten« war ein internationaler Bestseller und wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem National Book Award und der Nominierung für den Pulitzer Preis. Er lebt mit seinem Mann und seinem Sohn in New York und London. Für sein zuletzt erschienenes Buch »Weit vom Stamm« erhielt er den National Book Critics Circle Award 2013.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Erweiterte Neuausgabe
Covergestaltung: +malsy, Bremen
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2001 unter dem Titel »The Noonday Demon« bei Scribner, New York.
Kapitel 1 bis 9 wurden von Hans Günther Holl übersetzt, Kapitel 10 bis 12 von Carl Freytag
und der Epilog samt Kapitel 13 von Gabriele Gockel und Gerlinde Schermer-Rauwolf
© Andrew Solomon 2001
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2001 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491109-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Vorbemerkung
1. Depressionen
2. Zusammenbrüche
3. Therapien
4. Alternativen
5. Populationen
6. Sucht
7. Selbstmord
8. Historisches
9. Armut
10. Politik
11. Evolution
12. Hoffnung
Epilog Seither
13. Schwangerschaftsdepression
Anmerkungen
Vorbemerkung
1. Depression
2. Zusammenbrüche
3.Therapien
4. Alternativen
5. Populationen
6. Sucht
7. Selbstmord
8. Historisches
9. Armut
10. Politik
11. Evolution
12. Hoffnung
Epilog: Seither (Teil 1)
13. Schwangerschaftsdepression
Epilog: Seither (Teil 2)
Medikamentenliste
Bibliographie A-K
Bibliographie L-Z
Danksagung
Ergänzung zur erweiterten Neuausgabe
Namen- und Sachregister
Für meinen Vater,
der mir nicht nur ein-,
sondern zweimal
das Leben geschenkt hat
Alles wird vorübergehen: Leiden, Qualen, Hunger, Blut und Massensterben. Das Schwert wird verschwinden, aber die Sterne werden auch dann noch da sein, wenn von unseren Leibern und Taten auf Erden kein Schatten mehr übrig ist. Die Sterne aber werden immer so da sein, schön und flimmerig. Es gibt keinen Menschen, der das nicht wüsste. Warum also wollen wir unseren Blick nicht zu den Sternen erheben? Warum?
Michail Bulgakov, Die weiße Garde
Vorbemerkung
Nach fünf Jahren intensiver Arbeit an diesem Buch kann ich die Herkunft der darin entwickelten Gedanken im Einzelnen nicht mehr nachweisen. Dennoch habe ich versucht, alle benutzten Quellen aufzuführen, und die Anmerkungen an den Schluss gestellt, um den Leser nicht durch einen Wust von Eigennamen und Fachbegriffen im Text abzulenken. Meine Gesprächspartner behielten, sofern sie dem zustimmten, um der Glaubwürdigkeit willen ihre wahre Identität. In einem Buch mit dem Ziel, psychische Krankheiten zu entstigmatisieren, sollte man dem Stigma auch nicht durch die Verfremdung der Namen depressiver Menschen Vorschub leisten. Allerdings wollten sieben meiner Helden aus triftigen Gründen anonym bleiben und erscheinen nun im Text als Sheila Hernandez, Frank Rusakoff, Bill Stein, Danquille Stetson, Lolly Washington, Claudia Weaver und Fred Wilson. Sie sind jedoch keine Kunstpersonen, und ich habe mich um die möglichst getreue Wiedergabe ihrer Aussagen bemüht. In den Mood Disorders Support Groups (MDSG) kennt man einander nur mit den Vornamen, die ich aus Gründen der Diskretion geändert habe.
Dieses Buch handelt in erster Linie vom Lebenskampf schwer geprüfter Männer und Frauen, die mir ihre Leidensgeschichten erzählt haben. Dabei kam es mir zwar auf eine gewisse innere Schlüssigkeit an, ohne dass ich aber im Allgemeinen die Fakten selbst überprüft oder auf strenger Logik bestanden hätte.
Viele wollen wissen, auf welchem Weg ich meine Zeugen fand. Wie in den Anmerkungen dargelegt, haben mir eine Reihe von Ärzten Kontakte zu ihren Patienten vermittelt. Ansonsten lernte ich selber im Alltag zahlreiche Menschen kennen, die von meinem Thema hörten und sich freiwillig anboten, mir ihre zum Teil sehr faszinierenden Geschichten zu erzählen, die schließlich Eingang in mein Quellenmaterial fanden. Im Jahr 1998 veröffentlichte ich in The New Yorker einen Artikel über Depressionen und bekam in den folgenden Monaten mehr als tausend Leserbriefe. Graham Greene sinnierte einmal: »Schreiben ist eine Art Therapie; manchmal frage ich mich, wie all jene, die nicht schreiben, komponieren oder malen, es zuwege bringen, dem Wahnwitz, dem Trübsinn und der panischen Angst, die dem menschlichen Dasein innewohnen, zu entfliehen.« Ich meine, dass er die Zahl der Menschen, die auf die eine oder andere Weise schreiben, um ihre Melancholie und panische Angst zu lindern, gewaltig unterschätzte. Beim Beantworten der Berge von Post fragte ich einige der Absender, deren Zeilen mich besonders bewegt hatten, ob sie daran interessiert wären, mir Interviews für mein Buch zu geben. Außerdem besuchte ich als Teilnehmer oder auch Referent verschiedene Kongresse und lernte dort Betroffene kennen, die therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen.
Noch nie hatte ich über ein Thema geschrieben, das so viele Menschen anspricht beziehungsweise zum Sprechen bringt: Material über Depressionen zu sammeln ist erschreckend einfach. Am Ende gewann ich den Eindruck, dass in diesem Forschungsgebiet vor allem eine große Synthese nottäte, denn Naturwissenschaftler, Philosophen, Juristen, Psychologen, Literaten, Künstler, Historiker und andere Gelehrte befassen sich meist unabhängig voneinander mit dem Problem der Depression. So vielen interessanten Menschen widerfährt Interessantes, das sie aufschreiben und veröffentlichen – doch es fehlt die strukturierende Synthese. Wenn ich in erster Linie Empathie anstrebe, so in zweiter Linie Ordnung, die mir viel schwerer erreichbar scheint, soll sie doch möglichst durchgängig auf Empirie beruhen und nicht auf weitschweifigen, von wahllosen Anekdoten abgeleiteten Verallgemeinerungen.
Ich muss betonen, dass ich weder Arzt noch Psychologe, geschweige denn Philosoph bin. Dies ist ein sehr persönliches Buch und nur in diesem Sinne zu verstehen. Obwohl ich darin versuche, komplexe Vorstellungswelten zu erklären und zu interpretieren, soll es keineswegs geeignete Therapien ersetzen. Ich möchte einen Beitrag zur Aufklärung von Ärzten und Patienten leisten, damit es ihnen gelingt, die Qualen der Depression zu überwinden.
Nicht nachgewiesene Zitate stammen aus persönlichen Gesprächen, die ich überwiegend in den Jahren 1995 bis 2001 geführt habe. Ich habe nur solide, das heißt möglichst gründlich geprüfte und häufig zitierte Statistiken benutzt. Im Allgemeinen musste ich jedoch feststellen, dass statistische Angaben in diesem Gebiet eher ungereimt sind und viele Autoren damit lediglich bestehende Hypothesen absichern oder garnieren wollen. Zum Beispiel ergab eine größere Studie, dass depressive Drogenabhängige fast immer Stimulantien wählen, und eine andere, ebenso überzeugende, dass diese Gruppe sich durchweg für Opiate entscheidet. Viele Autoren leiten aus Statistiken eine ziemlich bornierte Selbstsicherheit ab, als sei es fasslicher und wahrer, beweisen zu können, dass ein Phänomen in 82,37 Prozent und nicht in knapp vier Fünfteln der Fälle auftritt. Aus meiner Sicht lügen gerade die exakten Zahlen, denn was sie darstellen, lässt sich in Wirklichkeit gar nicht so genau bestimmen. Zur Häufigkeit von Depressionen können wir nichts Genaueres sagen, als dass sie ziemlich verbreitet sind und mehr oder weniger direkt uns alle betreffen oder heimsuchen.
Über die Pharmakonzerne kann ich kaum unvoreingenommen schreiben, weil mein Vater selbst in dieser Branche tätig ist und mir daher der Abstand fehlt. Derzeit wirft man der Pharmaindustrie oft vor, sie schlage Kapital aus den Kranken. Doch meiner Erfahrung nach sind die Unternehmer sowohl Kapitalisten als auch Idealisten – zwar gewinnorientiert, aber auch voller Hoffnung, mit ihrer Arbeit den Menschen helfen und wichtige Entdeckungen fördern zu können, um bestimmte Krankheiten ein für alle Mal auszurotten. Ohne entsprechende Forschungsinvestitionen gäbe es zum Beispiel keine selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRIs), die mit ihrer antidepressiven Wirkung viele Menschenleben retten. Ich habe mich redlich um eine klare Sicht der Branche bemüht, sofern sie im Folgenden eine Rolle spielt. Wegen meiner schweren Depressionen hat mein Vater das Tätigkeitsfeld seines Unternehmens auf Antidepressiva ausgedehnt. Heute vertreibt es auf dem US-amerikanischen Markt Celexa.[1] (Zur Vermeidung jedweder Interessenkonflikte erwähne ich das Medikament jedoch nur, wenn es sich nicht umgehen lässt.)
Während der Arbeit an diesem Buch bin ich oft gefragt worden, ob das Schreiben kathartisch wirkte: Das tat es nicht. Meine Erfahrungen mit diesem Thema entsprechen denen anderer Autoren. Über Depressionen zu schreiben schmerzt, macht traurig, vereinsamt und belastet. Dennoch half mir der Gedanke, etwas Nützliches zu tun; und der Lernprozess dabei nützte wiederum auch mir selbst.
Ich hoffe, der Leser erkennt, dass meine Freude an diesem Buch vor allem eine solche der literarischen Darstellung und nicht der therapeutischen Selbstentblößung ist.
Anfangs hatte ich nur über meine Depressionen geschrieben, dann über gleichartige und später auch andersartige bei Dritten und schließlich über Depressionen in völlig fremden Kontexten. So habe ich in dieses Buch drei Fallgeschichten aus Ländern jenseits der ersten Welt aufgenommen: Ich berichte über meine Gespräche mit Menschen in Kambodscha, Senegal und Grönland, um Gegengewichte zu den kulturspezifischen Depressionskonzepten zu bilden, die viele Ansätze in diesem Gebiet einengen. Meine Reisen in ferne Länder waren von einer gewissen Exotik geprägte Abenteuer, und ich habe gar nicht erst versucht, das Märchenhafte dieser Erlebnisse auszutilgen.
Die Depression ist unter verschiedenen Namen und in mannigfachen Gestalten aus biochemischen und gesellschaftlichen Gründen immer allgegenwärtig gewesen. Mit diesem Buch strebe ich an, sie in ihrer ganzen historischen und geographischen Bandbreite zu erfassen. Wenn es mitunter so scheint, als seien Depressionen die ureigene Domäne der modernen westlichen Mittelschichten, so deshalb, weil wir in diesem Umfeld jetzt plötzlich anspruchsvollere Methoden entwickeln, Depressionen zu erkennen, zu benennen, zu therapieren und anzunehmen – jedoch nicht, weil wir irgendeinen Sonderanspruch auf die Krankheit selbst hätten. Kein Buch kann das volle Spektrum des menschlichen Leidens ausloten, doch möchte ich es wenigstens andeuten in der Hoffnung, damit Menschen helfen zu können, die unter Depressionen leiden. Zwar können wir niemals alles Ungemach ausmerzen, und es bürgt allein die Linderung depressiver Zustände noch nicht für Glück, aber vielleicht deutet das hier gesammelte Wissen zumindest gewisse Wege der Besserung an.
Fußnoten
[1]
Die im Text genannten amerikanischen Markennamen von Medikamenten bleiben aus Gründen der Plausibilität unverändert. Im Anhang findet sich eine Liste mit den deutschen Äquivalenten. A.d.Ü.
1. Depressionen
Die Depression ist das Zerrbild der Liebe. Liebesfähig zu sein heißt, im Fall des Verlusts verzweifeln zu können, und die Verzweiflung schlägt sich in Depressionen nieder. Wenn diese uns überkommen, fühlen wir uns völlig erniedrigt und verlieren letzten Endes das Vermögen, lieben oder geliebt werden zu können. Als radikalste Vereinsamung zerstören sie sowohl die Bindungen an andere als auch die Fähigkeit, im Frieden mit uns selbst zu leben. Liebe wirkt zwar nicht vorbeugend gegen Schwermut, bettet aber die Seele weich und schützt sie vor sich selbst. Medikamente und Psychotherapie können ein Übriges tun, indem sie das Lieben und Geliebtwerden erleichtern, und gerade deshalb wirken sie ja. In gehobener Stimmung lieben wir, sei es uns selbst, andere, unsere Arbeit oder Gott, und jede dieser Emotionen kann die Vitalität und Entschlusskraft nähren, die den Gegensatz zur Depression bilden. Doch die Liebe lässt uns mitunter im Stich, und ebenso wir sie. Im depressiven Zustand liegt klar auf der Hand, dass jedes Unterfangen und jede Regung, ja das ganze Leben sinnlos ist. In dieser Lieblosigkeit empfindet man nur noch eines, nämlich dass absolut nichts von Bedeutung ist.
Sorgen belasten die Liebe: Gleichgültig, was wir tun, am Ende müssen wir sterben; wir sind, jeder für sich, in der Einsamkeit eines autonomen Körpers gefangen; die Zeit vergeht, und das Vergangene wird nie wiederkehren. Schmerz ist das erste Erleben von Hilflosigkeit, das uns dann nicht mehr loslässt. Es erbost uns, dem behaglichen Mutterleib entrissen zu werden, und kaum hat sich dieser Zorn gelegt, da löst ihn auch schon der Weltschmerz ab. Sogar wer an ein besseres Jenseits glaubt, kommt nicht um die Qualen des Diesseits herum; Jesus selbst war der Mann der Schmerzen. Wir leben jedoch in einer Zeit der Linderungsmittel, dank deren wir fast nach Belieben entscheiden können, was wir empfinden wollen und was nicht. Das Leben bereitet dem, der über sie gebietet, immer weniger unvermeidliche Misshelligkeiten. Nur lässt sich die Depression, trotz überschwänglicher Parolen der Pharmaindustrie, nicht aus der Welt schaffen, solange wir mit Selbstbewusstsein ausgestattete Wesen sind. Bestenfalls kann man sie eindämmen – und genau das streben die heutigen Depressionstherapien an.
Eine stark politisierte Debatte hat die Grenze zwischen der Depression und ihren Folgen verwischt – den Unterschied zwischen Befindlichkeit und daraus resultierendem Handeln. In dieser Willkür äußern sich nicht nur gesellschaftliche und medizinische Phänomene, sondern auch emotionale und damit einhergehend sprachliche Marotten. Vielleicht beschreibt man die Depression am besten als einen Kummer, der uns unfreiwillig befällt und sich dann verselbständigt. Sie ist aber nicht nur sehr schmerzhaft, sondern ein Übermaß an Schmerz kann sich auch zur Depression verdichten. Wenn Gram eine den Umständen angemessene Depression wäre, so wäre diese ein völlig maßloser Gram, der sich nur in Metaphern und Allegorien einfangen lässt. Als sich der heilige Antonius in der Wüste nach dem Unterschied zwischen den demütig schlicht auftretenden Engeln und den in prunkvollen Gewändern daherkommenden Teufeln fragte, da ging ihm auf, dass man erst im Nachhinein Bescheid wisse: Verließ ihn ein Engel, so fühlte er sich durch die Erscheinung gestärkt; verließ ihn jedoch ein Teufel, so verspürte er blankes Entsetzen.
Kummer ist wie ein demütiger Engel, der dich mit kraftvollen, klaren Gedanken und tiefen Gefühlen zurücklässt. Die Depression dagegen stürzt dich wie ein Dämon ins Entsetzen.
Man unterscheidet grob nach leichten und schweren Depressionen. Erstere setzen allmählich ein und können Menschen auf Dauer so aushöhlen, wie Eisen rostet. Sie erwachsen aus zu viel Kummer über den geringsten Anlass, greifen schmerzhaft auf alle anderen Emotionen über und verdrängen sie. Depressionen dieser Art lähmen die Augenlider und Rückenmuskeln, peinigen Herz und Lungen, verhärten alle Reflexe. Gleich chronischen Schmerzen quälen sie einen weniger durch momentane Unerträglichkeit als durch das sichere Wissen, dass sie wiederkehren werden. Das Hier und Jetzt der leichten Depression stellt keinerlei Linderung in Aussicht. Diesen Zustand hat Virginia Woolf mit geradezu unheimlicher Klarheit beschrieben: »Jacob trat ans Fenster und stand mit den Händen in den Taschen. Dort sah er drei Griechen in Trachtenröcken; die Masten von Schiffen; müßige oder geschäftige Menschen der Unterschicht, die schlenderten oder wacker ausschritten oder sich zu Gruppen scharten und mit den Händen gestikulierten. Ihr mangelndes Interesse an ihm war nicht der Grund seiner Düsternis; sondern eine tiefere Überzeugung – es war nicht, dass er selbst zufällig einsam war, sondern dass alle Menschen es sind.« Im selben Roman, Jacobs Zimmer, schildert sie auch, woran das liegt. »In ihrem Gemüt machte sich seltsame Traurigkeit breit, als zeigten sich Zeit und Ewigkeit durch Röcke und Westen, und sie sah Menschen tragisch in ihr Verderben rennen. Doch, der Himmel weiß, Julia war keine Närrin.« Dieses scharfe Bewusstsein der Vergänglichkeit und Endlichkeit liegt der leichten Depression zugrunde, mit der man sich lange Zeit einfach abfand, während Ärzte heute zunehmend versuchen, sie möglichst differenziert zu behandeln.
Schwere Depressionen gipfeln oft in Zusammenbrüchen. Wenn man sich eine eiserne Seele vorstellt, die bei Kummer anläuft und bei leichter Depressivität rostet, so stehen schwere Depressionen für den erschreckenden Zusammenbruch einer gesamten Struktur. Psychische Krankheiten lassen sich dimensional und kategorial auffassen. Im dimensionalen Modell liegen depressive Zustände auf einer Linie mit der Traurigkeit und bilden den Extremfall von Regungen, die jedermann aus eigener Erfahrung kennt; im kategorialen dagegen erscheint die Depression als etwas gänzlich Eigenständiges, das vom Normalen ebenso weit entfernt ist wie ein Darmvirus von Verdauungsstörungen. Beide Modelle treffen zu: Man bewegt sich auf der Ebene des Emotionalen und kommt plötzlich an eine Schwelle, an der alles ganz anders aussieht. Zwar dauert es sehr lange, bis ein rostendes Eisengestell zusammenbricht, aber gewiss pulverisiert der Rost unaufhörlich das harte Metall, macht dieses brüchig, um es dadurch zu zersetzen. Der Kollaps, wie abrupt er auch wirken mag, ist das Endergebnis des stetigen Verfalls – und dennoch ein hoch dramatisches plötzliches Ereignis. Vom ersten Regen bis zu sichtbaren Spuren von Rostfraß muss viel passieren. Manchmal setzt der Rost an neuralgischen Stellen an, so dass die Zerstörung total erscheint, doch häufiger bleibt sie partiell: Dieser Teil bricht zusammen, reißt jenen mit und bringt so das Ganze in drastischer Form aus dem Gleichgewicht.
Verfall ist keine angenehme Erfahrung. Man sieht sich den Verwüstungen von Dauerregen ausgesetzt und spürt die zunehmende Schwächung, so dass schon ein kleiner Sturm vieles abtragen und der Wind dann immer weniger zurücklassen wird. Manche Menschen rosten emotional schneller als andere. Die Depression beginnt schal, taucht die Tage in neblig düstere Farben, lähmt das alltägliche Handeln, bis die aufgewandte Mühe alle klaren Konturen verzerrt, hinterlässt dich müde, gelangweilt und zerquält; doch man kann dergleichen überstehen: Nicht gerade glücklich vielleicht, doch man kann es schaffen. Zwar hat bisher niemand genau bestimmen können, bei welcher Bruchstelle eine schwere Depression einsetzt, aber wenn man sie erreicht hat, so gibt es kein Vertun mehr.
Schwere Depressionen sind Geburt und Tod zugleich: Sie erzwingen nicht nur Neues, sondern lassen auch etwas Altes endgültig verschwinden. Vor kurzem ging ich durch einen Wald und sah eine ehrwürdige hundertjährige Eiche, in deren Schatten ich einst oft mit meinem Bruder gespielt hatte. Im Lauf von zwanzig Jahren hatte sich eine Kletterpflanze um diesen stolzen Baum gerankt und ihn fast erstickt: Man erkannte kaum noch, wo er aufhörte und wo der Parasit anfing. Seine Triebe hielten das Astwerk so fest umschlungen, dass ihre Blätter von ferne wie Eichenlaub wirkten; nur aus der Nähe sah man genau, wie wenige lebende Äste noch verblieben waren und wie ein paar verzweifelt kleine Knospen gleich Däumlingen aus dem gewaltigen Baumstamm hervorstaken.
Gerade erst von einer schweren Depression genesen, in der ich kaum imstande war, Probleme anderer Menschen wahrzunehmen, konnte ich dennoch mit diesem Baum fühlen. Die Schwermut hatte Besitz von mir ergriffen wie das Gewächs von jener Eiche, mich umschlungen und ausgelaugt, war hässlich, grotesk und stärker als ich; in ihrem Eigenleben hatte sie nach und nach alles Leben in mir abgewürgt. In der schwärzesten Phase hatte ich Stimmungen, von denen ich wusste, dass sie nicht zu mir gehörten, sondern ebenso sicher zu der Depression wie das Laub in jener Baumkrone zu der Kletterpflanze. Als ich klar darüber nachzudenken versuchte, spürte ich, dass mein Geist wie eingebunkert und blockiert war. Ich wusste zwar, dass die Sonne auf- und unterging, aber ihr Licht erreichte mich kaum. Zudem fühlte ich etwas Übermächtiges auf mir lasten; zuerst versagten mir die Knöchel, dann die Knie, später krümmte sich meine Taille, danach fielen die Schultern ein, und am Ende war ich nur noch ein fötales Häufchen Elend, ausgehöhlt von diesem Gewächs, das mich zerquetschte, ohne mir Halt zu bieten. Mit seinen Ranken drohte es, mich seelisch und moralisch zu pulverisieren, mir sämtliche Knochen zu brechen und allen Saft aus dem Körper zu ziehen. Es zehrte noch an mir, als gar nichts Nahrhaftes mehr verblieben schien.
Mir fehlte die Kraft, nicht mehr zu atmen. Da ich schon wusste, dass ich das Gewächs der Depression nie würde abschütteln können, wollte ich nur noch sterben dürfen, denn ich war zu schwach, um mich selbst zu töten, und der Parasit tat mir den Gefallen nicht. Wenn mein Torso verrottete, so ließ dieser Schmarotzer ihn doch nicht fallen: Er stützte nun, was er zerstört hatte. Im hintersten Winkel meines Bettes kauernd, von etwas Unsichtbarem niedergemacht, bat ich jenen Gott, an den ich niemals ganz hatte glauben können, um Erlösung. Ich wäre gerne den qualvollsten Tod gestorben, war aber viel zu lethargisch, um an Selbstmord auch nur zu denken. Jeder Moment des Daseins schmerzte mich, doch weil dieses Gewächs mich völlig ausgedörrt hatte, konnte ich nicht einmal weinen. Sogar mein Mund war trocken. Ich hatte gemeint, im tiefsten Elend würden die Tränen nur so fließen, aber das Schlimmste ist der dürre Schmerz, wenn man restlos darniederliegt und alle Tränen versiegt sind, wenn die Qual alle Räume verstellt, in denen man einst der Welt oder diese einem selbst begegnet war. Das ist der Zustand einer schweren Depression.
Die Depression, hatte ich gesagt, ist Geburt und Tod zugleich, denn sie gebiert das Gewächs, und im Verfallsprozess des Sterbens brechen die Äste, auf denen das Elend ruht. Als Erstes verschwindet das Glück, so dass einem nichts mehr Freude macht, und das ist bekanntlich ein Hauptsymptom schwerer Depressionen. Doch bald folgen dem Glück andere Regungen: Die Traurigkeit, wie man sie kannte (und die einen erst so weit gebracht zu haben schien), der Humor, der Glaube an die Macht der Liebe. Das Innere wird derart ausgelaugt, dass man sich selbst nicht mehr erträgt. Du kannst dich selbst nicht riechen, verlierst jegliches Vertrauen, lässt dich weder berühren noch rühren. Schließlich kommst du dir einfach selbst abhanden.
Vielleicht bemächtigt sich dieses Neue ganz des Alten, und es fallen dadurch gewisse Schleier. Wie dem auch sei, du bist nicht mehr du selbst, sondern etwas Fremdem ausgeliefert. Zu oft greifen Therapien nur einen Aspekt des Problems an und konzentrieren sich allein auf das Neue oder das Alte. Nötig wäre aber, sowohl den Parasiten mit Stumpf und Stiel auszurotten als auch die Mechanismen des Wurzelns und der Fotosynthese neu zu erlernen. Medikamentöse Therapien kappen das Gewächs einfach. Man spürt, wie das Mittel wirkt und die Pflanze zu vergiften scheint, so dass sie nach und nach verwelkt, auch wie die Last abnimmt und die Äste fast wieder ihre alte natürliche Biegsamkeit zurückgewinnen. Solange du das Gewächs nicht abgeworfen hast, ist an Entlastung gar nicht zu denken; doch auch danach mag es sein, dass mit den wenigen verbliebenen Blättern und den flachen Wurzeln kein heute verfügbares Medikament dein Ich wiederherstellen kann. Wenn das Joch abgeschüttelt ist, reicht das verbliebene Laub zwar gewöhnlich noch für die Grundversorgung aus, aber das ist kein erfreulicher, kein vitaler Zustand. Nur Liebe, Einsicht, Arbeit und vor allem viel Geduld können das Ich in depressiven Zuständen und danach wieder aufbauen.
Die Diagnose ist so verwickelt wie die Krankheit selbst. Patienten fragen ihre Ärzte häufig, »Bin ich depressiv?«, als ob das mit Hilfe eines Blutbildes endgültig zu beantworten wäre. Um zu ermitteln, ob man depressiv ist, gilt es vielmehr, nach innen zu horchen und zu schauen, seinen Gefühlen zu folgen und über sie nachzudenken. Wer sich meistens grundlos elend fühlt, dürfte depressiv sein; ebenso wer sich meistens aus bestimmten Gründen elend fühlt – doch hier könnte die Ursachen zu beheben weit mehr bewirken, als sie unverändert zu lassen und lediglich die Depression zu bekämpfen. Sofern diese absolut lähmend wirkt, handelt es sich um einen schweren Fall, während die leichte nur störend und lästig ist. Die Bibel der amerikanischen Psychiatrie – das Diagnostic and Statistical Manual (4. Aufl.: DSM-IV.) – definiert die Depression abwegigerweise als das Zusammentreffen von mindestens fünf von neun Symptomen. Das ist reine Willkür, denn es gibt keinen triftigen Grund, gerade fünf Symptome vorauszusetzen und nicht vier oder sechs. Schon ein einziges kann unangenehm genug sein. Alle neun Symptome in eher milder Form zu haben mag weniger schlimm sein als zwei schwere. Nach erfolgter Diagnose treiben die meisten Menschen Ursachenforschung, obwohl die Kenntnis der Gründe für eine Krankheit keine unmittelbar Heilkraft entfaltet.
Psychische Krankheiten sind etwas sehr Reales und können schwere körperliche Auswirkungen haben. Doch wenn jemand bei seinem Arzt über Magenkrämpfe klagt, erhält er oft die Antwort: »Nanu? Im Grunde fehlt Ihnen gar nichts, außer dass Sie depressiv sind!« Wenn Depressionen schon Magenkrämpfe auslösen können, so muss doch einiges im Argen liegen und gezielt behandelt werden. Im Fall von Atembeschwerden sagt ja auch niemand: »Nanu? Ihnen fehlt gar nichts, außer dass Sie ein Emphysem haben!« Für den Betreffenden sind psychosomatische Beschwerden so real wie Magenkrämpfe im Fall einer Lebensmittelvergiftung: Sie wurzeln im Unbewussten, und oft genug sendet das Gehirn dem Magen irreführende Botschaften, mit schmerzhaften Folgen. Die Diagnose – ob etwas im Magen, im Blinddarm oder im Gehirn kaputt ist – spielt eine maßgebliche Rolle, um über die Therapie zu entscheiden. Im Übrigen zählt das Gehirn zu den wichtigeren Organen, und seine Funktionsstörungen sind dementsprechend zwingend zu beheben.
Oft bemüht man die Biochemie, um die Kluft zwischen Körper und Seele zu schließen. Wenn Menschen erleichtert auf die ärztliche Erklärung reagieren, dass ihre Depression »organischer« Natur sei, so liegt das an der Fiktion eines integralen, zeitbeständigen Ichs und der radikalen Trennung zwischen völlig nachvollziehbarem und rein zufälligem Leid. Das Wort organisch lindert offenbar Schuldgefühle, die Menschen wegen der stressbedingten Unzufriedenheit haben, ihren Beruf nicht zu lieben, das Altern zu fürchten, bei der Liebe zu versagen, ihre Familie zu hassen. Mit der Biochemie geht eine erfreuliche Schuldlosigkeit einher. Wenn das Gehirn eine Veranlagung zu Depressionen hat, so braucht man sich keine Vorwürfe zu machen. Ob man nun sich selbst oder die Evolution beschuldigt, jedenfalls lassen sich Schuld- wie übrigens auch Glücksgefühle als chemische Vorgänge begreifen. Da Chemie und Biologie jedoch nicht an das »reale« Ich heranreichen, muss die Depression zutiefst mit dem betroffenen Opfer verschmolzen sein. So behebt die Therapie keine Identitätsstörung im Sinne der Normalisierung, sondern richtet eine mannigfaltige Persönlichkeit neu aus und verändert in gewissem Maße die Identität.
Naturwissenschaftlich gesehen, besteht der Mensch aus chemischen Substanzen, und deren Erforschung sowie die ihrer Strukturen und Konfigurationen bildet den Gegenstand der Biologie. Alle Vorgänge im Gehirn haben chemische Korrelate und Ursachen. Erinnerungen an Episoden der Vergangenheit laufen über die komplizierte Chemie des Gedächtnisses. Kindheitstraumata und ihre Verarbeitung können die Gehirnchemie verändern. Analog sind an dem Entschluss, dieses Buch zu lesen, in die Hand zu nehmen, aufzuschlagen, das Schriftbild zu betrachten, sich einen Reim auf den Text zu machen und dann gedanklich und emotional auf diese Interpretation zu reagieren, Abertausende von chemischen Reaktionen beteiligt. Wer sich im Lauf der Zeit aus einer Depression befreit und wieder besser fühlt, macht keine spezielleren oder komplexeren chemischen Reaktionen durch als beim Einnehmen von Antidepressiva. Das Äußere determiniert das Innere im gleichen Maße, wie dieses es überhaupt erst ersinnt. Wenig reizvoll ist dabei lediglich die Vorstellung, dass neben allen anderen auch die Grenzen unseres Ichs verschwimmen. Es gibt keine Essenz des Ichs, die rein wie eine Goldader unter dem Chaos von Erfahrung und Chemie verborgen läge. Alles ist wandelbar, und wir müssen den menschlichen Organismus als eine Folge von Ich-Zuständen begreifen, die einander ablösen oder auswählen.
Wir wissen noch wenig über das Zusammenwirken der chemischen Vorgänge im Gehirn. So ist zum Beispiel schwer zu bestimmen, in welchem Umfang konkrete Erfahrungen zu spezifischen Depressionen führen; auch können wir nicht erklären, durch welche chemischen Prozesse äußere Ereignisse oder charakterliche Anlagen einen Menschen depressiv machen. Doch obwohl Boulevardpresse und Pharmaindustrie die Depression als eine monokausale Krankheit wie Diabetes darstellen, besteht dabei ein himmelweiter Unterschied. Diabetiker erzeugen zu wenig Insulin, und entsprechend behandelt man ihre Krankheit durch Anhebung und Einstellung des Blutzuckerspiegels. Die Depression ist dagegen nicht die Folge eines Mangels, den wir messen könnten. Erhöht man den Serotoninspiegel im Gehirn, so geht es schließlich vielen Depressiven besser, allerdings nicht deshalb, weil sie zuvor einen ungewöhnlich niedrigen Serotoninspiegel gehabt hätten. Außerdem schafft das Serotonin nicht sofort Abhilfe: Man könnte es literweise ins Gehirn von Depressiven pumpen, ohne dass diese sich momentan einen Deut besser fühlten. Eine langfristige Anhebung des Serotoninspiegels kann jedoch lindernd auf depressive Symptome wirken. »Ich bin depressiv, aber das ist nur die Chemie« ist eine ähnliche Aussage wie »Ich bin intelligent, aber das ist nur die Chemie«. Wenn man auf diesen Bahnen denken möchte, ist alles am Menschen nur Chemie. »Du kannst sagen, es ist ›nur Chemie‹«, schreibt Maggie Robbins, die unter der manisch-depressiven Erkrankung leidet. »Ich hingegen sage, nichts ist ›nur‹ Chemie.« Die Sonne strahlt, und auch das ist Chemie, ebenso dass Felsen hart und Meere salzig sind, dass gewisse Frühlingsnachmittage eine Art Wehmut in ihrer sanften Brise tragen, die das Herz zu Sehnsüchten und Phantasien anregt, nachdem diese lange unter dem Winterschnee geschlummert hatten. »Der Rummel um das Serotonin«, meint David McDowell von der Columbia University, »ist Teil eines modernen Neuromythos.« Ein kraftvolles Märchen.
Die innere und die äußere Realität bilden ein Kontinuum. Was geschieht, wie man dies auffasst und wie man darauf reagiert, hängt gewöhnlich zusammen, allerdings nicht ursächlich. Wenn Realität ihrerseits meist etwas Relatives und das Ich stets im Wandel begriffen ist, so müssen die Übergänge von gemäßigten zu extremen Stimmungen in aller Regel gleitend erfolgen. Krankheiten bildeten demnach extremere Gefühlszustände, und man dürfte das Emotionale durchaus als leicht krankhaft bezeichnen. Wer sich immerzu obenauf und groß fühlte (ohne einem manischen Selbstbetrug aufzusitzen), könnte viel schaffen und vielleicht auf Erden glücklich sein, aber trotzdem ist diese Vorstellung furchterregend (obwohl wir in diesem Zustand gewiss nichts mehr von Furcht oder gar Gruseln wüssten).
Grippe ist etwas Eindeutiges: Am Tag X hat man das betreffende Virus nicht in seinem System; am Tag Y liegt es vor. HIV überträgt sich in einem genau bestimmbaren Sekundenbruchteil von Mensch zu Mensch. Und die Depression? Es ist, als wolle man klinische Parameter des Hungers angeben, der uns alle mehrmals täglich befällt, aber im Extremfall eine Tragödie ist und seine Opfer tötet. Manche Menschen brauchen besonders viele Kalorien; andere können noch bei starker Unterernährung arbeiten; wieder andere bauen rapide ab und brechen dann plötzlich zusammen. So ähnlich schlagen Depressionen auf ganz unterschiedliche Weise zu: Während manche die Veranlagung haben, ihnen zu trotzen oder die Stirn zu bieten, sind andere dem Übel hilflos ausgeliefert. Halsstarrige und stolze Menschen mögen gegen Depressionen ankommen, die Menschen mit einem schwachen oder nachgiebigeren Charakter glatt niederstrecken würden.
Denn die Depression steht in einem inneren Zusammenhang mit dem Charakter. Da auch dieser selbst ein Zufallselement und eine verwickelte Chemie aufweist, könnte man alles auf die Genetik schieben, doch das wäre zu wohlfeil. »So etwas wie Stimmungsgene gibt es nicht«, sagt Steven Hyman, der Direktor des National Institute of Mental Health. »Sie sind lediglich Kürzel für hoch komplexe Wechselwirkungen zwischen Genom und Umwelt.« Wie jedermann unter gewissen Umständen mehr oder weniger starke Depressionen bekommen kann, so kann er auch dagegen ankämpfen. Oft läuft der Kampf darauf hinaus, sich die besten Behandlungsmethoden auszusuchen, solange man noch stark genug dafür ist. Dazu gehört, die Phasen zwischen den schlimmsten Schüben nach Kräften zu nutzen. Einige Menschen bringen es trotz entsetzlicher Symptome im Leben zu etwas; andere sind schon bei den leichtesten Anflügen der Krankheit völlig am Boden zerstört.
Leichte Depressionen ohne Medikamente zu überstehen bietet gewisse Vorteile, gibt es einem doch das Gefühl, Störungen des chemischen Gleichgewichts aus eigener Willenskraft beheben zu können. Wer über glühende Kohlen zu laufen lernt, erringt einen Sieg des Gehirns über die scheinbar unerbittliche Körperchemie des Schmerzes und hat dabei das prickelnde Gefühl, die schiere Kraft des Geistes zu entdecken. Depressionen »aus eigener Kraft« zu überwinden kann auch dazu beitragen, den sozialen Misslichkeiten auszuweichen, die mit der psychiatrischen Medikation einhergehen. Außerdem dürfte es bedeuten, sich uneingeschränkt so anzunehmen, wie man ist, mithin allein vermöge innerer Kraftquellen und ohne fremde Hilfe sich wiederherzustellen. Die allmähliche Befreiung aus den Qualen gibt auch dem Elend selbst einen Sinn.
Die inneren Kraftquellen sind indes widerspenstig und oft unzureichend. Oft zerstören Depressionen die Herrschaft des Geistes über das Gemüt. Häufig kommt die verwickelte Chemie des Leidens durch den Verlust eines geliebten Menschen in Gang, was direkt in depressive Zustände münden kann. Auch mag die Chemie der Liebe ganz von außen bestimmt sein oder Wege einschlagen, die immer das Geheimnis des Herzens bleiben. Vielleicht müssen wir uns damit abfinden, dass Gefühle gerne verrücktspielen. So scheint es verrückt, wenn Jugendliche gegen Eltern wüten, die ihr Bestes gegeben haben, aber dies ist ein derart verbreiteter Wahnsinn, dass wir ihn relativ fraglos hinnehmen können. Manchmal setzen die gleichen chemischen Vorgänge aus äußeren Gründen ein, die normalerweise nicht ausreichen würden, um die Verzweiflung zu erklären: Jemand rempelt dich in einem überfüllten Bus an, und du brichst in Tränen aus, oder du liest etwas über das starke Wachstum der Weltbevölkerung und findest das eigene Leben unerträglich. Jeder erlebt gelegentlich unangemessene Gefühlsausbrüche wegen Kleinigkeiten oder hat Regungen, deren Wurzeln dunkel und unerfindlich bleiben. Manchmal laufen Prozesse ohne erkennbaren äußeren Anlass ab. Die meisten Menschen kennen Anflüge unerklärlicher Verzweiflung, oft mitten in der Nacht oder am frühen Morgen, kurz bevor der Wecker läutet. Wenn solche Zustände zehn Minuten dauern, sind sie seltsame, flüchtige Stimmungen; dauern sie zehn Stunden, so erinnern sie an einen lästigen Fieberwahn; dauern sie jedoch zehn Jahre, so sind sie krankhaft und lähmend.
Beim Glück spürt man oft in jedem Moment die Vergänglichkeit, wohingegen sich Depressionen als etwas schier Unvergängliches darstellen. Auch wenn man weiß, dass Stimmungen wechseln und man morgen anders empfinden wird als heute, lässt das Glück nicht im gleichen Umfang Entspannung zu wie die Traurigkeit: Sie war und ist in meinen Augen immer das stärkere Gefühl, und sofern andere das nicht ähnlich empfinden, birgt sie vielleicht die Saat der Depression. Zwar hasste ich depressive Zustände, lernte in ihnen aber auch meine Grenzen und den Horizont meiner Seele kennen. Glück lenkt mich in der Regel etwas ab, so als ließe es einen wichtigen Teil meines Geistes und Gehirns ungenutzt. Dagegen bin ich mit Depressionen vollauf beschäftigt. Momente des Verlusts schärfen meinen Blick: Erst wenn ein Kristallglas zu Boden fällt, erkenne ich klar seine ganze Schönheit. »Unsere Empfindlichkeit für den Schmerz ist fast unendlich, die für den Genuss hat enge Gränzen«, schreibt Schopenhauer. »Hiezu stimmt auch Dies, dass wir, in der Regel, die Freuden weit unter, die Schmerzen weit über unsere Erwartung finden. … Sogar bedarf Jeder allzeit eines gewissen Quantums Sorge, oder Schmerz, oder Noth, wie das Schiff des Ballasts, um fest und gerade zu gehen.«
Eine russische Redensart lautet: Wenn du aufwachst und keine Schmerzen hast, weißt du, dass du tot bist. Während das Leben nicht nur aus Schmerz besteht, gehört dieser in seiner besonderen Intensität zu den sichersten Anzeichen des elan vital. Dazu erneut Schopenhauer: »Man versetze dies Geschlecht in ein Schlaraffenland, wo Alles von selbst wüchse und die Tauben gebraten herumflögen, auch jeder seine Heiß-Geliebte alsbald fände, und ohne Schwierigkeiten erhielte. – Da werden die Menschen zum Theil vor Langerweile sterben, oder sich aufhängen, zum Theil aber einander bekriegen, würgen und morden, und sich mehr Leiden verursachen als jetzt die Natur ihnen auflegt«, denn Langeweile sei das »Gegengewicht dazu, auf der Seite der Leiden«.
Meiner Überzeugung nach sind einige der alarmierendsten Statistiken über die Depression realistisch. Auch wenn man Zahlen nicht mit der Wahrheit verwechseln darf, lassen sie oft tief blicken. Neueren Forschungen zufolge leiden etwa drei Prozent aller Amerikaner – etwa neunzehn Millionen – unter chronischen Depressionen, und mehr als zwei Millionen davon sind Kinder. Die aus Hochs und Tiefs bestehende und deshalb als »bipolar« bezeichnete manisch-depressive Erkrankung hat etwa 2,3 Millionen Opfer und ist bei jungen Frauen die zweit-, bei jungen Männern die dritthäufigste Todesursache. Das DSM-IV stuft die Depression weltweit bei Personen im Alter über fünf Jahren als die Hauptursache der Behinderung ein; sie sei, gemessen an den Parametern Sterblichkeit und Invalidität, die international (einschließlich der Entwicklungsländer) nach den Herzleiden am weitesten verbreitete Krankheit und koste die Menschheit mehr Lebensjahre als Kriege, Krebs und Aids zusammengenommen. Wenn man bedenkt, dass andere Symptome, wie Alkoholismus oder Herzbeschwerden, die Depression als Ursache maskieren können, so dürfte sie der übelste Killer auf Erden sein.
Heute mehren sich zwar die Depressionstherapien, aber nur die Hälfte der Amerikaner mit schweren Depressionen suchen überhaupt irgendeine Hilfe – nicht einmal bei Geistlichen oder Therapeuten. Ungefähr fünfundneunzig Prozent davon gehen zu Hausärzten, die meist wenig von Psychiatrie verstehen. Nur bei vierzig Prozent der erwachsenen Amerikaner mit Depressionen kommt es zur richtigen Diagnose; gleichwohl nehmen rund achtundzwanzig Millionen, also knapp ein Zehntel der Gesamtbevölkerung, selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer ein (jene SSRIs, zu denen auch Prozac gehört), und auch andere Präparate sind weit verbreitet. Weniger als die Hälfte der richtig Diagnostizierten erhalten eine fachkundige Therapie. Auf nicht behandelte Depressionen entfällt eine Sterberate zwischen zehn und zwanzig Prozent. Vor zwanzig Jahren litten etwa 1,5 Prozent der Bevölkerung unter krankhaften Depressionen; heute sind es schon fünf Prozent, und nicht weniger als ein Zehntel aller Bürger müssen mit schweren depressiven Schüben, etwa die Hälfte mit leichteren Symptomen rechnen. Die klinischen Probleme haben zugenommen, die Therapien indes noch viel mehr. Zwar befindet sich die Diagnostik auf dem Vormarsch, aber das erklärt nicht die Ausmaße des Problems, denn besonders bei Kindern nehmen die Depressionen in allen Industrieländern zu. Auch ist das Durchschnittsalter bei Erkrankung binnen einer Generation um zehn auf sechsundzwanzig Jahre gesunken; die bipolare oder manisch-depressive Variante setzt sogar noch früher ein. Die Lage spitzt sich zu.
Wenige Krankheiten werden gleichermaßen unter- beziehungsweise übertherapiert wie Depressionen. Bei massiven Ausfällen hospitalisiert man die Patienten zuletzt, so dass sie dann wahrscheinlich in den Genuss einer Behandlung kommen, allerdings oft beschränkt auf die körperlichen Symptome, in denen sich die Depression äußert. Viele harren jedoch nur aus und müssen trotz der großen Umwälzungen in Psychiatrie und Psychopharmakologie andauernd entsetzliche Qualen erleiden. Mehr als die Hälfte der Hilfesuchenden – rund ein Viertel der Depressiven – bleiben ganz unversorgt, und etwa jeder Zweite – circa dreizehn Prozent – wird unsachgemäß behandelt, oft mit Beruhigungspillen oder abwegigen Psychotherapien. Von den übrigen erhält die Hälfte – etwa sechs Prozent – von allem, was nottäte, zu wenig. Damit verbleiben ungefähr sechs Prozent der Depressiven, die ordentlich therapiert werden. Viele davon setzen jedoch irgendwann ihre Medikamente ab, meist wegen der Nebenwirkungen. »Nur ein bis zwei Prozent kommen in den Genuss einer wirklich optimalen Behandlung«, sagt John Greden als Leiter des Mental Health Research Institute der University of Michigan, »bei einer Krankheit, die sich gewöhnlich mit recht preiswerten Medikamenten ohne große Nebenwirkungen gut beherrschen lässt.« Am anderen Ende des Spektrums schlucken unterdessen Menschen, die Seligkeit für ein Geburtsrecht halten, massenhaft Pillen in dem vergeblichen Bemühen, die leichten Unpässlichkeiten des Alltags zu mildern.
Vieles spricht dafür, dass der Aufstieg des Supermodels das Selbstbild der Frau beschädigt hat, indem es unrealistische Erwartungen begründete. Das psychische Supermodel des 21. Jahrhunderts erscheint sogar noch gefährlicher als das physische. Menschen überprüfen fortwährend ihre Befindlichkeit, um gewisse Stimmungen zu verwerfen. »Es ist das Lourdes-Phänomen«, meint William Potter, der in den siebziger und achtziger Jahren, als die neueren Medikamente aufkamen, die psychopharmakologische Abteilung des National Institute of Mental Health (NIMH) leitete. »Wenn man sehr viele Menschen in Zustände versetzt, die sie zu Recht als positiv wahrnehmen, so gibt es Berichte über Wunderheilungen – selbstverständlich auch über Tragödien.« Prozac ist derart gut verträglich, dass fast jeder es nehmen kann und ja auch nimmt. Es wird sogar schon gegen leichte Beschwerden eingesetzt, bei denen sonst niemand bereit gewesen wäre, die Unannehmlichkeiten der alten Monoaminooxidase(MAO)-Hemmer oder der Trizyklika in Kauf zu nehmen. Es besiegt die Traurigkeit, auch wenn man nicht depressiv ist; und wer lebt nicht lieber ohne als mit Schmerzen?
Wir pathologisieren das Heilbare und behandeln als Krankheit, was sich leicht beeinflussen lässt, auch wenn es früher einmal als Charakterzug oder Disposition galt. Sobald wir ein Medikament gegen Gewaltbereitschaft haben, wird auch sie als krankhaft firmieren. Zwischen ausgewachsenen Depressionen und dem milden Unbehagen, das noch nicht mit Störungen des Schlafs, des Appetits, der Energie oder des Interesses einhergeht, können viele Graustufen liegen; wir ordnen immer mehr davon als krankhaft ein, weil wir ständig neue Gegenmittel finden. Dennoch bleibt der Ansatzpunkt willkürlich. Wir haben beschlossen, einen Intelligenzquotienten von 69 als zurückgeblieben anzusehen, doch auch jemand mit 72 macht nicht viel her, und mit 65 kommt man noch irgendwie zurecht. Es heißt, der Cholesterinwert sollte unter 220 bleiben, aber bei 221 wird man nicht gleich sterben, und bei 219 ist schon Vorsicht geboten: 69 und 220 sind ebenso wie das, was wir als krankhaft bezeichnen, willkürlich gesetzte Marken. Wie also gehen wir mit jenen verwirrenden Grenzzonen um, die sich auch noch ständig verschieben?
Depressive benutzen oft den Ausdruck »Absturz«, um den Übergang vom Schmerz zum Wahnsinn zu markieren. Das ist ein recht körperliches Bild, meist auf einen »Abgrund« bezogen. Dabei verwundert mich der Gebrauch eines Vokabulars, das sich auf eine so abstrakte Metapher wie die Kante oder den Rand stützt. Wer fällt schon von irgendeiner Kante, und dann auch noch in einen Abgrund? Doch auf Befragen schildern die Betreffenden ihren Schlund ziemlich anschaulich. Vor allem ist er dunkel. Man fällt aus dem Tageslicht in ein Loch mit schwarzen Schatten, in dem man nichts sieht und überall Gefahren lauern. Man weiß weder, wie tief man fallen noch ob man irgendeinen Halt finden wird, kollidiert ständig mit unsichtbaren Dingen, bis man völlig zerschunden ist, ohne sich an irgendetwas klammern zu können.
Höhenangst als die weltweit bekannteste Phobie muss unseren Vorfahren gute Dienste geleistet haben, da die Furchtlosen wahrscheinlich abstürzten und so ihr genetisches Material selber auslöschten. Wer am Rand einer Klippe stehend nach unten blickt, bekommt Schwindelanfälle. Er ist wie gelähmt, kann kaum noch zurücktreten, verspürt einen Sog und muss sich regelrecht losreißen, um nicht abzustürzen. Ich erinnere mich an einen Ausflug mit Freunden zu den Wasserfällen bei Victoria, die über turmhohe nackte Felsmassive in den reißenden Sambesi donnern. Wir waren jung und provozierten einander etwas, indem wir uns möglichst nah am Rand knipsen ließen. Wenn wir überzogen, wurde uns allen schlecht und elend. Vermutlich heißt Depression gewöhnlich, nicht wirklich abzustürzen (was ja rasch zum Tod führen würde), sondern sich dem Rand zu nähern und voller Entsetzen festzustellen, dass man zu weit gegangen ist, einem schwindelig wird und man das Gleichgewicht nicht mehr halten kann. An den Victoriafällen entdeckten wir eine geheimnisvolle unüberschreitbare Schwelle, die deutlich vor dem Felssturz verlief. Rund drei Meter vom Rand entfernt fühlten wir uns alle noch ganz wohl; bei anderthalb begannen die meisten zu zittern. Irgendwann wollte mich eine Freundin mit der Brücke nach Sambia im Hintergrund fotografieren: »Könntest du ein bisschen weiter nach links treten?«, fragte sie, und ich gehorchte – mit einem vollen Schritt nach links. Ich lächelte freundlich, wie das Foto beweist, doch dann sagte sie: »Du stehst etwas nah am Rand. Komm wieder zurück.« Zuvor hatte ich völlig entspannt dort gestanden, doch plötzlich schaute ich hinunter und sah, dass ich meine Schwelle überschritten hatte. Alles Blut entwich mir aus dem Gesicht. »Nichts passiert«, sagte die Freundin beruhigend, kam auf mich zu und reichte mir ihre Hand. Die Felsklippe war noch dreißig Zentimeter entfernt, und doch musste ich mich erst hinknien und dann sogar legen, um ein Stück zu robben, bis ich dem Boden unter mir wieder traute. Ich weiß sicher, dass mein Gleichgewichtssinn stimmt, dass ich mühelos auf einer fünfzig Zentimeter breiten Rampe stehen, ja sogar amateurhaft ein bisschen Stepp tanzen kann, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Doch so nah am Sambesi versagte mein Stehvermögen.
Die Depression beruht in starkem Maße auf dem Gefühl einer lähmenden Bedrohung. Was du in zwei Meter Höhe machen kannst, wird unmöglich, wenn du den Boden unter den Füßen verlierst und einen dreihundert Meter tiefen Abgrund unter dir siehst. Die Angst vor dem Absturz erfasst dich, auch wenn dich gerade diese Angst erst stürzen lässt. Das Erleben der Depression ist grauenhaft, scheint aber sehr an das gebunden, was dir drohen mag. Unter anderem spürst du den Tod nahen. Sterben wäre nicht so schlimm, aber das Grenzgängertum an der Schwelle des Todes ist unerträglich. Bei schweren Depressionen sind die hingehaltenen Hände nie erreichbar. Du kannst dich auch nicht hinknien, denn sobald du dich vornüberbeugst, auch vom Abgrund weg, wirst du das Gleichgewicht verlieren und stürzen. Ja, einige jener Absturzbilder passen: die Dunkelheit und Ungewissheit, das Entsetzen. Doch im freien Fall wäre man absolut hilflos, und das ist genau dieses entsetzliche Gefühl: Nichts mehr machen zu können, und doch aufbegehren zu wollen. Der Schrecken des Drohenden nimmt die Gegenwart vollständig ein. Die Depression hat eine kritische Grenze überschritten, wenn man trotz eines großen Sicherheitsabstandes das Gleichgewicht nicht mehr halten kann. In ihr kündigt alles, was jetzt geschieht, künftiges Leid an, und die Gegenwart als solche hat aufgehört zu existieren.
Die Depression ist für den, der sie nicht kennt, ein nahezu unvorstellbarer Zustand, der sich nur durch eine Reihe von Metaphern – wie Kletterpflanzen an Eichen, Klippen mit Wasserfällen und so fort – umschreiben lässt. Auch ist ihre Diagnose nicht leicht, da sie auf Metaphern beruht und die des einen Patienten sich deutlich von denen anderer unterscheiden. Daran hat sich seit der Klage des Antonio in Shakespeares Der Kaufmann von Venedig im Grunde wenig geändert:
Fürwahr, ich weiß nicht, was mich traurig macht;
Ich bin es satt; ihr sagt, das seid ihr auch.
Doch wie ich dran kam, wie mir’s angeweht,
Von was für Stoff es ist, woraus erzeugt,
Das soll ich erst erfahren.
Und solchen Dummkopf macht aus mir die Schwermut,
Ich kenne mit genauer Not mich selbst.
Machen wir keine Umschweife. Letzten Endes kennen wir weder die Ursachen der Depression noch ihre Grundlagen, wissen auch nicht einmal, warum bestimmte Therapien dagegen helfen, wie sie den evolutionären Selektionsprozess überstehen konnte, warum jener sie bekommt, während dieser völlig unberührt davon bleibt, und schließlich, welche Rolle der Wille in diesem Zusammenhang spielt.
Das Umfeld von Depressiven erwartet, dass diese sich zusammenreißen: Für Trübsalblasen hat unsere Gesellschaft wenig Raum. Ehepartner, Eltern, Kinder und Freunde sind selbst von Schwermut bedroht und wollen sich schützen. Im Tief einer schweren Depression kann niemand mehr tun, als um Hilfe zu bitten (manchmal nicht einmal das), muss sie dann aber auch annehmen. Sogar Prozac, von dem viele Wunderdinge erwarten, hilft meiner Erfahrung nach nicht ohne unser Zutun. Hier einige Grundregeln: Höre auf Menschen, die dich lieben. Glaube an sie, und wenn es noch so schwerfällt. Suche nach den Erinnerungen, die im Schwarz versanken, und male dir danach eine Zukunft aus. Sei tapfer. Sei stark. Nimm deine Pillen. Trainiere, auch wenn du dich bleiern fühlst, denn es tut dir gut. Überwinde deinen Ekel und iss. Komm wieder zu Verstand, nachdem du ihn verloren hast. Diese Ratschläge mögen platt klingen, doch um die Depression überwinden zu können, muss man sie zurückweisen, darf sich nicht an sie gewöhnen: Sperre die auf dein Inneres einstürmenden Schreckgespenster aus.
Der Kampf wird sehr langwierig sein. Ich weiß nicht, was mir widerfuhr, habe keine Ahnung, wie ich so tief stürzen und dann immer noch weiter sinken konnte. Ich habe das Gewächs, die Kletterpflanze, mit allen nur erdenklichen Mitteln abgetötet und musste das Verlorene danach ebenso mühsam, aber auch intuitiv ersetzen, wie ich einst laufen oder sprechen lernte. Nach vielen leichten Anfällen kamen zwei schwere Zusammenbrüche, dann eine Atempause, gefolgt vom dritten Kollaps und noch einigen Anfällen. Nach all dem tue ich das Gebotene, um weitere Einbrüche zu vermeiden. An jedem Morgen und jedem Abend betrachte ich die Pillen in meiner Hand – weiß, rosa, rot und türkis, erscheinen sie mir manchmal wie ein Schriftzug, Hieroglyphen des Inhalts, dass alles noch gut werden kann und ich es mir schuldig bin, durchzuhalten und abzuwarten. Manchmal kommt es mir so vor, als schluckte ich zweimal täglich meine Begnadigung, denn ohne die Tabletten wäre ich längst tot. Wenn ich im Lande bin, gehe ich einmal wöchentlich zum Therapeuten. Mal langweilen mich die Sitzungen, mal finde ich sie auf ganz entrückte Weise interessant, mal erscheinen sie mir wie eine Epiphanie. In gewissem Sinne hat der Mann mir geholfen, mich so weit wieder aufzubauen, dass ich überhaupt diese Pillen schlucke. Dazu trugen viele Gespräche bei, und ich glaube an die Kraft der Worte: Dass sie überwinden können, was wir fürchten, wenn die Angst alles grauenhaft überschattet. Ich habe mich, zunehmend feinfühlig und aufmerksam, der Liebe zugewandt. Liebe ist das zweite Standbein, und beide gehören zusammen: Für sich genommen, ist die Medizin ein schwaches Gift, die Liebe ein stumpfes Messer, die Einsicht ein Seil, das unter zu hoher Spannung reißt. Doch als Triade können sie, wenn man Glück hat, den Baum vor dem Parasiten retten.
Ich liebe unser Jahrhundert. Zwar träume ich oft von Zeitreisen, um das biblische Ägypten, das Italien der Renaissance, das Elisabethanische England, die Hochkultur der Inka oder von Großsimbabwe und das Amerika der Ureinwohner zu sehen, möchte aber in keiner anderen Epoche leben als der heutigen. Mir gefallen der moderne Komfort, unsere raffinierte Weltanschauung, die über der Jahrtausendwende liegende gewaltige Umbruchstimmung, dereinst mehr zu wissen als alle früheren Generationen; und – nicht zu vergessen – die relativ große gesellschaftliche Toleranz der freien Welt. Ich liebe es, immer wieder in die Ferne reisen zu können, finde es schön, dass Menschen heute älter werden als je zuvor und ein wenig mehr Lebenszeit haben als vor tausend Jahren.
Allerdings stehen wir vor einer beispiellosen Umweltkrise, verbrauchen die vorhandenen Rohstoffe in furchterregendem Tempo, treiben Raubbau an der Natur. Wir holzen den Regenwald ab, verpesten die Meere mit Öl und Industrieabfall, schädigen die Ozonschicht und, schlimmer noch, heizen so das Klima auf. Die Erdbevölkerung ist größer als je zuvor mit weiter stark wachsender Tendenz. So schaffen wir Probleme, unter denen die nächsten Generationen leiden werden. Der Mensch verändert die Erde, seit er aus einem Feuerstein das erste Messer formte und ein anatolischer Bauer die erste Saat legte, doch heute dreht der Motor durch. Ich bin weder ein Ökoprophet noch meine ich, dass die Apokalypse kurz bevorsteht. Doch gewiss müssen wir, um nicht unterzugehen, schleunigst Maßnahmen zur Änderung des derzeitigen Kurses ergreifen.
Allerdings hat sich die Menschheit als findig erwiesen und derartige Probleme immer wieder zu lösen vermocht. Weder geht die Welt unter noch stirbt die Gattung aus. Hautkrebs nimmt deutlich zu, weil die Atmosphäre weniger Strahlung abhält als einst; also benutzen wir im Sommer Cremes mit hohem Lichtschutzfaktor und gehen regelmäßig zum Hautarzt. So bewältigen wir einen Aspekt der Krise, wählen neue Wege, ohne das Tageslicht ganz zu meiden. Trotz Schutzfaktor dürfen wir das Bestehende nicht zerstören. Derzeit erfüllt das Ozon seine Aufgabe ja noch leidlich. Zwar wäre es besser für die Umwelt, wenn wir unsere Autos stehen ließen, doch derlei wird ohne eine Flutwelle schwerer Katastrophen kaum geschehen, ja, fast meine ich, dass der Mensch eher auf dem Mond leben als die autofreie Gesellschaft einführen wird. Zwar sind radikale Veränderungen unmöglich und in vieler Hinsicht gar nicht wünschenswert, aber zweifellos müssen wir umdenken.
Depressionen gibt es offenbar so lange wie das menschliche Selbstbewusstsein, vielleicht sogar schon länger, sofern man annimmt, dass auch Affen, Ratten oder gar Kraken darunter leiden können. Gewiss entspricht ihre heutige Symptomatik weitestgehend dem, was Hippokrates vor zweitausendfünfhundert Jahren beschrieb. Weder Depressionen noch Hautkrebs sind eine neuartige Erfindung; und ähnlich wie dieser sind jene ein Unheil, das heute aus recht spezifischen Gründen zunimmt. Bleiben wir also nicht blind für die klare Botschaft eskalierender Warnsignale. Anzeichen, die man früher gar nicht bemerkt hätte, wachsen sich heute zu klinischen Symptomen aus. Wir müssen die unmittelbar drängenden Probleme nicht allein lösen, sondern auch eindämmen und verhindern, dass wir darüber den Verstand verlieren.
Ohne jede Frage sind die steigenden Depressionsquoten eine Folge der Moderne. Die Hektik und das technische Chaos, die Entfremdung, der Verlust traditioneller Familienstrukturen und die endemische Einsamkeit, das Versagen der religiösen, moralischen, politischen und sozialen Glaubenssysteme, die dem Leben einst Sinn oder Richtung zu geben schienen, wirkten sich wahrhaft katastrophal aus. Doch zum Glück haben wir ja Ersatzsysteme entwickelt. Für die organischen Störungen gibt es Medikamente, für die emotionalen entsprechende Therapien. Die Depression zwingt der Gesellschaft zwar wachsende Kosten auf, ruiniert sie jedoch nicht, denn wir verfügen ja über die organisatorischen Äquivalente von Sonnenschutzcremes, Schirmmützen und Schattenspendern.
Aber haben wir auch etwas wie das Äquivalent einer Ökobewegung, gleichsam ein System, um die Schädigung der gesellschaftlichen Ozonschicht einzudämmen? Wir dürfen uns von Therapien nicht blind machen lassen für das zugrundeliegende Problem. Die Statistiken müssten aufrüttelnd wirken. Was ist zu tun? Manchmal scheint es, als wetteiferten die Erkrankungsrate und die Anzahl der Therapien miteinander, um sich gegenseitig auszustechen. Zwar kann und will fast niemand auf die modernen Denk- oder gar Lebensweisen verzichten, aber wir müssen darangehen, die sozioemotionale Umweltverschmutzung schrittweise abzubauen, uns um einen Glauben (ob an Gott, das Ich, Idole, die Politik, die Schönheit oder sonst etwas) und um neue Strukturen bemühen; müssen den Entrechteten helfen, deren Elend die Lebensfreude insgesamt erheblich beeinträchtigt – sowohl um ihrer selbst als auch der Privilegierten willen, die lediglich keinen tiefen Lebensantrieb mehr finden; müssen die Kunst der Liebe sowohl pflegen als auch lehren; müssen der Gewalt und möglichst auch ihren Darstellungen entgegentreten. Doch ist das keine Gefühlsduselei, sondern ebenso dringlich wie der Aufruf zur Rettung des Regenwaldes.
An einem bestimmten Punkt, den wir wahrscheinlich bald erreichen werden, könnten die Schäden ein größeres Ausmaß annehmen, als es der dadurch erkaufte Fortschritt rechtfertigt. Zwar wird es keine Revolution geben, aber vielleicht setzen sich andere Schulformen, andere Familien- und Gemeinschaftsmodelle und bessere Informationssysteme durch. Sofern wir die Erde weiter bewohnen wollen, ist das unumgänglich. Wir dürfen nicht nur an den Symptomen herumkurieren, sondern müssen uns auch um ihre Ursachen kümmern, Prävention treiben, um sowohl die Regenwälder, die Ozonschicht, die Flüsse und Ströme, Seen und Meere, als auch die Menschlichkeit zu retten und die bösen Geister der Angst und der Depression zu vertreiben.
Kambodscha steht im Zeichen beispielloser Tragödien. In den siebziger Jahren errichtete Pol Pot dort nach einem Umsturz mit Hilfe seiner Roten Khmer eine maoistische Tyrannei. Darauf folgte ein jahrelanger mörderischer Bürgerkrieg, dem mehr als ein Fünftel der Einwohner zum Opfer fielen. Die Bildungselite wurde völlig ausgelöscht, die Bauernschaft regelmäßig von Ort zu Ort vertrieben, wenn nicht gar eingesperrt, verhöhnt und gefoltert. Das ganze Land lebte ständig in Angst. Zwar lassen sich Kriege schwer einstufen – das Gemetzel in Ruanda gehörte zweifellos zu den besonders widerwärtigen –, aber gewiss rangiert die Ära Pol Pot unter den grässlichsten unserer Zeit. Was geschieht mit den Gefühlen derer, die den Mord an fast einem Viertel ihrer Landsleute miterlebten und selbst unter den Schrecken eines brutalen Regimes litten, um dann gegen alle Widrigkeiten anzukämpfen und ein völlig zerstörtes Land wieder aufzubauen? Ich wollte mir ein Bild davon machen, wie ein verzweifelt armes Volk, dem es an allem fehlt und das kaum Bildungschancen oder Erwerbsquellen hat, mit einem derart schweren Trauma umgeht. Zwar hätte ich Not und Elend auch in anderen Ländern sehen können, wollte aber in kein Kriegsgebiet reisen, wo die Verzweiflung gewöhnlich einer Raserei gleicht, wohingegen der Zustand nach Verheerungen eher einer allumfassenden Erstarrung nahe kommt. In Kambodscha war nicht eine Partei brutal gegen eine andere vorgegangen, sondern jeder lag mit jedem im Krieg, was sämtliche sozialen Mechanismen völlig auslöschte, so dass es keine Liebe, keine Ideale und keine Güte mehr gab.
Die Kambodschaner sind im Allgemeinen leutselig, sehr gastfreundlich, auch gegenüber Fremden, und im Übrigen meist einnehmend, höflich und charmant. Man kann also kaum glauben, dass es in diesem reizenden Land zu Gräueltaten wie denen der Roten Khmer Pol Pots kommen konnte. Zwar hörte ich vor Ort vielfältige Erklärungen dafür, doch ähnlich wie im Fall der Kulturrevolution, des Stalinismus oder des Nationalsozialismus erschien keine einzige davon plausibel. In Gesellschaften kann so etwas eben passieren, und erst im Rückblick versteht man, warum eine Nation besonders anfällig dafür war, ohne dass man indes wüsste, in welchem Teil der menschlichen Phantasie solche Auswüchse wurzeln. Auch wenn der soziale Zusammenhalt oft schwach ist, bleibt rätselhaft, warum er sich so vollständig auflöst wie in diesen Staaten. Der amerikanische Botschafter sagte mir, das Hauptproblem der Khmer liege darin, dass die traditionelle Gesellschaft Kambodschas über keine Mechanismen der friedlichen Konfliktbewältigung verfüge. »Differenzen«, erklärte er, »müssen sie also entweder leugnen und total verdrängen, oder sie ziehen die Messer und kämpfen.« Ein Regierungsvertreter meinte, die Menschen hätten sich zu lange der absoluten Monarchie gebeugt und erst gegen die Staatsgewalt aufgelehnt, als es zu spät war. Ich hörte noch mindestens ein Dutzend ähnlicher Ausführungen, die allerdings meine Zweifel an ihrer Plausibilität nicht zerstreuen konnten.
Bei zahlreichen Gesprächen mit Menschen, die unter den Roten Khmer Abscheuliches erlitten hatten, musste ich feststellen, dass die meisten nur nach vorne blicken wollten. Als ich sie jedoch nach ihrem persönlichen Schicksal in der Vergangenheit fragte, glitten sie in eine düstere Traurigkeit ab. Was ich dann hörte, war erschreckend unmenschlich und widerwärtig. Alle Erwachsenen, die ich kennenlernte, waren so extrem traumatisiert, dass es sie in den Wahnsinn oder den Selbstmord hätte treiben können, denn sie mussten unvorstellbares Grauen verarbeiten. Wenn ich nach Kambodscha gereist war, um an fremdem Leid Demut zu lernen, so erschütterte es mich bis in die Grundfesten.
Fünf Tage vor dem Rückflug begegnete ich der einst für den Friedensnobelpreis vorgeschlagenen Phaly Nuon, die in Phnom Penh ein Waisenhaus und ein Zentrum für depressive Frauen ins Leben gerufen hat. Sie richtet mit erstaunlichem Erfolg restlos niedergeschlagene Frauen wieder auf, die andere Therapeuten schon abgeschrieben hatten. Dabei gelingt es ihr sogar, das Waisenhaus fast ausschließlich mit diesen Frauen zu betreiben, denen sie zuvor geholfen hat, so dass sich um Phaly Nuon herum eine Art Verein für gegenseitige Hilfe gebildet hat. Rettet die Frauen, heißt es dort, so retten sie wiederum die Kinder, und durch eine solche Kettenreaktion guter Taten werden wir das ganze Land retten.
Unser Treffen fand in einem Altbau nahe dem Zentrum von Phnom Penh in einem kleinen Büro statt. Wir saßen uns gegenüber, sie in einem Sessel, ich auf einem Sofa. Phaly Nuons etwas schräge Augen schienen dich sofort zu durchschauen, zugleich aber auch freundlich wahrzunehmen. Wie die meisten ihrer Landsleute ist sie nach westlichen Maßstäben ziemlich klein. Ihr leicht angegrautes Haar trägt sie glatt zurückgekämmt, was ihrem Gesicht einen betont harten Ausdruck gibt. Sie kann ihre Ansichten aggressiv durchsetzen, ist dabei aber scheu und schlägt, sooft sie nichts sagt, verlegen lächelnd die Augen nieder.
Zuerst erzählte mir Phaly Nuon einiges aus ihrer Lebensgeschichte. Anfang der siebziger Jahre hatte sie als Schreibkraft und Stenosekretärin beim Finanzministerium und der Handelskammer gearbeitet. Als Phnom Penh 1975 in die Hände Pol Pots und seiner Roten Khmer fiel, holte man sie, ihren Mann und die Kinder ab. Ihr Mann wurde mit unbekanntem Ziel verschleppt, ja sie wusste nicht einmal, ob er noch am Leben war. Sie selbst brachte man mit ihrer zwölfjährigen Tochter, dem dreijährigen Sohn und dem Neugeborenen aufs Land, wo man sie als Feldarbeiterin einsetzte. Dort herrschten schlimme Verhältnisse, und es gab kaum etwas zu essen, doch sie hielt durch, »ohne zu jammern, aber auch ohne zu lächeln, denn keine der Gefangenen lächelte je, da wir wussten, dass jede Minute unsere letzte sein konnte«. Nach einigen Monaten wurden sie und die Kinder abtransportiert. Unterwegs fesselten einige Soldaten sie an einen Baum, und sie musste mit ansehen, wie ihre Tochter mehrfach vergewaltigt und dann ermordet wurde. Ein paar Tage später traf es Phaly Nuon selbst. Man brachte sie zusammen mit anderen Arbeiterinnen auf ein Feld am Stadtrand. Dort band man ihre Hände nach hinten und fesselte ihr die Füße. Sie musste sich hinknien und nur von einem Bambusstock gehalten über ein Matschfeld beugen, also ständig die Beinmuskeln anspannen, um nicht umzukippen. Die Absicht dabei war, dass sie irgendwann entkräftet vornüber in den Schlamm fallen und elend darin ersticken sollte. Neben ihr brüllte und schrie der Dreijährige. Das Baby hatte man ihr auf den Leib gebunden, so dass es nach dem Sturz mit ertrinken würde, also von der eigenen Mutter getötet.