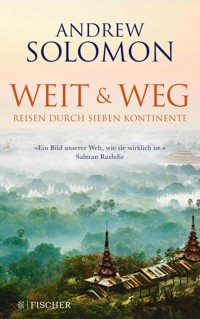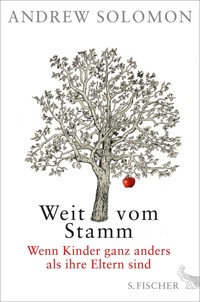
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie geht man damit um, wenn die eigenen Kinder ganz anders sind als man selbst, was bedeutet das für sie und ihre Familien? Und wie akzeptieren wir und unsere Gesellschaft außergewöhnliche Menschen? Ein eindrucksvolles Buch über das Elternsein, über die Kraft der Liebe, aber auch darüber, was unsere Identität ausmacht. Der Bestsellerautor Andrew Solomon hat mit über 300 Familien gesprochen, deren Kinder außergewöhnlich oder hochbegabt sind, die das Down-Syndrom haben oder an Schizophrenie leiden, Autisten, taub oder kleinwüchsig sind. Ihre Geschichten sind einzigartig, doch ihre Erfahrungen des "Andersseins" sind universell. Ihr Mut, ihre Lebensfreude und ihr Glück konfrontieren uns mit uns selbst und lassen niemanden unberührt. »Solomon hat eine Ideengeschichte geschrieben, die zur Grundlage einer Charta der psychologischen Grundrechte des 21. Jahrhunderts werden könnte... Erkenntnisse voller Einsicht, Empathie und Klugheit.« Eric Kandel »Das vielleicht größte Geschenk dieses monumentalen, so faktenreichen wie anrührenden Werks besteht darin, dass es zum permanenten Nachdenken anregt.« Philip Gourevitch »Dieses Buch schießt einem Pfeil um Pfeil ins Herz.« The New York Times »Dies ist eines der außergewöhnlichsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe: mutig, einfühlsam und zutiefst menschlich… Seine Geschichten sind von meisterhafter Feinfühligkeit und Klarheit.« Siddhartha Mukherjee, Autor von ›Der König aller Krankheiten‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2087
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Andrew Solomon
Weit vom Stamm
Wenn Kinder ganz anders als ihre Eltern sind
Über dieses Buch
Wenn Kinder ganz anders als ihre Eltern sind
Wie geht man damit um, wenn die eigenen Kinder ganz anders sind als man selbst, was bedeutet das für sie und ihre Familien?
Der Bestsellerautor Andrew Solomon hat mit über 300 Familien gesprochen, deren Kinder am Down-Syndrom oder an Schizophrenie leiden, Autisten, taub oder kleinwüchsig sind. Ihre Geschichten sind einzigartig, doch ihre Erfahrungen des „Andersseins“ sind universell. Sie alle eint großer Mut, bewundernswerte Kraft und eine enorme Lebensfreude, die uns tiefen Respekt abverlangen.
»Weit vom Stamm« ist ein einzigartiges Buch über das Elternsein, über die Kraft der Liebe, aber auch darüber, was unsere Identität ausmacht und wie sehr wir über uns hinauswachsen können. Ein Buch das niemanden unberührt lässt. Es zeigt uns unsere Grenzen auf und schärft unser Bewusstsein über wahre Toleranz und Moral.
»Mutig – diese Buch schießt einem Pfeil um Pfeil ins Herz.«
The New York Times
»Dies ist eines der außergewöhnlichsten Bücher, die ich in letzter Zeit gelesen habe: mutig, einfühlsam und außerordentlich human… Seine Geschichten sind von meisterhafter Feinfühligkeit und Klarheit und verdeutlichen uns, wie unterschiedlich wir Menschen sind und wie tief wir uns doch im Innersten ähneln. Ich konnte das Buch nicht mehr aus der Hand legen.«
Siddhartha Mukherjee, Autor von ›Der König aller Krankheiten‹
»Das vielleicht größte Geschenk dieses monumentalen, so faktenreichen wie anrührenden Werks besteht darin, dass es zum permanenten Nachdenken anregt.«
Philip Gourevitch
»Solomon, der menschliches Verhalten auf höchst originelle Weise erforscht, hat eine Ideengeschichte geschrieben, die zur Grundlage einer Charta der psychologischen Grundrechte des 21. Jahrhunderts werden könnte... Erkenntnisse voller Einsicht, Empathie und Klugheit.«
Eric Kandel
»Ich dachte, mir würde viel Leid begegnen, und war überrascht, wie viel Lebensfreude und Glück ich vorfand.«
Andrew Solomon
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Andrew Solomon hat in Yale und Cambridge studiert. Unter anderem schreibt er für den »New Yorker«, »Newsweek« und den »Guardian«. Er ist Dozent für Psychiatrie an der Cornell University und beratend für LGBT Affairs am Lehrstuhl für Psychiatrie der Yale University tätig. Sein großes Buch über Depression ›Saturns Schatten‹ war ein internationaler Bestseller und wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem National Book Award und der Nominierung für den Pulitzer Preis. Er lebt mit seinem Mann und seinem Sohn in New York und London. Für ›Weit vom Stamm‹ erhielt er den National Book Critics Circle Award 2013.
Impressum
Covergestaltung: buxdesign | München
Coverillustration: Claire Scully
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »Far from the Tree. Parents, Children, and the Search for Identity« im Verlag Scribner, Simon & Schuster, New York
© 2012 Andrew Solomon
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2013
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-402722-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
I. Sohn
II. Gehörlos
III. Kleinwüchsige
IV. Down-Syndrom
V. Autismus
VI. Schizophrenie
VII. Behinderung
VIII. Wunderkinder
IX. Vergewaltigung
X. Kriminalität
XI. Transgender
XII. Vater
Dank
Bibliographie [Teil 1]
Bibliographie [Teil 2]
Abdruckgenehmigungen
Verzeichnis
Für John,
für dessen Anderssein ich sofort
auf alle Gleichheit der Welt verzichten würde
Das Unvollkommene ist unser Paradies.
Seht, in dieser Bitternis, die Freude,
Weil das Unvollkommene so heiß in uns ist,
In brüchigen Worten, in störrischen Lauten.
Wallace Stevens, Die Gedichte unseres Klimas.
I.Sohn
Es gibt keine Reproduktion. Wenn zwei Menschen beschließen, ein Kind zu zeugen, vollziehen sie einen produktiven Akt. Der Gebrauch des Ausdrucks Reproduktion – der impliziert, zwei Menschen würden sich einfach vervielfältigen – ist im besten Sinne ein Euphemismus, um zukünftige Eltern zu beschwichtigen. Denn in den unterbewussten Phantasien, die eine Empfängnis so verlockend erscheinen lassen, sehen wir uns in unseren Kindern selbst weiterleben, wir nehmen sie zunächst nicht als eigenständige Persönlichkeiten wahr. In der Erwartung, unsere egoistischen Gene fortzupflanzen, reagieren viele von uns deshalb unvorbereitet auf Kinder mit ungewöhnlichen Bedürfnissen. Wir sehen uns plötzlich einem Fremden gegenüber, und je andersartiger dieser Fremde ist, desto stärker unsere Verwirrung. In den Gesichtern unserer Kinder wollen wir das Versprechen ablesen, dass wir nicht sterben werden. Aus diesem Grund sind Kinder, deren wesentliche Eigenschaften die Hoffnung auf Unsterblichkeit zunichtemachen, eine besondere Kränkung: Wir müssen sie um ihretwillen lieben, nicht etwa aufgrund unserer in ihnen verkörperten guten Eigenschaften. Das ist sehr viel schwerer zu leisten. Die Liebe zu unseren Kindern stellt unsere Vorstellungskraft auf die Probe.
Blut ist zweifellos dicker als Wasser. Nichts ist befriedigender als erfolgreiche und hingebungsvolle Kinder, und es gibt kaum Schlimmeres, als wenn unsere Kinder scheitern oder uns zurückweisen. Unsere Kinder sind aber nicht wir: Sie sind uns genetisch ähnlich, teilen deshalb aber nicht zwangsläufig alle unsere Eigenschaften, sondern sind vom ersten Moment an unkontrollierbaren Umweltreizen ausgesetzt. Und doch sind wir unsere Kinder: Aus der Elternschaft kann niemand ausbrechen. Entsprechend des berühmten Ausspruchs des Psychoanalytikers D. W. Winnicott »There is no such thing as a baby«[1], wird, wer ein Neugeborenes oder Baby beschreiben will, immer das Baby und jemanden beschreiben. Ein Baby kann nicht für sich allein stehen, sondern ist immer Teil einer Beziehung. Insofern uns unsere Kinder ähneln, sind sie unsere größten Verehrer; insofern sie sich von uns unterscheiden, können sie zu unseren stärksten Kritikern werden. Deshalb leiten wir sie von Beginn an dazu an, uns nachzuahmen, und sehnen uns nach dem vielleicht tiefsten Kompliment des Lebens, nämlich ihrem Entschluss, unser Wertesystem zu übernehmen. Auch wenn viele von uns stolz darauf sind, sich von ihren Eltern zu unterscheiden, sind wir doch unendlich traurig, wenn sich unsere Kinder von uns unterscheiden.
Da Identität von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird, haben die meisten Kinder zumindest einige Merkmale mit ihren Eltern gemeinsam. Dies sind vertikale Identitäten. Eigenschaften und Werte werden über Generationen von Eltern an ihre Kinder weitergegeben, nicht nur über die DNA, sondern auch über gemeinsame kulturelle Normen. Unsere ethnische Zugehörigkeit beispielsweise ist eine vertikale Identität. Die Hautfarbe der Kinder entspricht zumeist der Hautfarbe der Eltern: Die genetisch bedingte Hautpigmentierung wird von einer Generation auf die nächste vererbt, ebenso wie die Selbstwahrnehmung als Person mit einer bestimmten Hautfarbe, obgleich diese einem Wandel unterworfen sein kann. Sprache ist normalerweise vertikal, denn die meisten Eltern geben ihre Muttersprache an ihre Kinder weiter. Religion ist halbwegs vertikal: Katholische Eltern werden sich bemühen, ihren Kindern den Katholizismus nahe zu bringen, diese aber können sich von der Religion abwenden oder einem anderen Glauben anschließen. Nationalität ist vertikal, außer bei Immigranten. Blonde Haare und Kurzsichtigkeit werden oft von Eltern auf ihr Kind übertragen, bilden aber in den meisten Fällen keine echte Basis für Identität – die blonden Haare sind zu unbedeutend, und Kurzsichtigkeit lässt sich leicht korrigieren.
Oft aber besitzt jemand ein angeborenes oder erworbenes Merkmal, das den Eltern fremd ist. Ein solcher Mensch muss seine Identität dann in einer Bezugsgruppe ausbilden. Diese Identität ist horizontal. Horizontale Identitäten sind geprägt durch genetische Differenzen, zufällige Mutationen, vorgeburtliche Einflüsse oder Werte und Vorlieben, die ein Kind nicht mit seinen Erzeugern teilt. Homosexualität ist eine horizontale Identität: Die meisten homosexuellen Kinder stammen von heterosexuellen Eltern ab, und da ihre Sexualität nicht von der Familie geprägt wird, erwerben sie eine schwul-lesbische Identität, indem sie an einer Subkultur teilhaben. Eine körperliche Behinderung ist meist horizontal, genauso wie eine Hochbegabung. Auch eine Psychopathie ist oft horizontal, die meisten Kriminellen beispielsweise sind nicht etwa Kinder von Gangstern. Autismus und geistige Behinderung sind ebenfalls horizontal. Und ein durch eine Vergewaltigung entstandenes Kind wächst in emotionalen Wirren auf, die dem Trauma der Mutter entspringen.
Im Jahr 1993 erhielt ich den Auftrag, für die New York Times über das Leben von Gehörlosen zu recherchieren.[2] Ich hielt Taubheit damals für ein Defizit, mehr nicht. In den folgenden Monaten wurde ich dann unerwartet in die Lebenswelt von Gehörlosen hineingezogen. Die meisten gehörlosen Kinder haben hörende Eltern. Diese Eltern legen Wert auf das Funktionieren in der Welt der Hörenden und verwenden enorme Energie darauf, ihren Kindern das Sprechen und Lippenlesen beizubringen; dabei vernachlässigen sie aber möglicherweise andere Lerngebiete. Einige gehörlose Menschen können gut Lippenlesen und bringen verständliche Sprachäußerungen hervor, andere besitzen diese Fähigkeit jedoch nicht und sitzen endlos lang bei Audiologen und Sprachtherapeuten, anstatt Geschichte, Mathematik und Philosophie zu lernen. Viele kommen dann als Jugendliche mit einer Gehörlosen-Identität in Kontakt und erleben dies als große Befreiung. Sie begeben sich in eine Welt, die Gebärden als Sprache anerkennt, und entdecken sich selbst neu. Es gibt hörende Eltern, die diese kraftvolle neue Entwicklung akzeptieren, andere jedoch bekämpfen sie.
Die Situation kam mir frappierend bekannt vor, da ich schwul bin. Homosexuelle wachsen oft unter der Obhut heterosexueller Eltern auf, die der Ansicht sind, dass eine heterosexuelle Orientierung besser sei, und die ihre Kinder deswegen zuweilen in eine quälende Konformität drängen. Wenn die homosexuellen Jugendlichen irgendwann die schwul-lesbische Identität entdecken, empfinden sie dies ebenfalls als große Erleichterung. Als ich anfing, über Gehörlose zu schreiben, kam gerade das Cochlear-Implantat auf den Markt, ein Gerät, das die Hörempfindung in etwa nachbilden kann. Von seinen Erfindern wurde es als wundersame Erlösung von einem grausamen Defekt gepriesen, während die Gehörlosen es als Mittel zum Genozid an einer lebendigen Gemeinschaft geißelten.[3] Beide Seiten haben ihre Rhetorik inzwischen etwas heruntergeschraubt, doch die Angelegenheit bleibt dadurch kompliziert, dass Cochlear-Implantate am wirkungsvollsten sind, wenn sie früh, das heißt möglichst bei Kindern eingepflanzt werden.[4] Die Entscheidung wird also von Eltern gefällt, bevor das Kind überhaupt eine Meinung ausbilden oder äußern kann. Während ich die Debatte verfolgte, wurde mir klar, dass auch meine Eltern einem vergleichbaren frühen Eingriff entschieden zugestimmt hätten, wenn dadurch hätte gewährleistet werden können, dass ich heterosexuell werde. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Aufkommen einer solchen Methode auch heute noch zur Auslöschung der gesamten schwul-lesbischen Kultur führen würde. Diese Vorstellung deprimiert mich, und obgleich sich mein Verständnis der Gehörlosenkultur vertieft hatte, wurde mir bewusst, dass die Ansichten, die ich in meinen Eltern verfestigt sah, wahrscheinlich auch mein eigenes Handeln leiten würden: Mein erster Impuls auf ein gehörloses Kind wäre, die anormale Störung auf jeden Fall beheben zu wollen.
Dann bekam eine Freundin eine kleinwüchsige Tochter. Sie war unsicher, ob sie ihr Kind in der Überzeugung aufwachsen lassen sollte, es sei wie jedes andere auch, nur eben etwas kleiner; oder ob sie ihrer Tochter auf jeden Fall Kleinwüchsige als Vorbilder nahebringen sollte; oder ob sie sich um eine operative Verlängerung der Gliedmaßen ihres Kindes bemühen sollte. Als sie mir von ihrer Verwirrung berichtete, erkannte ich ein vertrautes Muster. Ich hatte mich schon gewundert, etwas mit Gehörlosen gemeinsam zu haben, und nun identifizierte ich mich auch mit Minderwüchsigen. Ich fragte mich, wer sich wohl noch unserer glücklichen Schar anschließen würde. Wenn die schwul-lesbische Identität aus der Krankheit Homosexualität erwachsen konnte, dachte ich, die Gehörlosenidentität aus dem Defekt Taubheit und die Identität von Minderwüchsigen aus einer offensichtlichen Behinderung, dann musste es noch viele weitere Kategorien in diesen prekären Zwischenräumen geben. Das war eine radikalisierende Einsicht. Ich hatte mich immer als Teil einer relativ kleinen Minderheit gesehen und fand mich nun in großer Gesellschaft wieder. Uns alle verbindet das Anderssein. Die individuelle Erfahrung kann die Betroffenen isolieren, doch zusammen bilden sie eine Gesamtheit von Millionen, die allesamt Kämpfe auszustehen haben, die sie stark solidarisieren. Die Ausnahme ist allgegenwärtig, das Typische ein seltener und einsamer Zustand.
So wie meine Eltern missverstanden hatten, wer ich war, so verstehen auch andere Eltern fortwährend ihre eigenen Kinder falsch. Viele Eltern fassen die horizontale Identität ihres Kindes als Affront auf. Wenn sich ein Kind deutlich vom Rest der Familie unterscheidet, verlangt dies Wissen, Fähigkeiten und Taten, die eine typische Mutter und ein typischer Vater nicht abrufen können, zumindest anfangs nicht. Während Familien vertikale Identitäten von frühester Kindheit an stärken, stellen sie sich oft gegen horizontale Identitäten. Vertikale Identitäten werden gewöhnlich als Identitäten akzeptiert, horizontale Identitäten als Makel betrachtet.
Gleichwohl werden keine Forschungen dazu angestellt, wie die genetische Ausstattung so verändert werden könnte, dass beispielsweise die nächste Generation von Kindern dunkelhäutiger Eltern glatte Haare und helle Haut bekommt. Im modernen Amerika ist es manchmal schwer, schwarz, asiatisch, jüdisch oder weiblich zu sein, aber niemand vertritt die Ansicht, dass Schwarze, Asiaten, Juden oder Frauen sich besser in weiße männliche Christen verwandeln lassen sollten, sofern das möglich wäre. Viele vertikale Identitäten verursachen Unbehagen, und dennoch versuchen wir nicht, sie einzuebnen.
Für die Homosexualität trifft das nicht zu. Die Nachteile der Homosexualität sind von etwa gleicher Größenordnung wie die Nachteile der genannten vertikalen Identitäten, dennoch haben die meisten Eltern lange versucht, ihre homosexuellen Kinder zu Heterosexuellen zu machen. Anomalien im Körperbau sind meist erschreckender für die Menschen, die sie beobachten als für die Menschen, die mit ihnen leben, und doch sind Eltern darauf erpicht, physische Ausnahmen zu normalisieren – oft mit schwerwiegenden psychischen Folgen bei ihnen und ihren Kindern. Die geistige Verfassung eines Kindes als krank zu etikettieren – entweder aufgrund von Autismus, geistiger Behinderung oder Transsexualität – spiegelt womöglich eher das Unbehagen der Eltern über diesen Zustand als die Schwierigkeiten, die das Kind mit ihm haben kann. Es wird viel korrigiert, was man lieber in Ruhe gelassen hätte.
Behinderung ist ein Ausdruck, der im liberalen Diskurs seit längerem als belastet gilt, doch die Bezeichnungen, die ihn ersetzt haben – Schwäche, Syndrom, Handicap – sind auf ihre diskrete Art nicht minder diskriminierend. Wir sprechen oft von Krankheit, um eine Daseinsform herabzusetzen, und von Identität, um eben diese Daseinsform anzuerkennen. Dies ist aber eine falsche Unterscheidung. In der Physik beispielsweise wird Energie als etwas beschrieben, das sich manchmal als Welle und manchmal als Teilchen verhält – im Grunde aber ist sie beides, nur lässt unsere menschliche Beschränkung uns nicht beides zugleich erkennen. Der Physik-Nobelpreisträger Paul Dirac hat dargelegt, wie wir Licht als Teilchen wahrnehmen, wenn wir eine teilchenrelevante Frage stellen, und als Welle, wenn wir eine wellenrelevante Frage stellen.[5] Eine ganz ähnliche Dualität herrscht in Angelegenheiten des Ich. Viele Zustände sind zugleich Krankheit und Identität, aber wir können die eine Seite nur erkennen, wenn wir die andere verdecken. Das Eintreten für die Identität widersetzt sich dem Konzept der Krankheit, die Medizin dagegen schätzt die Identität zu gering. Beide Ansätze sind zu eng gefasst.
Physiker gewinnen bestimmte Einsichten, indem sie Energie als eine Welle verstehen, und wiederum andere Einsichten, indem sie Energie als Teilchen verstehen, und sie wenden Quantenmechanik an, um die gesammelten Informationen in Einklang zu bringen. Auf ganz ähnliche Weise sollten wir Krankheit und Identität betrachten. Wir benötigen ein Vokabular, in dem beide Konzepte keine Gegensätze, sondern vereinbare Aspekte eines Zustands sind. Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir den Wert von Individuen und Leben anders bemessen müssen, um einen neuen Zugang zu dem Begriff gesund zu finden. Ludwig Wittgenstein sagte: »Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.«[6] Ich erkenne also nur das, wofür ich Worte habe. Ein fehlendes Wort macht uns gewissermaßen blind.
Die hier von mir beschriebenen Kinder besitzen horizontale Identitäten, die ihren Eltern fremd sind. Sie sind gehörlos oder minderwüchsig, sie haben das Down-Syndrom, Autismus, Schizophrenie oder mehrfache schwere Behinderungen. Sie sind Wunderkinder, sie sind Menschen, die durch eine Vergewaltigung gezeugt wurden, oder Menschen, die Verbrechen begehen. Sie sind transsexuell. Das alte Sprichwort sagt: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.[7] Diese Kinder aber sind Äpfel, die anders gefallen sind: einige ein paar Gärten weiter, einige ans andere Ende der Welt. Unzählige Familien haben Kinder, die nicht ihren ursprünglichen Vorstellungen entsprachen, tolerieren und schätzen gelernt. Oftmals erleichtert und manchmal durcheinandergebracht wird dieser transformative Prozess durch gesellschaftlichen Wandel und medizinischen Fortschritt.
Jeder Nachwuchs verwundert seine Eltern. Die hier dargestellten dramatischen Situationen sind nur Variationen eines Themas. So wie wir die Eigenschaften eines Medikaments durch die Wirkung extrem hoher Dosen untersuchen oder die Standfestigkeit eines Baumaterials testen, indem wir es überirdischen Supertemperaturen aussetzen, so lässt sich das universelle Phänomen der Andersartigkeit innerhalb von Familien besser begreifen, indem wir uns Extremfälle anschauen. Außergewöhnliche Kinder verstärken die elterliche Veranlagung: Potentiell schlechte Eltern werden schreckliche Eltern, und potentiell gute Eltern werden oft ganz hervorragende Eltern. Ich sehe die Dinge genau andersherum als Tolstoi: Alle unglücklichen Familien, die ihre abweichenden Kinder ablehnen, gleichen einander, während die glücklichen Familien, die versuchen, sie zu akzeptieren, auf vielerlei Weise glücklich sind.[8]
Da zukünftige Eltern immer mehr Möglichkeiten haben, sich gegen Kinder mit horizontalen Auffälligkeiten zu entscheiden, sind die Erfahrungen von Eltern, die solche Kinder großziehen, wesentlich für unser Verständnis von Andersartigkeit. Die frühe Zuwendung und die Interaktion mit den Eltern prägt die Sicht des Kindes auf sich selbst. Die Eltern werden durch ihre Erfahrungen tief verändert. Wer ein Kind mit einer Behinderung hat, wird auf ewig Vater oder Mutter eines behinderten Kindes sein – der Zustand wird zu einem herausgehobenen Kennzeichen und grundlegend dafür, wie andere uns wahrnehmen. Alle Eltern neigen dazu, Abweichung als Krankheit aufzufassen, bis Gewöhnung und Liebe sie befähigen, mit der seltsamen neuen Realität fertigzuwerden – oftmals dadurch, dass die Sprache der Identität eingeführt wird. Die Nähe zum anderen begünstigt seine Integration.
Das erlernte Glück dieser Eltern bekannt zu machen, trägt wesentlich dazu bei, Identitäten zu bewahren, die inzwischen bedroht sind. Ihre Geschichten zeigen uns allen einen Weg auf, wie wir unsere Definition des Menschlichen erweitern können. Es ist wichtig zu erfahren, wie autistische Menschen über Autismus denken, oder Minderwüchsige über Minderwuchs. Selbstachtung ist unentbehrlich, aber ohne familiäre und gesellschaftliche Akzeptanz kann diese nicht die endlosen Ungerechtigkeiten kompensieren, denen viele horizontale Identitäten ausgesetzt sind. Wir leben in xenophoben Zeiten, in denen die Gesetzgebung mit Mehrheitsunterstützung die Rechte von Frauen, Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen, illegalen Einwanderern und Armen beschneidet. Trotz und inmitten dieser Krise der Empathie herrscht jedoch im Privaten großes Mitgefühl, und die meisten Eltern, die ich porträtiert habe, lieben über die Grenzen hinweg. Wenn wir verstehen, wie sie dazu gekommen sind, ihren Kindern mit Wohlwollen zu begegnen, können wir Einsichten und Motive gewinnen, es ihnen gleichzutun. Wer in seinem Kind sich selbst und zugleich etwas ausgesprochen Fremdes erblickt und daraufhin eine begeisterte Zuneigung zu allen diesen Facetten gewinnt, der hat die selbstverliebte, selbstlose Hingabe der Elternschaft erreicht. Es ist erstaunlich, wie oft sich diese Wechselseitigkeit entwickelt – wie oft anfangs hadernde Eltern entdeckten, dass sie sehr wohl für ein außergewöhnliches Kind sorgen können. Die elterliche Veranlagung zu lieben obsiegt in den grausamsten Situationen.
Als Kind hatte ich eine Lese-Rechtschreibschwäche. Ich habe sie heute noch. Ich kann nicht per Hand schreiben, ohne mich auf jeden einzelnen Buchstaben zu konzentrieren, und selbst dann gerät mir einiges durcheinander oder bleibt lückenhaft. Meine Mutter erkannte die Dyslexie sehr früh und begann mit mir lesen zu üben, als ich zwei war. Ich verbrachte lange Nachmittage auf ihrem Schoß und lernte, wie man Wörter buchstabiert. Ich trainierte wie ein olympischer Phonetik-Athlet, und wir betrachteten Buchstaben, als könne keine Gestalt liebreizender sein als ihre. Um mich bei Laune zu halten, schenkte mir meine Mutter ein Notizbuch mit gelbem Filzeinband, auf den Winnie-the-Pooh und Tigger gestickt waren. Wir bastelten Lernkarten und spielten damit im Auto. Ich genoss die Aufmerksamkeit, und meine Mutter brachte viel Spaß ins Lernen, so als sei es das Aufregendste der Welt. Als ich sechs war, stellten meine Eltern an elf New Yorker Schulen einen Aufnahmeantrag, und alle elf lehnten mich mit der Begründung ab, ich würde nie lesen und schreiben lernen. Ein Jahr später wurde ich an einer Schule aufgenommen, deren Direktor widerwillig eingestehen musste, dass meine fortgeschrittenen Lesekenntnisse die urteilssichere Prognose widerlegt hatten. Für Triumphgefühle gab es bei uns zu Hause hohe Standards, doch dieser erste Sieg über die Lese- und Rechtschreibschwäche war prägend: Mit Geduld, Liebe, Intelligenz und Entschlossenheit hatten wir eine neurologische Abnormität überlistet. Unglücklicherweise legte er aber auch den Grundstein für unsere späteren Auseinandersetzungen, da niemand glauben wollte, dass wir nicht auch eine andere angebliche Abnormität bekämpfen konnten, die sich schleichend bemerkbar machte: mein Schwulsein.
Man fragt mich oft, wann ich bemerkte, dass ich schwul bin, und ich überlege dann, was diese Frage eigentlich unterstellt. Es dauerte einige Zeit, bis ich mir meiner sexuellen Vorlieben bewusst wurde. Die Erkenntnis, dass meine Wünsche exotisch waren und nicht denen der Mehrheit entsprachen, kam so früh, dass ich keine Erinnerung an eine Zeit davor habe. Studien zeigen, dass männliche Kinder, die sich später als schwul outen, schon im Alter von zwei Jahren bestimmten Raufspielen abgeneigt sind. Mit sechs dann verhalten sich die meisten offensichtlich geschlechtsuntypisch.[9] Da ich schon früh ahnte, dass meine Impulse unmännlich waren, unternahm ich auch in anderen Bereichen Selbstfindungs-Experimente. Als man uns im ersten Schuljahr fragte, welches unser Lieblingsessen sei, und alle »Eis«, »Hamburger« und »Spaghetti« antworteten, entschied ich mich stolz für Ekmek Kadayif mit Kaymak, das ich in einem armenischen Restaurant gegessen hatte. Ich habe nie Baseballkarten getauscht, aber ich habe im Schulbus Opern nacherzählt. All das machte mich nicht gerade beliebt.
Zu Hause war ich beliebt, aber auch erzieherischen Maßnahmen unterworfen. Als ich sieben war, kaufte meine Mutter meinem Bruder und mir ein paar Schuhe, und bevor wir das Geschäft verließen, fragte uns der Verkäufer, ob wir einen Luftballon haben wollten und in welcher Farbe. Mein Bruder wollte einen roten Ballon. Ich wollte einen pinkfarbenen. Meine Mutter wandte ein, das könne nicht mein Ernst sein, meine Lieblingsfarbe sei doch blau. Ich aber beharrte darauf, den pinkfarbenen haben zu wollen, aber unter ihrem zornigen Blick ließ ich mir dann doch den blauen geben. Dass meine Lieblingsfarbe immer noch blau ist, ich aber dennoch schwul bin, demonstriert den Einfluss meiner Mutter und zugleich seine Grenzen.[10] Sie sagte einmal: »Als du klein warst, wolltest du nicht tun, was die anderen Kinder taten, und ich habe dich ermutigt, du selbst zu sein.« Dann fügte sie halb ironisch hinzu: »Manchmal glaube ich, ich bin damit zu weit gegangen.« Ich dagegen habe oft gedacht, sie ist nicht weit genug gegangen. Aber ihre Unterstützung meiner Individualität, die zweifellos auch ambivalent war, hat mein Leben geprägt.
Meine neue Schule hatte eine quasi-liberale Einstellung und verstand sich als integrativ – das hieß, dass in unserer Klasse auch ein paar durch ein Stipendium unterstützte Schwarze und Latinos waren, die aber hauptsächlich untereinander Kontakt hatten. In meinem ersten Jahr dort lud Debbie Camacho zu einer Geburtstagsparty in Harlem ein. Ihre Eltern kannten die New Yorker Privatschuletikette nicht und hatten die Feier auf denselben Tag wie die Homecoming-Party gelegt. Meine Mutter fragte mich, was ich wohl sagen würde, wenn niemand zu meiner Geburtstagsfeier käme, und bestand darauf, dass ich hinging. Ich bezweifle, dass überhaupt viele Kinder zu dem Geburtstag gekommen wären, auch wenn es nicht diese bequeme Entschuldigung gegeben hätte. Letztendlich waren nur zwei weiße Kinder von vierzig Schülern der Klasse dort. Ich war reinweg verängstigt. Die Cousinen des Mädchens wollten mich zum Tanzen animieren, alle sprachen Spanisch, es gab ungewohnte frittierte Speisen. Da bekam ich eine Art Panikattacke und ging tränenüberströmt nach Hause.
Ich zog keine Parallele zwischen Debbies fehlenden Geburtstagsgästen und meiner eigenen Unbeliebtheit – selbst dann nicht, als ein paar Monate später Bobby Finkel seinen Geburtstag feierte und alle aus der Klasse außer mich einlud. Meine Mutter rief bei Mrs Finkel an, da sie annahm, es handele sich um einen Irrtum, doch Mrs Finkel sagte, ihr Sohn könne mich nicht leiden und wolle mich nicht dabeihaben. An dem Tag der Geburtstagsfeier holte meine Mutter mich von der Schule ab und ging mit mir in den Zoo und danach auf ein »Hot Fudge Sundae« zu Old-Fashioned Mr Jennings. Erst in der Rückschau kann ich mir vorstellen, wie gekränkt meine Mutter meinetwegen war – gekränkter als ich es war oder zeigen wollte. Mir war nicht bewusst, dass ihre Zuneigung auch der Versuch war, die Kränkungen der Welt zu kompensieren. Wenn ich das Unbehagen meiner Eltern angesichts meiner Homosexualität sehe, erkenne ich, wie verletzbar sie meine Verletzlichkeit machte und wie sie meiner Traurigkeit mit der Zusicherung zuvorkommen wollten, dass wir auch allein glücklich sein konnten. Dass meine Mutter mir den pinkfarbenen Luftballon verweigerte, muss zum Teil als schützende Geste verstanden werden.
Ich bin froh, dass meine Mutter mich zu Debbie Camachos Geburtstagsparty geschickt hat – weil ich glaube, dass es richtig war, und weil es mich Unvoreingenommenheit lehrte. Mich und meine Familie deshalb als Verfechter der Toleranz zu stilisieren, wäre jedoch unangebracht. Ich ärgerte einen afroamerikanischen Mitschüler in der Grundschule und behauptete, er sähe aus wie das Stammeskind in einem Rondavel auf einer Abbildung in unserem Sozialkundebuch. Ich fand das nicht rassistisch, ich fand es lustig und zum Teil zutreffend. Als ich älter war, erinnerte ich mich mit tiefem Bedauern an mein Verhalten, und als der Betreffende mich bei Facebook entdeckte, entschuldigte ich mich ausdrücklich. Er nahm die Entschuldigung an und erwähnte, dass er auch schwul sei. Ich bewunderte, wie er sich behauptet hatte, da doch Vorurteile von zwei Seiten im Spiel waren.
Ich kämpfte mich durch die Gemeinheiten der Grundschule, zu Hause wurden meine hartnäckigen Defizite heruntergespielt und meine Schrullen meist mit Humor genommen. Als ich zehn war, entwickelte ich eine Faszination für das winzige Fürstentum Liechtenstein. Ein Jahr später nahm uns mein Vater mit auf eine Geschäftsreise nach Zürich, und eines Morgens verkündete meine Mutter, sie habe eine gemeinsame Fahrt in Liechtensteins Hauptstadt Vaduz organisiert. Ich erinnere mich, wie begeistert die ganze Familie bei etwas mitmachte, das doch so offensichtlich ganz allein meinem Wunsch entsprach. Im Rückblick erscheint der Liechtenstein-Spleen merkwürdig, aber dieselbe Mutter, die den pinkfarbenen Luftballon verbot, arrangierte diesen Tag samt Mittagessen in einem schönen Café, einem Besuch des Kunstmuseums und einer Besichtigung der Druckerei, in der die berühmten Briefmarken des kleinen Landes hergestellt werden. Ich fühlte mich nicht immer geschätzt, aber immer anerkannt – man gab meiner Exzentrik Raum. Aber es gab Grenzen, und pinkfarbene Luftballons gingen wohl zu weit. Unsere Familie war am anderen interessiert, jedoch aus einem Bund des Gleichartigen heraus. Ich wollte aufhören, die weite Welt nur zu betrachten, ich wollte sie mir zu eigen machen: Ich wollte nach Perlen tauchen, Shakespeare auswendig können, die Schallmauer durchbrechen und stricken lernen. Einerseits kann der Wunsch, mich selbst zu verwandeln, als der Versuch gesehen werden, mich aus einer unerwünschten Daseinsweise zu befreien. Andererseits war es aber auch eine Hinwendung zu meinem wahren Ich, eine wichtige Ausrichtung hin zu der Person, die ich werden sollte.
Schon im Kindergarten verbrachte ich die Pausen damit, Gespräche mit den Erziehern zu führen, denn die anderen Kinder verstanden mich nicht. Das taten die Erzieher vielleicht auch nicht, aber sie waren alt genug, um höflich zu sein. In der Grundschule aß ich mein Mittagessen meist im Büro von Mrs Brier, der Sekretärin des Schuldirektors. Ich machte den Highschoolabschluss, ohne jemals in der Cafeteria gewesen zu sein, wo ich bei den Mädchen gesessen hätte und dafür ausgelacht worden wäre. Den Drang zur Konformität, der die Kindheit doch oft beherrscht, verspürte ich nicht, und als ich begann, über Sexualität nachzudenken, reizte mich der Nonkonformismus gleichgeschlechtlicher sexueller Vorlieben. Die Erkenntnis, dass das, was ich wollte, noch andersartiger und verbotener war als sämtlicher Sex, kam sehr früh. Homosexualität erschien mir wie die armenische Wüste oder ein Tag in Liechtenstein. Trotzdem dachte ich: Wenn irgendjemand herausfinden würde, dass ich schwul war, müsste ich sterben.
Meine Mutter wollte nicht, dass ich schwul bin, weil sie annahm, ich würde es dadurch schwer haben, doch gleichzeitig widerstrebte ihr die Vorstellung, Mutter eines schwulen Jungen zu sein. Schwierig war nicht, dass sie mein Leben kontrollieren wollte – obwohl sie wie die meisten Eltern davon ausging, ihre Art glücklich zu sein, sei die beste Art glücklich zu sein. Schwierig war, dass sie ihr Leben in den Griff bekommen wollte, und es war ihr Leben als Mutter eines Homosexuellen, das sie ändern wollte. Leider gab es keine Möglichkeit, ihr Problem zu lösen, ohne mich einzubeziehen.
Schon früh begann ich, diesen Aspekt meiner Identität zu hassen, denn ihre Haltung spiegelte den Umgang meiner Familie mit vertikalen Identitäten. Meine Mutter hielt es etwa für nicht wünschenswert, jüdisch zu sein. Diese Ansicht hatte sie von meinem Großvater übernommen, der seine Religion geheim gehalten hatte, um seine gut dotierte Stelle in einem Unternehmen zu halten, das keine Juden einstellte. Er war Mitglied in einem vorstädtischen Country Club, in dem Juden nicht gerne gesehen waren. Mit Anfang zwanzig war meine Mutter kurz mit einem Texaner verlobt, der sich aber trennte, als seine Familie ihm androhte, ihn zu enterben, falls er eine Jüdin heirate. Für meine Mutter war dieses Erlebnis traumatisch. Bis dahin hatte sie sich nicht ausdrücklich als Jüdin gesehen, sondern angenommen, sie könne die Person sein, als die sie auftrat. Fünf Jahre später entschied sie sich, meinen jüdischen Vater zu heiraten und Teil eines jüdischen Umfelds zu werden, aber sie trug den Antisemitismus in sich. Wenn sie Menschen sah, die bestimmte Stereotype erfüllten, sagte sie: »Diese Leute sorgen dafür, dass wir einen so schlechten Ruf haben.« Und als ich sie fragte, was sie von der begehrten Mittelstufenschönheit an meiner Schule hielt, antwortete sie: »Sie sieht jüdisch aus.« Ihre methodischen Selbstzweifel wendete ich auf mein Schwulsein an.
Noch lange nach der Kindheit hing ich an kindischen Dingen, als Abwehr gegen die Sexualität. Diese gewollte Unreife war überlagert von einer affektierten viktorianischen Prüderie, die das Verlangen nicht verdecken, sondern tilgen sollte. Ich hatte die phantastische Vorstellung, dass ich auf ewig Christopher Robin im Hundert-Morgen-Wald bleiben könnte, und das letzte Kapitel von Winnie-the-Pooh kam mir so sehr vor wie meine eigene Geschichte, dass ich kaum ertrug, es anzuhören, während mir mein Vater alle anderen Geschichten wohl hundertmal vorlesen musste. The House at Pooh Corner endet mit den Worten: »Aber wohin sie auch gehen und was ihnen auf dem Weg dorthin auch passieren mag: An jenem verzauberten Ort ganz oben in der Mitte des Waldes wird ein kleiner Junge sein, und sein Bär wird bei ihm sein, und die beiden werden spielen.«[11] Ich beschloss, dass ich dieser Junge und dieser Bär sein würde und dass ich mein kindliches Wesen behalten würde, denn was das Erwachsenwerden mir verhieß, war zu demütigend. Mit dreizehn kaufte ich mir einen Playboy, sah mir die Seiten stundenlang an und versuchte mein Unbehagen angesichts der weiblichen Anatomie zu klären. Das Ganze war zermürbender als Hausaufgaben. Als ich die Highschool erreicht hatte, wusste ich, dass ich früher oder später Sex mit Frauen haben müsste, doch ich spürte, dass ich das nicht könnte, und dachte mehr als einmal ans Sterben. Die Hälfte meines Ichs, die nicht vorhatte, auf ewig als Christopher Robin an einem verzauberten Ort zu spielen, wollte sich wie Anna Karenina vor den Zug werfen. Es war ein grotesker Zwiespalt.
Im achten Schuljahr an der Horace Mann School in New York gab mir ein älterer Junge den Spitznamen Percy, als Anspielung auf mein schwules Auftreten. Wir fuhren mit demselben Bus zur Schule, und immer wenn ich morgens einstieg, johlten er und seine Freunde: »Percy! Percy! Percy!« Manchmal saß ich neben einem chinesisch-amerikanischen Schüler, der zu schüchtern war, um mit jemand anderem zu reden (und der, wie sich später herausstellte, selbst schwul war), und manchmal neben einem nahezu blinden Mädchen, das ebenfalls erheblichen Grausamkeiten ausgesetzt war. Es kam vor, dass alle im Bus über die gesamte Strecke fünfundvierzig Minuten lang lauthals »Per-cy! Per-cy! Per-cy! Per-cy!« skandierten. Das blinde Mädchen riet mir immer wieder: »Beachte die gar nicht«, und so saß ich da und gab wenig überzeugend vor, es wäre nichts.
Vier Monate, nachdem die Provokationen begonnen hatten, kam ich eines Tages nach Hause, und meine Mutter fragte: »Ist etwas passiert im Schulbus? Haben die anderen Kinder dich Percy genannt?« Ein Klassenkamerad hatte seiner Mutter davon erzählt, und die wiederum hatte meine Mutter angerufen. Als ich es zugab, umarmte sie mich lange und fragte dann, warum ich ihr nichts davon erzählt hätte. Das war mir nie in den Sinn gekommen: Es schien die Erniedrigung konkret zu machen, wenn man darüber sprach, und außerdem dachte ich, man könne ohnehin nichts dagegen tun. Vor allem aber nahm ich an, dass die Eigenschaften, derentwegen ich gequält wurde, auch meiner Mutter zuwider wären, und vor dieser Enttäuschung wollte ich sie bewahren.
Danach fuhr eine Aufsichtsperson im Bus mit, und das Gejohle hörte auf. Ich wurde in der Schule nur noch »Schwuchtel« genannt, und das oft in Hörweite von Lehrern, die keinen Einspruch erhoben. Im selben Schuljahr erzählte uns unser Biologielehrer, Homosexuelle würden fäkale Inkontinenz entwickeln, da ihre Schließmuskel zerstört würden. Schwulenfeindlichkeit war in den siebziger Jahren allgegenwärtig, meine Schule aber ließ sie in zugespitzter Form zu.
Im Juni 2012 veröffentlichte das New York Times Magazine einen Artikel des Horace Mann-Alumnus Amos Kamil[12]. Darin berichtet er über den Missbrauch, den männliches Lehrpersonal an Jungen der Schule verübt hatte, und zwar während der Zeit, in der auch ich die Schule besuchte. Der Artikel zitierte Schüler, die infolge des Erlebten suchtkrank wurden oder anderes selbstzerstörerisches Verhalten entwickelten. Ein Mann mittleren Alters hatte Selbstmord begangen, offenbar auf dem Höhepunkt einer Verzweiflung, die laut seiner Familie in dem Kindesmissbrauch ihren Anfang genommen hatte. Der Bericht machte mich tief traurig – und verwirrt, denn einige Lehrer, die man dieser Taten anklagte, waren während jener trostlosen Zeit freundlicher zu mir gewesen als irgendjemand sonst an der Schule. Mein Geschichtslehrer hatte mich einmal zum Essen eingeladen, er schenkte mir ein Exemplar der Jerusalemer Bibel und unterhielt sich während der freien Zeiten mit mir, wenn die anderen Schüler nichts mit mir zu tun haben wollten. Der Musiklehrer belohnte mich mit Konzertsoli, ich durfte ihn mit Vornamen ansprechen und in seinem Büro abhängen, und er organisierte Chorfahrten, die zu meinen glücklichsten Abenteuern gehören. Diese Menschen schienen zu erkennen, wer ich war, und schätzten mich trotzdem. Die unausgesprochene Anerkennung meiner Sexualität half mir, kein Drogenabhängiger oder Selbstmörder zu werden.
In der neunten Klasse versuchte der Kunstlehrer (und Footballcoach) der Schule, mir ein Gespräch über Selbstbefriedigung aufzuzwingen. Ich war entsetzt. Es kam mir vor, als wolle dieser Lehrer eine strafbare Handlung provozieren, und wenn ich darauf einging, würde er allen erzählen, dass ich schwul war, und ich würde noch mehr zum Gespött der Schule werden. Keiner der anderen Lehrer machte mir gegenüber je Annäherungsversuche – vielleicht, weil ich ein schlaksiger, unbeholfener Junge mit Brille und Zahnspange war, vielleicht, weil meine Eltern für ihr beschützendes Engagement bekannt waren, vielleicht, weil ich mir eine schützende Arroganz zugelegt hatte.
Der Kunstlehrer wurde entlassen, als kurz nach meinem Gespräch mit ihm Beschuldigungen laut wurden. Der Geschichtslehrer wurde entlassen und beging ein Jahr später Selbstmord. Der Musiklehrer, ein verheirateter Mann, überstand die nachfolgende »Schreckensherrschaft«, wie ein homosexuelles Mitglied des Kollegiums es später nannte. Viele schwule Lehrer aber wurden vor die Tür gesetzt. Kamil schrieb mir, die Entlassungen von schwulen Lehrern, die sich keiner Übertritte schuldig gemacht hatten, wären ein »fehlgeleiteter Versuch, Pädophilie auszurotten, indem man sie fälschlicherweise mit Homosexualität gleichsetzt«. Schüler hetzten gegen homosexuelle Lehrer, da die Vorurteile so offensichtlich von der Schulgemeinschaft unterstützt wurden.
Die Leiterin der Theaterabteilung, Anne MacKay, eine Lesbe, ließ die Beschuldigungen stumm an sich vorüberziehen. Zwanzig Jahre nach meinem Schulabschluss begannen sie und ich E-Mails auszutauschen. Ein weiteres Jahrzehnt später fuhr ich nach Long Island, denn ich hatte erfahren, dass sie sterben würde. Miss MacKay war die kluge Lehrerin, die mir einst freundlich erklärt hatte, ich würde wegen meiner Art zu gehen geärgert, und mir daraufhin einen selbstbewussteren Schritt hatte beibringen wollen. In meinem letzten Jahr an der Schule führte sie The Importance of Being Earnest auf, damit ich als Algernon glänzen konnte. Ich kam, um ihr zu danken. Sie aber hatte mich eingeladen, um sich zu entschuldigen. Bei ihrer ersten Arbeitsstelle, erklärte sie, hatte sich herumgesprochen, dass sie mit einer Frau zusammenlebte. Eltern hatten sich beschwert, und sie war für den Rest ihrer Berufstätigkeit sozusagen in Deckung gegangen. Jetzt bereute sie ihre förmliche Distanz. Sie fand, sie habe gegenüber den homosexuellen Schülern versagt, denen sie doch ein Vorbild hätte sein können. Wir beide wussten jedoch, dass sie ihre Stelle verloren hätte, wenn sie offenherziger gewesen wäre. Als ihr Schüler wäre mir nie eingefallen, über eine größere Intimität zwischen uns nachzudenken, aber als wir nun Jahrzehnte später miteinander sprachen, wurde mir bewusst, wie einsam wir beide damals gewesen waren. Während meiner Highschool-Zeit wusste ich, dass sie lesbisch ist, und sie wusste, dass ich schwul bin, und dennoch waren wir beide durch unsere Homosexualität so gefangen, dass kein offener Austausch möglich war. Als ich meine Lehrerin nach so vielen Jahren wiedertraf, lebte meine alte Einsamkeit wieder auf, und ich erinnerte mich, wie isolierend eine ungewöhnliche Identität sein kann, wenn wir sie nicht in horizontaler Solidarität auffangen.
In dem aufgeregten E-Mailaustausch von Ehemaligen der Horace Mann, der auf die Veröffentlichung von Amos Kamils Bericht folgte, schrieb ein Mann über das Mitleid, das er sowohl für die Missbrauchsopfer als auch für die Täter empfinde, und sagte dabei über letztere: »Sie waren gekränkte, verwirrte Menschen, die sich darüber klarzuwerden versuchten, wie sie in einer Welt funktionieren sollen, die ihnen sagte, ihre homosexuellen Begierden seien krankhaft. Schulen spiegeln die Welt, in der wir leben. Sie können keine perfekten Orte sein. Nicht jeder Lehrer wird ein emotional ausgeglichener Mensch sein. Wir können diese Lehrer verurteilen. Aber damit behandeln wir nur das Symptom, nicht das eigentliche Problem, das darin besteht, dass eine intolerante Gesellschaft Menschen voller Selbsthass hervorbringt, die sich unangemessen ausleben.«[13] Sexueller Kontakt zwischen Lehrern und Schülern ist inakzeptabel, da er ein Machtgefälle ausnutzt, das die Grenze zwischen Nötigung und Zustimmung verwischt. Bei den Schülern, die Kamil befragte und beschrieb, hat der Missbrauch ein Trauma hervorgerufen. Ich fragte mich, wie meine Lehrer zu so etwas hatten fähig sein können, und kam auf die mögliche Antwort, dass jemand, dessen Wesenskern als Krankheit und Gesetzeswidrigkeit betrachtet wird, Schwierigkeiten haben könnte, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Wird eine Identität als Krankheit betrachtet, lässt dies die echte Krankheit weniger abschreckend erscheinen.
Jungen Menschen bieten sich viele Gelegenheiten für sexuelle Erfahrungen, zumal in New York. Zu meinen Pflichten gehörte es, abends mit dem Hund rauszugehen, und als ich vierzehn war, entdeckte ich auf diese Weise zwei schwule Bars in der Nähe unserer Wohnung: Uncle Charlie’s Uptown und Camp David. Fortan steuerte ich diese beiden Orte des Begehrens bei jedem Spaziergang mit Martha, unserem Kerry Blue-Terrier, an und beobachtete mit dem Hund an der Leine, wie die Typen auf die Lexington Avenue strömten. Einer der Männer, er hieß Dwight, folgte mir eines Tages und zog mich in einen Eingang. Ich konnte mit Dwight und den anderen nicht nach Hause gehen – wenn ich das getan hätte, wäre ich in jemand anderen verwandelt worden. Ich weiß nicht mehr, wie Dwight aussah, aber sein Name macht mich wehmütig. Als ich endlich mit einem Mann Sex hatte, war ich siebzehn und hatte das Gefühl, ich würde mich nun endgültig von der normalen Welt lösen. Ich ging nach Hause, gab meine Kleider in die Kochwäsche und duschte stundenlang mit heißem Wasser, so als könne ich mich von meiner Verfehlung reinwaschen.
Als ich neunzehn war, las ich im hinteren Teil des New York Magazine eine Anzeige, in der Menschen mit sexuellen Problemen eine Therapie mit Behelfspartnern angeboten wurde. Ich wusste natürlich, dass der Anzeigenteil einer Zeitschrift nicht unbedingt der geeignete Ort war, um eine seriöse Behandlung zu finden, aber mir war meine Lage zu peinlich, um sie jemandem zu eröffnen, der mich kannte. Ich brachte also meine Ersparnisse in ein schäbiges Büro in Hell’s Kitchen und unterwarf mich langen Gesprächen über meine sexuellen Ängste. Ich war unfähig, mir oder dem sogenannten Therapeuten zu gestehen, dass ich ganz einfach kein Interesse an Frauen hatte. Das angeregte Sexualleben, das ich inzwischen mit Männern hatte, erwähnte ich nicht. Ich begann, mich von Personen »therapieren« zu lassen, die ich »Doktor« nennen sollte und die mir »Übungen« mit meinen »Surrogaten« verschrieben – mit Frauen, die eigentlich keine Prostituierten waren, doch strenggenommen nichts anderes machten. In einer Sitzung sollte ich nackt auf allen vieren herumkrabbeln und so tun, als sei ich ein Hund, während meine Partnerin so tat, als sei sie eine Katze. Den Austausch von Intimitäten zwischen verfeindeten Arten ist eine stärkere Metapher für diese Therapie als ich es damals wahrnahm. Ich gewann die Frauen seltsam lieb, und eine von ihnen, eine attraktive Blonde aus den Deep South, erzählte mir irgendwann, sie sei nekrophil und habe diesen Job angenommen, nachdem sie im Leichenschauhaus Ärger bekommen hatte. Es war vorgesehen, dass man die Mädchen wechselte, damit man noch größere Unbefangenheit erreichte. Ich erinnere mich, wie mich zum ersten Mal eine Puerto Ricanerin bestieg, auf und ab hüpfte und ekstatisch schrie: »Du bist in mir drin! Du bist in mir drin!«, während ich dalag und mich mit besorgter Langeweile fragte, ob ich nun endlich ein diplomierter Heterosexueller geworden war.
Therapien wirken selten schnell und umfassend, wenn es nicht gerade um bakterielle Infektionen geht, doch das ist manchmal schwer zu erkennen, da sich gesellschaftliche und medizinische Gegebenheiten rasch ändern. Meine Genesung erfolgte, sobald ich meinen Zustand nicht mehr als Krankheit wahrnahm. Das Büro an der fünfundvierzigsten Straße taucht in meinen Träumen auf: die Nekrophile, die meine blasse, verschwitzte Gestalt einer Leiche ähnlich genug fand, um in Fahrt zu kommen, und die zielstrebige Latino-Frau, die mir ihren Körper mit so viel jubelndem Eifer darbot. Meine Behandlung dauerte nur zwei Stunden die Woche über etwa ein halbes Jahr, und sie verschaffte mir tatsächlich eine größere Unbefangenheit mit weiblichen Körpern. Sie war wichtig für meine nachfolgenden heterosexuellen Erfahrungen – Erfahrungen, die ich nicht missen möchte. Einige der Frauen, mit denen ich später Beziehungen hatte, habe ich aufrichtig geliebt. Dennoch war mir immer klar, das meine »Behandlung« eine Manifestation von Selbsthass war, und ich kann immer noch nicht ganz verzeihen, welche Umstände mich dazu bewegten, diese obszönen Bemühungen zu unternehmen. Dass ich meine Psyche zwischen Dwight und den Katzenfrauen aufs Äußerste anspannte, machte mir als jungem Erwachsenen romantische Liebe beinahe unmöglich.[14]
Mein Interesse an tiefen Differenzen zwischen Eltern und Kindern ist auch aus dem Bedürfnis entstanden, dem Grund meines Kummers nachzugehen. Auch wenn ich gern meinen Eltern die Schuld geben würde, bin ich doch zu der Erkenntnis gelangt, dass ein Großteil meines Schmerzes aus dem weiteren Umfeld kam, und auch aus mir selbst. Auf dem Höhepunkt eines Streits sagte mir meine Mutter einmal: »Irgendwann kannst du ja zu einem Therapeuten gehen und ihm erzählen, wie deine schreckliche Mutter dein Leben zerstört hat. Aber dann ist es dein kaputtes Leben, über das du sprichst. Also sieh zu, dass du dir ein Leben aufbaust, in dem du glücklich sein kannst, und in dem du lieben und geliebt werden kannst, denn nur das zählt.« Man kann jemanden lieben, ohne ihn zu akzeptieren, und man kann jemanden akzeptieren, ohne ihn zu lieben. Ich empfand den Mangel an Akzeptanz bei meinen Eltern fälschlicherweise als Defizit an Liebe. Inzwischen denke ich, ihre Haupterfahrung war, ein Kind zu haben, das eine Sprache sprach, die ihnen nie zu lernen eingefallen wäre.
Wie soll ein Elternteil wissen, ob man eine gegebene Eigenschaft fördern oder unterdrücken soll? Als ich 1963 geboren wurde, waren homosexuelle Handlungen ein Verbrechen; während meiner Kindheit waren sie Symptome einer Krankheit. Als ich zwei Jahre alt war, schrieb das Time Magazine: »Selbst in vollkommen unreligiösen Begriffen stellt Homosexualität einen Missbrauch der Geschlechtlichkeit dar. Sie ist ein erbärmlicher zweitklassiger Ersatz für die Realität, eine bemitleidenswerte Flucht vor dem Leben. Als solche verdient sie Fairness, Mitgefühl und Verständnis, und wo möglich eine Behandlung. Sie verdient jedoch keine Ermutigung, keine Verherrlichung, keine vernunftmäßige Erklärung, keinen falschen Status als Minderheitenmartyrium, keine Augenwischerei über verschiedene Vorlieben – und ganz bestimmt nicht den Vorwand, irgend etwas anderes zu sein als eine üble Abartigkeit.«[15]
Während meiner Kindheit gab es dennoch enge Freunde der Familie, die schwul waren – Nachbarn und Ersatzgroßonkel, die die Feiertage mit uns verbrachten, weil ihre eigenen Familien sie nicht haben wollten. Einer von ihnen, Elmer, war mitten im Medizinstudium in den Zweiten Weltkrieg gezogen, hatte an der Westfront gekämpft und nach seiner Rückkehr einen Laden eröffnet. Das erstaunte mich. Jahrelang erzählte man mir, die schrecklichen Dinge, die er während des Krieges erlebt hatte, hätten ihn verändert, und er habe nach seiner Rückkehr keinen Mumm mehr für ein Medizinstudium gehabt. Erst nach Elmers Tod erklärte mir Willy, über fünfzig Jahre Elmers Lebensgefährte, dass 1945 niemand zu einem bekennend schwulen Arzt gegangen wäre. Der Schrecken des Krieges hatte Elmer Aufrichtigkeit gelehrt, und er zahlte dafür, indem er sein nachfolgendes Leben damit verbrachte, Barhocker zu bemalen und Geschirr zu verkaufen. Ich habe Ehrfurcht vor Elmers Entscheidung. Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, mich ebenso zu entscheiden, und ob ich dann genug Kraft gehabt hätte, nicht zuzulassen, dass mein Bedauern meine Liebe zerstört. Obwohl Elmer und Willy sich niemals als Schwulenrechtler gesehen hätten, war ihr Mut doch Voraussetzung für mein Glück und das Glück anderer. Als ich ihre Geschichte verstand, wurde mir klar, dass die Befürchtungen meiner Eltern nicht nur einer übereifrigen Phantasie entsprangen.
In meinem Erwachsenenalter ist Schwulsein eine Identität, und die tragische Entwicklung, die meine Eltern in meinem Fall befürchteten, ist nicht länger unvermeidbar. Das glückliche Leben, das ich inzwischen führe, war noch undenkbar, als ich pinkfarbene Luftballons und ekmek kadayif verlangte – ja selbst, als ich Algernon darstellte. Und doch behält die dreifache Verurteilung von Homosexualität als Verbrechen, Krankheit und Sünde großen Einfluss. Vor zehn Jahren wollte eine Umfrage im New Yorker von Eltern wissen, ob sie ihr Kind lieber schwul, in einer glücklichen Partnerschaft, mit einem erfüllten Leben und Kindern oder aber hetero, alleinstehend oder unglücklich liiert und kinderlos sehen würden. Ein Drittel der Befragten entschied sich für letzteres. Man kann eine horizontale Identität nicht ausdrücklicher hassen, als wenn man seinen Kindern eher Unglück und Gleichheit statt Glück und Andersartigkeit wünscht. In den USA werden mit monotoner Gleichmäßigkeit neue schwulenfeindliche Gesetze erlassen: Im Dezember 2011 verabschiedete Michigan den Public Employee Domestic Partner Benefit Restriction Act[16], der gleichgeschlechtlichen Partnern von Arbeitnehmern eine Gesundheitsversorgung verweigert, obgleich Angestellte von Stadt und Land sämtliche anderen Familienmitglieder, auch Onkel, Tanten, Cousinen und Cousins, in die Gesundheitsversorgung einbeziehen können. In großen Teilen der Welt bleibt die von mir eingenommene Identität undenkbar. In Uganda wäre 2011 beinahe ein Gesetz verabschiedet worden, das die Ausübung homosexueller Handlungen unter Todesstrafe stellen sollte.[17] Und in einem Bericht der Zeitschrift New York über Schwule im Irak war Folgendes zu lesen: »Auf den Straßen tauchten die oftmals verstümmelten Körper von homosexuellen Männern auf. Hunderte Männer sollen getötet worden sein. Den homosexuellen Männern wurde das Rektum zugeklebt, worauf man sie zwang, Abführmittel und Wasser zu sich zu nehmen, bis ihre Eingeweide platzten.«[18]
In der Debatte um die sexuelle Orientierung ging es immer auch darum, dass eine gewählte Homosexualität nicht schützenswert sei, eine angeborene jedoch schon. Dagegen werden Anhänger von Minderheitenreligionen durchaus geschützt – und das nicht etwa, weil ihnen diese Religion angeboren wäre und sie nichts dagegen tun können, sondern weil wir ihr Recht anerkennen, den Glauben, mit dem sie sich identifizieren, entdecken, verkünden und leben zu dürfen. Die Schwulenbewegung konnte 1973 zwar erreichen, dass Homosexualität von der offiziellen Liste der Geisteskrankheiten gestrichen wurde[19], doch Schwulenrechte bleiben davon abhängig, dass Homosexualität unfreiwillig und unveränderlich ist. Dieses einschränkende Modell von Sexualität ist deprimierend, denn sobald jemand postuliert, Homosexualität sei gewählt und veränderbar, versuchen Gesetzgeber und Religionsführer Homosexuelle zu heilen und zu entrechten. Auch heute noch werden Männer und Frauen aufgrund ihrer Homosexualität in religiösen Besserungscamps und Praxen skrupelloser oder irregeleiteter Therapeuten »behandelt«. Die Ex-Gay-Bewegung evangelikaler Christen bringt Zehntausende Schwule in seelische Not, indem sie ihnen entgegen aller Erfahrung versichert, sexuelles Begehren sei allein dem Willen unterworfen.[20] Der Begründer der antihomosexuellen Organisation MassResistance hat befürwortet, dass Schwule aufgrund der angeblichen Freiwilligkeit ihrer angeblichen Perversion ausdrückliches Ziel von Diskriminierungen sein sollten.
Wer glaubt, eine biologische Erklärung für Homosexualität würde die soziopolitische Stellung von Schwulen verbessern, geht ebenfalls in die Irre, wie die Reaktion auf neueste wissenschaftliche Erkenntnisse deutlich macht. Der Sexologe Ray Blanchard hat einen »fraternal birth order effect« beschrieben, wonach die Wahrscheinlichkeit für einen schwulen Sohn mit jedem von der Mutter ausgetragenen männlichen Fötus ansteigt. Einige Wochen nach der Veröffentlichung seiner Daten wurde Blanchard von einem Mann angerufen, der sich gegen eine Leihmutter entschieden hatte, weil sie bis dahin nur Jungen zur Welt gebracht hat. Der Mann sagte: »Das möchte ich eigentlich nicht (…) erst recht nicht, wenn ich dafür bezahle.«[21] Und bei Frauen setzt man das Arthritismedikament Dexamethason off-label ein, um das Risiko zu senken, Mädchen mit einem Syndrom zu gebären, durch das ihre Genitalien teilweise vermännlicht werden. Maria New, Wissenschaftlerin am Mount Sinai Hospital in New York, vermutet darüber hinaus, dass in der Frühschwangerschaft verabreichtes Dexamethason auch die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass diese Babys später einmal lesbisch sind.[22] In Tierstudien hat ein vorgeburtlicher Kontakt mit Dexamethason zwar zu erheblichen Gesundheitsproblemen geführt, doch falls eine Medikation tatsächlich die Homosexualität eindämmen kann, werden die Forscher schon eine sicherere Version entwickeln. Medizinische Ergebnisse wie diese werden ernste gesellschaftliche Folgen haben. Falls wir einen pränatalen Marker für Homosexualität finden, werden viele Paare ihre homosexuellen Kinder abtreiben; falls es irgendwann ein anwendbares vorbeugendes Medikament gibt, werden viele Eltern es bereitwillig ausprobieren.
Ich kann Blanchards und News Forschungen nicht betrachten, ohne mir vorzukommen wie das letzte Exemplar einer aussterbenden Art. Ich bin kein Missionar. Ich muss meine Identität nicht auf meine Kinder vertikalisieren, aber es wäre mir ein Gräuel, wenn meine horizontale Identität verschwände. Es wäre mir ein Gräuel wegen all jener, die meine Identität teilen, und all jener, die anders sind. Ich verabscheue den Verlust von Vielfältigkeit auf dieser Welt, auch wenn es mir manchmal zum Hals raushängt, diese Vielfältigkeit zu repräsentieren. Ich wünsche mir nicht, dass irgendjemand schwul sein soll, aber bei der Vorstellung, dass niemand mehr schwul ist, vermisse ich mich jetzt schon.
Alle Menschen sind zugleich Objekt und Träger von Vorurteilen. Wenn wir die gegen uns gerichteten Vorurteile verstehen, erfahren wir zugleich etwas über unseren Umgang mit anderen. Das gegenseitige Verständnis hat jedoch seine Grenzen, und den Eltern eines Kindes mit einer horizontalen Identität mangelt es oft an Empathie. Das Problem, das meine Mutter mit dem Judentum hatte, hat nicht dazu geführt, dass sie besser mit meiner Homosexualität umgehen konnte, und meine Homosexualität macht mich nicht zu einem guten Vater für ein gehörloses Kind, solange ich die Parallelen zwischen den beiden Erfahrungen nicht erkenne. Ein von mir befragtes lesbisches Paar mit einem transsexuellen Kind sagte, es befürworte das tödliche Attentat auf den Abtreibungsarzt George Tiller, da die Bibel Abtreibung verurteile. Trotzdem waren die beiden erstaunt und verärgert über die Intoleranz, die ihrer Identität und der Identität ihres Kindes entgegengebracht wurde. Wir sind schon überfordert mit den Mühen unserer eigenen Situation, da ist der Schulterschluss mit anderen Gruppen ein anstrengendes Vorhaben. Viele Schwule reagieren ablehnend auf Vergleiche mit Behinderten, genauso wie viele Afroamerikaner dagegen sind, dass schwule Aktivisten das Vokabular der Bürgerrechtsbewegung übernehmen.[23] Doch der Vergleich von behinderten Menschen mit schwulen Menschen beinhaltet keine Wertung von Homosexualität oder Behinderung. Wir alle sind fehlerhaft und seltsam, und die meisten Menschen sind auch mutig. Die logische Konsequenz aus der Erfahrung, anders oder merkwürdig zu sein, ist die Erkenntnis, dass jeder einen Defekt hat und jeder eine Identität besitzt und dass diese oft ein und dasselbe sind.
Es ist mir eine schreckliche Vorstellung, dass ich ohne die beständige Intervention meiner Mutter vielleicht nie sprachliche Gewandtheit erreicht hätte. Ich bin jeden Tag aufs Neue dankbar, dass meine Dyslexie ausreichend behoben wurde. Doch obwohl ich als Heterosexueller vielleicht ein einfacheres Leben hätte, bin ich umgekehrt inzwischen der Ansicht, dass ich ohne die überstandenen Schwierigkeiten nicht ich selbst wäre. Mir behagt eher, ich selbst zu sein als jemand anders zu sein – denn ich habe weder die Fähigkeit, mir diesen Jemand vorzustellen, noch habe ich die Möglichkeit, dieser Jemand zu sein. Dennoch denke ich oft darüber nach, ob ich aufgehört hätte, meine sexuelle Orientierung zu hassen, wenn es die Gay Pride-Schwulenbewegung nicht gegeben hätte, der auch dieses Buch zu verdanken ist. Früher nahm ich an, ich würde reifen, wenn ich ganz einfach schwul sein könnte, ohne dies besonders zu betonen. Inzwischen sehe ich die Dinge anders: teils, weil es nahezu nichts gibt, dem ich neutral gegenüberstehe, aber vor allem, weil ich die Jahre des Selbsthasses als gähnende Leere empfinde, die nun mit Stolz und Freude gefüllt wird. Auch wenn ich meiner inneren Melancholie inzwischen adäquat begegnen kann, gilt es noch eine äußere Welt der Homophobie und Vorurteile zu reparieren. Eines Tages, so hoffe ich, wird die schwule Identität zu einer einfachen, weder gefeierten noch mit Schuld belegten Tatsache, aber das wird noch lange dauern. Neutralität, die in der Mitte zwischen Scham und Freude liegt, ist ein Ziel, das nur erreicht werden kann, wenn Aktivismus unnötig wird.
Dass ich mich leiden kann, überrascht mich. Von allen Möglichkeiten, die ich mir für meine Zukunft ausgemalt habe, war dies die letzte. Meine hart errungene Zufriedenheit beruht auf der einfachen Regel, dass innerer Frieden von äußerem Frieden abhängt. Im gnostischen Evangelium nach Thomas sagt Jesus: »Wenn ihr hervorbringt, was in euch ist, wird das, was ihr in euch habt, euch retten. Wenn ihr nicht hervorbringt, was in euch ist, wird das, was ihr in euch habt, euch töten.«[24] Wenn ich gegen die schwulenfeindlichen Positionen moderner Kirchenvertreter angehe, wünsche ich mir oft, die Worte des heiligen Thomas gehörten zum Kanon, denn seine Botschaft spricht Menschen mit horizontaler Identität an. Meine Homosexualität zu verbergen, brachte mich beinahe um, sie zu zeigen, hat mich beinahe gerettet.
Während Männer vor allem Personen töten, mit denen sie in keinem persönlichen oder verwandtschaftlichen Verhältnis stehen, bringen beinahe 40 Prozent der weiblichen Mörder ihre eigenen Kinder um.[25] Berichte von Säuglingen, die Müllcontainern oder der Fürsorge überlassen werden, weisen darauf hin, dass Menschen zur Ablösung fähig sind. Seltsamerweise hat dies mindestens genauso viel mit dem Aussehen des Säuglings zu tun wie mit seiner Gesundheit oder seinem Charakter. Eltern nehmen ein Kind an, das an einer lebensbedrohlichen inneren Krankheit leidet, lehnen aber ein Kind mit einem geringfügigen sichtbaren Defekt ab. Manche Eltern verstoßen gar Kinder, die durch einen Unfall schlimme Verbrennungsnarben davontragen.[26] Offensichtliche Behinderungen greifen den elterlichen Stolz und das Bedürfnis nach Privatsphäre an: Jeder kann sehen, dass dieses Kind nicht das ist, was man sich gewünscht hat, und man muss das Mitleid aller akzeptieren oder auf seinem Stolz beharren. Mindestens die Hälfte der zur Adoption freigegebenen Kinder in den USA hat eine Behinderung.[27] Doch diese Hälfte der zur Adoption freigegebenen Kinder stellt immer noch einen kleinen Anteil der behinderten Kinder insgesamt dar.
Modernen Paarbeziehungen bieten sich immer mehr Optionen. In der Vergangenheit haben Menschen nur Angehörige des anderen Geschlechts geheiratet, mit denen sie zudem Milieu, Abstammung und geographisches Umfeld teilten – all diese Grenzen lösen sich mehr und mehr auf. Von den Paaren wurde erwartet, die ihnen geschenkten Kinder anzunehmen; ohnehin gab es kaum Möglichkeiten, Zeugung und Geburt zu beeinflussen. Erst Verhütungsmittel und Reproduktionsmedizin haben den Zusammenhang zwischen Sex und Fortpflanzung aufgelöst: Der Geschlechtsakt führt nicht zwangsläufig dazu, dass ein Kind gezeugt wird, und andersherum ist er nicht länger erforderlich, um ein Kind zu zeugen. Die Präimplantationsdiagnostik und die Ausweitung der pränatalen Diagnostik geben Eltern Zugriff zu vielerlei Informationen und lassen sie entscheiden, ob sie eine Schwangerschaft herbeiführen, fortführen oder abbrechen sollen. Die Wahlmöglichkeiten werden von Tag zu Tag größer. Diejenigen, die an das Recht glauben, sich für gesunde Kinder entscheiden zu dürfen, sprechen von selektiver Abtreibung. Diejenigen, denen diese Vorstellung zuwider ist, sprechen von »kommerzieller Eugenik«[28] und befürchten eine Welt, in der Vielfalt und Verletzlichkeit ausgelöscht sind. Der riesige Markt der pädiatrischen Medizin setzt voraus, dass verantwortungsvolle Eltern ihre Kinder auf verschiedene Weise zurechtstutzen, und Eltern erwarten von Ärzten, dass sie die angeblichen Defekte ihrer Kinder reparieren: So sollen Wachstumshormone verabreicht werden, um »zu kleine« größer zu machen, es sollen gespaltene Lippen beseitigt und uneindeutige Genitalien korrigiert werden. Diese optimierenden Eingriffe sind nicht nur kosmetisch, aber sie sind nicht lebensnotwendig. Und sie führen in eine Zukunft, die Gesellschaftswissenschaftler wie Francis Fukuyama »posthuman« nennen, weil wir die Vielfalt innerhalb der Menschheit vernichtet haben werden.[29]
Während die Medizin verspricht, uns zu normieren, bleibt unsere gesellschaftliche Realität divers. Die Moderne, so heißt es, soll die Menschen einander angleichen. In der Realität aber tröstet uns die Moderne mit trivialer Uniformität, sie ermöglicht uns weitläufigere Wünsche und breitere Möglichkeiten zur Erfüllung dieser Wünsche. Soziale Mobilität und das Internet erlauben jedem von uns, andere zu finden, die unsere Interessen teilen. Kein Club französischer Aristokraten, keine Vereinigung von Bauernjungen aus Iowa war je enger als diese neuen Bündnisse des elektronischen Zeitalters. Da die Trennung zwischen Krankheit und Identität angefochten wird, sind die Onlinekräfte unerlässlicher Hintergrund für das Heraustreten eines wahren Ichs. Das moderne Leben ist in vielerlei Hinsicht einsam, doch da inzwischen jeder mit Zugang zu einem Computer Gleichgesinnte finden kann, muss niemand von der sozialen Vernetzung ausgeschlossen bleiben. Wenn einem der körperliche oder seelische Ort, an dem man geboren wurde, nichts mehr sagt, winken unzählige Orte der Geistesverwandtschaft. Vertikale Familien brechen bekanntermaßen auseinander, horizontale Familien jedoch blühen auf. Wenn man weiß, wer man ist, kann man andere finden, die genauso sind. Der gesellschaftliche Fortschritt macht das Leben mit Behinderungen einfacher, der medizinische Fortschritt kann sie eliminieren. Dieses Zusammentreffen hat etwas Tragisches – wie in der Oper, wenn der Held erst merkt, dass er die Heroine liebt, wenn sie gerade den letzten Atemzug tut.
Eltern, die in ein Interview einwilligen, sind automatisch eine selektive Gruppe. Verbitterte Menschen sind weniger bereit, ihre Geschichte zu erzählen als Menschen, die einen Sinn in ihren Erfahrungen sehen und anderen Menschen in ähnlichen Situationen helfen wollen. Doch niemand liebt ohne Einschränkung, und es ginge uns allen besser, wenn wir diese elterliche Ambivalenz nicht länger stigmatisieren würden. Nach Freud steckt hinter jeder Liebesbekundung ein gewisser Grad an Ablehnung, und hinter jedem Hass zumindest ein Hauch Bewunderung.[30] Kinder können von ihren Eltern im Grunde nur erwarten, dass diese ihr Gefühlschaos einigermaßen im Griff haben: dass sie also weder auf der Lüge des perfekten Glücks beharren noch in die Brutalität des Aufgebens verfallen. Eine Mutter, die ein Kind mit schwerer Behinderung verlor, äußerte in einem Brief an mich die Sorge, ihre Trauer könne doch nicht ernst sein, wenn sie zugleich Erleichterung empfinde. Es besteht kein Widerspruch dazwischen, jemanden zu lieben und diese Person zugleich als Belastung zu empfinden – tatsächlich neigt die Liebe oft dazu, die Last noch größer zu machen. Diese Eltern brauchen Raum für ihre ambivalenten Gefühle – ob sie diese nun zulassen oder nicht. Für Liebende sollte es keine Schande sein, erschöpft zu sein oder sich gar ein anderes Leben zu wünschen.
Marginalisierende Krankheiten wie Schizophrenie und Down-Syndrom gelten als allein genetisch bedingt, andere, wie Transsexualität, sollen vor allem umweltbedingt sein. Veranlagung und Umwelt werden als entgegengesetzte Einflüsse betrachtet, obwohl wir es, so der Wissenschaftsautor Matt Ridley, oft mit »nature via nurture« zu tun haben, also mit einer über die Umwelt geprägten Veranlagung.[31] Wir wissen, dass Umweltfaktoren zu Veränderungen im Gehirn führen und umgekehrt, dass Hirnchemie und Hirnstrukturen mit beeinflussen, wie sehr wir von äußeren Einflüssen betroffen sind. So wie ein Wort als Laut, als Buchstabenkette und als Metapher existiert, so sind Angeborenes und Anerzogenes verschiedene Konzepte für ein zusammenhängendes Phänomen.