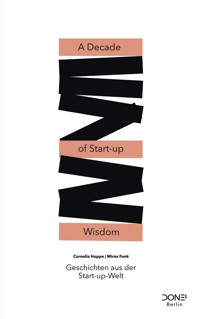12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
St. Pauli, 70er Jahre: Cornelia Hoppe wächst in bitterer Armut mit alkoholkranken Eltern auf. Ihr Spielplatz sind triste Trinkerkneipen mit zwielichtigen Gestalten. Einerseits schämt sich Cornelia schon als kleines Kind für ihre Eltern, andererseits sorgt und kümmert sie sich um sie – als typisch Co-Abhängige. In der Ehe mit einem erfolgreichen Banker scheint sie dann schließlich das Glück gefunden zu haben. Leider merkt Cornelia aber irgendwann, dass auch ihr Mann trinkt und der Teufelskreis von vorne beginnt: Sie leidet still, schämt sich, kümmert sich, hält trotz allem zu ihm. Irgendwann erkennt sie, dass auch ihre Kinder drohen, co-abhängig zu werden. Trotz wirtschaftlicher Abhängigkeit schafft es Cornelia schließlich, ihren Mann zu verlassen – und damit sich und ihre Kinder zu retten. Säuferkind ist ein ehrlicher, schonungsloser Bericht, der gleichzeitig Mut macht und zeigt, dass es möglich ist, sich aus den Fesseln der Co-Abhängigkeit zu befreien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Säuferkind
CORNELIA HOPPE, geboren 1968, wuchs in Hamburg-St.Pauli in einer Alkoholikerfamilie auf. Sie ist zweifache Mutter und lebt heute ein freies, selbstbestimmtes Leben. WIGBERT LÖER, geboren 1972, Journalist, ist Autor verschiedener Sachbücher und Biografien.
Rund drei Millionen Menschen sind in Deutschland alkoholkrank. Experten schätzen, dass in jedem Fall mindesten drei nächste Verwandte damit unmittelbar konfrontiert sind. Das bedeutet: Fast zehn Millionen Menschen sind co-abhängig. Die Betroffenen leben in allen Schichten unserer Gesellschaft, eines aber haben sie gemeinsam: ihre Scham, ihre Verzweiflung – und das Schweigen über ihr Schicksal.Cornelia Hoppe hat den Mut, dieses Schweigen zu brechen. Ehrlich und schonungslos erzählt sie die Geschichte ihres Lebens.Sie beschreibt, wie sie sich aus ihrer Co-Abhängigkeit befreien konnte und warum es wichtig und richtig ist, sich zu öffnen und Hilfe zu suchen. Ihre wichtigste Botschaft ist: Wenn Du das Gefühl hast, dass etwas nicht in Ordnung ist, hör auf dein Herz.
Cornelia Hoppe
Säuferkind
Mein Leben als Co-Abhängige und wie ich trotzdem glücklich wurde
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte wurden Namen, Orte und weitere Details verfremdet.
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Umschlaggestaltung: Jorge Schmidt, MünchenTitelabbildung: privatE-Book powered by pepyrusISBN 978-3-8437-3254-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Das Leben armer Leute
Anders als die anderen
Du sollst dich doch nicht mit ihr treffen
Conni, wir müssen hier weg
Besser in der U-Bahn als zu Hause
Ein Gefühl von Unabhängigkeit
Als warte man auf ein Wunder
Alles läuft in die richtige Richtung. Dachte ich
Somewhere over the rainbow
Entschlossen
ANHANG
DANK
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Meinen Töchtern
Prolog
Sonnenstrahlen fielen durch die Fenster, als Emma und ich den großen Esstisch deckten. Wir machten Rührei, holten Marmelade, Käse und Aufschnitt aus dem Kühlschrank. Emma faltete liebevoll die Servietten. Der Kaffee war fertig, und die frischen Brötchen dufteten.
Am Abend vorher war es spät geworden bei meinem Mann. Andreas hatte lange und ausgiebig getrunken.
Egal. Dieser Tag sollte mit einem gemütlichen Frühstück beginnen. Nur Paula fehlte. Unsere ältere Tochter, zwölf und damit drei Jahre älter als Emma, hatte bei einer Freundin übernachtet.
Als Andreas erschien und sich zu uns setzte, merkte ich ihm sofort eine gewisse Unruhe an. Das Gespräch kam auf Familien aus der Nachbarschaft. Andreas wollte von Emma wissen, ob sie einen Überblick hatte, wer wo wohnte. Es war ein kleiner Test, harmlos eigentlich und im Grunde unwichtig. Doch ich merkte, dass die Fragerei Emma Unbehagen bereitete.
»Komm, ist doch nicht so schwer, zähl einfach auf«, versuchte Andreas, sie zu ermuntern. Emma biss in ihr Brötchen. Dann nannte sie eine Familie, verstummte aber gleich wieder. Vielleicht wollte sie nicht weitermachen, vielleicht bekam sie es aber auch einfach nicht hin. Andreas setzte nach.
»Das glaube ich nicht, dass du das nicht weißt«, sagte er. »Du siehst die Leute doch andauernd, du kennst die. Los jetzt, das kannst du!«
Ich spürte Emmas Unsicherheit, die eindeutig die Folge der Erwartungen ihres Vaters war. Vorher hatte sie entspannt gewirkt und gut gelaunt, genauso wie ich. Jetzt warf sie mir einen ängstlichen Blick zu.
Das war mir nun zu viel Bedrängnis für unsere Kleine. Das ist ein Sonntagsfrühstück und keine Schulstunde, dachte ich. Gleichzeitig befürchtete ich, dass Andreas sich weiter hochschaukeln könnte.
»Können wir das jetzt mal bitte sein lassen?«, sagte ich mit einem gewissen Nachdruck – und merkte im selben Moment, dass ich mir damit zu viel herausgenommen hatte. Andreas’ Wut kam so schnell, wie eine Lampe angeht. Sein Gesicht färbte sich hochrot, das sichere Zeichen, dass er innerlich kochte.
»Waaas?«, schrie er mich an. »Das hast du doch überhaupt nicht zu entscheiden! Wenn ich hier ’ne Frage stellen will, dann stelle ich die auch. Du fällst mir schon wieder in den Rücken. Ich will das von ihr wissen, und natürlich bekomme ich jetzt eine Antwort.«
Er schrie weiter, irgendetwas, und ich sah, wie er eine geöffnete Packung Margarine in die rechte Hand nahm, aufstand, ausholte und sie mit voller Kraft gegen die Wand warf. Ein Teil des Inhalts blieb dort kleben, die Packung selbst fiel auf ein Sideboard, das direkt darunter stand. Emma weinte sofort.
Andreas verließ schreiend das Esszimmer, die Tür knallte er hinter sich zu. Dann rannte auch Emma raus und lief in ihr Zimmer. Ich folgte ihr, fand sie auf ihrem Bett und setzte mich zu ihr. Wir weinten beide eine Weile, und nur langsam ließ sie sich von mir trösten. »Und ich hatte mich doch so auf mein Leberwurstbrötchen gefreut«, sagte sie schließlich zu mir.
Andreas war für den Rest des Tages nicht ansprechbar. Er ignorierte mich, als wäre nicht er, sondern ich ausgerastet.
»Warum ist Papa immer so?«, fragte mich Emma später. Weil Alkoholiker eben so sind, hätte ich ihr antworten können. Stattdessen versuchte ich, das zerstörte Frühstück vor meiner Tochter herunterzuspielen.
An diesem Sonntag, im Frühjahr 2011, entschied ich, dass ich genau das nicht mehr tun wollte und auch nicht mehr tun würde. Ich würde nichts mehr kleinreden, nicht vor den Kindern und vor allem nicht vor mir selbst. Ich wollte solch eine Situation nie wieder erleben. Dafür musste ich etwas Grundlegendes ändern.
Meine Töchter wuchsen als Co-Abhängige auf. Sie hatten damit – wenn auch nicht so heftig und unter materiell völlig anderen Umständen – dasselbe Schicksal wie ich. Bei mir zu Hause tranken früher beide Eltern, als ich geboren wurde und wir auf St. Pauli in einer Nebenstraße der Reeperbahn wohnten. Nun mussten meine eigenen Töchter erleben, dass der hohe Alkoholkonsum das Leben ihrer Familie prägte und immer mehr belastete. Das hatte ich auf keinen Fall gewollt. Und doch war es genauso gekommen.
Es geht vielen Menschen so, Kindern und Erwachsenen: Als Bezugspersonen sind sie unmittelbar konfrontiert mit der Alkoholsucht ihres Vaters, ihrer Mutter oder ihres Partners, sind den extremen Stimmungsschwankungen ausgeliefert und der Unberechenbarkeit, die das Trinken hervorruft. Sie fühlen mit, leiden mit, spüren eine Mitverantwortung, und ihre Co-Abhängigkeit bestimmt oft auch ihr Handeln. Experten schätzen die Zahl alkoholsüchtiger Menschen in Deutschland auf rund drei Millionen. Auf einen Süchtigen kommen im Schnitt drei Co-Abhängige. Ich war also nicht allein und meine beiden Mädchen auch nicht. Die Co-Abhängigen bilden eine riesige Gruppe. Aber das ist kein Trost. Und erst recht kein Grund, sich weiterhin alles gefallen zu lassen.
Das Leben armer Leute
Mein Vater • Meine Mutter • Der Weg nach St. PauliMein erster Job • Kneipenkind • Joachim
Ich war noch nicht geboren, als meine Eltern Mitte der Sechzigerjahre mit ihren beiden Söhnen auf den Hamburger Berg zogen. Diese Straße mündet auf die Reeperbahn, parallel verlaufen die Talstraße und die Große Freiheit. »Kiez« nennt man in Hamburg diese Gegend des Stadtteils St. Pauli. Es waren vor allem Bordelle und heruntergekommene Kneipen, die den Kiez ausmachten, dazwischen Tanzlokale, Theater und Pornokinos. Und, gleich gegenüber von unserer Wohnung, ein Sadomasoklub. Heute werden auf dem Hamburger Berg TV-Dokus gedreht, in den Kneipen Elbschlosskeller und Zum Goldenen Handschuh. Die Straße ist das Ziel von Touristen und Partygängern. Wer damals dort im Herzen des Rotlichtviertels wohnte, konfrontiert mit Drogen, Kriminalität und Prostitution, war vor allem eines: arm.
Unser Zuhause, der Hamburger Berg, bildete von außen gesehen einen Block aus massiven Steinen. Das Innere unseres Hauses ist heute zusätzlich durch ein Metallgitter mit Extratür geschützt. Damals aber konnte jeder die paar Stufen hinauf zur Haustür gehen, die am Anfang unserer Zeit aus dünnem Holz bestand. Über weitere Stufen erreichte man das Hochparterre. Viel Platz war dort nicht für meinen Kinderwagen, doch das Gefährt über die steile Stiege sechsundsiebzig Stufen hinauf bis in die vierte Etage zu wuchten kam nicht infrage. Der Wagen blieb deshalb unten stehen. Leider diente er dort mitunter als Mülleimer und einmal einem Menschen, der sich Zugang verschafft hatte, sogar als Pissoir. Ich habe das nicht bewusst erlebt, doch mein Bruder Thomas erinnert sich noch daran. So was, sagt er, hatte man eben hinzunehmen, wenn man mitten auf St. Pauli wohnte. Als Elfjähriger mag er darüber damals nicht allzu sehr nachgedacht haben. Für meine Mutter muss es eine schreckliche Erfahrung gewesen sein, den Kinderwagen ihrer Tochter volluriniert vorzufinden. Sie wird Ohnmacht empfunden haben und zugleich vermutlich Wut, solchen Ereignissen ausgeliefert zu sein.
Unsere Wohnung hatte vier Zimmer. Nach hinten raus, zum Hof, hörte man Kneipenlärm und Musik. Das Wohnzimmer und ein damit verbundener Raum, den wir kaum nutzten, gingen nach vorne zur Straße hin. Von dort konnte man manchmal beobachten, wie mit viel Geschrei Freier aus dem Bordell auf der anderen Straßenseite gejagt wurden. Sie waren halb nackt und hatten sich wohl irgendetwas zuschulden kommen lassen. Jedenfalls machte der Rausschmeißer des Etablissements kurzen Prozess mit ihnen.
Die Wohnung war in keinem guten Zustand gewesen, als meine Eltern einzogen, und daran sollte sich in den nächsten Jahren auch nichts ändern. An den Innenseiten der Fenster, die nur einfach verglast waren, wuchsen im Winter Eisblumen. Eine Heizung gab es nicht, ein Kohleofen wiederum stand nur im Wohnzimmer. Ich habe die Zeit am Hamburger Berg als kalt und klamm in Erinnerung. An den Wänden der Schlafzimmer blühte der Schimmel.
Meine Brüder Thomas und Joachim, die zehn und dreizehn Jahre älter als ich waren, belegten ein Zimmer, mein kleines Bett stand im Schlafzimmer meiner Eltern. Später bekam ich tagsüber eine Ecke in dem Durchgangszimmer. Da befand sich in einem Koffer der alte Plattenspieler meiner Brüder. Ich habe dort Kinderschallplatten mit Märchen gehört, Rotkäppchen und Hänsel und Gretel. Geschlafen habe ich auch nach meiner Babyzeit im Zimmer meiner Eltern.
Die Küche hatte keinen Tisch. Im Wohnzimmer stand auch kein Esstisch, aber immerhin ein großer Couchtisch. Den hätte man höherkurbeln können, um als Familie gemeinsam daran zu essen. Doch dazu ist es nie gekommen. Dafür hätten wir nämlich Stühle gebraucht. Wir hockten uns stattdessen mit unseren Tellern auf das alte Sofa.
Die Einrichtung unserer Wohnung bestand aus Möbeln, die eher aus dritter als aus zweiter Hand stammten. Manches wirkte wie vom Sperrmüll. Am Ehebett war ein Bein abgebrochen. Damit es nicht umkippte, hatte mein Vater an der Stelle zwei Konservendosen untergeschoben.
Immerhin hatten wir eine eigene Toilette. Sie befand sich in einem Raum von der Größe eines Gäste-WCs – unser Badezimmer. Eine Dusche oder gar Badewanne gab es nicht. Später baute mein Vater in der Küche eine Duschwanne ein. Leider reichte der Wasserdruck nicht aus, um den Durchlauferhitzer zu befüllen. Obwohl mein Vater Klempnermeister war, bekam er es nicht hin, dass die Sache funktionierte. So stand die Wanne jahrelang ungenutzt in der Küche herum. Meine Eltern stellten keine großen Ansprüche an die Einrichtung ihres Zuhauses.
Mit der Hygiene verhielt es sich ähnlich. Sie begnügten sich in der Regel mit einer Katzenwäsche am kleinen Waschbecken des WCs. Uns Kinder schickten sie später ab und zu mal zum Waschen ins St.-Pauli-Bad, das auf der Reeperbahn neben einem der Theater am Spielbudenplatz lag. Die Schwimmhalle am Bahnhof Altona stand damals auch noch, das Bismarck-Bad. Dort konnte man für ein paar Münzen duschen. Manchmal badeten wir auch bei unseren Großeltern Berthold und Martha. Fotos in einem Album, das meine Großmutter für mich angelegt hat, vermitteln einen Eindruck davon, wie unsere Wohnung am Hamburger Berg eingerichtet war. Mein Stubenwagen ist im Wohnzimmer vor einem alten, verkratzten Holzschrank abgestellt, in einem ansonsten leeren Fach liegt eine Dose Babypuder. Gewickelt wurde ich auf dem Couchtisch oder auf der Couch selbst. Ein Telefon immerhin gab es, einen Fernseher auch.
Wenn ich heute an unsere Wohnung auf dem Hamburger Berg denke, steigt mir noch der Geruch von kaltem Rauch in die Nase. Meine Eltern waren klassische Kettenraucher. Gelüftet haben sie in der kälteren Jahreszeit selten, wohl auch aus dem Grund, dass die Wohnung mit dem einen Ofen ohnehin kaum warm zu bekommen war. Wir wuschen uns also wenig und lebten in stark verrauchter Luft. Entsprechend werden wir gerochen haben.
Mein Vater
Meine Eltern Karl Hoppe und Gisela Timmermann hatten 1954 in der Hamburger Kreuzkirche geheiratet. Mein Vater trug zur Hochzeit einen Zweireiher, ein weißes Hemd und eine weiße Krawatte, meine Mutter ein langes weißes trägerloses Kleid. Ich habe ein paar Fotos, die meine Mutter als junge Erwachsene zeigen. Sie sieht hübsch darauf aus. Am Tag ihrer Hochzeit gaben meine Eltern ein schönes und glücklich wirkendes Paar ab.
Ihr Trauspruch entstammt dem Brief des Apostels Paulus an die Galater: »Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.« Ob meine Eltern den Bibelvers damals selbst ausgesucht haben, weiß ich nicht. Lasten brachten sie jedenfalls beide in die Ehe ein.
Mein Vater wurde als der Ältere zweier Söhne 1919 in eine Händlerfamilie geboren, die in Hamburg am Rande des heutigen Schanzenviertels lebte. Meine Großeltern Heinrich und Alice führten dort einen Laden, in dem sie Kolonialwaren anboten, Tabak, Kaffee und Zucker etwa, Tee, Reis und Gewürze. 1930, als aus dem Börsencrash in New York eine weltweite Wirtschaftskrise geworden war, entschieden sich meine Großeltern, noch einmal neu anzufangen. Sie wanderten mit ihren beiden Kindern nach Südamerika aus. Mit der Cap Polonia erreichten sie gemeinsam mit Karl und dem jüngeren Sohn Rolf Argentinien. In der Hauptstadt Buenos Aires konnten sie bald einen Laden eröffnen. Mein Vater und mein Onkel gingen dort zur Schule. Doch dann, nach einem Jahr, geschah etwas Unfassbares: Meine Großeltern schickten ihre Kinder nach Deutschland zurück. Karl und Rolf waren inzwischen zwölf und zehn Jahre alt. Einen Grund für diese Trennung, die für sie aus dem Nichts heraus kam, nannten die Eltern ihnen nicht.
Die Brüder wurden auf ein Dampfschiff gebracht und überquerten in einer sechswöchigen Fahrt den Atlantik. Mein Vater hat das später oft erwähnt. »Stell dir das mal vor, man hat uns ganz allein zurückgeschickt«, sagte er und wirkte jedes Mal berührt. Die Zeiten waren andere, doch dass Eltern sich ihrer Kinder entledigten und sie zudem noch über Wochen in die, wie er sagte, »Hände fremder Menschen gaben«, empfand er auch als Kind schon als falsch und verantwortungslos.
Mein Vater und sein kleiner Bruder zogen dann zu ihrer Großmutter. Als mein Vater die Volksschule beendet hatte, waren in Deutschland die Nationalsozialisten an der Macht. Er begann eine Lehre bei einem Handwerksbetrieb im Stadtteil Eimsbüttel, die er 1938 als Klempner und Installateur abschloss. Sein Chef übernahm ihn als Gesellen. Der NSDAP trat Karl nicht bei. Er war unpolitisch.
Währenddessen spitzte sich die Situation in Buenos Aires zu. Mein Großvater war spielsüchtig, trank und brachte das Geld, das der Laden abwarf, komplett durch. Wohl noch in den Dreißigerjahren ist er gestorben. Meine Großmutter Alice verliebte sich dann in Pablo, einen Argentinier, der recht gut situiert war. Die beiden heirateten.
Als Deutschland die Welt mit Krieg überzog, wurden mein Vater und sein Bruder einberufen. Die Wehrmacht schickte den Soldaten Karl Hoppe zuerst nach Frankreich und dann nach Russland. Seine Truppe stieß weit nach Osten vor, bis nach Stalingrad. Der Panzergrenadier Hoppe machte einen großen Teil des Feldzugs mit. An Heiligabend 1942 würdigte man seine Teilnahme mit dem Panzerkampfabzeichen in Silber. Ein knappes Jahr später wurde er verwundet. Sein Bruder Rolf befand sich währenddessen als Teil einer Fliegerstaffel auf dem Afrika-Feldzug. Der Einsatz der Wehrmacht in Nordafrika gilt heute als weniger gefährlich als der Russlandfeldzug. Doch auch er forderte viele Todesopfer. Ende 1942 wurde der Unteroffizier Rolf Hoppe in einem Flugzeug der deutschen Luftwaffe gemeinsam mit einem anderen Soldaten abgeschossen. Sein Hauptmann und Kapitän schrieb nach Deutschland, der Verstorbene habe »sein Leben für die Größe und den Bestand von Volk, Führer und Reich hingegeben«. Mein Vater erhielt noch ein Papier mit einer Liste der Gegenstände, die sein Bruder in Afrika mit sich geführt hatte, darunter das Buch »Reichsbauernstadt Goslar«, einen Packen Briefumschläge und zwei Pfeifen. Was Rolf ansonsten gehört hatte, Kleidungsstücke, Bücher und persönliche Dokumente, befand sich zum Zeitpunkt seines Todes in der Wohnung in Hamburg. Die brannte ein halbes Jahr später aus, nachdem Bomber der Alliierten auch das Haus getroffen hatten, in dem Rolf und Karl zuletzt gewohnt hatten.
Der Krieg hat meinem Vater seinen Bruder genommen, dem er aufgrund ihrer gemeinsamen Jugend ohne Eltern besonders nahestand. Er hat den Krieg als Soldat auch selbst in seiner ganzen Grausamkeit und Unmenschlichkeit erfahren. Einmal, erzählte er, sei er mit seinem Panzer versehentlich über tote Soldaten gerollt. Er habe dann anhalten und erst einmal Menschenteile aus den Ketten des Panzers zerren müssen. Seine Erinnerungen lassen mich auch als Erwachsene noch erschaudern. Bei Kriegsende war mein Vater fünfundzwanzig Jahre alt. Ich frage mich, wie tief die psychischen Wunden gewesen sind, die mein Vater aus dieser Zeit davongetragen hat. Er muss mit schweren Traumata aus Russland zurückgekehrt sein.
Nach dem Krieg ging es jedoch erst einmal voran für ihn. Er arbeitete als Klempner und Dachdecker in der Nähe von Münster, kehrte nach Hamburg zurück, arbeitete wieder bei seinem Lehrbetrieb. Der Klempnergeselle legte bald auch seine Meisterprüfung ab. Und im Frühjahr 1947 meldete mein Vater ein Gewerbe an. Es war ein zügiger beruflicher Neustart, und er gelang. Seine kleine Firma erhielt Aufträge, und als Chef vernetzte sich mein Vater, trat der FDP und einem Tennisklub bei und verkehrte im Logenhaus der Freimaurer am Bahnhof Dammtor. Auch privat tat sich etwas. Karl Hoppe heiratete, und zwar die Tochter seines vormaligen Arbeitgebers. Ende der Vierziger-, Anfang der Fünfzigerjahre kamen die beiden Töchter Helga und Monika zur Welt.
Das alles mag wie der Anfang einer klassischen Wirtschaftswundergeschichte anmuten. Doch das Leben meines Vaters entwickelte sich bald in eine andere Richtung. Er betrog seine Frau, die Affäre kam heraus und führte zur Scheidung. Mit seinen kleinen Töchtern, meinen späteren Halbschwestern, hatte mein Vater fortan kaum mehr Kontakt. Seine Ex-Frau heiratete erneut, und ihr zweiter Ehemann adoptierte die Mädchen.
Meinem Vater blieb nur seine kleine Klempnerfirma.
Hamburg befand sich noch im Wiederaufbau, und fast überall in der Stadt wurden Klempner gesucht. Mein Vater aber war nicht in der Lage, den Bauboom zu nutzen. Während das Wirtschaftswunder begann, steuerte er seine Firma in die Pleite. Damit hatte er auch die paar befreundeten Gesellen um sich herum verloren, mit denen er nach Feierabend oft in die Kneipe gegangen war.
Mein Vater stand nun allein da, ohne Freunde und ohne Familie. Seine Mutter Alice schickte aus Argentinien hin und wieder Fotos von sich und ihrem neuen Mann Pablo. Doch sie spielte im Leben ihres Sohnes keine Rolle mehr.
Meine Mutter
Dieser Karl Hoppe, Anfang dreißig, traf nun im Hamburger Stadtteil Ottensen auf die einundzwanzigjährige Gisela Timmermann. Die beiden lernten sich in einem Rotklinkerbau kennen, in dem Karl als angestellter Klempner arbeitete. Die Wohnungsbaugenossenschaft Pädagogischer Verein schuf hier Unterkünfte für Lehrer. Giselas Eltern Berthold und Martha Timmermann waren gerade frisch in einen der vierstöckigen Blöcke eingezogen. Anders als mein Vater ist meine Mutter im Bildungsbürgertum und in materieller Sicherheit aufgewachsen.
Geboren wurde sie im Juli 1931 in Berlin-Neukölln. Ihre leibliche Mutter hatte als Haushaltshilfe bei verschiedenen wohlhabenden Familien gearbeitet. Wer ihr Vater war, hat meine Mutter nie erfahren. Gleich nach ihrer Geburt nämlich war ihre Mutter am Kindbettfieber gestorben.
Meine Mutter kam als Säugling in ein Berliner Waisenhaus. Dann lebte sie kurze Zeit in einer Pflegefamilie, in der sie offenbar geschlagen wurde. Meine Mutter hatte später noch Angst vor Gehstöcken, die Männer in jener Zeit gern als Accessoire trugen. Nach einigen Monaten gaben die Pflegeeltern sie zurück ins Waisenhaus, und als sie ein knappes Jahr alt war, erschien dort ein Hamburger Lehrerehepaar, deren Kinderwunsch sich nicht erfüllt hatte. Die beiden adoptierten das elternlose Mädchen und nahmen es mit nach Hamburg.
Dort wuchs meine Mutter als Einzelkind und dennoch in einer großen Familie auf. Beide Eltern hatten mehrere Geschwister. Meine Großmutter Martha führte ein Fotoalbum für ihre Tochter. Dort klebte sie Fotos von den Ausflügen und kleinen Reisen der Familie ein. Die drei wanderten durch den Harz, fuhren an die Ostsee und besuchten das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald. An den Wochenenden kamen Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen, man saß zusammen am weiß gedeckten Gartentisch. Im Hof der Genossenschaftshäuser stellten die Eltern ein Kasperletheater auf. Weihnachten feierte man als großes Familienfest. Den Weihnachtsbaum schmückten alle zusammen, darunter fanden die Kinder dann zahlreiche Geschenke. Meine Mutter konnte sich einmal über eine Spielküche freuen, ein anderes Mal über einen Puppenwagen.
Wenn mein Großvater Berthold zu Hause im Sessel seine Zigarre rauchte, trug er Anzug und Krawatte. Seine Frau schlüpfte im Haushalt in einen Kittel, trug darunter aber ein Kleid. Zu meinen Großeltern kam eine Haushälterin, Kisten mit Mineralwasser und Limonade ließen sie liefern. Auch Geburtstage wurden im großen Kreis gefeiert. Dann brachte der Metzger vom Othmarscher Kirchenweg kalte Platten mit Bratenscheiben, Kartoffeln und Gemüse.
Ein Foto zeigt meine Mutter als kleines Mädchen, das an der Ostsee auf einen Strandkorb geklettert ist. Neben ihr, an der Ecke des Korbs, weht eine Hakenkreuzfahne. Ihre Eltern waren Mitläufer. Während des Krieges verbrachten sie mit ihren Schülern und ihrer Tochter etliche Wochen im Erzgebirge und im Allgäu. »Erweiterte Kinderlandverschickung« nannten die Nationalsozialisten das. Der Nachwuchs sollte wegen der Bombengefahr raus aus den Städten. Die Wehrmacht hat meinen Großvater wohl deswegen nicht eingezogen.
Der Krieg ging zu Ende, und aus dem süßen Kind, das gerade noch auf Skiern gestanden und ein verletztes Rehkitz auf dem Arm gehalten hatte, wurde ein Teenager. Und der Teenager rebellierte. Meine Großmutter wusste sich manchmal nur noch zu helfen, indem sie meine Mutter in eine dunkle Kammer sperrte. Auf ihre Bildungschancen pfiff die durchaus nicht schwache Schülerin und verließ das Mädchengymnasium weit vor dem Abitur. Auf der Höheren Handelsschule schaffte sie dann doch noch einen Abschluss.
Ihre ungeklärte Herkunft nagte an meiner Mutter. Es war nicht so, dass meine Großeltern ihr von ihrer wahren Herkunft berichtet hätten. Darüber klärte man adoptierte Kinder damals in der Regel nicht auf. Doch meine Mutter hatte trotzdem davon erfahren, ausgerechnet während ihrer Pubertät. Ein Junge aus dem Block schmetterte ihr bei einem Streit entgegen, dass sie ja gar keine richtigen Eltern habe. Er hatte das wohl zu Hause aufgeschnappt. Der Junge wird nicht geahnt haben, was er meiner Mutter mit dieser Nachricht, die sich dann zügig verbreitete, antat. Sie fühlte sich fortan schlichtweg minderwertig. Noch Jahrzehnte später empfand sie es als Makel, dass sie ihre leiblichen Eltern nicht kannte und fast nichts von ihnen wusste. »Ich weiß nicht, aus was für einem Stall ich komme«, sagte sie oft. Einmal, da war sie noch nicht achtzehn, versuchte meine Mutter, mit einem Jungen durchzubrennen, nach Berlin wollten die beiden, in die Stadt, in der sie geboren wurde. Das Unterfangen scheiterte allerdings schon kurz hinter der Hamburger Stadtgrenze.
Nach der Handelsschule begann sie eine Banklehre, die sie mit Mühe zu Ende brachte. Danach fing sie als Schreibkraft in einem Büro an. Meine Mutter verliebte sich dort in Horst, einen Arbeitskollegen. Er war ihre erste richtige, vielleicht sogar ihre einzige große Liebe. Doch dieser Mann wollte in die USA auswandern. Das zu tun war ihm letztlich wichtiger als meine Mutter. Die überlegte deshalb ernsthaft, ihn zu begleiten. Sie sprach mit meinen Großeltern, versuchte sie zu überzeugen, doch die lehnten das strikt ab. Letztlich fehlte meiner Mutter wohl der Mut, mit ihm durchzubrennen. Man habe sie nicht mitgehen lassen, hat sie mir später erzählt.
Mein Vater war danach wohl der erste Mann, für den meine Mutter sich wirklich interessierte, auch wenn er ein Pleitier war, frisch geschieden und zweifacher Vater. Und er war ein gutes Jahrzehnt älter als sie. All das störte meine Mutter nicht. Ihrem Kollegen Horst hatte sie nicht folgen dürfen. Den Klempner Karl würde sie sich jetzt nicht auch noch verbieten lassen.
Die beiden gingen miteinander aus, und mein Vater ließ keinen Zweifel daran, dass er mehr als das wollte. Meiner Mutter gefiel an ihrem Verehrer wohl auch, dass es ihr mit seiner Hilfe gelingen würde, endlich bei ihren Eltern auszuziehen. Deren gutbürgerliches Idyll wollte sie schon aus Prinzip verlassen.
Der Weg nach St. Pauli
Nach der Hochzeit erwies es sich für meine Eltern als schwierig, eine ordentliche Unterkunft zu finden. Sie kamen dann auf der östlichen Seite der Alster unter, in Villen, die im Krieg halb zerstört worden waren. Im Grunde waren es Unterschlupfe in Ruinen. Die einst so stattlichen Häuser boten zwar Platz, aber keinerlei Komfort; sie waren noch nicht einmal abzuschließen. Mitunter pfiff bitterkalte Zugluft durch die Löcher in den Mauern. Meine Mutter kannte es anders, war jedoch froh, nicht mehr mit ihren Eltern unter einem Dach zu leben, und beschwerte sich deshalb nicht.
Im März 1955 brachte meine Mutter ihr erstes Kind zur Welt, meinen älteren Bruder Joachim. Im Dezember 1958 kam dann der zweite, Thomas. Meinen dritten großen Bruder habe ich nicht kennengelernt. Er wurde 1964 mit einem Herzfehler geboren und starb bereits nach vier Tagen.
Mein Vater eröffnete erneut eine Klempnerfirma. Genug zu tun gab es ja weiterhin. Meine Mutter würde ihm helfen, das war die Idee. Sie kannte sich mit Büroarbeit aus, hatte bei einer Bank gearbeitet und war aus Sicht meines Vaters eine optimale Besetzung für die Buchhaltung. Und die übernahm sie dann auch.
Mit meinen Brüdern zog die Familie in den Stadtteil Alsterdorf im Norden Hamburgs, in eine Dachgeschosswohnung, die direkt an einer Zugstrecke lag. Die Wohnung besaß eine Heizung. Die Tapete im Kinderzimmer der Jungen war mit Micky-Maus-Figuren bedruckt. Hier hatten sie es weitaus wohnlicher als in den halb zerstörten Stadtvillen.
Die zweite Selbstständigkeit meines Vaters entwickelte sich ebenfalls nicht wie erhofft. Erneut bekam er sein kleines Unternehmen nicht auf gesunde Füße gestellt und verfiel in alte Muster. Nach Feierabend ging er trinken, anstatt sich um neue Aufträge zu kümmern. Meine Mutter saß viel zu Hause. So hatte sie sich das nicht vorgestellt. Ihr Leben bestand jetzt vor allem aus Frust und Überforderung mit den Kindern. Womöglich kam auch das Gefühl hinzu, dass das Leben keine schöne Perspektive für sie bereithielt. Es wird in dieser Zeit gewesen sein, Anfang der Sechzigerjahre, dass auch meine Mutter anfing, regelmäßig Alkohol zu trinken.
Im Geschäft steuerte mein Vater unterdessen auf seine zweite Pleite zu. Er zog nicht genügend neue Aufträge an Land, und meine Mutter hatte die Buchhaltung offenbar auch nicht im Griff. Laufende Rechnungen konnten nicht bezahlt werden, das Geschäftskonto rutschte ins Minus. Die Schulden wuchsen. Irgendwann ging es nicht mehr. Der Gerichtsvollzieher erschien und forderte meinen Vater auf, einen Offenbarungseid zu leisten. Das bedeutete, dass mein Vater seine Finanzen offenlegen musste. Doch das wollte er nicht. Der Staat würde nicht nachgeben, das war ihm klar. Trotzdem weigerte er sich und begab sich lieber in Beugehaft. Natürlich wusste mein Vater, dass seine Schulden nicht verschwinden würden, wenn er ins Gefängnis ging. Aus falschem Stolz wählte er dennoch diesen Weg. Er ließ sich einsperren – und meine Mutter mit meinen beiden Brüdern und ohne irgendwelche Einkünfte allein.
Die Dachgeschosswohnung in Alsterdorf war so nicht mehr zu halten. Allerdings fand sich so leicht nichts Neues. Viele Vermieter wollten auch damals schon eine Verdienstbescheinigung sehen. Wohnungen mit solchen Besitzern kamen für meine Mutter nicht infrage.
Ihr neuer Stadtteil, Hamburg-Ottensen, steht heute in jedem Hamburg-Reiseführer, beschrieben als hippes, quirliges Quartier mit kleinen Straßen, Läden und Bars. Damals war die Gegend hinterm Bahnhof Altona alles andere als das, Fabriken und graue Fassaden prägten das Viertel. Die Wohnung, die Gisela Hoppe in Ottensen mit ihren beiden Jungs bezog, lag im ersten Stock eines Hinterhofhauses. Sie war über eine knarzige Treppe zu erreichen, bestand lediglich aus einem großen Zimmer und hatte keine Heizung. Mein Bruder Thomas hat die Unterkunft als schäbige Bleibe in Erinnerung. Die Toilette lag im Hausflur und wurde auch von den Nachbarn benutzt.