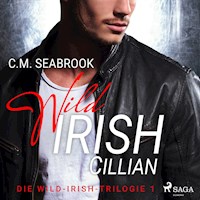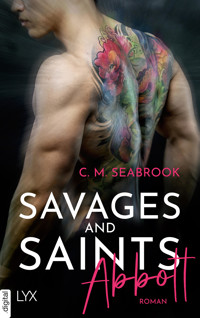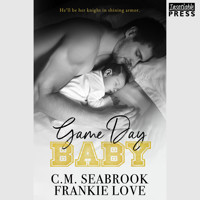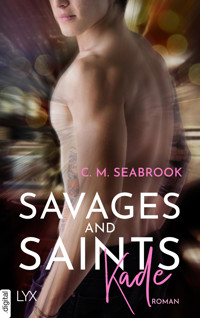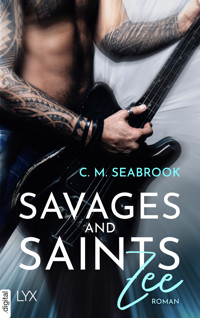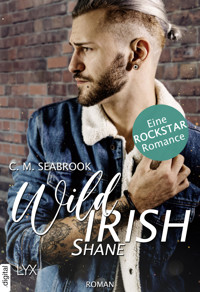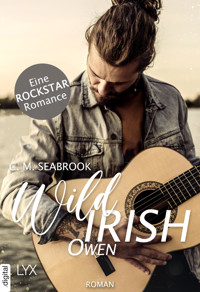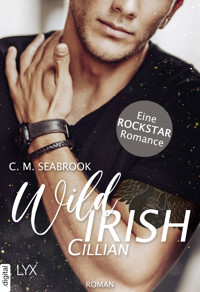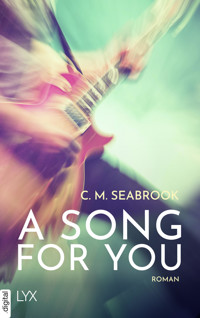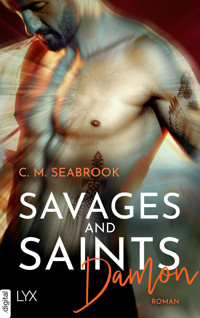
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Savages and Saints
- Sprache: Deutsch
Nicht die Liebe schmerzt, sondern die Erwartungen, die man in sie setzt.
Damon Savage ist der Sheriff des kleinen Städtchens Port Clover. Der wahre Grund, warum er zur Polizei ging: Er konnte sich nie verzeihen, dass er vor Jahren Lorelei, die Liebe seines Lebens mit einer unbedachten Bemerkung vertrieb, obwohl sie ihn so dringend gebraucht hätte. Nun bekämpft er die Verbrecher, die ihr das Leben einst zur Hölle machten. Als das Schicksal sie wieder zusammenführt setzt er alles daran, endlich die Schatten der Vergangenheit zu bannen, die sie noch immer bedrohen.
»Eine leidenschaftliche und emotional mitreißende Geschichte, ich habe dieses Buch in einem Rutsch verschlungen.« VERNA LOVES BOOKS, GOODREADS
Teil 3 der SAVAGES-AND-SAINTS-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Epilog
Die Autorin
Die Romane von C. M. Seabrook bei LYX
Leseprobe
Impressum
C. M. SEABROOK
Savages and Saints
DAMON
Roman
Ins Deutsche übertragen von Michaela Link
Zu diesem Buch
Nicht die Liebe schmerzt, sondern die Erwartungen, die man in sie setzt.
Damon Savage ist der Sheriff des kleinen Städtchens Port Clover. Der wahre Grund, warum er zur Polizei ging: Er konnte sich nie verzeihen, dass er vor Jahren Lorelei, die Liebe seines Lebens mit einer unbedachten Bemerkung vertrieb, obwohl sie ihn so dringend gebraucht hätte. Nun bekämpft er die Verbrecher, die ihr das Leben einst zur Hölle machten. Als das Schicksal sie wieder zusammenführt, setzt er alles daran, endlich die Schatten der Vergangenheit zu bannen, die sie noch immer bedrohen.
Bergung: etwas wiederherstellen oder vor einem möglichen Verlust oder vor widrigen Umständen bewahren. Rettung (eines Schiffswracks oder einer Schiffsladung) vor dem Untergang auf hoher See.
Prolog
DAMON
Siebzehnjährig
Donner kracht, und ein Blitz zuckt über den Himmel. Wellen spritzen über den Rumpf und durchnässen meinen Kapuzenpulli und meine Jeans. Ich umklammere mit weißen Knöcheln das Steuerrad des Bootes und blinzle durch die Hagelkörner, während ich gleichzeitig verzweifelt versuche, auf dem Eriesee ein Glitzern von Metall zu erhaschen.
»Wo zur Hölle bist du, Lorelei?« Meine Worte sind verzweifelt, voller Schuldgefühle, und verlieren sich im Wind.
Sie ist tot.
Im tiefsten Innern meiner Seele weiß ich es.
Und es ist alles meine Schuld.
Ich hatte sie nicht da in der Dunkelheit stehen sehen, wusste nicht, dass sie meine achtlos dahingesagten Worte gehört hatte, bis einer meiner Kumpels mir auf den Rücken schlug und auf das Aufblitzen von langem, dunklem Haar deutete, das im gleichen Moment um die Ecke verschwunden war. Und wusste es nicht, bis ich die Verletztheit in diesen todtraurigen, blauen Augen gesehen hatte.
»Scheiße.« Ich war aufgestanden, um ihr hinterherzulaufen, aber die Welt hatte sich in einem bierseligen Nebel um mich herum gedreht.
»Lass sie gehen, Savage.« Liam St. James hielt sich eine Flasche an die Lippen und zog eine Braue hoch. Obwohl seine nächsten Worte spaßig klangen, hörte ich die Warnung darin. »Sie bedeutet Ärger. Willst du wirklich Bence Farkas als Schwiegervater?«
Farkas und seine Schläger waren vor einigen Jahren nach Port Clover gezogen, mit einer Liste von Anschuldigungen gegen sie im Gepäck, darunter Drogenhandel, Prostitution und Geldwäsche. Nichts von alledem hatten die Behörden ihm jeweils nachweisen können. Der Mann schien unberührbar zu sein. Und Liam hatte recht, er war gefährlich.
Auch wenn es absolut widerwärtig war, der Mann hatte allen in Port Clover klargemacht, dass Lorelei ihm gehörte.
Sich auf die Stieftochter eines solchen Mannes einzulassen, war nicht nur dumm, es war Selbstmord. Gott allein wusste, was Farkas mit mir machen würde, wenn er herausfände, dass ich mir etwas genommen hatte, das er als seinen Besitz ansah.
Aber sie gehörte nicht ihm, sie gehörte mir. Und eines Tages würde ich dafür sorgen, dass jeder das wusste. Doch Verlegenheit oder, schlimmer noch, Feigheit, kombiniert mit der Wirkung der Flasche Jameson, die ich mir mit meinen Kumpels geteilt hatte, ganz zu schweigen von dem halben Dutzend Bieren, die ich heruntergekippt hatte, hatten mir die Zunge gelöst. Mein inneres Arschloch dazu gebracht, seinen hässlichen Kopf zu heben.
Ich hatte Tobys Bemerkung bezüglich der Gerüchte, laut denen man mich am Ende der Sommerparty auf Gull’s Island mit meiner Zunge halb in Loreleis Kehle beobachtet hatte, heruntergespült.
»Sie ist gut im Bett«, hatte ich unbedacht in mein Bier gemurmelt. »Es ist nicht so, als würde ich die Braut daten. Ich bin kein Masochist.«
Mistkerl. Galle war mir in den Mund geschossen, sobald ich die Worte ausgesprochen hatte, aber sie verwandelte sich in meiner Kehle in Säure, als ich Lorelei plötzlich dort stehen sah.
Sie hatte gehört, was ich gesagt hatte. Aber abgesehen von dem Aufblitzen von Verletztheit in ihrem Blick, die schnell von Abscheu verdrängt wurde, zeigte sie keine weitere Gefühlsregung. Das war etwas, das sie beherrschte, sich hinter einer Maske der Gleichgültigkeit vor der Welt zu verstecken. Die Schultern gestrafft, den Rücken durchgedrückt, hatte sie sich umgedreht und so getan, als machte ihr das Gelächter meines Kumpels nicht das Geringste aus.
Ich kannte die Wahrheit. Kannte das zarte, zerbrechliche, beschädigte Herz, in dem unter der eisigen Gelassenheit, mit der sie sich maskierte, Stärke und Wildheit brannten. Aber in der Sekunde vor ihrem Verschwinden sah ich, wie sie sich mir gegenüber verschloss. Und ich wusste, dass der Schaden, den ich angerichtet hatte, nicht wiedergutzumachen war.
»Ich habe gehört, dass Farkas sie jetzt für sich arbeiten lässt.« Toby feixte und lehnte sich in seinem Liegestuhl zurück, offensichtlich ohne einen Schimmer von dem Zorn zu ahnen, der meine Finger sich zu Fäusten ballen ließ. »Aber Scheiße, wer würde nicht für ein Stückchen von diesem Arsch zahlen, habe ich recht? Denkst du, du könntest einen Rabatt für deine Kumpels aushandeln?« Der Bastard hatte den Nerv, mich anzusehen und mit den Brauen zu wackeln, kurz bevor ich einen Satz nach vorn machte und meine Knöchel in sein Gesicht krachen ließ.
Der Liegestuhl, in dem er gesessen hatte, zerbrach unter unser beider Gewicht, und wir fielen ins Gras.
»Jesus, Savage, entspann dich.« Liam, der Einzige, der stark genug war, um mich zurückzuziehen, zerrte mich von Toby weg, der wimmernd auf dem Boden lag und sich seine blutige Nase hielt.
»Was ist dein Problem, Alter?«
»Es war nur ein Scherz.«
Ich ließ die Schultern kreisen und trat weg von meinem Freund. Dann murmelte ich jämmerlich: »Ich muss sie finden.«
Liam betrachtete mich stirnrunzelnd und schüttelte schwach den Kopf, als könnte er die Verzweiflung sehen, die in mir tobte, könnte sie aber nicht verstehen. »Geh.«
Ich zögerte nicht, aber sie war bereits fort.
»Lor, geh an dein verdammtes Handy.« Der Anruf ging direkt auf ihre Voicemail. »Ich habe es nicht so gemeint … die Jungs haben mir zugesetzt … und ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte.« Es war eine beschissene Entschuldigung. »Verdammt. Es tut mir leid. Ruf mich einfach zurück.«
Sie rief nicht zurück.
Zwei Tage verstrichen, bevor meine Verzweiflung groß genug war, um ihre Mutter anzurufen.
»Hallo, Mrs Farkas. Ich bin ein Freund von Lor –«
»Wo ist sie?«, schrie die Frau in den Hörer. Etwas zwischen einem Kreischen und Schluchzen vibrierte durch die Leitung. »Er wird mich umbringen. Sag ihr das. Er wird mich auf die Straße werfen, wenn sie nicht nach Hause kommt. Ich schwöre bei Gott, ich werde sie selbst verprügeln, wenn sie –«
Ich legte auf, und mein Magen krampfte sich zusammen angesichts des Fehlens jeglicher mütterlicher Zuneigung in der Stimme der Frau. Alle in Loreleis Leben hatten sie verraten – und ich hatte es ebenfalls getan.
In der Nacht, in der sie sich mir vollkommen hingegeben hatte, hatte ich versprochen, mich niemals der langen Liste von Menschen anzuschließen, die ihr wehgetan hatten. Ich hatte jedes Wort ernst gemeint, jedes Gelübde, das ich gesprochen hatte. Da war ein urtümliches Verlangen in mir gewesen, sie zu beschützen, sie glücklich zu machen, ein seltenes Lächeln von ihren weichen Lippen zu locken.
Ich hatte versagt.
»Gib keine Versprechen, die du nicht halten kannst«, hatte sie geantwortet, doch die Akzeptanz des Unvermeidlichen hatte ihr im Gesicht gestanden, als sie mit der Kuppe ihres Daumens über mein Kinn gestrichen hatte. Gleichzeitig hatte ihr Körper sich an meinen geklammert, als hätte sie gewusst, dass unsere Zeit begrenzt war.
Schon in dem Moment hatte ich eine Ewigkeit mir ihr gewollt, was für einen siebzehnjährigen Draufgänger höllisch Furcht einflößend war, einen Jungen, der sich daran gewöhnt hatte, zuerst mit seinem Schwanz zu denken und danach erst mit seinem Gehirn, während sein Herz in dieser Sache einen krachenden letzten Platz belegte.
Aber bei Lorelei waren meine Gefühle ein verrückter, intensiver Strudel, der mich alle mögliche Scheiße machen ließ, von der ich gedacht hatte, nur Weicheier würden sie machen. So hatte ich zum Beispiel jämmerliche Versprechen gegeben, Versprechen von Ewigkeit und Liebe und anderer Scheiße, die zu versprechen ich kein Recht hatte.
»Ich liebe dich, Lorelei«, hatte ich erst wenige Wochen zuvor erklärt und einen schweren Arm über ihre blasse Haut gelegt, als wir ausgestreckt im Rumpf des Bootes lagen. Draußen auf dem See bestand keine Gefahr, dass man uns zusammen erwischte. Es war unser Ort weitab von verurteilenden Augen. »Du kannst mir vertrauen.«
Vertraue darauf, dass ich die verdammt beste Sache in meinem Leben vermassele.
»Gott!«, brülle ich jetzt in den schrecklichen Sturm, der genauso wie die ganze Verzweiflung, die in mir brodelt und zischt, wütet. »Blödes verdammtes Arschloch.«
Donner grollt wie zur Zustimmung, und etwas fügt sich in meiner Brust zusammen. Ein Wissen, ein Eingeständnis des Unausweichlichen – ich habe sie verloren. Und nicht nur wegen der achtlosen Worte, die ich gesprochen habe, sondern weil das Mädchen schon immer nur einen einzigen Schritt davon entfernt war, von einer Klippe in eine Dunkelheit zu stürzen, in die ich ihr niemals hätte folgen können.
Oder in einen Sturm, in dem die Wellen drohten, ihr Unglück zu ertränken.
»Manchmal denke ich daran, einfach zu verschwinden.« Sie hatte mir den Rücken zugewandt, als sie die Worte gesprochen hatte, und ihre Beine hatten über den Rand des Bootes gebaumelt.
Geheimnisse schienen sie zu umhüllen wie Schatten, wie eine zweite Haut, trotz der sengenden Hitze der Julisonne.
Ich trat hinter sie, legte ihr die Arme um die Taille und zog sie an meine Brust. »Ich werde niemals aufhören, nach dir zu suchen. Niemals aufhören, dich zu lieben.«
Sie hatte sich leicht umgedreht und meinem Blick suchend standgehalten, als wäre sie sich nicht sicher, ob sie mir glaubte. »Hast du gewusst, dass es allein in diesem See mehr als zweitausend gesunkene Schiffe gibt, deren Wracks zum größten Teil nie gefunden worden sind?«
Ich küsste sie auf die Nasenspitze und sagte scherzhaft: »Wie morbide.«
Sie zuckte mit den Achseln und richtete den Blick wieder auf den Horizont. »Den Menschen ist nicht bewusst, wie tief die Großen Seen sind, wie leicht es ist, sich vom Wasser verschlucken zu lassen.«
Ich hatte nicht wirklich zugehört.
Wenn ich es getan hätte, wäre vielleicht …
Stattdessen hatte ich sie hochgehoben, mir ihre Beine um die Taille geschlungen, meinen Mund auf ihren gepresst und leise knurrend gesagt: »Ich habe etwas Besseres, was du verschlucken kannst.«
Sie hatte geschnaubt und die Augen verdreht. »Du bist schrecklich.«
»Aber du liebst mich trotzdem.«
Sie hatte meinen Blick festgehalten, tief Luft geholt und geantwortet: »Das tue ich.«
Aber es war mir nicht entgangen, dass sie die Worte selbst nie ausgesprochen hatte.
Liebe tut nicht weh. Erwartungen schon. Diese Worte hatte sie auf die Vorderseite ihres Englisch-Hefts gekritzelt, aber ich wusste schon damals, dass sie möglicherweise auch auf die Splitter ihres Herzens tätowiert waren.
Mein Mädchen war gebrochen, beschädigt, und doch liebte ich sie. Denn ich sah sie, wie sie wirklich war. Sah die Sanftheit und die Hoffnung und die Stärke, die sie antrieben, wenn alles andere in ihrem Leben beschissen war.
Ich hatte das Versprechen gegeben, den Rest meines Lebens damit zu verbringen, diese Einzelteile wieder mit Liebe zu kitten.
Liebe tut nicht weh. Erwartungen schon.
Erst Jahre später war mir klar geworden, wie wahr diese Worte waren.
Dummerweise hatte ich gedacht, ich wäre in der Lage, die Dunkelheit zu bannen, aber ich hatte sie nur für einige Momente verjagt.
Ich war viel zu jung, um die Dämonen zu verstehen, gegen die sie kämpfte. Zumindest war das meine Ausrede in den Tagen danach. Aber ich sollte mich schon bald mit meiner eigenen Dunkelheit konfrontiert sehen. Einer Schwärze in meiner Seele, die mich niemals loslassen würde.
Statt dass ich Lorelei heilte, würde sie mich zerbrechen. Sie würde eine Wunde in mich schlagen, die niemals heilte.
In der Dunkelheit blitzen Suchlichter vor mir auf, und ich lenke mein Boot in Richtung Gull’s Island, wo zwei Seenotrettungsboote langsam das Gebiet absuchen. Um mich herum tobt noch immer der Sturm, und die Wellen machen es unmöglich, näher an die Schiffe der Küstenwache heranzukommen, aber der Regen lässt nach, sodass ich sehe, worauf ihre Strahlen sich richten – ein metallisches Glitzern am Ufer der kleinen Insel.
Zerbeult und aufgerissen, wie es ist, ist das kleine Boot unrettbar beschädigt. Ich erkenne das Motorboot, das Mike St. James, Liams Dad, vor zwei Tagen als gestohlen gemeldet hat. Dasselbe Boot, das, wie mein Bruder Kade beobachtet hat, Lorelei an diesem Abend am Hafen betankt hat.
Ich atme ein, aber die Luft erstickt mich.
Sie könnte überlebt haben. Sie war eine gute Schwimmerin. Sie könnte zum Strand geschwommen sein. Noch während ich das denke, weiß ich, dass es, selbst wenn der Seegang nicht so rau gewesen wäre, fast unmöglich ist, die mehr als fünfzehn Meilen ans Ufer zu schwimmen.
»Lorelei.« Ihr Name ist ein Flehen im Wind. »Was hast du getan?«
Etwas Kleines taucht im Wasser links von meinem Boot auf. Ein leuchtend roter Deckel, der meine Aufmerksamkeit von dem Wirbel an Aktivitäten in der Nähe der Insel ablenkt. Zuerst ignoriere ich ihn, bis der metallene Behälter gegen den stählernen Bootsrumpf scheppert.
Klirr.
Klirr.
Klirr.
Mit einem Kescher ziehe ich die alte Kaffeedose aus dem Wasser. Jemand hat mit schwarzem Textmarker Muster darauf gezeichnet und um ein großes Herz herum mit schnörkliger Schrift geschrieben: Damon + Lorelei
Loreleis Handschrift. Ihre Handschrift war eins der wenigen mädchenhaften Dinge an ihr, die kleinen Muster, die sie überall hinterließ … an ihrem Schließfach, ihrem Schreibtisch, in ihren Büchern, manchmal sogar auf meinem Körper. Das verblasste geometrische Muster, das sie vor einer Woche mit einem schwarzen Stift auf meinen Unterarm gezeichnet hat, juckt, als wäre es ein Hinweis auf ihr Verschwinden.
Ich setze mich mit der Kaffeedose auf dem Schoß hin. Das Boot schaukelt, und meine Finger zittern, als ich den Plastikdeckel aufschraube.
Ein großes Bündel Geldscheine bildet den Inhalt. Ich ziehe das Gummiband ab und blättere in den Zwanzigern, Fünfzigern und Hundertern.
»Scheiße.« Ich kann nicht schätzen, wie viel da drin ist, aber es ist eine Menge. Was zur Hölle hatte sie mit so viel Geld vor?
Weglaufen. Sie wollte weglaufen. Vor mir. Vor dem Bastard, der geschworen hat, sie zu verteidigen, der sie aber nicht einmal vor sich selbst beschützen konnte. Ich hatte sie im Stich gelassen.
Die Worte schießen in meinem Gehirn umher, und Verdammnis überwältigt jedes andere Gefühl.
»Wir haben etwas gefunden.« Rufe hallen über den See. »Hier drüben.«
Das Geld vergessend, stehe ich abrupt auf. Die Dose fällt mir vom Schoß, und ich fühle mich gleichzeitig massig und schwerelos. Blinzelnd schaue ich zu den Männern hinüber, die etwas Schlaffes und Lebloses aus dem Wasser ziehen.
Nein. Nein. Nein.
Ich halte den Atem an, und mein Herz hämmert so hart in meinen Ohren, dass jedes andere Geräusch gedämpft ist.
Aber es ist nicht Lorelei.
Jemand zieht eine alte Armeetasche hoch über den Rand des Bootes. Ganz gewöhnlich, abgenutzt. Aber ich weiß, dass es ihre Tasche ist.
Sie war hier. Aber die kleine Insel ist jetzt verlassen, bis auf das zerbeulte Boot und die Rettungshelfer, die die felsigen Ufer absuchen.
Wie betäubt stehe ich da. Minuten, Stunden, ich weiß nicht, wie viel Zeit verstreicht. Genug, dass weitere Rettungsboote das Gebiet befahren, dass Männer in Tauchanzügen in das kalte Wasser springen und suchen … wonach?
Nach einem Leichnam, schreit mein Gehirn. Sie suchen nach ihrem Leichnam.
Einem Leichnam, den sie niemals finden werden. Denn im tiefsten Teil meiner Seele weiß ich, dass Lorelei, wo immer sie ist, ob auf dem Grund des Sees bei den unrettbaren Schiffen oder als Anhalterin so weit entfernt von Port Clover entfernt wie nur möglich, erreicht hat, was sie immer wollte.
Sie ist verschwunden.
1
DAMON
Elf Jahre später …
»Du siehst beschissen aus.« Jasper lässt sich in meiner Sitznische auf die Bank gegenüber gleiten. Bekleidet mit einem maßgeschneiderten Anzug, das Haar zurückgegelt, sieht er aus, als wäre er eher der Besitzer der Boeing BBJ, mit der er irgendeinen Ölmagnaten um die Welt fliegt, statt nur der Pilot.
Das komplette Gegenteil zu meiner eigenen Erscheinung.
Ich streiche mir mit einer Hand über meinen dichten, ungestutzten Bart und beobachte, wie der Blick meines Bruders zu den Tätowierungen auf meinem rechten Arm wandert.
»So lassen die dich arbeiten?«
»Ich bin jetzt Sheriff. Ich kann tun, was zur Hölle ich will.«
Er zieht kritisch seine Brauen hoch und schüttelt leicht den Kopf.
Schon in unserer Kindheit hat mein ältester Bruder davon geträumt, mehr zu sein als einer von Port Clovers berüchtigten Savages. Das hat ihn nicht daran gehindert, genau wie wir anderen allen möglichen Scheiß anzustellen, er war nur erheblich besser darin, sich nicht erwischen zu lassen. Aber in letzter Zeit ist er so jenseits von allem, dass ich mich manchmal frage, ob er wirklich derselbe Bursche ist, der die berüchtigte Sommerparty auf Gull’s Island ins Leben gerufen hat.
Ich schätze, mit der Zeit verändern sich Menschen. Mich hat die Zeit definitiv verändert. Ich mag aussehen wie einer dieser Männer, deren Gesichter auf den Fahndungslisten an der Wand neben meinem Schreibtisch hängen, aber ich verbringe mein Leben damit, diesen Dreckskerlen den Boden unter den Füßen wegzuziehen.
Und ich bin ziemlich gut darin bisher.
Ich habe nicht nur die Hälfte von Farkas’ Männern wegen diverser Vergehen, die sie für mehr als ein Jahrzehnt in ein staatliches Gefängnis bringen werden, der Justiz übergeben, es ist mir auch gelungen, den restlichen Abschaum aus meiner Stadt zu vertreiben.
Ich bereue nur, dass Farkas immer noch irgendwo da draußen ist. Nach meinen letzten Informationen hat er sich in Harristown niedergelassen, was für meinen Geschmack viel, viel zu nah bei Port Clover ist.
Da ist etwas in mir, das niemals zur Ruhe kommen wird, das niemals Frieden finden wird, bis ich diesen Mann dort hingebracht habe, wo er hingehört: hinter Gitter oder zwei Meter tief unter die Erde.
Er ist der wahre Grund, warum ich nach dem Sheriff-Abzeichen gegriffen habe. Vielleicht ist das meine Art zu versuchen, mein eigenes Versagen auszulöschen, mein Gewissen zu beruhigen. Obwohl ich weiß, dass nichts mir Lorelei jemals zurückbringen wird.
»Was willst du, Jasper?« Ich strecke die Beine unter dem Tisch aus, lehne mich an die Rückenlehne des roten Plastiksitzes, mustere den Mann mir gegenüber und weiß, dass es nicht um ein brüderliches Miteinander geht. »Du hättest die zusätzlichen dreißig Minuten, um in die Stadt reinzufahren, nicht einrichten können?«
»Übellaunig wie eh und je, wie ich sehe.« Jasper hebt seinen Kaffeebecher in Richtung der Kellnerin, die mit einer dampfenden Kaffeekanne an den Tisch kommt.
Der Blick der jungen Frau wandert zwischen uns hin und her, und ich kann mir nur ausmalen, was sie denkt, als sie unser Erscheinungsbild betrachtet. Ich in meinen abgenutzten Jeans und einem engen T-Shirt, das die dunklen Tattoos auf meinen beiden muskelbepackten Armen entblößt, mit einem dichten Bart, der den größten Teil meines Gesichtes bedeckt. Eine alte Baseballkappe sitzt tief über meiner Stirn und verbirgt den Rest des Gesichts.
Ich betrachte die Familien und die alten Leute in ihrem schönsten Sonntagsstaat, die das kleine Restaurant füllen. Weder Jasper in seinem Zehntausend-Dollar-Anzug noch ich, der ich aussehe, als hätte ich gerade ein Wochenende in der Wildnis campiert, passen zu der Kirchgängerkundschaft.
»Wollen Sie etwas bestellen?«, fragt die Kellnerin, und der Hauch von Argwohn, der in ihre Augen getreten ist, als sie mir meinen Platz zugewiesen hat, verwandelt sich in Anerkennung, als ihr Blick eine Spur zu lange auf meinem Bruder verweilt.
»Für mich nur Kaffee, meine Schöne«, sagt Jasper glattzüngig, bevor er ihr zuzwinkert und ihr dann die laminierte Speisekarte zurückgibt. »Ich bleibe nicht, aber bringen Sie ihm Ihr Sonntagsangebot.«
Das Mädchen wendet sich mit einem übertriebenen Seufzer ab, in den sich ein Kichern mischt, bevor ich eine Chance habe, Jasper zu korrigieren, obwohl es genau das ist, was ich bestellen wollte.
Ich bin mir jeder einzelnen Person bewusst, die seit meinem Eintreffen gekommen und gegangen ist, und mein Blick wandert wie von selbst zur Tür, als die Glocke erklingt und eine Frau hereinkommt.
Sie hat sich eine Baseballkappe tief über die Stirn gezogen und trägt eine Fliegersonnenbrille, die zu groß für sie ist und ihre Gesichtszüge verbirgt.
Aber es sind nicht ihr Gesicht oder die sanften Kurven, die sie zweifellos unter ihrem ausgebeulten Kapuzenpulli versteckt, die meine Aufmerksamkeit fesseln. Es ist die Art, wie ihre rechte Hand zu ihrer Hüfte wandert, und das Glitzern von Metall, das ich sehe, bevor sie ihr Sweatshirt wieder überzieht.
Warnglocken schrillen in mir, und ich spüre eine Verlagerung der Energie im Raum, die niemand sonst zu bemerken scheint, vielleicht mit Ausnahme der Frau, die für einen Moment stutzt und über ihre Schulter in meine Richtung schaut. Noch immer kann ich ihr Gesicht nicht sehen, aber ich sehe den kleinen Schauder, der über sie hinwegrast, bevor sie der Kellnerin zu einer Sitznische auf der anderen Seite des Restaurants folgt.
»Du gehst schon?«, frage ich Jasper und behalte die Frau am Rande meines Gesichtsfeldes. Sie wendet mir jetzt den Rücken zu, aber ich sehe das Zittern ihrer Hände, als sie nach einer Speisekarte greift und sie dann wieder weglegt.
Das Letzte, was ich an meinem freien Tag brauche, sind Scherereien, und dieses Mädchen hat das Wort Scherereien förmlich auf der Stirn stehen.
»Ich muss vor Mittag wieder in New York sein«, antwortet Jasper. »Dann breche ich nach Europa auf. Dort werde ich bis Oktober sein.«
»Was ist mit Dads Party?« Quinn, unsere Schwester, plant seit drei Monaten die Überraschungsparty zu seinem sechzigsten Geburtstag, und ihre einzige Bitte war die, dass wir alle dort auftauchen.
Ich hätte wissen sollen, dass er irgendeinen Vorwand finden würde, um sich da rauszulavieren.
»Ich muss arbeiten. Ich kann nicht wegen einer dummen Party blaumachen.« Jasper holt einen Umschlag aus der Innentasche seines Anzugs und schiebt ihn über den Tisch. »Gib Dad das hier.«
Ich zögere, bevor ich danach greife; bereit zu streiten, aber ich weiß, dass es keinen Sinn hat. Er mag nicht länger aussehen wie ein Savage mit seinen lächerlichen Anzügen und seinem überteuerten Haarschnitt, aber er ist trotzdem genauso starrköpfig und unflexibel wie der Rest von uns.
»Quinn wird sauer sein.«
Er zuckt mit den Achseln und schlüpft von der Bank, aber nicht, bevor er einen Zwanziger auf den Tisch geklatscht hat. »Ich werde an Thanksgiving wieder da sein.«
»Du bist ein echter Mistkerl, weißt du das?«
Ein Feixen umspielt seine Lippen. »Schätze, das liegt in der Familie.«
»Was immer du für Probleme mit Dad hast, Mom will dich sehen. Es bricht ihr –«
»Ich habe zu tun. Das ist alles.« Er stützt sich mit den Händen auf den Tisch und beugt sich vor. »Nur weil ich nicht in dem größten Drecksloch Amerikas leben will wie der Rest von euch, heißt das nicht, dass ich nichts mehr mitkriege, wie du es immer wieder Abbott gegenüber behauptest.«
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Lebensmission unseres jüngsten Bruders ist, uns gegeneinander aufzuhetzen, daher überrascht es mich nicht, dass er Jasper erzählt hat, was ich gesagt habe. Es schockiert mich, dass sie überhaupt miteinander gesprochen haben.
»Du hast mit Abbott geredet?«
Jaspers Lippen werden schmal. »Ich habe ihm etwas Geld geliehen.«
»Du meinst, du hast es ihm geschenkt.« Ich reibe mir das Gesicht, dann rücke ich meine Kappe zurecht. »Du weißt, dass du niemals einen Penny davon wiedersehen wirst. Du wirfst mit deinem Geld herum, als könnte das irgendetwas in Ordnung bringen.«
»Besser, als mit diesem verdammten Abzeichen rumzulaufen.« Er richtet sich auf, und sein Kinn zuckt. »Er hat mir erzählt, dass du ihn eingesperrt hast.«
»Ich habe keine Anzeige gegen ihn erstattet, obwohl ich das hätte tun sollen. Der Junge hat was Ungutes an sich. Du unterstützt ihn nur, wenn du ihm Geld gibst. Was er braucht –«
»Ist ein endgültiger Abschied von dieser gottverdammten Stadt.«
»Warum, damit er sich in ein selbstherrliches Arschloch wie du verwandeln kann?«
Die Spannung zwischen uns, die sich seit Jahren schon aufbaut, siedet zu dicht unter der Oberfläche, und etliche Köpfe drehen sich in unsere Richtung.
Ich senke die Stimme. »Du kannst hinfliegen, wo immer du hin willst, aber das ändert nichts daran, wo du herkommst.« Bevor ich eine Gelegenheit habe, mir auf die Zunge zu beißen, füge ich hinzu: »Oder daran, dass du das Beste in deinem Leben verloren hast, indem du fortgegangen bist.«
Seine Nasenflügel beben, und ich kann erkennen, dass ich ins Schwarze getroffen habe, was vielleicht der wahre Grund ist, warum er sich von hier fernhält.
Ich will mich gerade entschuldigen und versuchen, meine Worte zurückzunehmen, als er ein leises Knurren ausstößt. »Und du kannst jeden Mistkerl in Port Clover verhaften, aber das wird nichts an der Tatsache ändern, dass du das Mädchen nicht retten konntest. Ich schätze, wir sind uns ähnlicher, als du zugeben möchtest.«
Er zupft an seinem Anzug. Die Schultern durchgedrückt, das Gesicht stoisch, würde niemand den Schmerz ahnen, den ich für eine flüchtige Sekunde in seinen Augen habe aufblitzen sehen, bevor er ihn mit der dummdreisten Miene maskiert hat, die dauerhaft auf seinem Gesicht einzementiert zu sein scheint.
»Wie immer ein gutes Gespräch, kleiner Bruder.« Er dreht sich um und geht zur Tür hinaus, zu dem Lexus LC, der am Straßenrand parkt. Ein weiteres seiner Spielzeuge, die er benutzt, um das klaffende Loch in seiner Brust zu füllen, da, wo früher sein Herz war.
Aber ich schätze, es ist nicht viel anders als bei mir mit der Arbeit oder bei Abbott mit Alkohol und Drogen. Wir kaschieren die Leere in unserem beschissenen Leben.
»Er ist gegangen?«, fragt die Kellnerin und zieht einen kleinen Schmollmund, bevor sie den Teller mit Eiern und Schinken vor mich hinstellt. Dann holt sie ein zusammengefaltetes Stück Papier aus ihrer Schürze, auf dem zweifellos ihre Handynummer steht. »Würde es Ihnen etwas ausmachen, das an Ihren Freund weiterzugeben?«
Ich stoße ein Brummen aus und proste ihr mit meinem Kaffeebecher zu. »Das wird nicht passieren, Schätzchen. Aber Sie können mir Kaffee nachschenken.«
Ihre Wangen werden flammend rot, und sie zappelt für einen Moment herum und murmelt etwas, das wie Arschloch klingt, bevor sie meinen Becher wieder auffüllt und davonstolziert.
Die Frau besteht ganz aus Hüften und Brüsten, total Jaspers Typ, aber ich werde nicht den Kuppler für seinen traurigen Arsch spielen. Außerdem bin ich wieder ganz auf das Mädchen in der Nische am hinteren Ende konzentriert. Wann immer es an der Tür bimmelt, sehe ich sie leicht zusammenzucken, und ihre Hand gleitet zu der Waffe, die sie, wie ich weiß, unter ihrem Kapuzenpulli versteckt hat.
Ich bin nicht im Dienst, und das hier ist nicht meine Stadt, aber der Cop in mir kann nicht einfach wegsehen, denn ich weiß, dass hier nichts Gutes passieren wird. Ich kann die vibrierende Angst praktisch spüren, die dieses Mädchen ausstrahlt. Es ist mehr als nur Angst, es ist Verzweiflung. Ihre Bewegungen sind ruckartig wie ein in einem Käfig gefangenes Eichhörnchen und ihr Blick ist gehetzt.
Ich hole mein Handy hervor und will gerade die örtliche Polizei verständigen, damit die sich darum kümmern, was immer sie für Probleme hat oder was für Probleme sie sich gleich einhandeln wird, als sie ihren Kopf nach links dreht und ich ihr Profil sehe.
Scheiße.
Der Atem entweicht mir, als hätte mich ein Baseballschläger gegen die Brust getroffen. Denn für eine Sekunde, das schwöre ich, sehe ich einen Geist.
Ich versuche das Gefühl abzuschütteln, aber es schlingt sich um meine Kehle und drückt das letzte Fetzchen Luft aus meinen Lungen.
Lorelei.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich denke, ich hätte sie gesehen. Als sie damals verschwand, ist mir das ständig passiert. Ein Aufblitzen von braunem Haar, ähnliche, stürmische, graublaue Augen oder ein unvergleichliches Lachen haben mich mit einer lähmenden Hoffnung erfüllt. Bis die Realität wieder über mir eingestürzt ist und die Wunde aufgerissen hat, die nie ganz verheilt ist.
Sie ist fort. Ob tot oder lebendig, sie wird nie mehr zurückkommen. Es ist ein Mantra, das ich mir im Laufe der Jahre immer wieder selbst vorsagen musste, denn da war zu jeder Zeit ein Teil in mir, der es niemals glauben würde, niemals glauben konnte.
Vielleicht ist es dieser verdammte Hoffnungsfunke, der mich dazu treibt, mein Handy wieder einzustecken, bevor ich den Sheriff aus dem Ort anrufe. Und ich bin froh darüber, dass ich das getan habe, denn als die Glocke das nächste Mal läutet und sie über ihre Schulter schaut, sehe ich sie.
Sie.
Sie.
Sie.
Mein Herz erinnert sich daran, wieder zu schlagen, eine ungestüme Macht in meiner Brust.
Ihr Blick gleitet über mich hinweg und zögert kurz, aber obwohl ich weiß, dass sie mich nicht erkennt, bin ich mir sicher, dass sie es ist.
Lorelei.
2
LORELEI
»Wenn Sie nur Wasser bestellen, muss ich Sie bitten, diesen Tisch für zahlende Kunden frei zu machen.« Die drahtige, grauhaarige Kellnerin schaut finster auf mich herab. Sie hält eine dampfende Kaffeekanne in einer Hand und in der anderen ein Tablett mit schmutzigem Geschirr.
Die Frau hat die Stimme erhoben, und einige Köpfe drehen sich in meine Richtung, bevor die Leute wieder zu ihren stumpfsinnigen Gesprächen zurückkehren, ohne etwas von der Gefahr zu ahnen, die ich mitgebracht habe.
Ich ziehe meine Baseballkappe tiefer herunter, rutsche auf meinem Stuhl nach vorn und bin mir dabei schmerzhaft der Waffe bewusst, die sich in meine rechte Hüfte bohrt.
Jede Zelle in meinem Körper schreit mir zu, dass ich wegrennen soll. Aber ich kann nicht. Nicht so lange Farkas mein Leben, mein Herz, in seinen sadistischen Händen hält.
»Nun?« Die Kellnerin mustert mich zungenschnalzend.
»Ich nehme … ich nehme einen Kaffee«, murmle ich und schiebe die Keramiktasse vor mir an die Tischkante, obwohl ich mir den einen Dollar fünfzig, den mich das kosten wird, nicht leisten kann.
Sie schürzt die Lippen und füllt meine Tasse, bevor sie sich mit erneutem Zungenschnalzen abwendet. Ich mache ihr keinen Vorwurf, dass sie frustriert ist. In dem kleinen Restaurant wimmelt es nur so von Familien, und es kommen immer mehr Leute herein.
Gute Menschen. Anständige Menschen. Menschen, die nichts von den Kakerlaken wissen, die ihre Stadt verunreinigen und den Verletzlichen und den Schwachen auflauern; Menschen, die das Gesetz mit ihrem schmutzigen Geld manipulieren und sich nehmen, was immer sie wollen, ohne sich um die Konsequenzen zu scheren.
Ich trinke einen kleinen Schluck, aber die heiße Flüssigkeit fühlt sich wie Säure an, als sie sich in meiner Kehle einen Pfad hinunterbrennt. Es ist fast drei Tage her, seit ich das letzte Mal mehr als einige Minuten hintereinander geschlafen habe, aber das Koffein macht mich nur kribbeliger. Ich funktioniere rein auf Rest-Akku und Adrenalin. Aber ich kann nicht schlafen, kann nicht aufhören, nicht bis ich den Rest des Geldes zusammenbekommen habe.
Und nachdem ich mein Auto für einen Bruchteil seines Werts verkaufen musste, kann ich nirgendwo schlafen, selbst wenn mein Gehirn herunterfahren und es mir erlauben würde. Im Moment ist Furcht mein größter Motivator, das Einzige, das mich aufrecht hält, das mich daran hindert, zusammenzubrechen.
Ich war unvorsichtig.
Habe mir gestattet, das Böse zu vergessen, das in den Schatten lauert und nur darauf wartet, zu verschlingen und zu zerstören. Aber ich hatte mir ein Leben aufgebaut. Sicher, ich war zurzeit arbeitslos und lag mit der Miete einen Monat im Rückstand, aber ich war an einem Ort, von dem ich dachte, dass Farkas mich dort niemals finden würde.
Nach all dieser Zeit hatte ich geglaubt, er hätte mich vergessen. Hatte geglaubt, ich wäre sicher.
Gott, was bin ich nur für eine Idiotin.
Meine Hände zittern, als ich den warmen Becher an die Lippen halte und noch einen Schluck nehme.
Es ist meine Schuld, dass Farkas mich gefunden hat. Ich hätte dem Fotografen letztes Jahr niemals erlauben dürfen, ein Foto von mir zu machen.
»Du solltest diesen Augenblick feiern.« Patty, die Frau, die mir mehr eine Mutter geworden war als meine eigene, schlang einen ihrer kräftigen Arme um meine Schultern. Tränen, die bei ihr immer so schnell kamen, kullerten über ihre Wangen. »Du hast unsere kleine Stadt mit deinen Tortenkreationen berühmt gemacht.«
Voller Stolz hatte ich beobachtet, wie der Fotograf Bilder von den extravaganten Gebäckstücken und Torten in der Vitrine von Patty Cakes, Cookies, and Confections knipste, eine Vitrine, deren Inhalt ich über Wochen konzipiert hatte und die dem Laden beim landesweiten Backwettbewerb das blaue Band beschert hatte.
»Die sind wirklich großartig.« Der Fotograf schoss ein Foto von einer vierstöckigen Torte von der Teeparty des verrückten Hutmachers aus Alice im Wunderland, mit einer lebensechten Grinsekatze aus Fondant, die von der obersten Schicht herablächelte. »Sie sehen zu schön aus, um sie zu essen.«
Ein Lächeln umspielte meine Lippen, denn es war eine der häufigsten Bemerkungen, die ich hörte, wenn Leute kamen, um ihre Bestellungen abzuholen. Ich war stolz auf das, was ich geleistet hatte.
»Kann ich ein Foto von Ihnen neben dieser Torte machen?« Der Mann bereitete sich darauf vor, mich zu fotografieren, noch bevor ich zugestimmt hatte.
»Ich, ähm …«
»Nur zu.« Patty versetzte mir einen kleinen Stoß. »Genieße diesen Augenblick.«
Das hatte ich getan. Für eine flüchtige Sekunde hat ich vergessen, warum ich Baseballkappen trug und falsche, klobige Brillengestelle, um mein Gesicht zu verstecken. Ich hatte mit dem Selbstbewusstsein eines Menschen in die Kamera gegrinst, der Bence Farkas kein Geld gestohlen und es dann im kühlen Wasser des Großen Sees verloren hatte.
Es war Merv gewesen, Pattys Ehemann, der mich vor all jenen Jahren gefunden hatte, nachdem ich irgendwo zwischen Port Clover und Harristown ans Ufer gespült worden war.
Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich im kalten Wasser getrieben war, nachdem mein Boot gekentert war, aber ich hätte nicht überlebt, wenn ich nicht die Rettungsweste getragen hätte, die ich bei Ausbruch des Sturms unter der Stahlbank gefunden hatte. Ich hätte auch keinen weiteren Tag überlebt, wenn sich Merv nicht meiner erbarmt hätte, wenn er mich nicht zu Patty gebracht hätte, die sich um mich kümmerte, als wäre ich das Kind, das die beiden niemals haben konnten.
Sie haben mich aufgenommen. Mir zu essen gegeben. Mir einen Job in der Bäckerei angeboten. Mir Hoffnung geschenkt, als ich keine hatte.
Aber wie alles andere in meinem Leben sind sie mir genommen worden. Zuerst Merv durch einen Herzinfarkt, dann Patty vor wenigen Monaten durch eine Krebserkrankung, von der ich noch nicht einmal etwas gewusst hatte. Die Bäckerei musste schließen, und obwohl sie gehofft hatten, ich würde das Geschäft übernehmen können, fehlte mir das Geld, um es über Wasser zu halten.
Und ich war unvorsichtig. Ging zu Banken, um Kredite zu beantragen. Unter meinem echten Namen.
Dumm.
Aus meiner Reisetasche hole ich den Brief, der vor drei Tagen unter meinem Scheibenwischer geklemmt hat. Ein Zeitungsausschnitt liegt dabei, der jetzt herausfällt und flatternd auf dem Tisch landet. Er enthält das Foto von mir neben der Grinsekatze, mit einem roten Marker ist eine Zielscheibe aufgemalt, deren Mittelpunkt auf meine Stirn gerichtet ist, und darüber stehen in Großbuchstaben die Worte: HAB DICH GEFUNDEN.
Der Zettel ist nicht unterschrieben, aber das ist auch nicht nötig. Ich weiß, von wem er stammt.
Annabel’s Diner, HARRISTOWN. SONNTAGMITTAG. BRING DAS GELD MIT. ALLES! KEINE COPS ODER DER JUNGE STIRBT.
Mit zitternden Fingern falte ich den Zettel zusammen und stecke ihn zurück in meine Tasche, neben die Plastiktüte mit Geldscheinen – den Ersparnissen meines Lebens, dem Geld von den Krediten und von all den Dingen, die ich hatte verpfänden können. Es ist nicht einmal annähernd die Summe, die ich ihm schuldig bin, aber ich bete, dass es mir ein wenig Zeit verschaffen wird, um den Rest zusammenzubekommen. Ich habe nur keinen Schimmer, wie ich das anstellen soll.
Wann immer die Türglocke klingelt zum Zeichen, dass jemand kommt oder geht, beschleunigt sich mein Herzschlag.
Seit ich das Restaurant betreten habe, lastet etwas Schweres auf mir, als würde sich ein Gewicht gegen meinen Hinterkopf pressen. Es ist das Gefühl, beobachtet zu werden. Aber andererseits ist Paranoia zu meinem stetigen Begleiter geworden, seit ich Farkas’ Zettel gefunden habe.
Ich lasse den Blick durch den Raum wandern und treffe auf ein Paar dunkle Augen mit intensivem Blick, die mich aus dem Schatten einer weiter entfernten Nische beobachten. Der Mann ist groß und massig, und tätowierte Bizepse dehnen den Stoff seines engen, schwarzen T-Shirts. Er fährt sich mit einer riesigen Hand über seinen dichten Bart, dann zieht er seine Kappe über sein Gesicht, eine Bewegung, der ich mir nur allzu bewusst bin, da sie zu meiner eigenen typischen Handbewegung geworden ist. Und ich weiß, dass der Mann nicht gesehen werden will.
Ist er einer von Farkas’ Männern?
Er hat etwas Vertrautes an sich, etwas …
Ich schnappe nach Luft und zucke auf meinem Stuhl zusammen, als sich ein großer, schlaksiger Fremder in die Nische gleiten lässt, mir gegenüber Platz nimmt und einen Rucksack neben sich auf die Bank wirft.
Er schnappt mir die Kaffeetasse aus der Hand und leert sie, bevor er sie wieder zurück auf den Tisch stellt, dann fährt er sich mit einer Hand durch sein kurz geschorenes, blondes Haar.
»Haben Sie das Geld?«, fragt er, und seine Stimme zittert fast so heftig wie seine Finger, mit denen er nervös auf den Tisch trommelt. Sein Blick irrt durch den Raum, er stellt den Kragen seines Poloshirts auf und lockert den obersten Knopf. Sein Adamsapfel hüpft auf und ab, und er sieht fast so verängstigt aus, wie ich mich fühle.
»Wer sind Sie?« Das hier kann keiner von Farkas’ Leuten sein. Er sieht aus wie ein Verbindungsstudent bei einem Vorstellungsgespräch.
»Spielt keine Rolle, wer ich bin.« Er stützt sich mit den Unterarmen auf den Tisch und beugt sich vor. »Haben Sie das Geld oder nicht?«
So hatte ich mir den Ablauf der Dinge nicht vorgestellt. Aber andererseits hat mein Stiefvater niemals irgendetwas auf die konventionelle Weise getan. »Ich will mit Farkas reden. Woher weiß ich –«
»Sprechen Sie leiser.« Er lehnt sich zurück und greift nach etwas hinter sich. Die Bewegung veranlasst mich, die Hand nach meiner eigenen Waffe auszustrecken, aber als sich meine Finger um den Griff schließen, halte ich inne, denn er klatscht einige Polaroidfotos vor mich hin. »Man hat mir gesagt, ich soll das Geld abholen und Ihnen die hier zeigen. Mehr weiß ich nicht.«
Mir stockt der Atem, als ich sehe, was die Fotos zeigen. Oder vielmehr, wen sie zeigen.
Mein Herz.
Mein Leben.
Bekleidet mit demselben Iron-Man-T-Shirt und den Jeans, die er anhatte, als ich ihn vor drei Tagen vor der Schule abgesetzt habe. Er hat die Knie bis ans Kinn hochgezogen, und seine braunen Augen starren trotzig auf die Person, die die Fotos gemacht hat, wer immer diese Person war.
Mein mutiger Junge. Sitzt auf einer fleckigen Matratze, vor zerrissenen, vergilbten Tapeten, und sein Haar steht ihm in alle Richtungen vom Kopf ab. Ein alter Gameboy und ein Haufen Comic-Hefte liegen neben ihm, und er sieht eher wütend aus als verängstigt. Aber das hindert meine eigene Angst nicht daran, meine Lungen zusammenzukrampfen und alle Luft hinauszupressen.
»Wenn Sie ihm wehtun …«