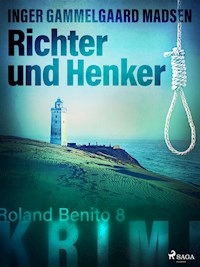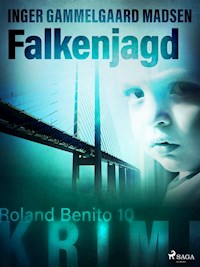Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Roland Benito-Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Kriminalkommissar Roland Benito macht mit seiner Familie Urlaub in Italien, als ihn in einem Café ein unbekannter Däne kontaktiert. Der Mann sucht nach seiner Tochter, die auf einer Tauchreise in Italien verschwunden ist und zuletzt auf dem Weg nach Sizilien gesehen wurde. Obwohl Roland genug damit zu tun hat, seiner eigenen Tochter zu helfen, die ebenfalls in Gefahr ist, wird er in die Sache verwickelt, die ihn mit Begebenheiten konfrontiert, die er bisher erfolgreich verdrängt hatte. Er muss sich nicht nur mit seiner eigenen, sondern auch mit der grausamen Vergangenheit seines ermordeten Vaters auseinandersetzen. Roland spürt das Gift der Schlangen und erfährt fatal, dass die Mafia nie vergisst. Schlangengift ist der siebte Band der Serie um den aus Italien stammenden Kriminalkommissar Roland Benito bei der ostjütländischen Polizei und der Journalistin Anne Larsen.Inger Gammelgaard Madsen arbeitete lange Zeit als Grafikdesignerin in verschiedenen Werbeagenturen. 2008 debütierte sie mit ihrem Kriminalroman Dukkebarnet, der jetzt bei Osburg unter dem Titel "Der Schrei der Kröte" erscheint. Sowohl der erste als auch der zweite Band ihrer Krimireihe um den Ermittler Roland Benito wurden von Kritik und Publikum begeistert aufgenommen. 2010 gründete Madsen ihren eigenen Verlag Farfalla und seit 2014 konzentriert sie sich ganz auf das Schreiben. Die Robert Benito-Reihe umfasst inzwischen acht Bände, im Februar 2016 erscheint der neunte. Inger Madsen lebt in Aarhus.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 470
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inger Gammelgaard Madsen
Schlangengift
Kriminalroman
Aus dem Dänischen vonKirsten Krause
SAGA Egmont
Schlangengift
Aus dem Dänischen von Kirsten Krause nach
Slangernes gift
Copyright © 2014, 2017 Inger Gammelgaard Madsen Lindhardt og Ringhof Forlag A/S
All rights reserved
ISBN: 9788711731437
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt og Ringhof gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Für Mama & Papa
1
Sizilien, Catania
Der Schweiß rann aus Albertos Poren, die bei dieser feuchten Hitze geweitet waren. Mehrmals fuhr er mit den Fingerspitzen leicht über die Stirn und wischte sie an der Hose ab. Sie rochen nach Fisch.
Er war am Hafen von zwei Beamten abgeholt worden, als er gerade dabei war, das Netz klar zu machen, und war unter Protest und mit den Armen rudernd zum Polizeirevier in der Piazza Santa Nicolella mitgegangen. Es gab ein schabendes Geräusch, als ihm der Chef des Einsatzkommandos, der sich Franco Pazienza nannte, ihm über die dunkel patinierte Eichenholztischplatte einen Aschenbecher zuschob. Trotz des Rauchverbots, das aber keiner ernst nahm.
„Ich weiß nichts davon, dass mit meinem Kutter etwas passiert sein soll. Mein Vetter hat sich den ausgeliehen“, antwortete er, nahm einen letzten Zug von dem Zigarettenstummel und drückte ihn mit zitternden, nikotingelben Fingern aus.
„Giuro!“, fügte er überzeugend hinzu und sah dem großen, finster aussehenden Mann, der ihm auf der anderen Seite des Tisches gegenübersaß, fest in die Augen. Aber sein Schwören schien Franco Pazienza nicht zu überzeugen. Sein Nachname passte gut zu ihm; er wirkte wie ein geduldiger Mann, schaute Alberto jedoch weiterhin mit zusammengekniffenen dunklen Brauen über einer schmalen, geraden Nase an. Vielleicht verstand Pazienza seinen Sicilianu-Dialekt nicht. Er selbst schien aus dem Norden zu kommen und hielt ihn sicher für Dreck. Einen einfachen, armen Fischer. Niemand, der es wert war, dass man ihm Glauben schenkte.
„Sie können meine Frau fragen – und meine Söhne, die können das bestätigen“, fuhr er fort. Versuchte, so hochitalienisch wie möglich zu sprechen. Plötzlich stand Franco Pazienza auf und verließ wortlos den Raum. Alberto schwitzte nun noch mehr und starrte hinaus in Richtung der Piazza, aber er sah nur das Gitter vor dem Fenster. Obwohl es kunstvoll in barocker Manier gestaltet war, gab es ihm immer noch das Gefühl, im Gefängnis zu sitzen. Eingesperrt zu sein. Er knibbelte an einem Stück eingerissener Nagelhaut und atmete tief durch die Nase ein. Die Hände hatten aufgehört zu zittern. Von der harten Arbeit mit den Netzen waren sie trocken, spröde und rissig. Sie mussten ihm glauben. Sie mussten es einfach, sonst war er erledigt. So oder so. Vielleicht war er das ohnehin bereits.
Kurz darauf kam Pazienza zurück und setzte sich wieder. Sein Gesicht war immer noch ernst und er strahlte eine fast militärische Haltung aus, die Alberto einschüchterte.
„Ich muss Sie verhaften, Alberto Campelli. Sie wissen wohl, dass Silberfinger abgesprungen ist? Er arbeitet mit den Behörden zusammen.“
„Silberfinger?“, wiederholte er verständnislos und schluckte, obwohl sein Mund so trocken war wie nach einem Tag auf dem Meer ohne Flüssigkeit.
„Nicco Morelli – alias Silberfinger.“
„Ich kenne keinen Nicco Morelli – oder Silberfinger.“
„Er kennt Sie aber. Er hat uns von Ihrem Kutter erzählt.“
„Meinem Kutter! Was gibt es über meinen Kutter zu erzählen?“ Er versuchte es mit einem Lächeln, das kläglich misslang.
„Sagen Sie’s mir. Wofür benutzt ihr den? Schmuggel? Waffen? Drogen?“
Alberto lehnte sich auf dem Stuhl zurück. Der Schweiß troff seinen Rücken hinunter.
„Sie müssen mich mit jemandem verwechseln. Ich fische von meinem Kutter aus. Mein Vetter hat ihn nur gerade ausgeliehen.“
„Und wo ist Ihr Vetter dann?“
„Keine Ahnung. Er darf ihn sich leihen, so lange er will.“
„Und wofür benutzt er ihn?“
„Sardinen, glaube ich …“
„Sardinen?“ Ein Lächeln huschte über Franco Pazienzas versteinertes Gesicht, um gleich wieder zu verschwinden.
„Und wie kommen Sie so lange ohne Ihren Kutter aus? Ohne zu fischen und Geld zu verdienen?“
Alberto zuckte die Schultern.
„Ich komm’ zurecht.“
Franco Pazienza schwieg lange. Er stapelte einige Unterlagen und schaute auf die Uhr, die hinter Alberto an der weiß getünchten Wand hing. Er wusste, sie hatten nicht genug, um ihn dazubehalten.
„Sie wollen uns also nichts erzählen?“
„Es gibt nichts zu erzählen.“
Pazienza öffnete eine Schublade und holte einen Notizblock heraus. Er blätterte vor zu einer freien Seite, legte den Block vor Alberto hin und reichte ihm einen Stift.
„Jetzt schreiben Sie den Namen und die Adresse Ihres Vetters auf.“
Widerwillig nahm Alberto den Stift entgegen und schrieb. Jetzt zitterten seine Hände wieder, als ob er fror.
Franco Pazienza nahm ihm danach das Papier ab und sah sich den Namen und die Adresse an. Zufrieden nickte er.
„Falls Sie Recht haben und nichts über den Verbleib Ihres Kutters wissen, haben Sie nichts zu befürchten“, sagte er.
Alberto schüttelte den Kopf.
„Tu ich nicht. Und ich kenne keinen Morelli. Ich weiß natürlich, wer er ist, und von Mafiosi halte ich mich so fern wie möglich.“
„Das hoffe ich für Sie, denn jetzt wissen sicher alle, dass Nicco Morelli redet. Selbstverständlich passen wir gut auf ihn auf, aber was ist mit Ihnen? Was ist mit Ihrer Familie?“
Alberto schluckte wieder. Dieses Mal sichtlich.
„Wir haben nichts zu befürchten. Wir sind in nichts verwickelt.“
„Okay.“
Pazienza stand auf und reichte ihm zum Abschied die Hand.
„Dann wünsche ich einen guten Abend. Wir fahren Sie selbstverständlich nach Hause.“
Alberto drückte die Hand, die, im Vergleich zu seiner eigenen verschwitzten, trocken und warm war.
„S…Sie müssen mich nicht nach Hause fahren. Es ist nicht so weit …“
Pazienza nickte.
„Okay, das entscheiden Sie natürlich selbst.“
Nun lächelte er freundlich und geleitete Alberto hinaus. Glücklicherweise war niemand im Vorzimmer. Draußen legte sich eine weiche, rosige Dämmerung über die Stadt. Essensdüfte wogten ihm aus der Trattoria Romantica entgegen, als er zügig um die Ecke in die Via Collegiata bog. Er spürte den Hunger und die Lust auf Wein, wie der in den Gläsern, die auf den Tischen standen. Es saßen viele Menschen draußen, lachten und redeten auf Italienisch und in Fremdsprachen, die er nicht verstand. Die Touristensaison war hier Anfang September noch nicht vorbei. Das sah man auch deutlich auf der Via Etnea, der belebtesten Straße Catanias – Tag und Nacht; die Gegend hatte Hunderte von Restaurants, Pubs, Bars und Pizzerien, die Touristen und Einheimische gleichermaßen anlockten. Zum Glück war es nicht weit bis nach Hause, in diesem Punkt hatte er nicht gelogen, aber natürlich wusste die Polizei jetzt, wo er wohnte. Alberto machte, dass er weiterkam. In der Via Vittorio Emanuele II entlang der Mauer des Archivio Di Stato wurde es etwas ruhiger. An die Fassade waren Graffiti gesprüht. Er beschleunigte das Tempo. Schweiß rann seinen Hals und Nacken hinab. In der Via Porticello atmete er erleichtert auf, als die Bahnüberführung, die Stadt und Hafen teilte, in Sicht kam. Er überquerte die Straße und folgte der Via Cardinale Dusmet. Hielt sich die ganze Zeit im Schatten. Das Gefühl, dass ihm jemand folgte, kribbelte im Rückgrat. War es die Polizei? Hatte Franco Pazienza jemanden auf ihn gehetzt? Er schlüpfte in eine der Wölbungen des Viadukts, die zum Parken und als Garagen genutzt wurden. Ein gelbes Auto und ein pastellgrüner Motorroller hielten dort. Er lehnte sich im Schatten an die kühle Mauer und brauchte mehr als alles andere eine Zigarette. Seine Hände hatten nicht aufgehört zu zittern. Er zitterte am ganzen Körper, aber es gelang ihm, die Schachtel aus der Tasche zu holen, eine herauszuklopfen und anzuzünden. Die filterlosen Alfa-Zigaretten, die er in Massen gehamstert hatte, als das staatliche italienische Tabakmonopol 2000 beschlossen hatte, die Produktion einzustellen, schmeckte besser als die, die er von Pazienza verehrt bekommen hatte. Er inhalierte und beobachtete mit zusammengekniffenen Augen das Gebäude auf der anderen Seite der Straße. Er wollte sichergehen, dass ihn niemand beschattete. Lorenzo und sein Sohn, die von ihrem dreirädrigen Vespacar aus in dem Gewölbe nebenan immer frisches Gemüse verkauften, waren für heute heimgefahren. Busse, Autos und Roller dröhnten vor seinen Augen vorbei und der Zug brachte das Viadukt zum Beben, als er auf dem Weg zum Bahnhof direkt über seinen Kopf rumpelte und quietschte. Aber er hörte es kaum, es war ein Teil des alltäglichen Rhythmus, eines der Geräusche, die das Gehirn zu ignorieren gewöhnt war. Ansonsten hätte er hier nicht wohnen können – denn dort, direkt über der roten Markise des Pferdefleisch-Händlers, war seine Wohnung. Der bekannte süße Duft gegrillten Pferdefleischs – einer Spezialität bei Ricardo – ließ ihn sich heimisch fühlen. Die Gardine aus leichter Spitze, die Maria für die Küche genäht hatte, war aus dem offenen Fenster geweht, hing am Balkongeländer und flatterte wie eine weiße Fahne – wie ein Zeichen der Kapitulation. Aber er ergab sich nicht. Niemals! Er warf die Zigarette weg und trat sie mit der Schuhsohle aus. Zerquetschte sie mehr als nötig auf den ölbefleckten dunklen Steinen. Er wusste nicht, ob es alte Lavasteine vom Ätna waren, wie einige behaupteten. Er richtete sich auf und erstarrte, als seine Arme plötzlich mit einem festen Griff hinter seinem Rücken fixiert wurden und eine kalte Messerklinge seine Kehle berührte.
„Ciao, Alberto“, zischte eine Stimme schlangenhaft in sein Ohr. Selbst bei dem Verkehrslärm erkannte er sie sofort und schaute ein letztes Mal zu dem Gebäude hoch, wo Maria gerade die Gardine hereinzog und das Fenster schloss.
2
Italien, Neapel
Während Roland Benito unter dem Sonnenschirm vor dem Café La Nuit saß und auf seinen Espresso wartete, betrachtete er den Vesuv, der am diesigen Horizont an zwei geschwollene Brüste erinnerte oder an den Oberteil eines Cowboyhuts – je nach Phantasie und ob man Vulkane als feminin oder maskulin sah. Er bevorzugte Ersteres.
Sein Blick glitt weiter die Strandpromenade entlang, er suchte nach ihr in der Menge sommerlich gekleideter Italiener und Touristen, die die Brise vom Golf Neapels genossen. Der Kellner kam mit dem Kaffee und einem Stück der bekannten dolci regionali des Cafés. Er vertiefte sich einen Augenblick in den Anblick und den Duft und hielt wieder nach ihr Ausschau. Vielleicht hatten die Zwillinge ihre Anwesenheit erfordert und und sie hatte ihren alten Vater versetzt. Er schaute auf die Uhr. Aber sie war diejenige gewesen, die ihn um ein Treffen hier gebeten hatte. Natürlich wusste sie, dass er die Kuchen liebte, die er für die besten in ganz Neapel hielt. Sie wollte mit ihm über etwas sprechen, hatte sie gesagt und ihn mit diesen ernsten, braunen Augen angesehen, denen er nie widerstehen konnte. Es hatte auch ein Ausdruck in ihnen gelegen, der all seine väterliche Fürsorge und Besorgnis hervorrief, ohne dass er präzise sagen konnte, was es war.
Sie kam aus der Seitenstraße Via Palepoli, deswegen sah er sie nicht, bis sie den Stuhl zurückzog und sich an den Tisch setzte.
„Hallo, Papa. Ich konnte keinen Parkplatz finden – hier ist es fast schlimmer als in Rom!“ Sie lächelte, aber er konnte ihre Augen nicht sehen hinter der dunklen Sonnenbrille, die aussah wie die eines Rennradfahrers.
„Ich dachte, die Zwillinge hätten dich aufgehalten.“
Sie schob die Brille in die Haare und schaute auf seinen Kuchen.
„Nein, auf die passt Mama auf. Wie schön zu sehen, dass es ihr so gut geht, wie gut, dass ihr …“
„Möchtest du ein Stück Kuchen? Und einen Espresso?“
Olivia schwieg und sah auf ihre Armbanduhr; eine Gucci aus Gold, die perfekt zu ihrer sonnengebräunten Haut passte. Sicher ein Geschenk ihres Ehemannes und wohl nicht billig.
„Lieber einen Cappuccino – und ein Stück Kuchen.“
Roland versuchte ihren Blick aufzufangen, aber sie schaute nach dem Kellner, der sich athletisch zwischen den Tischen bewegte.
„Bin gleich wieder da“, sagte er, stand auf und ging hinein, um an der Bar zu bestellen. Das ging schneller, als draußen auf die Bedienung zu warten.
Als er zurückkam, saß Olivia zurückgelehnt auf dem Stuhl, den Blick gedankenvoll auf das Meer und die Schiffe gerichtet, die an der Mole ein- und ausliefen. Sie zuckte ein wenig zusammen, als er die Tasse und den Kuchen vor ihr auf dem Tisch abstellte.
„Danke, Papa.“
„Gerne. Den Kuchen kann ich sehr empfehlen.“
Er spülte seinen Espresso in einem Zug herunter, er war kalt geworden. Schweigend aßen sie ihren Kuchen und schauten auf das Wasser. Er wartete darauf, dass Olivia von sich aus zu reden anfing, damit sie sich nicht dazu gedrängt fühlte. Er war mit ihr immer vorsichtiger umgegangen als mit Rikke. Sie waren zwei sehr unterschiedliche Menschen, obwohl sie Schwestern waren. Olivia konnte man sehr leicht verletzen, und in der Regel wusste er nie, wodurch er sie verletzt hatte. Aber es war zu oft passiert. Selbstverständlich hatte es ihre Beziehung nicht verbessert, dass er seinen Schwiegersohn nicht akzeptieren konnte und keinen Hehl daraus machte. Aber er hatte das Gefühl, dass es bei dem, was Olivia ihm erzählen wollte, um Giuseppe ging. Er betrachtete sie, während sie aß. Alle sagten, sie sei ihm ähnlich, und sie konnte ihre italienischen Gene auch nicht verleugnen. Er hätte stolz und froh sein sollen, als sie einen Praktikumsplatz und danach einen Job in der dänischen Botschaft in Rom bekommen hatte und in sein Heimatland ziehen wollte, aber sie war damals viel zu jung gewesen. Irene hatte sie unterstützt und er versuchte, nicht an diese Zeit in seinem Leben zu denken. Er war wütend gewesen und hatte sich verraten gefühlt, konnte aber nichts machen. Olivia war achtzehn und tat, was sie wollte. Auch in diesem Punkt war sie ihrem Vater ähnlich, hatte Irene gesagt. Dann hatte sie Giuseppe getroffen, der Anwalt war. Eine gute Partie, meinte Irene, aber Roland mochte ihn nicht. Ein ganzes Stück älter als Olivia – das war, wie es war, aber als er einen Fall als Verteidiger eines großen Geschäftsmannes in Rom gewann, der wegen Korruption angeklagt war und sich als Mafioso entpuppte, hatte Roland verlangt, dass Olivia sofort zurück nach Dänemark ziehen sollte. Stattdessen hatte sie den Kerl geheiratet und nun hatten sie Zwillinge zusammen.
„Woran denkst du, Papa?“
Jetzt musterte sie ihn, während er in den Kuchen und seine Gedanken vertieft war.
„Ach, nichts Besonderes. Bloß das Leben.“
„Nichts Besonderes. Das Leben?“ Sie lächelte leicht.
„So meinte ich das nicht. Wie läuft’s denn in deinem Leben, Olivia? Wieso wolltest du dich mit mir hier treffen?“
„Wieso? Du bist mein Vater, du wohnst in Dänemark und ich in Rom, wir sehen uns nicht gerade oft und machen gerade hier Urlaub, ist das nicht Grund genug?“ Sie trank aus der großen Tasse und hatte danach Milchschaum an der Oberlippe.
„Doch, natürlich. Aber du …“
„Mama geht es gut, das sehe ich, aber was ist mit dir? Wie läuft es mit deinem Fall?“, unterbrach sie ihn.
Roland wandte den Blick von seiner Tochter ab und ließ ihn wieder über das Meer mit dem diesigen Vulkankegel gleiten. Er musste zugeben, dass er diesen Urlaub mehr als nötig hatte. Irgendwie hatte er das Gefühl, seinem unsteten dänischen Alltag entflohen zu sein. Obwohl man ihn in Wirklichkeit abgeschrieben hatte. Suspendiert.
„Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es noch nicht, Olivia“, antwortete er.
„Glaubst du wirklich, du wirst entlassen?“
Er zuckte die Schultern, aber nicht gleichgültig, beinahe hilflos.
„Ja, aber du hast doch nichts falsch gemacht, Papa. Okay, du hast vielleicht nicht wie ein Polizist gehandelt, aber wie ein Mensch. Das ist doch viel mehr wert! Guck dir nur Mama an, die …“
„Doch, mein Schatz. Ich habe etwas falsch gemacht. Sehr falsch, und wenn das für die Gerichte ein Präzedenzfall wird, ja, dann muss ich mich von meinem Job verabschieden.“
„Das ist so unfair!“, fand Olivia und legte eine Hand sanft auf seinen Arm. „Mama ist viel glücklicher, sie ist nicht mehr so abhängig von dem Rollstuhl. Ihr könnt jetzt bei Zia Giovanna wohnen, obwohl es da viele Treppen gibt, weil Mama am Geländer hochlaufen kann.“
Roland nickte bloß und entfernte mit einem leichten Streichen seines Daumens den Milchschaum von Olivias Oberlippe. Sie wischte sofort mit der Serviette nach.
„Ist er weg?“
„Ja, ist weg. Du hast Recht, Mama geht es viel besser, aber trotzdem war das, was wir getan haben, illegal, besonders ich als Gesetzeshüter. Aber lass uns jetzt nicht mehr darüber reden. Magst du noch Kuchen haben?“
Olivia schüttelte den Kopf und warf einen betrübten Blick auf eine Frau, die mit zwei kleinen Kindern vorbeiging, an jeder Hand eins, ein Junge und ein Mädchen. Er folgte ihrem Blick.
„Läuft es gut mit den Zwillingen?“, fragte er und hoffte, dass sie bald mit der Sprache herausrücken würde. Er war sich sicher, dass sie ihn nicht wegen eines gemütlichen familiären Beisammenseins um ein Treffen gebeten hatte.
„Ja, es läuft gut. Sehen sie etwa nicht aus, als ginge es ihnen gut?“
Sie schaute ihn fragend an und er konnte nicht anders als zu lächeln.
„Doch, doch. Man kann sicher lange suchen, bis man behütetere Kinder findet.“
„Was meinst du damit?“
„Olivia, ich kann dir ansehen, dass irgendetwas nicht stimmt. Darüber wolltest du mit mir reden, oder?“
Sie drehte den Löffel, der auf der Untertasse lag. Die Sonne reflektierte in seinem blanken Stahl. Lange schwieg sie und sah ihn nicht an.
„Es ist etwas mit Giuseppe …“, sagte sie leise.
Er war kurz davor auszurufen ‚Ich wusste es!‘, ließ es aber, da es alles zerstören würde.
„Ich weiß, was du denkst, Papa, und es ist nicht, wie du glaubst. Giuseppe hat nur gerade einen Fall, der ihm sehr nahe geht … er will mir nichts darüber erzählen, aber ich habe das Gefühl, er wird bedroht.“
„Bedroht? Inwiefern? Sein Leben?“
Olivia nickte, schüttelte dann aber sofort den Kopf.
„Nein, ich weiß es nicht. Ich habe bloß gehört, wie er eines Abends telefoniert hat, als ich ihm eine Tasse Kaffee ins Arbeitszimmer bringen wollte. Er arbeitet so viel und oft spät. Ich habe gehört, wie er sagte, er lasse sich nicht einschüchtern und der andere solle mit seinen Drohungen aufhören … dann hat er mich in der Tür bemerkt und sofort aufgelegt. Aber ich konnte in seinen Augen sehen, dass etwas nicht stimmte. Er hatte Angst, Papa, und das erschreckt mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll.“
„Hast du mit ihm darüber gesprochen?“
„Natürlich. Normalerweise haben wir keine Geheimnisse voreinander, aber er sagte bloß, ich solle mir deswegen keine Sorgen machen.“
„Vielleicht hast du es missverstanden. Kann es nicht um irgendetwas anderes gehen?“
„Es ist ja nicht das erste Mal, dass etwas Merkwürdiges vor sich geht. Wir werden auch von einem Auto verfolgt. Einem glänzenden schwarzen Audi, aber Giuseppe versucht so zu tun, als wäre nichts. Ich habe ihn gefragt, ob er weiß, wer das ist, aber er sagt, das sei niemand, den er kenne, und es müsse ein Zufall sein.“
„Und du glaubst, das hat etwas mit einem seiner Gerichtsverfahren zu tun?“
Olivia nickte ernst. Eine leichte Meeresbrise ergriff ihre langen, dunklen Haare.
„Weißt du, worum es in diesem Fall geht?“
„Nein, er darf ja nicht viel darüber sagen, daher …“
Roland wagte es nicht, das Wort auszusprechen, das ihm auf der Zunge lag, aber falls es stimmte, dass Giuseppe etwas mit denen zu tun hatte, könnten Olivias Zwillinge in Gefahr sein. Das Misstrauen gegen seinen Schwiegersohn wuchs.
„Aber was soll ich deiner Meinung nach tun, Olivia?“
Sie lehnte sich zurück und klopfte sich resignierend auf die Oberschenkel.
„Ich weiß es nicht, Papa. Vielleicht musste ich einfach mit jemandem darüber reden, vielleicht, weil du Polizist bist und dich mit so was auskennst, und …“ Olivia schwieg und biss sich auf die Unterlippe.
„Und was?“
Sie schüttelte den Kopf, als ob sie sich weigerte, ihm mehr zu erzählen, dann atmete sie tief ein und ihre Stimme klang beinahe weinerlich, als sie fortfuhr.
„Ich habe das Auto hier in Neapel gesehen. Die sind uns aus Rom gefolgt.“
„Bist du sicher, Olivia?“
„Ganz sicher! Ich kann das Kennzeichen auswendig. Es ist dasselbe Auto. Was macht es hier? Wir sind im Urlaub, verdammt noch mal!“
„Olivia …“ Er griff nach ihrer Hand, aber sie zog sie zurück, trank schnell den Rest des Cappuccinos und stand auf.
„Ich bin gleich mit Giuseppe verabredet. Jetzt, da Mama und Zia Giovanna auf Rinaldo und Gabriella aufpassen, haben wir verabredet, uns ein bisschen die Stadt anzugucken und ein gemütliches Lokal zum Abendessen zu finden. Mit zwei kleinen Kindern sind wir selten allein. Danke für den Kaffee und den Kuchen, Papa.“
„Ach, gebe ich einen aus?“ Er lächelte scherzhaft. „Aber, Olivia …“
Sie lächelte auch, aber angestrengt, und er spürte, dass sie wie immer vor ihm flüchtete, wenn er zu nah drankam. Sie hängte sich den Riemen der Tasche über die Schulter.
„Du darfst Giuseppe nicht sagen, dass ich mit dir über das hier gesprochen habe. Ja?“
„Aber er muss …“
„Versprichst du das, Papa?“
„Ja, natürlich, Olivia, aber …“
Sie winkte schnell mit den Fingern; dann war sie weg. Roland blieb mit einer wachsenden inneren Unruhe zurück, die ihn einen Whiskey beim Kellner bestellen ließ, der gerade vorbeikam und Olivias leere Tasse und ihren Teller abräumte. Er hatte gerade ein Glas Jack Daniels serviert bekommen, als sich ein sonnengebräunter älterer Herr mit schneeweißem, getrimmtem Vollbart und ebenso weißen gut frisierten Haaren, die von einer Sonnenbrille zurückgehalten wurden, auf den Stuhl setzte, auf dem Olivia gesessen hatte. Der Mann trug ein kurzärmliges marineblaues Poloshirt und weiße Bermudashorts, die wie die aussahen, die Roland anhatte.
„Entschuldigung, ich konnte nicht umhin zu hören, dass Sie dänisch gesprochen haben“, sagte er.
Roland nahm sofort eine distanzierte Körperhaltung ein. Er mochte Touristen nicht, die sich als die besten Freunde ihrer Landsleute fühlten, bloß weil sie in der großen, weiten Welt zufällig am gleichen Urlaubsort gelandet waren.
„Es ist doch in Ordnung, wenn ich mich setze?“
Er brachte es nicht übers Herz, den Mann abzuweisen. Er wirkte harmlos und war nicht betrunken.
„Ich konnte auch nicht umhin zu hören, dass Sie Polizist sind. Aus welcher Stadt kommen Sie?“, fuhr er höflich fort.
Roland überlegte, wie viel der Mann wohl von dem Gespräch mit seiner Tochter gehört hatte. Eigentlich hatten sie nicht besonders laut geredet. Wo hatte er gesessen? Direkt hinter ihnen?
„Aarhus“, antwortete er ein wenig abweisend.
„Aarhus ist eine schöne Stadt“, lächelte der Mann. „Ich wohne auf Seeland. In Rødovre. Aber meine gesamte Familie stammt vom Festland. Nordjütland.“
Roland nickte gleichgültig, richtete seinen Blick wieder auf den Vesuv und versuchte die Unruhe zu dämpfen, die Olivias Geständnis in ihm ausgelöst hatte. Er nippte an dem Whiskey.
„Sie sind wohl im Urlaub? Oder sind Sie ein Einheimischer? Sie sehen nicht dänisch aus.“
Roland zwang seinen Blick hinüber auf den neugierigen Herrn und war kurz davor, ihn zu bitten, sich herauszuhalten und seine Zeit jemand anderem zu widmen, aber etwas in den Augen des Mannes änderte seine Meinung. Trauer erkannte er immer wieder. Sie lag tief in den Augen derer, die einen Verlust erlitten hatten und vermissten. In diesen Augen lag auch noch etwas anderes – ein Flehen um Hilfe.
„Ich bin hier in Neapel geboren. Tatsächlich nicht weit von hier.“
„Darf ich fragen, warum in aller Welt Sie aus dieser exotischen Großstadt nach Aarhus gezogen sind?“
Roland zögerte.
„Das war nicht freiwillig. Meine Mutter ist mit mir nach Dänemark geflohen, sie hatte eine Schwester, die dort wohnte. Ich war damals erst vier …“
„Geflohen, sagen Sie?“
„Mein Vater war Carabiniere. Er wurde ermordet, und …“ Er stoppte sich selbst und der andere nickte, als verstünde er.
„Wohnt Ihre Mutter denn wieder hier in Neapel?“
„Nein, sie ist vor vielen Jahren in Dänemark gestorben. Aber der Großteil meiner Familie wohnt hier.“
Er leerte das Whiskeyglas und hatte Lust, einen weiteren zu bestellen. Seine Gedanken kreisten um das Gespräch mit Olivia. Sein Blick fiel auf ein Polizeiauto, das auf der anderen Straßenseite mit dem Meer und dem Vulkan im Hintergrund parkte. Ein weiteres taubenblaues Auto mit Polizia auf der Seite hielt an der Ecke der Via Palepoli. Man bemerkte sie fast gar nicht in dem Stadtbild, aber sie waren hier überall. Zur Stelle. Wachsam. Dennoch fühlten sich die Neapolitaner nie ganz sicher.
Plötzlich streckte der Mann die Hand über den Tisch.
„Ich heiße Asger Brink. Pensionierter Uhrmacher.“
Roland drückte die Hand, die schlank und sehnig war.
„Rolando Benito“, erwiderte er und wunderte sich darüber, dass er völlig natürlich seinen Geburtsnamen verwendete, mit dem ihn nur Freunde und Familie ansprachen. Vielleicht, weil er in Urlaub war und das Polizeipräsidium in Aarhus, wo ihn alle Roland nannten, so weit weg war. Vielleicht für immer weg.
„Ich entschuldige mich noch mal, wenn ich Sie nerve, Rolando Benito, aber als ich hörte, dass Sie dänischer Polizist sind, hatte ich das Gefühl, es müsste beinahe Schicksal sein, und ich sollte versuchen … vielleicht können Sie mir helfen.“
„Womit?“, fragte Roland weiter beunruhigt.
Asger Brink hielt den Kellner an, der gerade vorbeikam, und bat ebenfalls um einen Whiskey. Roland nickte, als ihn der fragende Blick des Kellners traf. Es waren nur zirka fünfzehn Minuten Fußweg zu Giovannas Wohnung in der Via Monte di Dio, wo sie während ihres Aufenthaltes wohnten, auch wenn es dort eng war. Ihren Antiquitätenladen in der Via Chiaia hatte sie längst geschlossen und war seitdem Rentnerin. Sie habe nichts anderes zu tun, als sie zu bedienen, hatte sie beteuert. Aber bei ihr wohnte auch Opa Pippino. Nonno Pippino, wie sie ihn nannten. Er weigerte sich strikt, bisnonno genannt zu werden, obwohl er schon Uropa war. Er fand, das klang alt. Nach dem plötzlichen Tod seiner Frau vor ein paar Jahren hatte er allein in dem Haus gewohnt, in dem Rolands Vater und Giovanna geboren wurden, in der Via Calastro an den Bahngleisen, circa dreizehn Kilometer südlich von Neapel, in Torre Del Greco. Aber nun hatte es Zwischenfälle gegeben, die zeigten, dass der Großvater nicht mehr allein zurechtkam. Giovanna wollte nicht, dass er in ein Pflegeheim kam. Er selbst bestimmt auch nicht. Aber es musste trotzdem nicht ganz leicht sein, ihn dort wohnen zu haben. Er brauchte eine Menge Pflege, Hilfe auf den Treppen, um in die Bar zu kommen und mit den anderen Alten zu reden, und es gab Phasen, in denen er in einer ganz anderen Zeit lebte und glaubte, dass Il Duce an der Macht wäre.
„Ich bin seit ein paar Tagen hier in Neapel. Ich suche meine Tochter. War das Ihre Tochter, mit der Sie gerade gesprochen haben? Ich konnte eine Ähnlichkeit sehen.“
Roland nickte verständnislos.
„Elisabeth, oder Beth, wie wir sie meistens nennen, ist zum Tauchen hergekommen. Sie ist eine hervorragende Taucherin, aber seitdem sie am Elefantenfelsen bei Ischia war, hat niemand mehr etwas von ihr gesehen oder gehört.“
Die Sorge in den Augen des Mannes flehte ihn um Hilfe an.
„Warum gehen Sie nicht hier in Neapel zur Polizei?“
„Da war ich tatsächlich schon, aber ich kann kein Italienisch, nur ein bisschen Englisch, daher kam dabei nicht besonders viel rum.“
„Haben Sie es in der Botschaft probiert?“
„Auch da. Dort habe ich angerufen. Sie sagen, dass hier in Neapel viele junge Frauen verschwinden, in der Regel aber wieder heimkommen, wenn die Romanze vorbei ist. Aber so ist meine Beth nicht, ich spüre, dass ihr etwas zugestoßen ist.“
„Haben sie das in der Botschaft wirklich gesagt?“
Er nickte.
„War sie ganz allein unterwegs?“
Asger Brink lächelte, aber nur kurz.
„Beth ist sehr selbstständig. Sie macht alles allein, so war sie schon immer – auch als Kind schon. Deswegen hat sie auch nie geheiratet, weil sie nicht an einer Beziehung interessiert ist. Tauchen ist ihre einzige Leidenschaft.“
„Hat hier in Neapel niemand mit ihr gesprochen?“
„Vielleicht, aber wie soll ich die finden?“
„Das Hotel, in dem sie gewohnt hat? Die Tauchbasis?“
„Aus dem Hotel hatte sie gerade ausgecheckt. Aber die Tauchbasis …“
„Wie alt ist Elisabeth?“
„Ach, eigentlich erwachsen.“ Asger lächelte fast verlegen. „Sie ist letzten Monat 35 geworden. Die Reise war ein Geburtstagsgeschenk, an dem ich mich beteiligt hatte. Sie müsste auf sich selbst aufpassen können, aber ich weiß, dass etwas passiert sein muss, weil ich sie nicht auf ihrem Handy erreiche und sie nicht zurückruft. Ich spüre es. Ich habe mehrere Nachrichten hinterlassen. Ihre Mutter ist auch unruhig. Ja, tatsächlich ist sie so krank geworden, dass sie Beruhigungstabletten bekommt und nur noch passiv in einem Sessel sitzt und darauf wartet, dass ich Elisabeth finde. Das ist furchtbar anzusehen, ich musste etwas tun. Sie ist unser einziges Kind und meine Frau war nie sonderlich stark …“
„Wenn sie nicht mehr im Hotel wohnt, muss sie doch irgendwo anders hingegangen sein.“
Der Kellner kam mit ihrem Whiskey und Asger Brink bezahlte.
„Ja, und das ist ja das Merkwürdige. Warum hat sie es mir nicht erzählt, wenn sie weiterreist?“
Roland atmete den Whiskeyduft ein und betrachtete den Tropfen, der das Glas hinunterlief.
„Ich verstehe nicht ganz, was ich Ihrer Meinung nach tun soll“, sagte er und ihm fiel auf, dass er diese Worte zum zweiten Mal innerhalb von ein paar Stunden sagte.
„Vielleicht können Sie auch nicht helfen, aber ich dachte … wenn Sie nun mit der Polizei hier in Neapel sprechen könnten. Ich glaube, ich bin nicht richtig zu denen durchgedrungen. Ein verwirrter alter Tourist, der glaubt, dass seine Tochter verschwunden ist, die sicher bloß unterwegs ist, um sich zu vergnügen …“
Roland antwortete nicht sofort, er probierte den Whiskey und dachte nach.
„Ich verstehe, wenn Sie das Gefühl haben, dafür nicht verantwortlich zu sein, und das sind Sie natürlich auch nicht, aber ich weiß bald nicht mehr, was ich tun soll …“
Asger Brink kramte in seiner Hosentasche und beförderte eine schwarze Brieftasche zutage, die er öffnete. Das Foto, das er herausholte, reichte er Roland.
„Ich habe noch mehr Bilder von Beth. Wollen Sie es nicht versuchen?“
Roland nahm das Foto einer Frau entgegen, die aussah, als wäre sie gerade aus dem Wasser gekommen. Sie trug einen Taucheranzug und hatte etwas natürlich Schönes an sich. Der Körper war schlank und durchtrainiert, die Haare nass und dunkel, die Augen hatten einen festen und entschlossenen Ausdruck, aber auf eine charmante Art. Sie sah aus wie jemand, der problemlos auf sich selbst aufpassen konnte. Roland wollte das Bild zurückgeben, sich entschuldigen und sagen, dass er in Urlaub – und im Übrigen suspendiert – sei, aber als er die Tränen in Asger Brinks ohnehin schon traurigen Augen sah, die ihn an einen Basset erinnerten, rührte sich etwas tief in seinem Inneren. Er wusste, es war der Polizist. Der Teil von ihm, der nie frei hatte, auch wenn er in Urlaub war.
3
Dänemark, Aarhus
Anne Larsen fasste ihre schwarzen Haare mit einem Haargummi zu einem kleinen, abstehenden Pferdeschwanz im Nacken, während sie das frisch gepflügte Feld entlang durch das hohe, verdorrte Gras ging, das nach trockenem Heu roch. Es war lange her, dass sie beim Friseur gewesen war, und sie überlegte immer noch, ob sie ihre Haare wachsen lassen sollte. Ihr Image ändern. Alle sagten, sie sähe wie ein Junge aus. Nicht, dass ihr das etwas ausmachte. Esben bevorzugte Mädchen mit langen Haaren. Auch das änderte nichts. Im Gegenteil. Das gab nur Anlass, sie superkurz zu schneiden. Vielleicht sogar kahl zu rasieren.
Etwas weiter weg, in der Nähe der Bäume, starrte eine kleine Gruppe Menschen auf den Boden. Das Navi hatte gezeigt, dass sie vor dem Fajstrup Krat geparkt hatte, nachdem sie den Lading-See passiert hatte und auf den Viborgweg abgebogen war. Freddy Hauge entdeckte sie und winkte. Wie immer in einem färöischen Strickpulli, egal wie das Wetter war. Er hatte in der Redaktion angerufen. Gerade war nicht viel los und Nicolaj hatte sich ein paar Tage freigenommen, um sie mit seiner Tochter zu verbringen. Sonst hätte er für solche Aufträge ausrücken müssen, die nicht als Kriminalfälle zählten. Freddy zog sie eifrig näher und deutete auf den Boden.
„Guck mal! Ist das nicht ein besonderer Anblick?“, flüsterte er mitgerissen.
Anne nahm die Sonnenbrille ab und starrte auf das Netz feiner Spinnweben, die sich in dem trockenen Gras verteilten, so weit das Auge reichte. Keine prachtvollen, symmetrischen Spinnweben, sondern Unmengen von Seidenfäden, bunt durcheinander, als wäre eine Spinne betrunken und wüsste nicht, was sie tat.
„Siehst du, dass sie dreidimensional sind? Zuerst kommt eine Schicht Netz, dann einige Stützfäden und danach etwas Klebriges, das Insekten einfängt.“ Seine Stimme war voller Ehrfurcht.
„Welche Spinnenart webt solche Netze?“, fragte sie und nahm ihre Kamera aus dem Rucksack.
Er öffnete seine Tasche und holte ein Glas heraus, das er vor ihren Augen hochhielt, sodass sie nicht umhinkam, die Sensation zu sehen.
„Was ist das für eine?“
„Kannst du das nicht sehen?“
„Du bist der Biologe, Freddy!“, entgegnete sie und machte ein paar Nahaufnahmen von den Spinnweben.
„Biologen in den USA haben ihre Netze erforscht und herausgefunden, dass sie verschiedene Fäden produzieren, je nachdem, wie hungrig sie sind. Die hier sind sehr hungrig, deswegen gibt es so viele klebrige Fäden, die wollen …“
„Okay, Freddy. Aber was ist das für eine?“
Er zeigte ihr wieder die kleine, schwarze und glänzende Spinne im Glas.
„Der rote Fleck in Form einer Sanduhr auf dem schwarzen Bauch zeigt deutlich, dass es sich hierbei ganz sicher um eine Latrodectus mactans handelt. Das hier ist eine Sie.“
Anne sah ihn mit einem etwas schiefen, verunsicherten Lächeln an.
„Ich bin immer noch keine Biologin. Hat die auch einen dänischen Namen?“
„Ja, wir nennen sie die Schwarze Witwe.“
Ihr Lächeln verschwand. Unwillkürlich wich sie ein paar Schritte zurück und schaute nach unten auf ihre Füße, die in Sandalen steckten.
„Das hättest du mir doch echt vorher sagen können, dann hätte ich Gummistiefel angezogen.“
„Ja, Sandalen sind wohl nicht das Klügste. Aber die Spinnen sind ja gar nicht so gefährlich …“
„Nicht? Aber ihr sagt ja auch, Wölfe wären nicht gefährlich! Fragt mal ein Reh.“
Freddy überhörte ihre Stichelei.
„Die Latrodectus mactans ist ja nicht sonderlich groß, wie du siehst, daher gibt sie bei jedem Biss nur eine geringe Dosis Gift ab. Wird ein kleines Kind gebissen – oder schwache alte Menschen – ist das selbstverständlich nicht gut. Oder wenn man unter hohem Blutdruck leidet. Sie verteidigen sich, wenn sie bedroht werden. Nur der Biss der weiblichen Spinne ist gefährlich und es gibt ein Gegengift. Dennoch ist diese Spinne diejenige, die weltweit die meisten Menschen tötet.“
Anne machte weitere Bilder von dem Spinnennetz aus großem Abstand und benutzte das Zoomobjektiv. Anschließend versuchte sie, ein Foto von der Spinne im Glas zu knipsen, die hin und her flitzte und herauszukommen versuchte.
„Aber die leben doch nicht hier in Dänemark?“
„Normalerweise nicht, nein, aber es wurden schon aus Versehen giftige Spinnen hier zu uns gebracht. hierhergebracht. In Supermärkte kommen sie zum Beispiel mit exotischen Früchten. Autos aus den USA werden an dänische Kunden geliefert mit der Schwarzen Witwe als blindem Passagier, und es ist auch schon vorgekommen, dass sie sich hierzulande in einer Garage vermehrt haben. Ein Autobesitzer in Schweden wurde sogar gebissen, als er sein neues Auto saubermachen wollte. Aber normalerweise dürfte die Latrodectus mactans in unserem Klima nicht lange überleben.“
„Die scheinen sich aber recht wohlzufühlen mit all den Spinnweben.“
„Ja, das wundert mich auch. Man sollte fast glauben, sie hätten sich an das Klima gewöhnt.“ Vorsichtig legte er das Glas in die Tasche zurück. „Ich nehme die hier mit, dann kann ich das Phänomen näher studieren. Nun war es natürlich auch ein ziemlich heißer und trockener Sommer und der Herbst war ebenfalls warm, daher kommen sie vielleicht noch ein Weilchen gut zurecht.“
„Wie viele, glaubst du, sind das?“ Anne sah sich um. Das Gebiet, über das sich die Spinnweben erstreckten, war groß.
„Schwer zu sagen …“ Freddy kratzte sich den Bart.
„Was sind diese schmalen, ovalen Klumpen? Sind das Eier?“
Er nickte. „So eine Puppe kann 25 bis 900 Eier enthalten – oder mehr.“
„Shit! Sollte man die nicht vernichten?“
„Doch, das wäre wohl das Beste.“
„Woher können die gekommen sein? Aus den USA in einem Auto?“
„Das lässt sich nicht so leicht feststellen. Vielleicht.“
„Ist hier nebenan nicht ein Sägewerk? Können die mit dem Holz nach Dänemark gekommen sein?“
„Weißt du was, Anne? Deswegen habe ich dich kontaktiert. Du bist keine Biologin, nein, aber Journalistin, und ich weiß, wie scharfsinnig du bist. Du sollst herausfinden, wo die hergekommen sind.“
„Ich bin Kriminalreporterin, daher ist das hier nicht gerade mein Gebiet, mein Kollege ist in ein paar Tagen wieder da, dann …“
Freddy sah sie nicht an, nur die Spinnweben, die im Sonnenlicht glitzerten.
„Dann ist es zu spät und vielleicht schon ein Unglück passiert. Stell dir nur mal vor, wenn die in die Häuser gelangen und sich dort weiter vermehren.“
Anne erschauderte bei dem Gedanken. Freddy wusste, wovon er sprach. Sie hatte ihn zum ersten Mal getroffen, als sie gerade als Journalistin beim Tageblatt angefangen hatte. Es hatte sich um eine hitzige Debatte gehandelt, ob man Kriechtiere in Wohnungen halten dürfe, nachdem ein ungefährlicher Gecko in einem Treppenhaus in der Innenstadt entwischt war und Panik ausgelöst hatte. Freddy war im Lokalfernsehen gewesen, um in der Debatte seine Expertenmeinung abzugeben, und Anne hatte ihn anschließend interviewt. Freddy war nicht dagegen, Reptilien in Gefangenschaft zu halten. Anne schaute sich wieder um.
„Wer wohnt in dem Haus da? Sieht ein bisschen verwahrlost aus.“
Freddy schüttelte den Kopf. „Ich weiß es nicht, aber du kannst ja einen der Nachbarn fragen, die müssen das doch wissen.“
Er zeigte in Richtung der Personen, die Anne vom Weg aus hatte sehen können. Sie standen in angemessenem Abstand zu den Spinnweben. Die Gesichter der Frauen waren erstarrt, während die Augen zweier Jungen vor Begeisterung leuchteten. Eine der Frauen, sicher die Mutter, hatte dem einen Jungen die Hand auf die Schulter gelegt, als wollte sie ihn daran hindern, hinzulaufen und in die Seidenfäden zu trampeln.
Anne ging zu ihnen hin.
„Seltsamer Anblick, nicht?“
Sie nickten schweigend. Anne schätzte, dass sie von den umliegenden Höfen kamen. Sie sahen wie Landwirte aus. Die Kleidung des Mannes roch nach Kuh, die Stiefel waren voller Mist.
„Ja, die Jungs haben diese merkwürdigen Spinnweben gefunden und sind heimgerannt, um mir davon zu erzählen. Zum Glück haben sie sie nicht angefasst“, meinte eine der Frauen.
„Sie wissen also, was das ist?“
„Ja, das hat dieser Biologe erzählt, den sie geschickt haben“, sagte der Mann und machte Anstalten, die Stelle verlassen zu wollen.
„Wer hat ihn geschickt?“
„Ich habe beim Naturgeschichtlichen Museum angerufen. Die soll man doch kontaktieren, wenn man Wölfe sieht, daher dachte ich …“, antwortete die Frau.
„Haben Sie nicht mit der Polizei gesprochen?“
„Nein, was sollten die tun? Die kommen ja nicht mal, wenn bei uns eingebrochen wird“, entgegnete der Mann trocken und ging davon. Die Frau und einer der Jungen folgten ihm.
„Wer wohnt in dem Haus da drüben?“, fragte Anne die Frau, die zusammen mit dem anderen Jungen zurückgeblieben war. Sie schaute hinüber, man erahnte gerade so den Giebel über den Bäumen, dann schüttelte sie missbilligend den Kopf.
„Komischer Typ! Ich habe ihn nur ein Mal gesehen, als er zu uns gekommen ist, um Eier zu kaufen. Mein Mann hat sie ihm herausgesucht. Er sah genauso verwahrlost aus wie das Haus. Frührentner, habe ich gehört.“
„Ein alter Mann?“
„Nein, er sah ziemlich jung aus. Manchmal kriegt er Besuch von ein paar ebenso seltsamen Typen wie er selbst. Lange Haare. Ungepflegt. Manche sagen, die gehören zu einer Sekte, aber es ist nicht sicher, ob das stimmt.“
Anne lächelte. Sie wusste genau, dass in diesen kleinen Dörfern schnell etwas zusammenfabuliert wurde.
„Das ist also niemand, mit dem Sie sonst Kontakt haben?“
„Nein, und er ist auch nur das eine Mal gekommen, um Eier zu kaufen. Aber das war schon seltsam, sagte mein Mann …“
„War das der, der nur warme Eier haben wollte?“, unterbrach der Junge, der ihrem Gespräch neugierig mit offenem Mund gefolgt war.
„Ja, der war sehr schwierig. Die Eier durften nicht zu groß sein und hätten am besten noch direkt aus dem Huhn gezogen werden sollen, um frisch genug zu sein. Er hat fünf frisch gelegte bekommen, die er in eine Thermoskanne gelegt hat, damit er sie warmhalten konnte, bis er zu Hause war. So weit ist das doch auch nicht.“ Verständnislos schüttelte sie den Kopf.
„Er mag wohl einfach frische Eier“, schlug Anne vor.
„Vielleicht. Aber er ist nie wiedergekommen, also waren die sicher trotzdem nicht frisch genug.“ Die Frau nahm den Jungen an der Hand und zog ihn mit sich. Anne rief ihnen ein Danke nach und schaute wieder auf das Haus.
„Hast du etwas herausgefunden?“, fragte Freddy, der einige Proben der Spinnweben eingesammelt hatte und dabei war, zusammenzupacken.
„Nicht besonders viel, aber irgendjemand muss ja diesen Typen warnen, dass giftige Spinnen in seinem Garten sind.“
„Was ist mit dem Sägewerk?“
„Mit denen spreche ich auch gleich. Wenn die Tierchen mit ihrem Holz hergekommen sind, muss etwas getan werden. Sollte die Polizei nicht Bescheid wissen?“ Es überraschte sie selbst, dass sie so darauf aus war, sie zu informieren. Der Bauer hatte sicher Recht damit, dass sie keine Zeit hatten, sich um so etwas wie Spinnen zu kümmern, aber mit der Schwarzen Witwe war trotz allem nicht zu spaßen.
„Doch, aber lass uns erst ein bisschen mehr herausfinden, bevor wir sie hinzuziehen, ja?“
„Okay.“ Anne nickte widerwillig. Sie hatte das Gefühl, dass Freddy hauptsächlich an die Spinnen dachte. Für einen Biologen war es eine große Sache, dass Schwarze Witwen nach Dänemark gekommen waren. Vielleicht eine noch größere, als dass der Wolf in die dänische Natur zurückgekehrt war. Sobald die Polizei Bescheid bekäme, wäre sicher das Erste, was sie tun würde, dafür zu sorgen, diese lebensgefährlichen unwillkommenen Spinnentiere auszurotten. Sie verabschiedete sich von ihm und versprach, sich zu melden, wenn sie mehr herausgefunden hatte.
Im Sägewerk brachen die meisten gerade in den Feierabend auf.
Anne hielt einen Mann an, der im Begriff war, sich in sein Auto zu setzen. „Der Direktor ist nach Hause gefahren“, teilte er kurz mit, als sie darum bat, mit dem Verantwortlichen sprechen zu dürfen.
„Kann ich weiterhelfen?“, fragte er leicht und freundlich, als ob er das oft sagte. Sie schätzte, er war Verkäufer.
„Bekommen Sie Holz aus dem Ausland? Aus Südamerika oder Australien zum Beispiel?“
Der Mann warf seine Jacke auf den Rücksitz und lächelte beinahe erleichtert über diese einfache Frage.
„Nein, damit kann ich Ihnen leider nicht dienen. Wir verarbeiten nur Nadelholz. Dänisches Holz.“
„Okay, und an wen verkaufen Sie?“
„Holzhändler und Baumärkte. Die Holzindustrie. Aber sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich?“
„Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Anne Larsen. Ich bin Journalistin. In der Nähe des Sägewerks wurden giftige Spinnen gefunden, daher dachte ich, Sie könnten vielleicht verantwortlich sein.“
Einen Augenblick lang sah der Mann beleidigt aus, dann runzelte er besorgt die Stirn.
„Was für Spinnen?“
„Leider die Schwarze Witwe.“
Die Art, wie er offensichtlich schauderte, brachte sie auf den Gedanken, dass er wohl unter Arachnophobie litt.
„Die können unmöglich von hier kommen. Sind die in unserem Holz?“ Er warf einen erschrockenen Blick auf die Holzstapel, die den Großteil der Umgebung füllten.
„Ich weiß nicht, ob die auch hier sind, aber direkt hinter dem Sägewerk sind massenweise Spinnen. Ein Biologe ist sich ganz sicher, dass es die Schwarze Witwe ist.“
Er schluckte sichtlich, setzte sich hinters Steuer und zog die Füße heran, ohne die Autotür zu schließen.
„Ich muss meine Kinder aus dem Kindergarten abholen, daher kann ich nicht wirklich …“ Er sah auf seine Uhr und war blass geworden. „Ich kontaktiere unseren Direktor, sobald ich die Möglichkeit habe.“ Er fummelte mit den Schlüsseln und schaute zu ihr hoch. „Kommt das in die Zeitung? Das wäre für unser Unternehmen nicht sehr förderlich, wenn …“
„Ja, kommt es. Aber vorläufig wissen wir nicht, ob das Sägewerk ebenfalls betroffen ist, daher kann ich Sie auch raushalten.“
Der Mann nickte, lächelte kurz und steif, drehte den Autoschlüssel und knallte die Tür zu. Anne schaute dem Wagen nach, der auf den Viborgweg bog. Ihr eigenes Auto hielt in der Nähe und sie entschied, zu dem Haus des seltsamen, jungen Mannes mit einem Hang zu warmen, frisch gelegten Hühnereiern zu fahren. Sie hatte bemerkt, dass es einen schmalen Feldweg dorthin gab.
Vor dem Haus stank es widerlich aus einem dreckigen, grünen Mülleimer, der lange nicht geleert worden war. Ein weiteres Mal bereute sie die Sandalen und beschloss, künftig immer Gummistiefel im Auto zu haben. Eine Ratte verschwand schnell hinter einer der durchsichtigen Mülltüten, die um den Abfalleimer herumlagen und deren Inhalt sich aufgrund der Verwesung nicht mehr identifizieren ließ. Die Plastiktüten waren zerlöchert, und der Großteil des Abfalls lag auf dem Hof verstreut. Als sie ausstieg und sich vorsichtig näherte, bemerkte sie, woher der schlimmste Geruch kam. An der Treppe lag ein halb vertrockneter Dachskadaver, der aussah, als hätte sich das Tier vor seinem Tod in Krämpfen gewunden. Zögernd blieb sie stehen und beobachtete das Haus. Es war totenstill. Das Wort erschreckte sie plötzlich. Was war das für ein Mensch, der in so einem Abfall leben konnte, noch dazu mit einem stinkenden toten Tier vor der Tür? Sie guckte in den Garten über ein Holztor, das schief in seinen Angeln hing. Der Bewohner musste definitiv gewarnt werden; der gesamte Garten war mit Spinnweben bedeckt. Sie versuchte, durch die Fenster hinein zu spähen, aber sie waren zu schmutzig. Die Innenseite war mit einer grauen Staubschicht bedeckt. Das Haus stand leer. Das musste die Erklärung sein. Es konnte keine andere geben. Sie riss sich zusammen und ging entschlossen die Treppe hoch. Vor der Tür zögerte sie erneut, dann klopfte sie und horchte, aber von drinnen kam kein Laut. Der Verwesungsgestank drückte im Hals und sie schluckte ein paar Mal, um sich nicht zu übergeben. Sie entschied sich, wieder zu gehen. Das Haus war ganz sicher bloß verlassen. Der junge Mann, der hier gewohnt hatte, war schon lange ausgezogen. Bestimmt hatte er deswegen keine weiteren warmen Eier gekauft. Dann hörte sie ein Geräusch, als ob drinnen etwas umfiel. Also gab es doch Leben.
„Hallo! Ist jemand zu Hause?“, rief sie und klopfte noch einmal an die Tür. Nichts passierte, es war wieder still. Die Klinke war klebrig und klamm. Sie drückte sie herunter und überwand die Übelkeit. Die Tür war nicht abgeschlossen. Sie brauchte nur einen kleinen, zusätzlichen Schubs mit der Schulter.
4
Italien, Neapel
Sein Herz klopfte wie wild, als er vor dem Gebäude stand und die Erinnerungen hochkamen. Mutter hatte ihn hierher mitgenommen, als sie die Familie in Neapel besuchten. Viele Jahre waren vergangen, bis es dazu kam und sie zurückgekehrt war. Er musste ungefähr neun gewesen sein, als er seine Geburtsstadt zum ersten Mal wiedergesehen hatte und meinte, er könnte sich an das Ganze erinnern. Seine Mutter behauptete, das sei nicht möglich, er sei erst vier gewesen und an Erlebnisse in diesem Alter erinnere man sich nicht. Aber genau jetzt vor diesem Gebäude wusste er, dass er es tat. Er erinnerte sich, dass seine Mutter geweint hatte. Das hatte er zum ersten Mal erlebt und es hatte Spuren in seinem Gedächtnis hinterlassen. Er hatte sie das auch nie wieder tun sehen. Was sie hier gemacht hatten, bevor sie, mit ihm im Schlepptau, zu ihrer Schwester nach Dänemark weitergereist war, wusste er jedoch nicht. Es hatte etwas mit irgendwelchen Papieren zu tun und dann hatten ein paar bewaffnete Beamte sie zum Flughafen begleitet. Er erinnerte sich an ihre Waffen, die er hatte anfassen dürfen. Da hatte er auch zum ersten Mal ein Flugzeug gesehen und sollte damit fliegen. Diese Episoden hatten sich fest in sein vierjähriges Gehirn eingebrannt. Ein Teil von ihm gehörte hierher und es war in ihm geblieben, obwohl seine Mutter ihn entwurzelt hatte.
Am Haupteingang standen zwei Carabinieri. Roland erinnerte sich an das Foto seines Vaters in der schmucken, schweren Uniform mit roten Streifen auf den Hosenbeinen. Damals, als seine Mutter noch gelebt hatte, hatte es immer dagestanden, damit er es angucken konnte, wenn er am Küchentisch aß. Wo war es abgeblieben?
Einer der Carabinieri hielt ihn Achtung gebietend an. Er sah für einen Carabiniere sehr jung aus, aber das war Rolands Vater, Adriano Benito, auch gewesen. Sicher erinnerten sich nicht mehr viele hier an ihn. Aber einer auf jeden Fall.
„Ich möchte mit Sergio Minitti sprechen“, erklärte er und hoffte, sein Italienisch hatte keinen zu starken dänischen Akzent. Sofort wurde ihm Platz gemacht, damit er hineingehen konnte. Es wunderte ihn, wie leicht es war.
Er erinnerte sich an den Weg zu Sergios Büro, und der wartete auf ihn, erhob sich hinter seinem Schreibtisch, umarmte Roland und küsste ihn auf beide Wangen.
„Rolando! Schön, dich zu sehen! Willkommen daheim, wenn ich das sagen darf. Wie geht’s der Familie?“
Sergio war Sizilianer und Roland hatte oft Mühe, seinen Dialekt zu verstehen. Es war normal, dass das Korps Leute zwischen den großen Städten austauschte. Sein Vater war auch eine Zeitlang in anderen Kasernen gewesen, auch auf Sizilien, aber immer wieder zurück nach Neapel gekommen, hatte seine Mutter erzählt. Sergio kehrte nie nach Sizilien zurück.
Roland setzte sich auf den angebotenen Stuhl. Sergios Büro war ganz anders als sein eigenes zu Hause eingerichtet, fast wie ein kleines Wohnzimmer mit kleinen, originalen Landschaftsölgemälden in Goldrahmen an der Wand, Seite an Seite mit diversen Diplomen in Glas und Rahmen. Alles in dem Raum hatte einen Zug, der einen gedanklich in die Fünfziger zurückversetzte. Das Einzige, was diesen Eindruck störte, war ein Computerbildschirm, der moderner als Rolands aussah. Er stand hinter ihm auf einem Tisch neben einem altmodischen Fax. Eine Miniaturausgabe der italienischen Flagge hing schlaff an einer verchromten Fahnenstange auf dem Tisch und ein Messingschild verkündete, dass Sergio Minittis Titel Oberst war. An einem Kleiderbügel am Schrank hing seine elegante schwarze Jacke mit drei Sternen auf jeder Schulter, Flaggen und Abzeichen auf der Brust und Silberstickerei am Kragen. Sie kam bei besonderen Anlässen zum Einsatz.
Roland erzählte schnell von den Kindern und Enkeln, damit Sergio die Möglichkeit bekam, ebenfalls von seiner Familie zu berichten. Der Stolz leuchtete in den funkelnden, dunklen Augen. Irenes Schicksal ließ Roland unerwähnt; das war ein prekäres Thema.
„Wie läuft’s mit dem alten Benito? Lebt er noch?“
„Ja, ja. Pippino geht es gut. Er ist nicht so leicht unterzukriegen.“
„Wie alt ist er eigentlich mittlerweile?“
„Er ist gerade 95 geworden, aber immer noch geistig rege.“
„Nicht schlecht für einen Mann. Sonst sind es ja meist die Frauen, die in diesem Land am ältesten werden.“
Roland wusste, dass die Statistik dies besagte und nickte.
„Ach ja. Wie die Zeit vergeht. Ich bin nun auch ein alter Mann, Rolando, und hätte schon längst in Rente gehen sollen. Es gibt neue Regeln; als alternder Carabiniere darf man seinen Posten erst verlassen, wenn man 65 geworden ist.“
„Aber wie ich sehe, hast du doch einige Jahre länger ausgehalten.“
Sergio beugte sich über den Schreibtisch vertraulich zu ihm und flüsterte mit hochgezogenen weißen Augenbrauen und einem Funkeln in den Augen.
„Sie haben mich überredet, aber jetzt ist Schluss damit, ich mache nur noch ein halbes Jahr! Basta!“
„Verständlich. Das ist ein aufreibender Job.“
„Mittlerweile gibt es nun auch viel Schreibkram zu erledigen – und Kaffee für die Jungs zu kochen. Das ist ungefährlich.“
Er lehnte sich auf dem Stuhl zurück und lächelte, dann wurde sein Gesicht sehr ernst.
„Ich hatte gerade erst als Beamter angefangen, als dein Vater ermordet wurde. Das war ein furchtbares Erlebnis und ich hätte beinahe deswegen meine Ausbildung hingeschmissen … damals hat das Ganze angefangen. In Palermo. Weitere getötete und verletzte Beamte, dein Vater hätte …“ Sergios Stimme klang belegt, er schwieg und schob verlegen die italienische Flagge zurecht.
Roland hielt die Luft an. Seine Mutter hatte ihm nie erzählt, was eigentlich passiert war. Er hatte auch nie danach gefragt. Er wusste nur, dass die Camorra Adriano Benito getötet hatte und seine Mutter mit ihm hatte fliehen müssen, weil auch sie in Gefahr gewesen waren. Mehr brauchte er nicht zu wissen. Mehr wollte er auch gar nicht wissen. Er wusste, wer der Feind war.
Sergio lächelte wieder und seine Stimme klang fast normal, als er fortfuhr. „Aber was führt dich zu uns? Seit deine Mutter von uns gegangen ist, habe ich nicht besonders viel von dir gesehen.“
Roland räusperte sich.
„Ich habe mich gefragt … wurde Salvatores Mörder schon gefasst?“
Sergios Lächeln verschwand wieder.
„Wir haben wirklich getan, was wir konnten. Glaub mir! Adriano Benitos Familie haben wir immer verteidigt. Aber du weißt, wie es ist, Rolando. Wir glauben zu wissen, wer es ist, aber die Beweise …“
„Was habt ihr aus dem Autoverschrotter herausbekommen?“
„Er hat steif und fest behauptet, nichts von dem Auto mit Salvatores Leiche gewusst zu haben, das sich auf seinem Grundstück befand, aber … hmm, sicher nicht die Wahrheit gesagt. Dann hat die Familie ihn gefunden. Drei Genickschüsse. Hinrichtung. Die anderen dachten wohl, er hätte geredet.“
Roland schluckte und trank von dem Wasser, das Sergio ihm eingeschenkt hatte.
„Aber das ist noch nicht zu Ende. Wir werden ihn schon noch kriegen, wenn nicht wegen Mordes, dann wegen etwas anderem. Mehrere Mafiosi sind ausgestiegen und haben angefangen, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir haben einen Unterboss in Catania, der lustig singt. Der kann sehr nützlich werden.“
„Ja, aber das ist doch wohl die Cosa Nostra, was haben die mit …“
„Die meisten Clans kennen sich, und wenn sie festgenommen wurden und anfangen auszupacken, ist das Erste, was sie tun, ihre Konkurrenten in den anderen Familien reinzureiten, daher: wer weiß. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit Catania, meiner alten Abteilung.“
„Aber kann man denen trauen? I pentiti. Den Reumütigen?”
„Tja, das ist die Frage. Sie nennen sich ja Männer von Ehre. Wie ehrerbietig die in Wirklichkeit sind, ist zweifelhaft, aber die Aussagen können ja überprüft werden.“
Der Fall um Salvatore stand trotz allem nicht still, das tröstete Roland. Als Salvatore verschwunden war, war Irene diejenige gewesen, die ihn daran gehindert hatte, nach Neapel zu reisen und selbst an den Ermittlungen teilzunehmen. Wie Asger Brink es nun tat, um seine Tochter zu finden. Roland hatte seinen Schmerz spüren können, seitdem sie sich im Café voneinander verabschiedet hatten.
„Ich habe noch eine andere Sache, ich habe einem … äh, Freund versprochen, mich danach zu erkundigen. Er sagt, er habe euch kontaktiert. Seine Tochter ist hier in Napoli verschwunden.“
„Davon weiß ich nichts.“
„Die Frau ist nach einer Tauchtour in Ischia verschwunden.“
„Nein, darüber weiß ich wirklich nichts. So viele werden vermisst gemeldet, daher … vielleicht ist es eine andere Abteilung, wir treten uns mit ganzen fünf Korps fast auf die Füße.“ Sergio richtete seine Krawatte.
„Fünf?“
„Ja, fünf! Wären es nur ein oder zwei wäre es überschaubar, aber man braucht auch Platz für die Polizia di Stato, das staatliche Polizeikorps. Polizia Penitenziaria, die Gefängnispolizei. Corpo Forestale dello Stato, die Waldpolizei und Guardia di Finanza, die sich um den Zoll und Wirtschaftskriminalität kümmert, so wie wir, die Arma dei Carabinieri, es ja über die militärischen Aufgaben hinaus auch tun. Ja, und damit nicht genug, haben wir noch die Polizia Provinciale, die Provinzpolizei, die Polizia Municipale, die Stadtpolizei, die sich jedoch hauptsächlich um Verkehrsdelikte kümmert, und nicht zu vergessen die Guardia Costiera, die Küstenwache. Alle sind eigenständige Korps, daher verstehst du vielleicht …“
„Ja, ich weiß nicht, an wen sich mein Freund gewandt hat – vielleicht an die verkehrte Abteilung“, murmelte Roland verwirrt.
„Ist die Vermisste Italienerin?“
„Nein, Dänin. Sie heißt Elisabeth Brink, 35 Jahre. Versierte Taucherin. Ihr Vater ist hierhergekommen, um nach ihr zu suchen.“
Roland kramte in seiner Tasche und holte das Foto heraus. Er legte es vor Sergio, der es kurz betrachtete.
„Ich werde die Sache untersuchen. Das muss eine furchtbare Situation für ihn sein. Hat er schon in den Krankenhäusern nachgefragt?“
„Ich glaube, er hat getan, was er konnte, aber er spricht kein Italienisch, daher …“
Sergio stand auf und sah entschlossen auf die Uhr, dann ging er zum Schrank, zog den Bügel aus der schicken Jacke und zog sie an. Er richtete sich auf und schob die Brust raus, während er die Jacke zuknöpfte. Danach legte er eine Hand schwer auf Rolands Schulter.
„Weißt du was, Rolando. Ich finde, du solltest deinem dänischen Freund helfen. Ich muss zu einer Versammlung – oder besser gesagt, einer Festlichkeit. Ein Kollege, der in Rente geht – du verstehst. Du kennst sicher die Redewendung: Wenn du nicht zu derBeerdigung deines Freundes gehst, kommt er auch nicht zu deiner, oder? Wir sehen uns noch einmal, bevor du wieder abreist. Vielleicht könnten du und deine Frau uns privat besuchen? Ihr habt unser schönes Haus mit Treppen durch die Klippen vom Meer bis hoch zum Garten noch gar nicht gesehen. Wie lange bleibt ihr?“
Roland dachte sofort an Irene mit Gehhilfe und Krücken, was natürlich besser als der Rollstuhl war. Er stand ebenfalls auf und bereitete sich auf weitere Küsse und Umarmungen vor. Er fühlte sich in Bermudashorts und einem verschwitzten T-Shirt sehr klein und unbedeutend neben dem uniformierten, schicken Riesen.
„Das wird die Zeit zeigen. Ein paar Wochen sind wir sicher noch hier.“
Er ging mit Sergio hinaus in die Herbstsonne. Das Foto ließ er auf seinem Schreibtisch liegen. Die Küsse bekam er vor einem glänzenden, schwarzen Alfa Romeo mit roten Streifen aus, die zu der Uniform passten.
„Grüß daheim. Wir sehen uns, Rolando.“