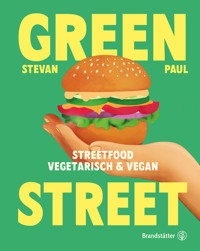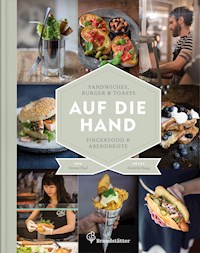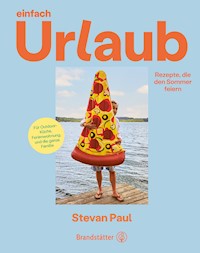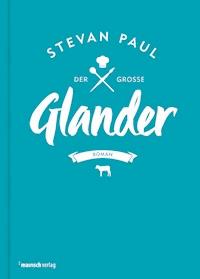Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mairisch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Oberkellner Adam liebt seinen Beruf, nur die Gäste stören ihn immer ein bisschen. Ein Restaurantkritiker folgt seinem Bauchgefühl und begeht einen kleinen Fehler von großer Wirkung. Ein Foodblogger lässt mal fünfe gerade sein und kauft normales Hackfleisch. Und Kantinenköchin Herta Klöpke will sich nicht wegrationalisieren lassen. Eines Nachts kocht sie am alten Arbeitsplatz noch mal ganz groß auf ... Mit hintergründigem Sprachwitz und klugem Humor erzählt Stevan Paul in 15 neuen Kochgeschichten pointiert von der Suche nach dem modernen Schlaraffenland. Dieser ganz und gar nicht märchenhafte Sehnsuchtsort liegt gleich hinter den Umkleidekabinen eines alten Ostberliner Kaufhauses, findet sich in den verschneiten Wäldern Schwedens, am Strand von Sylt, in den Tiefen des Internets, der Küche eines längst geschlossenen Berghotels und auf dem Boden eines geleerten Suppentellers. Und natürlich gibt es zu jeder Geschichte das passende Rezept. Stevan Paul glänzt nach dem großen Erfolg seines Debüts "Monsieur, der Hummer und ich" und seiner Kochbücher (u.a. "Auf die Hand" und "Deutschland vegetarisch") erneut auf unverwechselbare Weise. Ein Buch über die tröstliche Wirkung von warmem Milchreis, die Kunst, ein Linsengericht zu kochen und die Unwägbarkeiten der Liebe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Nachtschichten
Wellenreiter
Dienstschluss
Dem Wodka treu die ganze Nacht
Schlaraffenland
Tri Tra Truffola
Mit Herrn Wilhelm durch die Nacht
Revolution
Röda Huset
Von der Kunst, ein Linsengericht zu kochen
Alte Schule
Bauchgefühl
Liebesprüfung auf dem Hindenburgdamm
Erbsensuppe
Karl, aus Mexiko
Stevan Paul
Impressum
Nachtschichten
Es riecht nach Männerschweiß, der Alkohol der letzten Nacht dünstet sauer aus, die Jungs haben gefeiert, Herr Adam atmet durch den Mund. Er trägt geruchloses Deodorant auf, schließt das gestärkte Hemd vor der glatt rasierten Brust. Im Spiegel der Spindtür zeigt sich Routine beim Anlegen der Schleife, altmodisch, finden die jungen Kollegen, nicht zeitgemäß, so eine Fliege. Herr Adam sieht das anders. Er liebt seinen Querbinder, denn der schafft Abstand.
Herr Adam nimmt zwei Stufen gleichzeitig, in seinem Mund dreht ein Pfefferminzbonbon energisch seine Runden, hinter Adam schlurfen die verkaterten Jungköche auf Birkenstockschuhen die Wendeltreppe hinauf, lustlos in ihren grau gewaschenen Uniformen. Erster. Im Dunkel der Küche wispert ein Fond, es riecht nach gebrannten Knochen, karamellisierten Zwiebeln und schwerem Rotwein. Herr Adam drückt im Vorbeigehen die Lichtschalter, Neonröhren blenden auf, aufgeschreckte Kakerlaken suchen Schutz unter den Öfen und Metalltischen der Küche, fliehen über weiße Bodenkacheln, nur einen Wimpernschlag lang zu sehen.
Im Getränkeoffice räuspert sich die Kaffeemaschine, zwölf Nachtschwarze für die Küche mit ordentlich Zucker. Herr Adam geht hinaus ins Restaurant, hinter ihm schneidet die Schwingtür alle Geräusche ab, in der Mitte des Raumes bleibt er stehen. Diese Ruhe. Im Halbdunkel schimmern die Seidenbezüge der akkurat ausgerichteten Stühle, auf den Tischen feines Porzellan, schweres Silberbesteck ruht auf weichen Stoffservietten, zarte Gläser stehen Spalier. Herr Adam sieht sich um und nickt nachdrücklich. So gefällt ihm das Restaurant am besten. So still. Und vor allem: so menschenleer. Vor den Fenstern zieht der Wind durch die blattlosen Bäume der Uferpromenade, fröstelnd kräuselt sich der See im Dämmerlicht des Nachmittages. War eigentlich überhaupt mal Tag heute, fragt sich Adam, der lange geschlafen hat, beim Blick in die Welt da draußen. Ihm fällt seine alte Großmutter ein, die zu dieser Jahreszeit die immer gleiche Wetterwarnung ausgab, mit dem Zeigefinger in der Luft stochernd, der März ist ein Kindstöter.
»Adam, altes Tellertaxi, mach dir doch mal Licht hier!«, ruft Gröpke aus dem Nichts und platziert einen gekonnten Handkantenschlag in den Nacken seines Serviceleiters, Herr Adam zuckt zusammen, er hatte den Küchenchef nicht kommen hören.
»Mensch Adam, Alter, ich sach ma so, das wird ja überhaupt nicht mehr hell da draußen, ist das hier Helsinki, oder was?«
Gröpke hat jetzt einen Arm um Adam gelegt, spielt mit der anderen Hand an dessen Fliege, schwitzt redselig Restalkohol: »Hömma, Bude voll heute, 56 Couvert, Lehmanns sind dabei mit vier Gästen, Pingstädter wieder Fensterplatz wie immer, und die Aschmanns kommen auch noch mit sechs Leuten, machste bisschen schön bei denen, ne? Und kuckst mal, dass die nicht alle à la carte fressen, die sollen Menü nehmen, weißte Bescheid, Mensch Adam, diese Dunkelheit macht mich ganz trübsinnig!« Gröpke holt kurz Luft, seufzt ausdrücklich: »Ich sach dir, ich hasse diesen Job!« Adam, aus der Umarmung des Küchenbullen entlassen, rückt sich gerade und macht sich an die Arbeit. Ihm geht es da ganz anders. Er liebt seinen Beruf. Aufrichtig. Es sind eigentlich nur die Gäste, die Herr Adam nicht leiden kann.
Herr Pingstädter studiert konzentriert den Teppichlauf, Frau Pingstädter gibt schmallippig die Beleidigte: »Herr Adam! Wir haben das schon bei der Reservierung angegeben, dass wir am Fenster sitzen wollen, wir sitzen immer am Fenster!« Heute nicht, denkt Herr Adam und lächelt herzlich: »Da muss was schiefgelaufen sein, ich mach's wieder gut, ein Glas Champagner auf meine Rechnung, Frau Pingstädter, kommt sofort, nehmen Sie doch schon mal da am kleinen Tisch bei der Garderobe Platz!«
Herr Adam zwinkert Frau Pingstädter verschwörerisch zu.
»Aber wir haben doch …«
»Frau Pingstädter. Ich zeige Ihnen mal was.«
Mit ausladender Geste lenkt Herr Adam das Augenmerk der Eheleute Pingstädter zum Fenster: »Sehen Sie?« Eine ganze Weile stehen die drei schweigend, betrachten das große Fenster des hell erleuchteten Restaurants, draußen die Dunkelheit, nachtschwarze Rechtecke zwischen weißen Holzrahmen. Herr Pingstädter begreift zuerst: »Es gibt nichts zu sehen!«
»Es gibt nichts zu sehen.« Herr Adam nickt und holt den Champagner, er weiß, da ist noch eine Flasche mit einem Rest von gestern.
Herr Adam liebt insbesondere die ersten Abendstunden im Restaurant, die Kerzen brennen hoch, die Gäste unterhalten sich in angemessenem, gedämpftem Ton miteinander, sitzen aufrecht und aufmerksam vor unbefleckten Tischdecken, auf denen erst später mit Rotwein, Saucenfett und kalter Zigarrenasche der Verlauf des Abends festgehalten sein wird. Er mag die Klarheit der unberührten Gläser, das glänzend polierte Besteck. Er mag, dass am Anfang eines Abends alles an seinem Platz ist. Und dann der Auftritt der Kollegen: Braunthaler, der junge Sommelier im Zweireiher, silbern schimmert die kleine Traubenrispe am Revers, das Erkennungszeichen seiner Zunft; Lehrling Mirko mit dem strengen Façonschnitt und den ausbaufähigen Manieren und Helena, diese wunderschöne, große Frau. Manchmal unterbricht Adam seine Arbeit im Restaurant, unbemerkt und nur für eine Sekunde bewundert er Helenas Gang, ihre vornehmen, weichen Bewegungen, beobachtet den Lauf der Stofffalten auf ihrem akkurat gebügelten Hemd, sieht zu, wie sich ihre gepflegten Hände mit großer Zartheit um eine Wasserkaraffe legen und sich die Muskeln ihrer Unterarme beim Aufnehmen der schweren Teller spannen. Eine Sekunde nur, die Adam stets gänsehäutig zu seiner Arbeit zurückkehren lässt. Adam hat sie alle ausgesucht und eingestellt, Helena, Herrn Braunthaler, Mirko, er hat sie gelehrt, dass dienen Respekt erfordert, auch vor sich selbst.
Da kommen Aschmanns mit ihren Gästen, Guten Abend zwischen Mantelbergen, ich darf Sie zu Ihrem Tisch führen, dazu spielt Strauss, Johann Strauss, alle beide, der Vater und der Sohn, Best-of im Endlosloop, Gröpkes Idee. Alle 78 Minuten ertönt der Kaiserwalzer. Die Bestellung der Aschmanns bringt Adam lieber selbst in die Küche. Ungläubig starrt Gröpke auf den Bon: »Willst du mich verarschen, Adam? Sind das Aschmanns? Hab ich nicht gesagt, die sollen Menü essen?«
Herr Adam ist unendlich müde: »Wollen die aber nicht.«
»Arschloch«, zischt Gröpke und dreht sich um: »Bon neu! Tisch neun, zweimal das große Menü, dazu als Première zweimal die Gänsestopfleber, einmal die Langustenterrine und einmal die Austern. Deuxième: zweimal die Jakobsmuscheln. Troisième: zweimal Lamm, einmal Loup de Mer und einmal die Ente in zwei Gängen. Dessert auf Abruf.«
»Oui, Chef!«, antwortet die Küchenmannschaft aus einem Mund, es folgt vielstimmiges Fluchen und Stöhnen. Noch viermal Kaiserwalzer, dann ist Feierabend, denkt Adam, und irgendwie tröstet ihn der Gedanke nicht wirklich.
»Hier Tisch fünf, nimm ma mit«, grantelt Gröpke, schiebt zwei Teller unter die Wärmelampen der Durchreiche, greift zum Glas mit Kochwein, spült seinen Ärger in zwei großen Schlucken runter und annonciert: »Zweimal die Jakobsmuscheln mit Wasabi-Schaum und geröstetem Nori-Blatt.« Herr Adam nimmt die Teller auf und verschwindet aus der Hitze. Kurz vor der Schwingtür zum Restaurant biegt er ab ins Getränkeoffice.
Er stellt die Teller auf den Schanktresen, betrachtet sie lange und denkt, was er schon oft gedacht hat: Seltsam, dass so ein grober, schlichter Mensch wie Gröpke so etwas berührend Schönes, Filigranes erdenken und auf den Teller bringen kann. Adam stippt mit der Fingerspitze in die Sauce und leckt ab, cremig schmilzt der Schaum im Mund, die würzige weiße Fischsauce ist intensiv und reich, fein geschärft mit grünem Meerrettich aus Japan und einer feinen Säure von Limette und Zitronengras. Mit seinem Kellnermesser schneidet er von jeder Jakobsmuschel ein Stückchen ab. Das Muschelfleisch ist perfekt gebraten, noch schön glasig, knisternd schmilzt das knusprig geröstete Algenblatt. Eine Weile sieht er noch dem Schaum zu, der sich leise zersetzt, verflüssigt und zergeht, dann trägt er die Teller zurück in die Küche: »Reklamation, Tisch fünf! Den Gästen ist das Essen zu kalt!«
Gröpkes Augen weiten sich, schlagartig tritt Zornesröte in sein Gesicht, die geplatzten Adern auf seinen Wangen schimmern in kräftigem Lila. »Arschlöcher!«, schreit er, »alles Arschlöcher« und wirft eine Pfanne mit zwei Hirschmedaillons quer durch die Küche, dann noch mal: »Arschlöcher!«
Adam denkt an die Textur und das Aroma der Sauce, an das perfekt gegarte Muschelfleisch, zuckt mit den Schultern, er versteht es nicht: so ein Mensch. Und dann so ein Essen.
»Was gibt's denn da so schwul mit den Schulten zu zucken, Adam, das ist ja wohl deine Schuld, das zieh ich dir auch vom Gehalt ab, wenn ich das schon seh, wie du da immer im Schneckentempo raus servierst, klar wird das kalt, die Jakobsmuscheln zieh ich dir ab!«
Im Restaurant geigt Der Ziegeunerbaron auf Adams Nerven herum, der Sechsertisch will zahlen, aber bitte getrennte Rechnung, ja, auch den Wein, irgendwie umschichtig auf die sechs Einzelrechnungen verteilen, das sei ja wohl kein Hexenwerk. Während Herr Adam an der Computerkasse zaubert, flutet ein Gast an Tisch zwölf seine Sitznachbarin mit teurem Rotwein. Sommelier Braunthaler wirft mit Stoffservietten, sagt: »Macht doch nichts«, weiter lässt er sich nichts anmerken.
An Tisch fünf mault Herr Lehmann, es sei hier auch alles schon mal ein bisschen schneller gegangen, man warte nun schon ewig auf zweimal Jakobsmuscheln, und Frau Pingstädter vom Garderobentischchen will jetzt noch eine Flasche Champagner zum Dessert, Wöööf Klickotte, den mag sie, »weil die so schön orange sind, vom Etikett her, die Flaschen!«
Herr Adam atmet ein und atmet aus und lächelt und geht ins Getränkeoffice und stoppt die Best-Of-Johann-Strauß-CD und biegt den Silberling, bis er mit einem leisen Knack mittig bricht. Dann kehrt er lächelnd zurück an seinen Arbeitsplatz. Er merkt als Einziger, dass über dem Stimmengewirr keine Musik mehr läuft.
Während er am Tisch der Lehmanns die Flasche Sauvignon zu den Jakobsmuscheln öffnet, die bestimmt gleich kommen, erzählt Frau Lehmann vom Urlaub. Ägypten diesmal, aber zum letzten Mal, fast gestorben sei man vor Angst im Hotel, wegen der Volksaufstände, also wirklich, nie wieder und besonders bedauerlich sei das, weil das ja jetzt der Jahresurlaub gewesen sei, jetzt gehe es nur noch eine Woche nach London und über Neujahr zum Skifahren nach Ischgl, das sei Tradition. Betrübt seufzt Frau Lehmann in ihren Weißwein.
Herr Adam nickt wissend. Alle seine Gäste erzählen immerzu vom Urlaub, die einen haben ihn gerade hinter sich gebracht, die anderen schmieden Pläne. Herr Adam hat schon die ganze Welt gehört. »Und Sie so, Adam, Balkonien?«, dröhnt Herr Lehmann und grinst Beifall heischend seine Gäste an. Adam wird nachher beim Bezahlen dafür sorgen, dass es Probleme geben wird mit Herrn Lehmanns Kreditkarte.
Die jungen Leute an Tisch eins. Er nervös, sie erwartungsvoll. So geht Liebe los, weiß Adam, er hatte den beiden den Fenstertisch gegeben, Pingstädters hatten sich um volle zwei Minuten verspätet, da hat er natürlich den Tisch weggeben müssen! Zwei Gläser Champagner, zweimal kleines Menü, Flasche Wasser, zwei Gläser Weißwein, den offenen. Der junge Mann während des Essens ein einziges, flatterndes Bewerbungsgespräch, Erlösung dann, zum Hauptgang nahm sie seine Hand. Seitdem herrscht Erleichterung auf beiden Tischseiten, und Herr Adam hört Gespräche über die Unwegsamkeiten der gemeinsamen Vergangenheit, die leider erst hier und heute zum Happy End führten. Jetzt sitzt der junge Mann für einen kurzen Moment allein am Tisch und geht die Kammern seines Portemonnaies durch, die Stirn in Sorgenfalten gelegt. Herr Adam storniert die zwei Champagner von der Rechnung der Liebenden und setzt sie bei Pingstädters auf den Bon, die können ruhig mal einen ausgeben, für die Umstände und auf das Glück der jungen Leute.
In der Küche hält Gröpke sich mit beiden Händen am Stahlrahmen der Tellerausgabe fest, die ihn in rasender Fahrt mitzureißen droht, jetzt steht das Karussell, aber nur, solange Gröpke nicht loslässt. Sprechen kann er noch: »Wie, die Gäste wollen mich sehen? Die sollen nach Hause gehen, die Furzköppe!«
Ein letztes Mal geht Herr Adam durchs Restaurant, entschuldigt den Küchenchef, druckt Rechnungen aus. Herr Lehmann beteuert, heute Mittag hätte seine Kreditkarte noch funktioniert, er könne sich das gar nicht erklären, seine Gäste legen zögerlich zusammen und übernehmen den Preis der Einladung. Herr Pingstädter gibt 1 Euro 50 Cent Trinkgeld und setzt seine Frau als Geschäftsessen ab. Der junge Mann an Tisch eins schiebt erleichtert einen rötlichen Schein zusätzlich unter den Rechnungsbeleg, nickt Herrn Adam kurz und kräftig zu. Der überreicht Gröpke später den Briefumschlag mit dem Trinkgeldanteil für die Küche, halbe-halbe, wie ausgemacht. Na ja, fast. Wortlos lässt Gröpke den Umschlag in seiner ausgebeulten Hosentasche verschwinden, den Blick zu Boden gerichtet. Im Restaurant saugt Mirko Baguettekrümel aus dem Teppichdickicht.
Adam zieht sich das T-Shirt über den Kopf, Santa Fu Hamburg steht darauf, direkt über den gezeichneten Umrissen der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel, und hinten, auf dem Rücken, steht: derbe rocker. Immer ist er unsicher, ob er schon zu alt ist, noch bedruckte T-Shirts zu tragen, oder schon wieder alt genug. Das hier ist sein Lieblings-Shirt. Es ist das T-Shirt, das er am meisten mit den Begriffen Feierabend und Freizeit verbindet, das passt jetzt gut, findet Adam.
Vor der Umkleide rumpelt etwas die Wendeltreppe runter, wenn das mal nicht Gröpke war, denkt er, schließt die Knöpfe seiner Jeans und geht nachschauen. Gröpke liegt stöhnend auf der letzten Stufe der Treppe, reibt sich den breiten Schädel, die Augen zusammengekniffen. »Adam«, keucht er, zieht sich an seinem Oberkellner hinauf, kommt wieder auf die Beine: »Nix passiert!« Gröpke lächelt schief. Gott ist mit den Kindern und den Betrunkenen. »Adam, wir brauchen hier mehr Licht!« Mit glasigem Blick sieht der Koch die Wendeltreppe hinauf ins Dunkel, sortiert sichtbar seine Gedanken und sagt dann: »Tut mir leid wegen vorhin, die Schreierei, war so im Stress und hab auch heute ʼn bisschen viel getrunken, morgen mal nur Wasser für mich, wa, Adam, altes Tellertaxi!« Gröpke lacht grob, und Adam nickt, wie jeden Abend an dieser Stelle: »Bis morgen dann, Gröpke, schlafen Sie gut!«
Adam tritt hinaus in die Nacht, hinaus aus den Küchengerüchen, lässt den Rauch von verbranntem Fett und den Dunst der Parfümwolken seiner Gäste zurück, es hat aufgehört zu regnen, frisch gewaschen weht die Nacht den Duft von altem Holz und Wasserlinsen über den See. Helena steht an der Uferpromenade, schon umgezogen, wartend, unter einer Bogenlampe, beleuchtet wie ein wertvolles Gemälde.
»Bist du nicht ein bisschen zu alt für bedruckte T-Shirts?«, lacht sie und zieht fürsorglich den Reißverschluss seiner Jacke nach oben, streicht mit ihren Fingern durch sein Haar, küsst ihn kurz, er zuckt die Schultern und lächelt: »Du wirst es mir hoffentlich sagen.«
Sie gehen in Richtung Innenstadt, auf die Lichter zu. Hinter ihnen wird das Restaurant immer kleiner, verschwindet im Dunkel. Herr Adam atmet tief ein.
Jakobsmuscheln mit Wasabi-Schaum und Gurke
Für 4–6 Personen
Zutaten
1/2 Salatgurke Zucker Salz 1 Nori-Algenblatt 80 g Schalotten 1 Stängel Zitronengras 50 g Butter1/4 Liter trockener Weißwein1/4 Liter Fischfond a. d. Glas1/2 Limette 200 ml Schlagsahne1/2–1 Tl Wasabi-Paste 2–6 Jakobsmuscheln pro Person (siehe Tipp) 4 El Olivenöl Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
1. Von der Gurke mit einem Sparschäler nur jeden zweiten Streifen Schale abschälen. Gurkenfleisch mit einem Perlausstecher ausstechen. Die Gurkenperlen mit etwas Zucker bestreuen, einer Prise Salz würzen und beiseitestellen. Nori-Blatt in einer Pfanne ohne Öl rösten, bis es zu knistern beginnt und sich leicht bräunt.
2. Schalotten und Zitronengras in feine Scheiben schneiden und in einem kleinen Topf in 20 g Butter glasig dünsten. Mit 1 Tl Zucker bestreuen, mit Weißwein auffüllen. Offen auf die Hälfte einkochen. Fischfond und die Hälfte des Nori-Blattes zugeben, offen auf die Hälfte einkochen. Fond durch ein feines Sieb in einen zweiten, kleinen Topf passieren. Limettenschale fein abreiben und mit der Sahne zugeben. Offen 6 Minuten kochen. Mit Salz und einem kleinen Spritzer Limettensaft würzen.
3. Gurkenperlen abtropfen lassen und auf Tellern anrichten. Das übrige halbe Nori-Blatt zerbröseln. Die Jakobsmuscheln in einer Pfanne im heißen Öl von jeder Seite 2–3 Minuten braten, mit Salz und Pfeffer würzen und warm stellen.
4. Die Sauce aufkochen, 30 g kalte Butter und Wasabi zugeben und mit dem Stabmixer schaumig pürieren. Die Jakobsmuscheln auf den Gurkenperlen anrichten, mit der Sauce beträufeln und mit zerbröseltem Nori-Blatt bestreuen. Sofort servieren.
Tipp
Das Rezept kann als Vorspeise eines Menüs für 6 Personen serviert werden (2–3 Jakobsmuscheln pro Person) oder als Hauptgang für 4 Personen (5–6 Jakobsmuscheln pro Person). Als Beilage für einen Hauptgang eignen sich die zarten, dünnen Capellini-Nudeln, die vor dem Servieren, heiß und tropfnass, mit einem Teil der Sauce vermengt werden können.
Zubereitungszeit
30 Minuten
Wellenreiter
Wiedergeburt, das ist ja so ein Thema für Leute, die Schiss vor der eigenen Endlichkeit haben oder zu selbstverliebt sind, um sich vorstellen zu können, dass sich die Erde auch mal ohne sie drehen wird. Oder natürlich für kluge Buddhisten mit Durchblick. Ich gehöre momentan keiner dieser drei Gruppen an, denke aber viel nach in den letzten Tagen. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich verändere mich. »Ganz schön braun bist du geworden«, sagt die Liebste. »Crem dich lieber noch mal ein.« Zu sehen ist die Veränderung also nicht.
»Ich geh lieber noch mal ins Wasser«, entscheide ich und laufe mit weiten Schritten durch den heißen Sand zum Meer, das Wasser kühlt die Fußflächen im letzten Moment. Ich sehe hinüber zu den Häusern des alten Dorfes, die in den knochenbleichen Felsen hängen wie getrocknete Vogelnester, früher hielt man von dort Ausschau nach Piraten. Draußen auf dem Meer stehen Segelyachten, bewegungslos in der Windstille, kleine motorisierte Schlauchboote bringen die Segler in die Strandrestaurants, auf deren bunt gestrichenen Dächern die Telefonnummern für Tischreservierungen aufgemalt sind, riesige weiße Zahlen, aufgetragen mit saftigen Pinselstrichen. Immer mehr Taxiboote springen knatternd über das dunkelblaue Wasser, das kurz vor der Küste türkisgrün ausfranst. Am Strand spielt ein Rasta mit seinem Hund. Der Hund beißt die geworfene Frisbeescheibe zackig aus dem Himmel, der Himmel ist so blau, man könnte diesen Himmel nicht malen, man kann diesen Himmel nicht fotografieren. Ein einzigartig blauer Himmel, zum Selbstmerken. Jeden Tag stehe ich am Meer, seit einer Woche schon. Mein Haar ist hell und strohig geworden unter der weißen Sonne, ich atme die warme, mineralische, trockene Luft ein, während ich langsam ins Wasser gleite, immer weiter weg vom Strand, das Wasser wird kühler, beginnt an mir hinaufzuklettern, meine Füße verlieren den Grund, und dann passiert es, ich werde ein anderer. Ich tauche ein, ich schwimme los, mit kräftigen Zügen. Mein Körper, den ich zu Hause immer ein bisschen ungelenk, verspannt und dicklich finde, bewegt sich geschmeidig. Meine dünnen Arme schaufeln kraftvoll, elegant durch die Wellen. Ich schwimme weit hinaus, alles fließt, alles strömt, ich werde nicht müde, und es ist, als hätte ich nie etwas anderes getan.
Es ist nicht so, dass ich ein großer Schwimmer wäre. Mit der Volljährigkeit habe ich den persönlichen Badebetrieb eingestellt, ich habe seit zwanzig Jahren kein Hallenbad mehr betreten, und der Besuch eines Freibades erscheint mir retrospektiv selbst bei heftigeren Hitzewellen völlig absurd. Muffig riechende Baggerseen mit flirrenden Algen in moosgrünem Trübwasser animieren mich allerhöchstens zum Grillen am Uferrand. Nein, für mich muss es schon das Meer sein.
Die Liebste winkt mir vom Strand aus zu, sie schwenkt eine Zeitschrift über ihrem Kopf, die Sonnenbrille zwei riesige, schwarze Augen. Jeden Tag schwimme ich ein bis zwei Stunden, und erst am Strand bemerke ich, dass ich nichts gedacht habe in dieser Zeit, nur aufgenommen. Die mir eigene Gedankenrastlosigkeit ertrinkt, sinkt trudelnd auf den Meeresboden unter mir und bleibt zurück, während ich weiter schwimme, schwimme, schwimme. Die Geräusche des Wassers hören, das weiche Wippen spüren, das Perlen des Wassers durch meine Hände. Unter Wasser lauschen. Das feine Klirren der Ankerketten im weit entfernten Fischerhafen, wie dünne Glasstäbe, die aneinander schlagen. Und wie das Meer riecht, wie das Meer schmeckt! Kein Koch würzt so verschwenderisch und doch so elegant. Tauchen auch, tief eintauchen in die zunehmende Kühle, dem verschwommenen Grund entgegen. Ich huste viel zu Hause, ich rauche ja auch viel. Im Meer habe ich Luft.
Später am Mittag schlüpfen wir unter den Schatten der Strandbude mit dem blauen Dach, setzen uns an den Tresen, streichen ein paar Sandkörner aus dem Haar, wir küssen uns und trinken kaltes Bier aus gefrorenen Gläsern. Die Segler rufen nach mehr Wein, liegen wie satte Könige in den Klappstühlen, ihre Frauen lachen in geleerte Gläser, lutschen Eiswürfel, die Kinder bauen Sandburgen zwischen den Tischen.
In der Küche steht Anjos, er winkt uns über die blau gestrichene Salontür zu: »Hallo Leute, schöner Tag heute!«, dann wendet er die goldbraunen Fische im flüsternden Olivenöl, stapelt Cheeseburger, rüttelt fettglänzende Pommes frites in schwarz gebrannten Gitterkörben. »Extramenü«, ruft er, keine Frage, wischt sich den Schweiß mit einem Küchentuch aus dem Gesicht und lacht ein Lachen mit sehr wenigen Zähnen, alle hundert Falten seines Gesichts lachen mit. Anjos spricht unsere Sprache, wie überhaupt jeder hier unsere Sprache spricht. Wir revanchieren uns mit den wenigen Vokabeln aus dem Reiseführer, Kategorie Im Restaurant, es ist uns immer ein bisschen peinlich. Anjos ist hier geboren, »ich komme aus Krefeld«, sagt er aber, das sei seine Heimat. Mit seiner Frau betreibt er dort ein kleines Lokal, im Sommer ist er alleine hier, bewirtschaftet die alte Strandbude seiner Familie. »Das hält die Liebe jung, solltet ihr mal sehen, im Herbst ist die Liebe wie neu, hält den ganzen kalten Winter«, Anjos lacht, häuft Salatstreifen auf eine Silberplatte, sprenkelt Zitronensaft und dickflüssig funkelndes Olivenöl darüber, bettet die gebratenen Fischfilets darauf. Und dann kommt das Extra. In einer zweiten Pfanne raucht Olivenöl, darin brät Anjos eine Handvoll winziger Calamares scharf an, gibt Kichererbsen dazu und grob gewürfelte Tomaten, gehackten Knoblauch, ein Lorbeerblatt und eine Chilischote, eine Handvoll Kräuter. »Was da ist! Ganz egal«, erklärt Anjos, es zischt und duftet, augenblicklich. Viermal fliegt der Pfanneninhalt in die Luft und wieder zurück in die zerbeulte Pfanne, Zitronensaft noch und etwas Salz und frisches Olivenöl, und dann löffelt Anjos die Calamares mit dem Sud über den gebratenen Fisch. »Ist ein bisschen doppelt, so mit Fisch und Calamares, ist aber auch doppelt gut«, sagt er und schiebt die Platte mit zwei Gabeln über den Tresen, reißt knuspriges Brot mit schneeweiser Krume von einem großen Laib. »Lasst es euch schmecken, Leute!«
Wir genießen schweigend das reiche Essen, die Doppelung aus zartem Fischfleisch und dem leichten Biss der gebratenen Calamares, das Nussige der Kichererbsen mit der Frische der Tomaten und der Würze der frischen Kräuter. Noch ein Bier, dann drehe ich mich wieder zum Meer, ich werde unruhig.