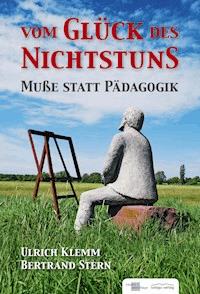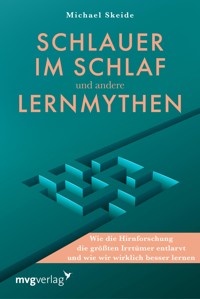
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mvg Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Können wir im Schlaf eine neue Sprache lernen? Hilft Gehirnjogging wirklich? Und nutzen wir tatsächlich nur einen Bruchteil unseres Gehirns? Rund ums Lernen kursieren zahllose Mythen – doch was sagt die Wissenschaft? Dr. Michael Skeide, renommierter Hirnforscher an einem Max-Planck-Institut, nimmt die größten Irrtümer unter die Lupe und zeigt, was tatsächlich funktioniert – und was eher Wunschdenken ist. Auf dem aktuellen Stand der Spitzenforschung, dabei locker, unterhaltsam und voller überraschender Aha-Momente, erklärt er, was unsere Lernfähigkeit wirklich stärken kann und warum sich viele vermeintliche Lerntechniken als nutzlos erweisen. Eine spannende Entdeckungsreise in neue Welten des Lernens – mit überraschenden Erkenntnissen, die den Blick auf die Möglichkeiten und Grenzen unseres Gehirns für immer verändern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Titelseite
Michael Skeide
Schlauerim Schlaf
und andere
Lernmythen
Wie die Hirnforschung die größten Irrtümer entlarvt und wie wir wirklich besser lernen
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und [email protected]
Wichtiger HinweisDieses Buch ist für Lernzwecke gedacht. Es stellt keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung und Ernährungsberatung und sollte auch nicht als solcher benutzt werden. Wenn Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt. Der Verlag und der Autor haften für keine nachteiligen Auswirkungen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind.
Originalausgabe1. Auflage 2025© 2025 by mvg Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbHTürkenstraße 89 80799 MünchenTel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Petra HolzmannUmschlaggestaltung: Sabrina PronoldUmschlagabbildung: Adobe_Stock/smalvikSatz: Daniel FörstereBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7474-0701-1ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98922-120-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.mvg-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
1. Aufwärmrunde
2. Beweise bitte!
3. Lernen im Schlaf
4. Was Hänschen nicht lernt …
5. Gehirnjogging
6. Auf die Größe kommt’s an
7. Früh, früher, Frühförderung
8. Zehn Prozent
9. Nervennahrung
10. Rational links – kreativ rechts
11. Lerntypen
12. Frauen- und Männergehirne
13. Erklärbärenfallen aufstellen
14. In Bewegung bleiben
15. Neugier nachgeben
1. Aufwärmrunde
Lernen kann sooo langweilig sein. Oder zumindest anstrengend. Aber ohne Lernen gibt es kein Können. Und: »Kannst du was, bist du was« – wie ein altes Sprichwort behauptet. Zum Beispiel diejenige Person, die ständig um Hilfe gebeten wird. Im Ernst: Wissen erweitert den Horizont. Meistens zumindest. Denn vielleicht wollen Sie ja lieber nicht ganz so genau wissen, was andere Leute über Sie denken. Doch würden Sie sich dagegen wehren, sämtliche Sprachen der Welt sprechen zu können? Oder würde es Ihnen etwas ausmachen, all Ihre Lieblingsinstrumente spielen zu können? Was ist mit Mathe komplett verstehen? Aber gerne doch!
Wie funktioniert Lernen? Und wie lernt es sich eigentlich am besten? Dazu gibt es erstaunliche Vorstellungen. Ein Beispiel: Angeblich bevorzugt jeder Mensch einen anderen Sinneskanal, um Informationen aufzunehmen. Als »Seh-Typ«, so die Behauptung, behalten Sie neue Informationen bereits, wenn Sie aufmerksam lesen und schreiben. Ein sogenannter »Hör-Typ« lernt am besten beim aufmerksamen Zuhören. Diese Vorstellungen gehen bis hin zu »kinästhetischen« Typen, die am liebsten sozusagen mit ganzem Körpereinsatz lernen. Untersuchungen, die das beweisen, habe ich allerdings vergeblich gesucht.
Warum halten sich solche Lernmythen so hartnäckig? Und wer kann sie zum Mond schießen? Oder besser noch: in ein anderes Universum? Hier könnte die Wissenschaft helfen. Aber die hat in der Öffentlichkeit eine erstaunlich leise Stimme, wenn es um das Thema »Lernen« geht. Stimmen aus der Praxis höre ich oft lauter. Meine Tochter sollte in der Grundschule nach Gehör schreiben. So wollte man ihr das Lesn und Schraim lernen erleichtern. Denn Korrekturen können Kinder verunsichern und ihnen die Lust am Lesen vermiesen, so die Begründung. Auf diesen gut gemeinten Rat kam übrigens eine engagierte Lehrkraft in den 1980er-Jahren, die hier nicht namentlich verpetzt werden soll. Unglaublich, wie sich diese Idee in den Grundschulen verbreitet hat und wie lange sie sich halten konnte. Viele Eltern fanden Lesn und Schraim am Ende der vierten Klasse nicht mehr so niedlich.
Ihre Nebenrolle hat sich die Wissenschaft in meinen Augen selbst eingebrockt. Das hat mindestens zwei Gründe. Der erste Grund: Sie schafft es nur selten, zu erklären, was sie wirklich leistet. Und wenn der Journalismus einspringt, führt das gar nicht so selten zu einer Verschlimmbesserung. Schade eigentlich. Kommen wir zum zweiten Grund: Es ist schwer, verständlich über Wissenschaft zu schreiben. Und viele, die es versuchen, halten sich außerdem nicht an die Spielregeln: Welche Studie belegt meine Behauptung? Wie eindeutig sind die Beweise? Welche Schlüsse darf ich daraus ziehen? Wenn Prof. Dr. Dr. Dr. XYZ meinungsstark warnt, dass Smartphones dem Lernen schaden, ist das noch lange keine wissenschaftlich begründete Aussage. Manchmal ist in einer Behauptung eben nicht das drin, was draufsteht.
Ich glaube an eine Wissenschaft des Lernens. Und ich bin davon überzeugt, dass Wissenschaft verständlich erklären kann, was funktioniert und was weniger funktioniert, was stimmt und was weniger stimmt. Ohne verklausulierten Fachjargon, sondern im So-klar-wie-möglich-Text. Darum bemühe ich mich in diesem Buch.
Was habe ich vor? Nehmen wir dazu die Redewendung »Jemandem einen Bären aufbinden«. Ich möchte mit diesem Buch gerne zehn Bären von Ihnen losbinden. Stellen Sie sich diese Bären als Schauspieltalente vor. Sie geben sich geschickt als seriöse Erklärbären aus und wollen Ihnen eis(bären)kalt immer wieder ihre Lernmythen unterjubeln. Einer flüstert Ihnen zum Beispiel ins Ohr: »Wussten Sie eigentlich schon, dass Sie nur zehn Prozent der Gedächtniskapazität Ihres Gehirns nutzen?« Dann denken Sie vielleicht erst mal: »Wow, echt?« In dem Moment tippe ich sanft auf Ihre Schulter und weise höflich darauf hin: »Sie haben da was auf Ihrem Rücken!«
Gegen Ende des Bucheszeige ich Ihnen, wie man Erklärbärenfallen aufstellt. Außerdem verrate ich, was man denn wirklich tun kann, um lebenslang lernfähig zu bleiben.
2. Beweise bitte!
Ich bin Wissenschaftler, genauer gesagt: Gehirnentwicklungsforscher. Deshalb möchte ich möglichst eindeutig beweisen, was ich Ihnen hier erzähle. In meinem Beruf ist das eigentlich selbstverständlich. Was hätten Sie auch von einem Wissenschaftler, der in eine andere Rolle schlüpft und nur seine eigene Meinung herausposaunt? Das bedeutet auch, dass ich es offen zugebe, wenn die Wissenschaft mal keine Beweise parat hat. Oder wenn die Beweislage gerade eher mau ist.
Um meines Amtes zu walten, habe ich wissenschaftliche Datenbanken nach Fachtexten zu den einzelnen Themen dieses Buches durchsucht. Dann habe ich die potenziell passenden Fachtexte gelesen. Ein paar davon haben es in dieses Buch geschafft, genauer gesagt 89 Artikel. Jeden dieser Artikel habe ich überprüft und ihm je nach Qualität eine bestimmte »Beweiskraft-Stufe« zugeordnet. Diese Stufen möchte ich Ihnen kurz erklären, damit Sie meine Bewertungen nachvollziehen können.
Stufe 5/5
Bedeutet: Daran gibt es wirklich nichts zu rütteln.
Diese Ergebnisse sind mehrfach unabhängig bestätigt worden. Dabei gibt es keine nennenswerten Einschränkungen. An solchen wasserdichten Beweisen war ich natürlich besonders interessiert. Aber sie sind schwer zu finden. Trotz sorgfältiger Suche sind nur zwölf der 89 Artikel auf dieser höchsten Stufe gelandet.
Stufe 4/5
Bedeutet: ein belastbarer Beweis.
Die Fragestellung ist klar und die Untersuchung liefert ebenfalls eine klare Antwort. Hier und da wünscht man sich vielleicht noch mehr Daten oder eine weitere Kontrolluntersuchung. Aber insgesamt kann man sich auf die Ergebnisse verlassen.
Stufe 3/5
Bedeutet: Auf den ersten Blick sieht alles in Ordnung aus.
Bei näherer Betrachtung hapert es dann aber doch an der einen oder anderen Stelle. Ein Beispiel sind kleine Trainingseffekte, die größer dargestellt werden, als sie eigentlich sind. Hier sollte man den Ball flach halten.
Stufe 2/5
Bedeutet: wenig überzeugend.
Typisch sind hier mehrdeutige Ergebnisse, die viel Spielraum in der Auslegung lassen. Oder sogar ganz andere Erklärungen, die nicht ausgeschlossen werden können. Häufig ist die Untersuchung nicht streng genug kontrolliert oder nicht groß genug angelegt. Vorsicht!
Stufe 1/5
Bedeutet: nicht seriös.
Die Datenqualität ist fragwürdig oder grundlegende handwerkliche Fehler fallen sofort auf. Stellenweise stolpert man über widersprüchliche Aussagen. Es gibt gute Gründe, dieser Untersuchung zu misstrauen.
Stufe 0/5
Bedeutet: unverantwortlich.
An den Haaren herbeigezogene Schlüsse, die von den Daten überhaupt nicht gestützt werden. Nur ein Artikel in diesem Buch hat sich diese Blöße gegeben. Der Anteil wäre aber vermutlich weitaus höher, wenn ich die gesamte Literatur gelesen hätte. Aber leider bräuchte ich dafür mehr als ein Leben.
Die Welt der Forschung ist kein Ponyhof. Wissenschaftliche Untersuchungen werden (mehr oder weniger) rigoros begutachtet, bevor sie zur Veröffentlichung freigegeben werden. Diese Begutachtung läuft anonym ab. Wenn es schlecht läuft, weiß man als Wissenschaftler also nie, welche Kolleg*innen einen mal wieder auseinandergenommen haben. Bekommt man dann eine Arbeit um die Ohren gehauen, an der man jahrelang gearbeitet hat, ist das natürlich frustrierend. Aber es geht nun mal um die Sache und nicht um Befindlichkeiten. In diesem Sinne bitte ich alle Kolleg*innen, meine Beweiskraft-Einstufungen nicht persönlich zu nehmen. Ich möchte die Leistung der Beteiligten keinesfalls schmälern und ich weiß ihre aufwendige Arbeit sehr zu schätzen. Meine eigenen Werke, dieses Buch mit eingeschlossen, stehen natürlich auch zur offenen Diskussion.
3. Lernen im Schlaf
Den Timer für den Audio-Sprachkurs einschalten, die tonausgabefähige Maschine ans Bett stellen, einschlafen, aufwachen und am nächsten Morgen wieder ein bisschen besser Chinesisch sprechen. Ein Traum, oder? Wir verschlafen schließlich locker ein Drittel unseres Lebens. Da wäre es doch nett, aus dieser Masse an Zeit mehr machen zu können. Vokabeln zu pauken, kann ein hartes Brot sein. Da käme sie doch gerade recht, diese Kopfarbeit in Abwesenheit.
Kein Gerät mit Timer zu haben, wäre keine überzeugende Ausrede für das Lernen beim Schlummern. Denn es gibt schließlich auch andere Lösungen. Man könnte zum Beispiel jemanden bitten, ein Audio-Ausgabegerät anzuschalten, nachdem man eingeschlafen ist. Obwohl das natürlich schon aufwendiger wäre. Und bei dieser Maßnahme zeigt sich auch das erste ernsthafte Problem, nämlich die Beantwortung der Frage: Welchen Einfluss haben Geräusche auf die Schlafqualität? Ein besonders heikles Thema für ruhebedürftige geräuschsensible Wesen wie mich. Ohne meine Ohrstöpsel geht nichts. Ich brauche zum Schlafen Stecknadelfallstille. Ich hatte kürzlich mal nachts keine Ohrstöpsel zur Hand und habe den nächsten Tag im Körper eines Zombies erlebt. Dieses Erlebnis passt zu dem Ergebnis einer Untersuchung1, die ich für einigermaßen solide halte (Beweiskraft-Stufe 3/5). Sie zeigt, dass die Robustheit des Schlafes gegenüber Geräuschen individuell sehr unterschiedlich ist. Ich bin mir sicher: Mein Schlaf wäre bei Beschallung so robust wie mein Vorsatz, nie wieder Zucker zu essen.
Na gut, was ist mit den weniger geräuschempfindlichen Menschen? Haben sie eine Chance auf erholsamen Schlaf, wenn hörbar neben ihrem Bett gesprochen wird? Das könnte man meinen, wenn man sich den Artikel2 mit der Überschrift Das Gehirn verteidigt seinen Schlaf gegen Lärm in einer bekannten Tageszeitung durchgelesen hat. Doch die Untersuchung3, die dort besprochen wird, ist in meinen Augen handwerklich ausbaufähig und befindet sich auf Beweiskraft-Stufe 1/5. An der Studie haben sich junge Leute beteiligt, die freiwillig drei Stunden früher aufgestanden sind. Es handelte sich somit um einen Eingriff in den natürlichen Schlafrhythmus. Am Abend haben sie sich eine Hirnstromkappe aufgesetzt und versucht, in einem Hirnmessmagneten zu schlafen – mit Kopfhörern, durch die sie Töne hörten. Das war gegen 21 Uhr, also ganz schön früh. So früh gehen höchstens Leute wie ich ins Bett. Zu bedenken ist auch, dass Hirnstromkappen Noppen haben, die ein bisschen wehtun, wenn man darauf liegt. Auch Kopfhörer fördern nicht gerade den Schlafkomfort. Das könnten Gründe sein, warum die Versuchspersonen so zappelig eingenickt sind. Für die Qualität der Daten sind Zappeleien aber ein echtes Problem. Sie können Hirn-Signale auslöschen. Deswegen bleibt offen, ob das Gehirn bei Geräuschen im Schlaf tatsächlich seine Hörsensoren herunterregelt. Oder ob die Signale weggezappelt worden sind. Außerdem bildet das Ergebnis nur die ganze Gruppe ab. Wir wissen nicht, wie gut der Lärmschutz bei einzelnen Personen geklappt hat.
Ein letzter Rettungsversuch: Schlafen trotz Geräuschkulisse kann man vielleicht trainieren. Manche Menschen, die eine militärische Spezialausbildung durchlaufen, machen das angeblich auch. Aber möchte man sich diesen Verlust an Lebensqualität wirklich antun? Droht bei dieser Geräuschkulisse nicht ein Schlafentzug, der wiederum erwiesenermaßen die Lernfähigkeit beeinträchtigt (Untersuchung4 auf Beweiskraft-Stufe 5/5)? Mit diesen Zweifeln verliert die Idee, sich das Lernen im Schlaf anzutrainieren, doch einiges an Reiz.
Meine Empfehlung: Lassen Sie Ihre Schlafruhe lieber in Ruhe. Selbst wenn Lernen im Schlaf funktionieren würde (dazu kommen wir gleich), wäre der Preis zu hoch. Warum? Die Antwort gibt uns die schon angesprochene erste Untersuchung1: Je höher der Geräuschpegel, desto weniger Schlafspindeln erzeugt das Gehirn. Schlafspindeln sind ganz besondere Hirnströme; zackige Hirnströme im wahrsten Sinne. Der Stromfluss wird in Sekundenbruchteilen abwechselnd stärker und schwächer. Wird das aufgezeichnet, wird eine scharf gezackte Linie sichtbar. Das sind Spindeln. Sie entstehen bei leichtem Schlaf. Und warum ist es nun wichtig, dass unser Gehirn solche Schlafspindeln produziert? Weil sie anzeigen, dass das Gehirn Eindrücke des Tages im Schlaf noch einmal durchspielt. Wird diese Replay-Taste blockiert, brennen sich Eindrücke weniger stark ins Gedächtnis ein. Das haben unzählige, zum Teil sehr überzeugende starke Untersuchungen5 gezeigt (mit Beweiskraft-Stufe 5/5). Lernen im Schlaf wäre also vermutlich mit Verlusten verbunden, denn die Inhalte, die beim Schlafen durch Audiotexte hinzukommen, würden Inhalte verdrängen, die davor im Wachzustand aufgenommen worden sind.
Doch nun zur entscheidenden Frage: Kann das mit dem Lernen im Schlaf überhaupt funktionieren? Ich sage: wenn überhaupt, dann nur bei leichtem Schlaf. Also praktisch nur in der Einschlafphase. Startet also der Lern-Audiokurs später, können wir nicht sicher sein, ob wir gerade in einer Leicht- oder in einer Tiefschlafphase sind.
Aber warum kommt nur leichter Schlaf infrage? Das wissen wir aus einer recht geschickt gemachten Untersuchung6 (Beweiskraft-Stufe 3/5). Dort waren Versuchspersonen eine ganze Nacht lang an ein Hirnstrommessgerät angeschlossen. So konnten sie alle Schlafphasen durchlaufen, und man konnte ablesen, in welcher Schlafphase sie sich gerade befanden. Dabei bekamen sie über einen Lautsprecher einzelne Wörter vorgespielt. Ihre Aufgabe war, per Tastendruck mit der linken oder rechten Hand zu entscheiden, ob das Wort ein Tier oder ein Gegenstand war. Das konnten sie nur bei