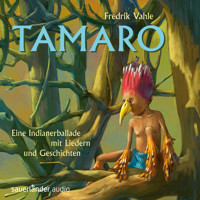16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Seit mehr als 45 Jahren gehört er zu den bekanntesten Kinderliedermachern in Deutschland. Millionen Kinder sind mit seinen Liederhelden und -heldinnen »Anne Kaffekanne«, dem »Hasen Augustin« oder dem »Cowboy Jim aus Texas« aufgewachsen. Aber der Li-la-Launebär war Fredrik Vahle nie. Geprägt vom Aufbruchsgeist der späten 60ger Jahre wollte der habilitierte Linguist nicht nur unterhalten, sondern hatte immer auch eine Botschaft. Ums Miteinander geht es in seinen Liedern, um Selbstwahrnehmung und Fürsorge, um den Mut zur Freiheit, aber auch ums Hinhören und die Stille.
In diesem Buch blickt der sich immer wieder neu erfindende Poet auf sein wandlungsreiches Leben zurück. Keine Biografie hat er geschrieben, vielmehr nimmt er seine Leserinnen und Leser mit auf »Erinnerungsausflüge«. Flanierende, nachdenkliche, ironische und komische Geschichten über das, was Fredrik Vahle wichtig geworden ist. Das heitere Buch eines freien Menschen mit der Experimentierfreude eines Kindes. Ein Buch voller Weisheit und Ermutigung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 395
Ähnliche
Fredrik Vahle
Schräge Lieder
schöne Töne
Erinnerungen und Denkausflüge
zwischen Anne Kaffeekanne und Cowboy Jim
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://portal.dnb.de abrufbar.
Copyright © 2019 Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
Umschlagfoto: © Paul Alexander Probst, EVOLAIR
ISBN 978-3-641-25008-9V001
www.gtvh.de
»In Zusammenhang mit all dem kommt mir der
Gedanke,
dass die Kunst, mit der ich mich beschäftige,
nicht als Ausdruck meiner selbst, sondern nur als
Akkumulation,
als das von mir im Umgang mit Menschen Erfasste
möglich ist.
Kunst wird in dem Moment zur Sünde,
in dem ich sie für meine eigenen Interessen zu
nutzen beginne.
Das Wichtigste ist, dass ich aufhöre, mir selbst
interessant vorzukommen.
Möglicherweise ist genau dies der Beginn meiner
Liebe zu mir selbst.«1
(Andrej Tarkowski)
Inhalt
Vorbemerkung
Und das mit 75
Soundpanoptikum einer mäßig musikalischen Kindheit
Wenn abends die Heide träumt – Pfiffe, Summen, Juchzer
Stalins Lieblingslied, Fritze Bollmann und Freie-Wildbahn-Verse
Erste Kinderworte und das Herz-Geheimnis der Sprache
Darmstadt-Schuldorf und die weite Welt
Auf der Suche nach Musik. Schräge Töne wirken!
Freude, schöner Götterfunken und traurige Männertrostlieder
Absaufen oder gehen, gehen, gehen
Griechischer Wein, die Weltrevolution und Karl Marx in Salzböden
Seht mal, wer da rennt
Eine Anne-Kaffeekanne-Liederreise
Ich bin ich … und was ist mit den andern?
Das Katzentatzen-Thema Liebe
Hans mein Igel und Frau Holle –
Verwandlung und mein Weg zum Märchen
Einfach nur: Beweglichkeit
Schritte und Gangarten auf meinem Lebensweg
Tigeroma – Zauberhände
Vom Segen des Sich-Bewegens
Liegend den Horizont überschreiten
»Niederlagen« inklusive
Es ist nie zu spät …
»Wenn ihr nicht werdet …«
Dank
Anmerkungen
Literatur und Quellen
Vorbemerkung
Ich habe gehört, dass, bevor wir diese Welt verlassen, das ganze Leben in einer Art Film in allen Einzelheiten vor uns abläuft. Das findet sich in Beschreibungen von Nahtoderlebnissen und in vielen anderen Quellen. Unserem Bewusstsein scheint viel mehr zugänglich zu sein als das, was wir meinen, aus ihm abrufen zu können. Der sogenannte »Lebensfilm« ist ein letztes Beispiel dafür. Warum nicht etwas versuchen wie eine notwendigerweise subjektive Vorschau auf diesen Bewusstseinsfilm, sinnvoll als Innehalten zur Bewusstwerdung – gelingt das?
Dieses unserem normalen Zeit- und Erlebnisverständnis unerklärliche Phänomen des Lebensfilms weist auf etwas hin. Die Gesamtsicht auf unser Leben bleibt uns nicht erspart, egal, wie wir gestrickt sind. Einen umfassenden Totalfilm meines Lebens kann ich hier natürlich nicht abliefern, obwohl dieses Bestreben in Biografien immer wieder zum Ausdruck kommt. Ich möchte aber versuchen, aus der Sicht dessen, was mir inzwischen im Leben wichtig geworden ist, einen Blick auf mein Leben zu werfen. – Also keine vollständige Biografie, sondern Erinnerungsausflüge aus dem Impuls jetziger Einsicht und der Vorausahnung zukünftiger Ereignisse …
Und das mit 75
Gerade habe ich die erste Gesangsstunde meines Lebens bekommen.
Mit 75.
Alles zu seiner Zeit …
Anfang ist immer …
Man lernt nie aus …
Mein Gesangslehrer heißt Anselm Richter. Anselm hat eine ganz besondere Lehre vom Singen entwickelt. Eine sehr besondere …
Gleich höre ich auch die Stimme von Mehmet, meinem Lieblings-Minitaxi-Fahrer und leidenschaftlichen Sänger: »Wenn ich singe, bin ich andere Mensch.« Er singt auch so. Er macht nicht die Töne. Die Töne machen ihn …
Anselm hat dieses Thema in seiner Arbeit aufgegriffen:
Singen heißt nicht, Töne machen. Sondern Töne empfangen. Sich empfänglich machen. Nicht die Stimme stützen, manipulieren, Stimmmaterial forcieren … Aus der Dualität herauskommen, d. h. beim tönenden Ausatmen schon den Einatem beleben. Die »heilige Mundhöhle« wie bei einem Gähn-Reflex locker öffnen, sich an das Lächeln der Mona Lisa erinnern, die Oberlippe etwas nach oben ziehen. Die Seelenlaute der Vokale tief in der »heiligen Mundhöhle« empfangen. In jedem Vokal die öffnende A-Kraft, die formende O-Kraft und die aufrichtende I-Kraft beleben … und im entstehenden Tonraum oben Leichtigkeit und unten Gewicht und Schwere aufspüren … »Der Mund ist aufgegangen«, soll das geplante Buch von Anselm heißen. –
Halt!
Hat das etwas mit einem Blick auf mein Leben zu tun? Üblicherweise fängt so etwas ja mit dem Geburtsdatum und Geburtsort, Eltern, Großeltern, Zeitumständen usw. an. Und ich bin gleich beim Singen und beim Ton gelandet. Doch ich möchte in mein Leben eher hineinhorchen, -lauschen und -spüren. Ton und Person klingen nicht nur ähnlich. Sie lassen sich auch in Hinsicht auf unser Ich, die Entwicklung unserer Individualität aufeinander beziehen: Jeder Mensch sein eigener Ton, sein eigenes Lied, sein ganz eigenes Schwingungsmuster. In sich selbst empfunden und dann auch geäußert … und … und … ein ganzes Leben lang. Gereimte Zeilen kommen mir da in den Sinn:
»Noch ist der Ton
ganz leise und klein,
doch er will in die Welt,
er will hörbar sein.
Er macht sich aus seiner Stille los,
er-tönt und er-klingt,
schwillt an und wird groß …
Du kannst einen Ton
weder riechen noch seh’n.
Du kannst ihn erhören
und ein wenig versteh’n …
Ist er sanft, ist er schräg,
ist er laut, ist er schrill;
ist er hart oder weich,
klingt er so, wie er will?
Aus der Stille heraus
kommt jeder Ton und …
geht wieder in die Stille davon …«2
Gar so viel mehr Essenzielles lässt sich über ein Menschenleben auch nicht sagen. Und andererseits bin ich schon mittendrin in den Schwingungs-, Erlebnis- und Ausrichtungsthemen meines Lebens und was es für andere bedeuten könnte.
In einem gestalttherapeutischen Stimm-Seminar, in dem ich auch meine jetzige Lebensfreundin Barbara Wolf kennenlernte, schrieb ich einmal Folgendes, das hier hineingehört:
Meine ersten Schreie
ziemlich laut
und unter einem schwarzen Haarschopf
Mein Lallen und Babbeln
Allerlei Laute und
Vogel- und Tierstimmen
Noch nicht wissen
dass ich ein Mensch bin
Singen
mit dem Kindermädchen
Singen
mit dem Vater
Lieder singen
heißt zuhören
und berührt werden
Buchstabieren und Lesen
Buchstabenfiguren
mit angestrengter Stimme
Geheimnissen auf der Spur
Rufe
zu den anderen Kindern
Ahuuu – ahuuu – ahuuuu
Altmärkischer Stadtindianer
Baum- und Dachhocker
Butzenbauer
Liedersingen in der Schule
Stalins Lieblingslied
Fahrtenlieder singen
nächtelang am Lagerfeuer
Hinterher, hinterher bis ans Meer
Bundeswehr
Keine Kommandostimme
Kräht wie Billi auf ’m Mist
Studentenzeit
Viel Üben
Protestieren
Lachen
Universität
Die angestrengte akademische Stimme
Körperarbeit und Bewusstwerdung
Die Neuentdeckung der eigenen Stimme
in die Tiefe
in die Höhe
in die Gefühle
ins Fühlen
bis hin, wenn ’s nicht mehr ge-hin-dert wird
zur Emotion
Des is de Fritz
der secht naut
der guckt nur …
Soundpanoptikum einer mäßig musikalischen Kindheit.
Wenn abends die Heide träumt – Pfiffe, Summen, Juchzer
Es stimmt.
Im Alter von 75 Jahren habe ich noch einmal neu mit dem Singen begonnen. Dabei habe ich nachweislich mit vier Jahren mein erstes Konzert gegeben …
Ich schaue und horche zurück.
Ein kleiner Junge in von der Mutter genähten Hosen, in Kniestrümpfen steht er da im Wohnzimmer eines als »Villa« bezeichneten Hauses, in der Nikolaistraße 36, ganz in der Nähe des backsteingotischen Doms in Stendal, in der Altmark, damaliger Bezirk Magdeburg, Ostzone – »Soffjetzone«, wie Adenauer das sagte, schließlich DDR und jetzt »neues« Bundesland Sachsen-Anhalt. Da steht er mit etwas zu großem Kopf, ernstem, fast traurigem Blick. Irgendwie etwas daneben. Doch wenn er singt, holt er auf. Da steht er, der wechselweise Aki, Fritzlein, Fissiken, Fritz-Eckart, Fritze, später auch Charly oder Fredrik genannt wurde. Die Eltern, die Großeltern und der drei Jahre jüngere Bruder Karsten sind das Publikum. Und er will ihnen ein Lied vorsingen, und das tut er aus Leib und Seele. Nein, er singt kein Kinderlied aus dem Kindergarten, den er nur kurz besuchte. Es musste wohl schon damals etwas anderes als »Alle meine Entchen« sein.
»Wenn abends die Heide träumt,
erfasst mich ein Seeehnen,
und ich denke unter Trääänen
an verlorenes Glück.«
Die Heide kennt der Junge aus den Erzählungen des Vaters, der als Ruhrgebietskind in die Heide verschickt wurde, sich dort mit einer Bauernfamilie samt Schäferhund anfreundete, sodass die Lüneburger Heide so eine Art Kindheits- und Jugendparadies für ihn wurde, das er sich durch Absingen der Lieder – »In der Lüneburger Heide, in dem wunderschönen Land, ging ich auf und ging ich unter …« – immer wieder vergegenwärtigte. Das Lied, das der Junge da sang, drückt keine reine Freude an Harmonie und Idylle aus. Keine heile Kinderwelt. Da gab es nicht umsonst in seinem Lied die Tränen und das verlorene Glück. Und selbst in Vaters Kindheitsparadieserinnerungslied heißt es ja: »ging ich auf und ging ich unter« …
Und dann das Bild im mit Möbeln vollgestellten Schlafzimmer der Großeltern in ihrer Wohnung in der Karl-Liebknecht-Straße 16; das Schlafzimmer vollgestellt, weil eine Flüchtlingsfrau aus Ostpreußen in die Wohnung aufgenommen wurde, die Frau Trense hieß. Auf diesem Schlafzimmerbild war eine abendliche, sehr harmonische Heidelandschaft mit Bauernhof zu sehen. Aber auch ein sehr großer, dunkelhaariger Hund, vor dem der Junge Angst hat, denn das Kinderbett steht in der Nähe des Hundes. Und wenn die Großeltern das Licht gelöscht hatten, war immer noch dieser Hund zu sehen. Oder noch hinterlistiger: Er hatte sich versteckt, um unerkannt heranzuschleichen. Eine riesige Gefahr also. Der Großvater erzählte dann zwischen Tür und Angel das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Immer, immer wieder. Mit den Tieren im Märchen und auch mit dem Märchenhund konnte der Junge sich gut anfreunden. Und darüber hinaus war in diesem Märchen ja auch das Thema Weglaufen aus enger Häuslichkeit, waren Wanderschaft und Musik thematisiert. Etwas, das im späteren Leben des Jungen von großer Bedeutung sein würde. »Die Bremer Stadtmusikanten« wurde so lebenslang sein Lieblingsmärchen.
Das Dunkle und Angsterregende in einer scheinbar heilen Kinderwelt ängstigte und faszinierte ihn zugleich. Wenn er genauer hinhörte und hinsah, konnte er es in Klängen, Liedern und Bildern immer wieder entdecken. Das Brave, »Artige«, Harmonische und Saubere war für ihn oft wie ein Zwang, verbunden mit Langeweile und Belohnung, zumal er eine solide Grundversorgung mit den entsprechenden Kinderliedern nie erhalten hat. Und das kam so:
Seine Großmutter sang für ihn nie Lieder und war doch in einer ländlichen Umgebung aufgewachsen, wo Kinderlieder und erst recht Volkslieder jedenfalls aus romantischer Sicht zu erwarten waren: »Wo denkst du hin, ich musste schon als kleines Mädchen Kühe hüten«, und sie erzählte ihm von einer Kuh, die sie durch ihre Widerborstigkeit schier zur Verzweiflung gebracht hatte. Seiner Mutter war in der Nazizeit beim BDM (Bund deutscher Mädel) das Volksliedersingen verleidet worden. Und so kamen seine frühen Singanregungen von den Schlagern und Moritaten des Kindermädchens:
»Zarinda, ein zartes Naturkind«
»Das muss ein Stück vom Himmel sein, Wien und der Wein«
sowie eine schauerliche Moritat von einem Soldaten mit zwei abgeschossenen Beinen.
Er schlief damals in einer engen Stube unter dem Dach, mit einer schrägen Decke und einer Dachluke, durch die man mit Hilfe eines Stuhls als Klettergerüst aufs Dach des Hauses steigen konnte, um mutterseelenallein und glücklich die Welt von oben zu betrachten. Stundenlang. Und dort oben wurde dann auch Ellen, das Kindermädchen, untergebracht, die er sehr mochte und in die er auch ein wenig verliebt war. Er hat sie in guter Erinnerung, auch wegen der Lieder. Jetzt erfuhr er von seinem Bruder, dass Ellen in jener Dachstube, noch während seiner Kinderzeit, an Diptherie gestorben sei. Er konnte sich an dieses sicherlich für ihn schreckliche Erlebnis nicht mehr erinnern! –
Sein Vater sang auch Lieder, die er beim CVJM, dem Christlichen Verein junger Männer gelernt hatte, insbesondere:
»Jetzt kommen die lustigen Tage!!«
Eigentlich ein durch und durch optimistisches Lied. Nur diese eine Zeile: »Und ein lustiges Blut kommt überall davon« – das gab dem Jungen zu denken, wo er doch Blut hauptsächlich in Zusammenhang mit Verletzung und Schmerz kennengelernt hatte. Ganz zu schweigen von dem, was er in der Kirche erlebte beim Anblick des gekreuzigten Heilands bzw. in der Liedstrophe »Oh Haupt voll Blut und Wunden« …
Jetzt hätte er beinahe seinen Großvater vergessen, der als pensionierter Volksschullehrer mit einer von langen Dienstjahren ramponierten Stimme unbedingt zu dem dazugehört, was der Junge in früher Kinderzeit als Gesang und Lied erleben konnte.
Der Großvater sang nicht oft, aber heftig. Und dann in erster Linie ein Lied, und zwar den »Lindenbaum« von Franz Schubert. Seine Stimme hätte gut zu Joe Cocker und zum Blues gepasst, die er natürlich nicht kannte; doch heute weiß der Junge es ganz genau: Der Lindenbaum war der Blues des Großvaters. Nicht so sehr rhythmisch, aber von der Emotion, vom Blues-Gefühl her. Also ziemlich weit vom sogenannten Belcanto entfernt, was ihm dann häufig die aus der Küche tönenden Worte der Großmutter einbrachte: »Otto, knötter nicht so!«
Das waren also die Lieder und Gesänge meiner frühen Kindheit, in denen mich von klein auf die Fenster und die Wege nach draußen interessierten. In versteckter Form gibt es so etwas auch in traditionellen Kinderliedern, die zum Teil ja umgedichtete Volkslieder sind. Die Aufbruchstimmung in »Hänschen klein« war etwas, was mich schon früh begeisterte. »In die weite Welt hinein«, das war mein Ding. Der zweite Teil mit der weinenden Mutter nicht. Zumal mir meine Mutter für eigene Unternehmungen viel Freiheit gab. Die reichten von Streifzügen mit Gleichaltrigen durch die Wälder bei Stendal bis hin zu Trampfahrten nach Schweden und Spanien, die ich als 16- bzw. 17-Jähriger unternahm. Sie freute sich dann sehr, wenn ich zurückkam und ihr erzählen und singen konnte, von dem, was ich draußen erlebt hatte.
Stalins Lieblingslied, Fritze Bollmann und Freie-Wildbahn-Verse
Geräusche, Klänge und Gesänge außerhalb der Familie …
Aus dem Erdgeschoss unseres Hauses in der Nikolaistraße erklang häufig Geigenspiel. Da wohnte nämlich der erste Geiger des Stendaler Stadttheaters, der den schönen Namen Kratzer trug. Da waren die Meckertiraden von Oma Süß und die Schimpfkanonaden von Frau Kratzer, die manchmal alles übertönten und als großes Drama aufgeführt wurden, doch dann wieder friedlicher Stille Platz machten. Da waren die nicht enden wollenden Traktorengeräusche von der Landmaschinen- und Traktorwerkstatt Schreiber, die die Traktorenmotoren lange probelaufen ließ. Ein Geräusch, an das man sich auch gewöhnen konnte. Und dann wieder wurde so ein Flappern hörbar, wenn ein Auto die Nikolaistraße am Dom vorbei in die Innenstadt fuhr. Da war das Tschilpen der Spatzen, der Buch- und Grünfinken, der Amseln und Stare und schließlich die weithin hörbaren Rufe der Turmfalken vom nahen Stendaler Dom.
Einen singenden Hausgenossen hatte ich mir dann später in einer tagelangen Verfolgungsjagd in den Schrebergärten vor der Wohnung meiner Großeltern eingefangen. Es war ein Star mit einem verwundeten Flügel, den ich mit Mehlwürmern fütterte und der zu meiner großen Freude lange Gesänge anstimmte, sich dabei plusterte und schüttelte und sogar Percussions-Einlagen durch Schnabelklappern in seine Gesänge einflocht. Wenn mein Bruder mit dem Großvater vierhändig Klavier spielte, konnte es vorkommen, dass der Star sich auf den Kerzenhalter am Klavier setzte und stargenau die Melodie des jeweiligen Klavierstücks mittirilierte. Ich nannte den Star Tilo. Er war für mich ein Sinnbild dafür, wie man mit ganzer körperlicher Hingabe bis in die kleinste Feder hinein musizieren konnte. Tilo sang nicht so schön wie eine Schwarzdrossel oder gar eine Nachtigall, war aber an akustisch-musikalischer Vielfältigkeit kaum zu überbieten.
Eher grenzwertig waren dagegen die Grunz- und Quiekgesänge eines Wildschweinfrischlings, der mir beim Ziegenfutterholen über den Weg gelaufen war. Ich habe ihn gejagt und dann in meinen Ziegenfuttersack gesteckt. Ich brachte ihn mit nach Hause und ließ meine Eltern raten, was wohl in dem Sack sei. Sie vermuteten eine Katze, ein Hund, ein Igel. Ich legte den Sack auf den Boden. Das kleine Wildschwein kam aus dem Sack hervor, schaute uns verwundert an, schnupperte in der Luft herum, stakste dann zum Schuhregal, wo die Schuhe meines Vaters standen, schnupperte noch einmal daran, um sich zu vergewissern und – kackte hinein. Später unterhielt es sich dann mit den Hausschweinen. Das war für mich eine wunderbare Gelegenheit, die Schweinesprache zu studieren. Doch eines Tages lag es tot im Stall. Es hatte wohl die Kuhmilch, mit der ich es fütterte, nicht vertragen. Zum Trost schenkten mir meine Eltern eine Tafel West-Schokolade.
Starengesänge und Grunzlaute … – Natürlich haben wir Kinder auch selbst gesungen, und hier komme ich zu dem, was Peter Rühmkorff in seiner Schrift »Über das Volksvermögen« die »Reime und Gesänge der freien Wildbahn« nennt. Zunächst wurde ich besungen, und zwar mit Worten, deren Sinn ich gar nicht verstand. Und zwar nur, weil ich »Fritz« heiße. In einem dieser Sprüche tauchte das mir damals völlig fremde Wort »Selleriesalat« auf. Nach und nach bekam ich mit, dass das was zum Essen war, mit dem ich aber keinerlei Erfahrung hatte. Und als ich es probieren konnte, schmeckte es mir nicht. Trotzdem musste ich mir immer wieder anhören, was psalmodierend zu mir herüberklang:
»Fritzchen freu dich,
morgen gibt’s Selleriesalat!«
Ausführlicher und sogar in Liedform wurden mir immer wieder die Verse von »Fritze Bollmann« vorgesungen, der beim Angeln ins Wasser fällt und um Hilfe schreit. Stendal hat einen kleinen Fluss, die Uchte; eigentlich, wie mir ein alter Stendaler jüngst erzählte, der »Stadtgraben«. Die eigentliche Uchte wurde auf der Höhe der Uferstraße unterirdisch quer durch die Stadt zum Schwanenteich geleitet. Und es gab einen ziemlich großen Stadtsee mit ziemlich vielen Anglern. Die Szenerie von Fritze Bollmann konnte ich mir schon besser vorstellen. Natürlich war die Handlung des Liedes frei erfundene Dichtung; doch 40 Jahre später machte ich eine lange Fußwanderung durch Deutschland und durchquerte auch die Stadt Brandenburg bei Berlin, als ich plötzlich vor einem Gedenkstein stand, der Fritze Bollmann gewidmet war, einem stadtbekannten Barbier und Original, der beim Angeln auf dem Beetzsee ins Wasser fiel und ertrank …
Schließlich wurde mir ein weniger tragischer, aber dafür sehr bekannter Fritz-Vers gerne nachgerufen:
Fischers Fritze fischte frische Fische,
frische Fische fischte Fischers Fritze.
Noch heute klingen diese Verse und Gesänge in mir nach, wenn es um meinen Vornamen geht, wenn mein Name ins Assoziationsspiel kommt.
Andere Reime und Gesänge sind mir in Erinnerung geblieben, weil da auf drastische Weise sexuelle Aufklärungs- bzw. psychische Abhärtungsarbeit geleistet wird:
Banane, Zitrone
an der Ecke steht ein Mann.
Banane, Zitrone
er lockt die Weiber an …
oder
Negeraufstand ist in Kuba,
Schüsse hallen durch die Nacht,
Weiße werden abgeschlachtet
und die Totentrommel kracht.
oder
Es war einmal ein Mann,
der hieß Pu Pam
Pu Pam hieß er
ein’ Pup ließ er.
Wer solche Verse und Gesänge kannte, gerade auch über sichernde Distanzen hinweg, wer sie variieren und umdichten konnte und vor allen Dingen, wer sie schnell und treffsicher gebrauchen konnte, der galt etwas in der jeweiligen Kinderbande … Es war vielleicht eine Reim- und Liedkultur, die noch ganz ohne das Medium der Schrift auskam. Manchmal war das Ganze nicht frei von Gemeinheit, Klischee und Gehässigkeit, doch war es für mich so eine Art poetischer Kindheitsbodensatz, der in meiner späteren literarischen Arbeit, gerade, wenn es um lebendige, vitale Lieder ging, oft fruchtbar werden konnte. Dann meldet sich etwas zu Wort und Klang, was in gehobener Poesie oft übergangen wird. (Gerade die schrägen Klänge sind es ja häufig, die Entwicklung und Wandlung ermöglichen.)
Zur Klang- und Gesangslandschaft meiner Kindheit gehört noch etwas anderes dazu; ich hatte gehört, dass Russen und Deutsche beim Marschieren singen. Marschierende Russen (im DDR-Jargon »Sowjetsoldaten«), die sangen, waren damals keine Seltenheit und für uns Kinder etwas Faszinierendes, was uns neugierig machte – trotz allem, was uns unsere Eltern und Großeltern über die bösen Russen erzählten, den Iwan, die Muffkis, die Watzkis und was es sonst noch an freundlichen Bezeichnungen für die russischen Soldaten gab. Manchmal marschierten wir auch – soweit wir nicht verscheucht wurden – hinter den singenden russischen Soldaten her, die dann so etwas sangen wie »Djelajesch, Djelajesch«, und wir sangen dann auf Deutsch dazu:
»Leberwurst,
Leberwurst,
wir wollen Leberwurst!«
Wieder eine kindliche Form, mit Sprache und Musik umzugehen, ein Lust- und Erfolgsgefühl zu haben, auch wenn es gefährlich werden konnte. Wir wollten unsere eigenen, machtmusikalischen Erfahrungen mit den russischen Soldaten machen, gegen die von den Erwachsenen oft geschürte Russenangst. Dass die Rote Armee im Verein mit den Alliierten die verbrecherische Existenz Nazi-Deutschlands beendet hatte, war eine weitreichende, oft übergangene historische Tatsache. Die reale – aber dann auch wieder gebetsmühlenhafte – Thematisierung der Befreiung vom Hitler-Faschismus führte in der DDR jedoch zu einer fast distanzierten Freundschaftlichkeit, die die Russen zum vorbildlichen »Sowjetmenschen« emporlobte.
Ein weiteres musikalisches Russenerlebnis kam bei uns Kindern hinzu. Es war jeweils ein besonderer Nachmittag. Im Stendaler »Russenviertel« (ein Stadtteil, in dem fast ausschließlich die Villen betuchter Stendaler standen) gab es Lautsprecher, aus denen fast den ganzen Tag heroische sowjetische Propagandamusik und patriotische Ansprachen, wahrscheinlich von Radio Moskau erklangen. (Nicht mal Radios hatten die damals …) Der siegreiche Sound, der aus den Lautsprechern tönte, hatte etwas Scheppernd-Quäkiges, eher eine akustische Zumutung als ein Ohrenschmaus.
Eine ganz andere Musik ertönte, wenn sich im Russenviertel ein Trauerzug formierte, um einen Toten zur letzten Ruhe zu begleiten. Der sogenannte »Russenfriedhof« lag nämlich weit weg, ca. zwei Kilometer von der Stadt entfernt an der Dahlener Allee in einem Kiefernwald. Der Tote war aufgebahrt, und vor der marschierenden Trauergemeinde ging eine Blaskapelle, die eine Musik machte, wohl russische Trauermärsche, die mich und andere Kinder ganz eigen in ihren Bann zog. (Später sagte mir mein Freund Fitzi, auf dem Russenfriedhof lägen viele Soldaten, die sich an billigem Fusel zu Tode getrunken hatten.) Wir liefen damals lange Zeit in gemessenem Abstand neben dem Trauerzug her, den langen, langen Weg bis zum Russenfriedhof, und immer die traurigen Melodien der russischen Blaskapelle in den Ohren. Es war etwas sehr, sehr Trauriges und Tröstliches zugleich in dieser Musik. Und wir waren die ganze Zeit neben dem Trauerzug her in Bewegung und hörten und hörten …
Einmal nahm mich meine Mutter mit in die Stendaler Marienkirche. Dort gastierte der berühmte Thomanerchor. Die Kirchenbänke waren unbequem und ich musste die ganze Zeit stillsitzen. Der Gesang war schön, klang aber für meine Ohren auch etwas künstlich und andressiert. Dieser Eindruck wurde dann durch meine Erlebnisse im Stendaler Domchor bestätigt. Wir mussten als Zehnjährige bei der Johannespassion mitwirken, haben unendlich lange das »Kreuzige, kreuzige« geübt, für mich eine vokale Quälerei. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Jesus, der ja wusste, was Qualen sind, so etwas zugelassen hätte. Etwas lockerer war das gemeinschaftliche Singen im Schulchor der Comeniusschule, die ich bis zur achten Klasse besuchte. Die meisten Pionier- und Aufbaulieder rauschten eher an mir vorbei. Ausnahmen waren »Blauen Fahnen nach Berlin«, »Bau auf, bau auf«, ein FDJ-Lied, aber mehr noch die DDR-Nationalhymne mit dem Text von Johannes R. Becher und der Musik von Hanns Eisler. Was mir aber am deutlichsten in Erinnerung blieb, war »Suliko«, ein Lied, das mich an die russischen Trauermärsche erinnerte, jedoch ein georgisches Liebes- bzw. Klagelied ist, von dem gesagt wurde, dass es Stalins Lieblingslied gewesen sei.
Die Schule, in der wir dieses Lied sangen, war nicht weit weg vom Stalin-Denkmal, eine auf einem Sockel befestigte Büste des diktatorischen Sowjetführers am Stendaler Stadtsee. Noch lange vor der Wende (1956) war der Sockel plötzlich leer. Ein freiheitlicher Widerstandsakt also? 15 Jahre später outete sich mein Freund Fitzi Lindner als Täter. Er hatte mit einem Freund den Kopf der Büste im Stadtsee versenkt. Bis heute ist sie nicht wiedergefunden worden. Nicht direkt als politischen Akt, wie er sagte, sondern weil sie gerade ihre Zeugnisse bekommen hatten und mit ihren Noten nicht zufrieden waren.
Ein anderes russisches Lied, das eigentlich gar nicht in die DDR-Aufbau- und Zukunftslieder passte, war das Lied vom Glöckchen, »Kalakoltschik«, wie es im Russischen so schön heißt.
Leis’ das Glöckchen ertönt,
so verschwiegen.
Auf dem Weg tanzt der Staub
sacht wie Schnee.
Wo die Felder zum Walde sich neigen,
singt der Fuhrmann sein Lied voller Weh.
Dieses Lied war für mich ein Ausbund an naturseliger Einsamkeit. Wenn man sich ganz darauf einließ, konnte man in seinem eigenen Weinen davonschwimmen – ein gar nicht so unangenehmes Gefühl –, um dann bei einem Lied wie »Kalinka« zu landen, das die ganze traurige Abend- und Mondenstimmung wegwischt und wo nur noch Sonne, Frohsinn und ekstatische Tanzseligkeit vorherrscht. (Tanzen können ’se, die Russen!)
Man sollte vermuten, dass das Lied vom Glöckchen mit dem voller Weh singenden Fuhrmann ganz selbstverständlich in einer Moll-Tonart erklingt. Dem ist aber nicht so. Das Lied steht in Dur. Ähnliches fand ich sonst nur in einem spanischen Volkslied, von Federico García Lorca gesammelt und bearbeitet. Er besingt das todtraurige Schicksal eines jugendlichen Stierkämpfers, dessen Leichnam seiner Mutter überbracht wird. Die Melodie erklingt aber in Dur. In Lorcas oft Haiku-artig kurzen Naturschilderungen schwingt immer wieder ein großes Weinen, eine allgegenwärtige Traurigkeit mit. Das Lied vom Glöckchen ist bei mir aus meiner Schulchorzeit hängen geblieben. Und heute, am 11.8.2018 habe ich es wieder gesungen, zu singen versucht nach der Ein-Ausatem-Methode meines jetzigen Gesangslehrers, und siehe bzw. horche da: Es bekommt seinen ganz eigenen Klangraum und glitzernden Glanz …
Es ist spannend, solche musikalisch-poetischen Impulsströmungen im eigenen Leben zu verfolgen. Bei mir gab es nach der Übersiedlung in den »goldenen Westen«, nach Darmstadt 1956, die Jungenschaft, eine Nachfolgeorganisation der Bündischen Jugend bzw. des Wandervogels, teilweise weltoffen, teilweise auch völkisch-rechts orientiert. Wir ließen uns von der Mutter eines Exilrussen in Griesheim bei Darmstadt russische Hemden, Rubaschkas, nähen, sangen u. a. russische Lieder rauf und runter, trampten 50 Kilometer weit zu einem Don-Kosaken-Konzert, das leider ausverkauft war. Doch wir überbrachten dem damaligen Leiter der Don Kosaken, Sergej Jaroff, einen großen Blumenstrauß und durften uns darauf das Konzert anhören. Kein Wunder, dass mein erstes Saiteninstrument eine Balalaika war, ehe ich zur E-Gitarre und dann zur spanischen Gitarre überwechselte. Begonnen hatte der Instrumentalunterricht jedoch bei meinem Großvater mütterlicherseits, Otto Gießler, der in Stendal auch »Stummel« Gießler genannt wurde, weil er relativ klein war, was ihn nicht hinderte, mit Gott und der Welt Gespräche zu beginnen. Einmal stand er mitten in der Zirkusarena und unterhielt sich angeregt mit dem Direktor. Ein anderes Mal erschien er – wie peinlich – in der Tanzstunde, begann ein Gespräch mit der Tanzlehrerin und zeigte auf seinen mindestens zwei Köpfe größeren »kleinen Enkel da«, wie er sich ausdrückte.
Bei meinem Großvater hatte ich erste Klavierstunden bekommen. Ich schaffte es in Damms »Klavierschule« bis zu dem Lied »Schöne Minka« und zum Geburtstagsmarsch. Danach wurde mir der Klavierunterricht zu anstrengend. Mein Großvater entließ mich gnädig aus der musikalischen Fron. Da war ich zehn Jahre alt. Danach war vier Jahre Pause, bis es dann in Darmstadt mit der Balalaika weiterging.
Die musikalischen Impulse aus dieser Zeit haben in vielen meiner Lieder weitergelebt. Da ist z. B. das Lied vom »Friedensmaler« mit der russischen Strophe »Pust wsjegda budjet solnze« – »Immer soll die Sonne dir scheinen«. Da ist das Lied von »Tanja« aus Leningrad. Mein Vater hatte als Soldat bzw. als »Frontmaler« die Belagerung Leningrads mitgemacht. Während in Leningrad zehntausende Menschen verhungerten, saß er relativ sicher hinter der deutschen Frontlinie und malte hingebungsvoll russische Bauern. Und ich habe mich eine Zeit lang mit der unvorstellbaren Grausamkeit der Blockade befasst und bin mit meiner damaligen Lebensgefährtin Annemarie auch an verschiedene Orte bei Leningrad bzw. dem heutigen St. Petersburg gefahren. Auch zwei meiner relativ bekannt gewordenen griechischen Lieder, nämlich »To chimona« und »Griechisches Winterlied« und schließlich das »Schlaflied für Anne« sind nicht weit von diesem musikalischen Mentalitätsstrom entfernt.
Meine Kindheit in Stendal hatte zwei Phasen: Die erste reichte ungefähr bis zur dritten Klasse. In dieser ersten Phase fühlte ich mich frei und ungebunden. Die langen, langen Nachmittage gehörten mir. Ich konnte machen, was ich wollte. Es gab intensiv ausgekostete Rückzüge in Einsamkeit und Stille. Ich erkletterte Bäume, z. B. die hohen, alten Kastanienbäume vor unserem Haus in der Wilhelm-Külz-Straße, ehemals Nikolaistraße und verbrachte längere Zeit dort oben, wo ich auf die Dächer der Häuser herabschauen konnte und den Stendaler Dom aus einer ganz eigenen Perspektive sah. Ich kroch durch die schon erwähnte Dachluke auf das Dach unseres Hauses und verbrachte dort Stunden in stiller Sicht auf alles, was da friedlich unter mir lag und mir oben nichts anhaben konnte. Niemand wusste, wo ich war, und das habe ich genossen. Später bin ich alleine u. a. nach Spanien und England getrampt und genoss diesen Wechsel von Einsam- und Alleinsein und dann wieder die unverhofften Begegnungen mit anderen Menschen. Ich war schon ein Einzelgänger, und doch als Kind viel mit meinem drei Jahre jüngeren Bruder Karsten zusammen – ein nordischer Name. Als er geboren wurde, habe ich ihn einmal in einem Bollerwagen durch Stendal gezogen, den meine Eltern auf besondere Weise zurechtgemacht und mit einem Schild versehen hatten, auf dem stand: »Ich habe ein Brüderchen bekommen.« Wie mein Bruder mir erzählte, habe ich ihn später dann oft mit lauter Stimme so vorgestellt: »Das ist mein Bruder Boppel, der ist ganz neu.«
Wir malten und bastelten, bekamen von unseren Eltern, die ja von Berufs und Berufung wegen malten, viele Anregungen. Es gab Kaspertheater, das mein Vater inszenierte. Nicht vergessen, die Puppe mit dem Kartoffelkopf, der vom Kasper mit einem scharfen Küchenmesser abgesäbelt wurde. Und das sogenannte Bibaböken, ein Männlein mit Türkenkappe und dicken Backen und einem weißen Gewand mit großen blauen Punkten, das witzig sprechen konnte, aber auch Ermahnungen aussprechen und vor allem schmerzhaft zukneifen konnte. Angst und Spaß waren da nah beieinander.
Draußen spielten mein Bruder und ich mit den anderen Kindern Humpelkasten, Zehnte Rose – ein Ballspiel –, Treibball, Völkerball, später Fußball. Wir kletterten überall hin, spielten in der Ruine eines zerbombten Hauses, bauten Butzen (Hüttchen). Einmal sah ich einen riesigen grünen Fisch mit roten Flossen in der Uchte. Eine unglaubliche Erscheinung.
»Wenn ich sage: Ich habe diesen Fisch gesehen, so stimmt das. Und wieder auch nicht.
Es war etwas ganz Anderes als sonst. Dabei war es ein Tag, an dem überhaupt nichts passierte. Außer, dass wir schulfrei hatten. Und ich mich langweilte wie lange nicht. Schulfrei ist ja eine prima Sache. Aber an diesem Tag war es eben nicht so.
Irgendwo musste ich trotzdem hingehen.
Also ging ich an die Uchte.
Krempelte mir die Hosen hoch und ging barfuß in der Uchte spazieren. Ein paar Bitterlinge und Stichlinge sah ich. Aber die kannte ich ja schon. Dann ging ich ein Stück die Uchte aufwärts, und als es tiefer wurde, ging ich am Ufer weiter, und nach einer Weile setzte ich mich ans Ufer und ließ mir von der Sonne die Füße trocknen. Dann legte ich mich nach hinten, döste eine Weile vor mich hin und schlief ein. Als ich wieder aufwachte, war heller Mittag. Die Sonne stand hoch am Himmel.
Doch im nächsten Moment war ich knallwach.
Denn da sah ich ihn.
Zuerst wollte ich es nicht glauben.
Es war an einer Stelle, wo die Uchte ziemlich tief war und die Schatten des Ufers die meisten Sonnenstrahlen nicht durchließen. Ein einzelner Sonnenstrahl schaffte es trotzdem, und man sah, wie tief und etwas löhmerig das Wasser hier war. Und die Schlingpflanzen bewegten sich geheimnisvoll und ein wenig unheimlich. Manchmal, als wären sie Fische. Aber sie waren keine Fische. Jedenfalls keine Fische, die ich kannte. Hier schwamm ganz ruhig und schwer – ohne jede Schlängelbewegung – etwas sehr, sehr Großes …
Ich sah zuerst seine Rückenflossen. Die waren rot. Nicht knallrot leuchtend, aber so rot, dass sie mir in dem graugrünen Wasser sofort auffielen. Und sie bewegten sich fast unscheinbar, als würden sie das Wasser wie Luft fächeln. Erst nach und nach sah ich den Körper, der zu den Flossen gehörte. Und ich erkannte, dass es ein übergroßer Fisch war. Einer, wie ich ihn bis dahin noch nie gesehen hatte. Ich selber und alles um mich herum schien den Atem anzuhalten. Ich rührte mich nicht. Doch in meinem Kopf rumorte es.
War es möglich, den Fisch zu fangen?
Oder ihn wenigstens dahin zu treiben, wo man ihn festhalten und fangen konnte?
Ich war wie gebannt, starrte auf den großen, graugrünen Körper, der sich nur wenig vom Wasser abhob, und die roten Flossen. Es war kein Hecht und kein Karpfen, sondern etwas ganz Seltsames. Es schwamm dahin wie eine majestätische Erscheinung, und vielleicht war es auch eine Erscheinung. Ich sah die Richtung, in der sich der Fisch bewegte. Ich sah die Bewegung seines Schwanzes und konnte es trotzdem nicht glauben. Nein, es war kein Traum. Es war mittagshelle Wirklichkeit.
Ein sprechender Zauberfisch, ein Butt, wie im Märchen vom Fischer und seiner Frau? Nein, so einer war das nicht. Es war ein schweigsamer Zauberfisch. Dabei schwamm er ganz selbstverständlich durch die Uchte. So, als wollte er sagen: Dies ist nichts Außergewöhnliches. Dies ist ein ganz normales Ereignis um die Mittagszeit, wenn die Sonne am höchsten steht.
Und wir waren ganz allein.
Ich und der Zauberfisch. Sollte ich jemanden holen? Meinen Bruder, meinen Vater? Ich blieb, wo ich war, ich konnte nicht weg. Sagte kein Wort und sah, wie der Fisch langsam verschwand, und nur die Schlingpflanzen waren noch da und bewegten sich. Der große graugrüne Fisch mit den roten Flossen war verschwunden, und ich starrte noch eine Weile auf die Stelle, wo ich ihn zuletzt gesehen hatte.
Plötzlich war wieder alles so wie vorher. Der graugrüne Zauberfisch war davongeschwommen. Und ich hatte das Gefühl, ich werde ihn nie wiedersehen. Nie in meinem ganzen Leben. Aber umso deutlicher versuchte ich, mir seinen Anblick zu bewahren. Es war wie ein Wunder, wie ein Geschenk. Ich hatte das Bild von diesem Fisch ganz deutlich vor Augen. Mein Staunen und meine Beobachtung waren hier ganz nah beisammen. Es war, als würde das Erlebnis in mir weiterleben. Als müsste ich es als mein Geheimnis in mir bewahren. Und es pflegen und behüten. Am Anfang hatte ich Angst, dieses Geheimnis könnte mir verloren gehen. Ich könnte eines Morgens aufwachen und überhaupt nicht mehr wissen, wie der Fisch aussah und wie er damals an mir vorbeigeschwommen ist.
Es war nicht so. Ich habe das Bild heute noch vor Augen. Ganz genau. Und dass das alles so kam, war schon außergewöhnlich. Normalerweise erzähle ich nämlich allen Leuten sofort, wenn ich etwas Außergewöhnliches erlebt habe.
Aber diesmal, dieses eine Mal war es anders. Vielleicht habe ich es meiner Mutter erzählt. Das weiß ich nicht mehr genau.
Aber sonst niemandem.
Vielleicht wusste ich nicht, wie man Worte für so was findet.
Vielleicht wollte ich kein ungläubiges Kopfschütteln sehen und erst recht nicht ausgelacht werden. Ich hätte die Geschichte ja nicht beweisen können. Es gab auch keinen Biologielehrer, der dann ganz genau gewusst hätte, was das für ein Fisch ist und warum der sich ausgerechnet in die Uchte verirrt hat. Vielleicht ein Fisch, den es sonst nur in der Südsee gibt. Aber das würde die Zeitung wahrscheinlich nur am ersten April bringen.«3
Was aber bestimmt bleibt, ist die Frage: Wie kann ich etwas erkennen, was ich noch nie gesehen habe? … Meine Lebensfreundin Barbara hat sich später mit dieser Frage befasst und hat Kinder in der Salzbödener Schule ihren Zauberfisch malen lassen. Und diese Kinderbilder haben uns Erwachsene richtig zum Staunen gebracht.
Doch zurück zu meiner Stendaler Kindheit und dem, was wir damals als Kinder alles getrieben haben. Im Winter legten wir Schlitterbahnen an, versuchten uns im »Kunstschlittern« auf einem Bein, rodelten und pressten Schneebälle auf Klingelknöpfe, um in Häusern verborgene Erwachsene zu ärgern. Wenn sogar die Uchte zugefroren war, das Eis aber noch nicht ganz hielt, gingen wir zum »Kuttelaufen«. Das war so eine Art Mutprobe. Man musste über das federnde bis brüchige Eis der Uchte so geschickt laufen, dass man nicht einbrach. Wer einbrach, hatte verloren. Viele Stunden, Tage und Jahre, die ich so mit meinem Bruder verbrachte. Oft hielten wir gut zusammen, selbst beim großen Feuer im Heerener Wald, aber ich ließ ihn oft spüren, dass er der Kleinere war, und er durfte auch manchmal nicht mitmachen, was einmal dramatisch wurde, als mein Bruder traurig und weinend zurückblieb, dann aber einen spitzen Speer schnitzte, mit dem er mich sehr schmerzhaft verletzte, sodass ich zu einem unserer Nachbarn, Dr. Schürmann, gebracht werden musste und mein Bruder Stubenarrest bekam. So ein Ereignis stand der von den Eltern propagierten Bruderliebe ziemlich im Wege. Heute tut es mir leid, dass ich als älterer Bruder oft so hart war.
Außerdem spielten wir immer auch mit anderen Kindern. Wir waren die »Westwall-Bande«, die von der jenseits der Uchte ansässigen Mittelhofbande mehr als einmal verprügelt wurde. Wir nannten uns selber aber eine »Mannschaft«, hatten sogar ein Mannschaftsheft und trafen uns hochheimlich in einer Nische bzw. Höhle einer backsteingotischen Mauer, die den Garten des gutherzigen Pfarrers Müller vom Bereich des Stendaler Doms trennte und über die eine mächtige Hecke gewachsen war, sodass es innen fast ganz dunkel war. Nur im Flüsterton konnten wir uns darin unterhalten, denn Pfarrer Müller durfte nicht wissen, dass wir ausgerechnet seinen Garten als Bandentreffpunkt ausgewählt hatten. Wir sind auch vorher immer über den Gartenzaun geklettert, was ebenfalls niemand sehen durfte und die Attraktivität unseres heimlichen Treffpunkts wesentlich erhöhte.
Ein weiteres Kindheitserlebnis für unsere Bande bzw. Mannschaft war der Pulverturm. Er hatte keinen normalen Eingang, sondern ein großes, offenes Fenster in etwa drei Metern Höhe. Da kam man aber nur hin, wenn man erst einmal an einer dichten Efeuhecke emporkletterte und sich an einigen seitlich hervorstehenden Steinen abstützte, um so zu dem offenen Fenster zu gelangen – eine Klettertour, die uns zunächst unmöglich schien. Wir versuchten es immer wieder, stützten uns gegenseitig ab, soweit es ging, und schließlich klappte es. Es war unsere Form von halsbrecherischer Bergsteigerei, wobei anzumerken ist, dass eine der Erhebungen in Stendal, ein hoher Bahnübergang, den stolzen Titel »Stendaler Alpen« trägt. In der Mitte des Turms war ein großer ehemaliger Pulverkessel, der schauerlich drei Meter in die dunkle Tiefe führte und in dem im unteren Teil im Schummerlicht vier Eingänge sichtbar wurden, die zu unterirdischen Gängen gehörten. Sie sollten angeblich zur Marienkirche und zu anderen zum Teil weit entfernten Orten in Stendal führen. Um das zu überprüfen, so wird in Stendal erzählt, sei einmal ein Strafgefangener mit einer Trommel in einen der Gänge geschickt worden. Sein Trommeln habe man hören können, etwa die halbe Strecke zur Marienkirche. Danach verstummte es. Und der Mann ist nie wieder aufgetaucht … Im Pulverturm gab es auch eine Wendeltreppe, die zu einer Plattform unter dem Dach führte. In der Mitte der Plattform war eine Öffnung, durch die man bis hinunter in den Pulverkessel sehen und kacken konnte. Wer noch auf der Höhe des Einstiegsfensters war, konnte die Kacke vorbeifliegen sehen. Außerdem gab es im Pulverturmdach einige marode Ziegel, durch die man von da oben in die Ferne gucken konnte. – Ein Turm also voller Abenteuermöglichkeiten, die wir selbst nach und nach entdeckt hatten.
Dann gab es in der Nähe eines toten Uchtearmes noch einen heimlichen Einstieg in die Stendaler Kanalisation, große Rohre, die unter der Stadt herliefen und in die wir einstiegen, um Entdeckungsreisen zu machen, die oft sehr lange dauerten, oder um in den Gängen Räuber und Gendarm zu spielen. Auch hier kam es darauf an, heimlich und unbemerkt von Erwachsenen zu spielen. Einmal lief ich in der unterirdischen Dunkelheit gegen eine Bleistange, meine Nase tat entsetzlich weh. Es war für mich ein Überfall aus der Dunkelheit und ich musste lernen, mich dort unten ganz vorsichtig zu bewegen.
Auch das Lernen der Unterschiede zwischen rechts und links wurde für mich eine schmerzhafte Angelegenheit. Ich war offiziell durch das Gartentor zu Pfarrer Müller bzw. zu der dort ebenfalls wohnenden Tante Luise mit den wunderschönen alten Bilderbüchern gegangen, und danach wollte ich wieder sehr schnell auf die Straße laufen, umfasste den Torpfosten und schlug mir selber mit der halbhohen Eisentür auf den rechten Daumen, der fürchterlich weh tat und sich später unter dem Nagel dunkelblau verfärbte. Seitdem weiß ich wirklich, wo rechts und links ist. Andere Kinder wussten das schon lange vor mir, auch ohne Pfarrer Müllers Gartentor.
Schnell laufen war damals die normale Fortbewegungsart, wenn wir nicht an der Uchte saßen oder in Bäumen, in der Kanalisation, im Pulverturm oder sonstwo herumkletterten. Wir hatten auch eine Art Indianderruf: Ahuuu … ahuuu … ahuuu … Damit konnten wir uns auch über längere Distanzen verständigen. Wir lebten in unserer ganz eigenen Bewegungs-, Erkundungs- und Erlebniswelt, die sich radikal von der der Erwachsenen und der von älteren und oft streng behüteten Kindern unterschied. Ja, wir hatten die denkwürdigen historischen Anlagen der Stadt Stendal zu unserem aktuellen Spielgelände gemacht. Dazu gehörte der Dom und seine unmittelbare Umgebung, der Pulverturm und sogar das altmärkische Museum. Das Museum wurde so eine Art besonderer Abenteuerspielplatz, in dessen heilige Atmosphäre wir Lachen und Bewegung brachten. Einmal passte ich nicht genau auf, lief haarscharf an einer großen, weißen Figur vorbei, ich glaube es war ein Engel, und ein Finger brach ab. Mein Vater ging mit mir zum Museumsdirektor, um Entschuldigung bittend – doch der sagte: »Hätte der Bengel doch die ganze Figur umgerannt, dann wäre der Kitsch wenigstens weg!« Das Museum war für uns so eine Art Labyrinth; können Labyrinthe wie in der Antike äußerst bedrohlich sein, und zwar in der Vorstellung von Erwachsenen, so laufen Kinder hinein und beginnen zu spielen. Sie bringen Lachen ins Labyrinth bzw. ins Altmärkische Museum.
Im Sommer kamen die Erlebnisse am und im Wasser dazu. Da war also die Uchte, die sich vom Stadtsee bis zum Schwanenteich und dann weiter, zunächst aber quer durch Stendal schlängelte. Sie war zu flach zum Baden, aber es gab eine ganze Wasserwelt zu beobachten: Fische wie Bitterlinge, Gründlinge, prächtig rote, stachelige Stekerböcke, die ihre Kinder ins Maul nehmen konnten; es gab Köcherfliegenlarven, Gelbrandkäfer und Hechte – Anlass für lange Wasserwanderungen im Flussbettchen der Uchte. Dann gab es die Städtische Schwimmanstalt, die »Städt’sche« mit einem leidlich großen, in Beton gefassten Schwimmbecken, einer Liegewiese und einem Planschbecken für die kleinen Kinder.
Das Soundpanoptikum meiner Kindheit wäre unvollständig ohne die sommerliche Klanglärmwolke, die man weiter bis über die Schrebergartenkolonie und die angrenzenden Häuser der Karl-Liebknecht-Straße bzw. bis hin zum sogenannten »Russenplatz« hören konnte. Es war eine Klangwolke aus rufenden, schreienden, juchzenden, vor Freude schrill quiekenden Kinderstimmen, die ganze lange Sommernachmittage die Stille der Schrebergärten und der vor sich hindösenden Stadt durchtönten. In der Städt’schen mussten viele, viele Kinder auf engstem Raum zurechtkommen, was sich anscheinend nicht ohne schrille Schreie, laute Freudenrufe und alle möglichen anderen Formen von kindlicher Stimmgewalt bewältigen ließ. Zur Städt’schen gab es eine Alternative, nämlich die sogenannten »Wasserfreunde«, ein größerer Teich, in dem ein Schwimmbadbereich abgetrennt war, mit hölzernen Stegen über das Wasser, auf denen man in der warmen Sonne liegen und durch die Ritzen zwischen den Brettern den Wasserkäfern und -läufern sowie kleineren Fischen zuschauen konnte. Man hörte das Plätschern der Wellen, die verschmätzt kunstvollen Lieder der Teichrohrsänger und die Schreie der Blässhühner. Es gab auch eine veritable Klangwolke aus Kinderrufen, Juchzern u. Ä., aber viel gedämpfter und in die Teichlandschaft integriert. Es gab sogar so etwas wie einen Strand. Man konnte also im warmen Sand liegen. Gegenüber der Städt’schen waren die Wasserfreunde eine Oase der Ruhe.
Und dann war da noch die Elbe. Mit dem Fahrrad in eineinhalb Stunden erreichbar, auf manchmal mühseligen Sandwegen durch duftende Kiefernwälder. Es gab tote Elbarme und Teiche in der Nähe des großen Flusses, der ab und zu glucksend, aber ansonsten ruhig und behäbig dahinströmte. In so einem kleinen Teich in der Nähe der Elbe habe ich schwimmen gelernt. Ich wollte gar nicht mehr raus aus dem pottwarmen Wasser.
Ab und zu kamen – meist tschechische – Raddampfer vorbei, die eine lange Kette von Schleppkähnen hinter sich herzogen. Die brachten Bewegung in den Fluss. Und wenn dann die von den Raddampfern erzeugten großen Wellen ans Ufer schwappten, konnte man denken, man säße am Meer. Das satte Geräusch der schwappenden Wellen brachte eine leichte Dramatik in die Ruhe der Elbe, die aber schnell wieder verebbte.
Dann waren da noch die weithin hörbaren Wanderlaute der Regenpfeifer. Und die Geräusche von unserem hölzernen Paddelboot. Wir hatten nämlich später von einer befreundeten Familie ein Wochenendhaus übernommen. Die Frau hatte unbedacht einen Ulbricht-Witz erzählt, was, wie sich später herausstellte, ein SED-treuer Nachbar mitbekommen hatte, und das war damals Grund genug, in den »goldenen Westen« zu türmen. Die geflohene Familie hinterließ uns neben dem Wochenendhaus in der Nähe von Storkau auch ein großes grünes Paddelboot, das sauschwer war. Wir mussten es vom Wochenendhaus den langen Weg zur Elbe schleppen. Das Boot hatte außerdem einen sehr ungewöhnlichen Namen. Es hieß nämlich »Illusion«, ein Wort, das mir damals noch völlig rätselhaft war. Ich freundete mich mit zwei Dorfjungen an. Der eine hieß Pelle, der andere Hullelu. Nach Hullelu zu rufen grenzte an ein indianisches Ritual, obwohl unsere Spiele dort nur bedingt etwas Indianisches hatten. Wir bewaffneten uns nämlich mit verrosteten Maschinenpistolen, die wir im Sand gefunden hatten. Später sind wir häufig durch die Elbe ans andere Ufer geschwommen. Manchmal mehrere Male am Tag haben wir uns, kam ein Raddampfer vorbei, in das Rettungsboot, das der letzte Schleppkahn hinter sich herzog, gesetzt und sind, falls wir nicht entdeckt wurden, bis zur Eisenbahnbrücke bei Hämerten mitgefahren, von der aus wir sogar einmal in die Elbe sprangen und nach Storkau zurückschwammen. Die Elbe hatte etwas Friedliches, Großes, Behäbiges, eine mächtige und doch leicht bewegliche Stille und Ruhe, die durch die hellen Klangtupfer der Wasservogellaute und die kaum hörbaren Strudelgeräusche in der Nähe der in den Fluss ragenden Buhnen nur noch deutlicher wahrnehmbar wurde. Und das gegenüberliegende Ufer war besonders still. In meiner kindlichen Phantasie fing da der Osten an, die östlichen Landschaften Ostpreußen, Polen, die russische Weite. Dass davor erst noch Berlin kommt, habe ich in dieser Phantasie nicht berücksichtigt. Wenn ich heute nach Stendal fahre, muss ich unbedingt auch einen langen Elbspaziergang machen.
Das Soundpanoptikum meiner Kindheit rundet sich mit den Stimmen, die ich damals täglich oder sehr oft hörte. Die Stimme meiner Mutter, mit der ich sehr vertraulich reden konnte, die sehr schön und sanft war und gerade, wenn sie am Telefon sprach, von vielen gelobt wurde, auch als sie schon alt und gebrechlich war. Sie strahlte gerade in der Stendaler Zeit sehr viel Lebensfreude aus, konnte aber auch, wenn sie von etwas enttäuscht war, bockig und knotig werden. Der Vater war der Erzähler in froher Runde, erzählte von Originalen in der Altmark, kannte ostpreußische Witze und Geschichten noch und noch, auch von seiner Kindheit im Ruhrgebiet, in Bochum-Linden. Später hat er Gedichte geschrieben, in denen er versuchte, die herbe Poesie der Elbe und der altmärkischen Landschaft in Worte zu fassen.
»Elbe 1968
Auf dem Wasser
die treibenden Laute.
Bewegtes Sternbild
im Spiegelfluß
bis zum Duft
der Pflanzen am Ufer.
Wie damals die Fischer an den Buhnen.
Sie wechselten unmerklich
und blieben die alten.
Wie damals
verzichtet der Mond nicht
auf die leuchtende Brücke
zwischen Tangermünde
und Jerichow.
Über allem
die stille Weigerung,
etwas anderes
als sich selbst zu wollen.«4
Die Stimme meines Vaters hatte etwas Sonorig-Gütiges. Nur, wenn er für etwas nicht die Resonanz bekam, die er sich erwartet hatte, konnte seine Stimme sehr jähzornig, brachial und laut werden, ein beleidigter Heulton konnte darin sein. Oder er konnte lange Zeit stur und verletzt schweigen, was für uns und andere besonders schlimm war. In das Stendaler Soundpanoptikum gehören unbedingt auch die Pfiffe meines Vaters. Sie bedeuteten beide »nach Hause kommen«, auf unterschiedliche Weise. Es war keine ausgeklügelte Pfeifsprache, kein »Silbo« wie auf La Gomera. Doch die Pfiffe waren so bedeutungsvoll und dringlich, dass sie mir noch heute in den Ohren klingen. Der erste war ein geflötetes Melodiestück, das aus einem Amsellied stammen könnte, sehr schön und fast eine Vorlage für eine Beethovensche Sinfonie. Die Botschaft dieser Pfeifmelodie: »Bitte ohne Eile nach Hause kommen.« Der zweite war ein durchdringender hoher Alarmpfiff, der uns zu verstehen geben sollte: »Höchste Eisenbahn, sofort nach Hause kommen, aber dalli!« Letzteren Pfiff fürchteten wir, denn er bedeutete oft nichts Gutes.
Und dann noch dies von meinem Vater: Er konnte den Kuckucksruf so gut nachahmen, dass er damit tatsächlich einen Kuckuck anlocken konnte, was uns Kinder in großes Erstaunen versetzte. Wir schauten unseren Vater an und dachten, er wird nun selbst zum Kuckuck. Er war überhaupt ein großer Naturkundler und hat es damals in der DDR sogar bis zum Kreis-Pilz-Sachverständigen gebracht.