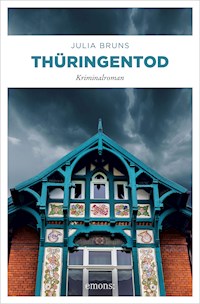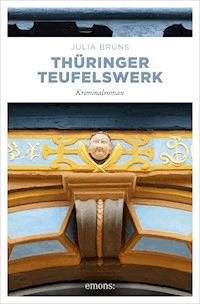Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Amalfi-Krimi
- Sprache: Deutsch
Amalfi 1951: Claretta Lépore braucht dringend Arbeit. Ihr Mann Emilio ist im Krieg gefallen, und sie muss ihre vier Söhne allein durchbringen. Ausgerechnet der Capitano der Carabinieri stellt sie schließlich als Sekretärin ein - dabei hat sie nicht einmal gelernt, eine Schreibmaschine zu bedienen. Wo auch, als Fischerstochter aus einem kleinen Dorf? Aber Claretta ist so klug wie keck, und Capitano Spadaro ist schon froh, wenn sie das Büro putzt und seine Hemden bü- gelt. Was das mit den Aufgaben einer Sekretärin zu tun hat, weiß Claretta nicht, aber sie macht sich munter an die Arbeit. Und ehe sie sichs versieht, steckt sie mitten in ihrem ersten Fall: In einem abgelegenen Bauernhaus wurden zwei Leichen gefunden: Milchbäuerin Carmela Maria De Rosa und ihr Mann Tommaso wurden erstochen - ausgerechnet mit einem Kruzifix. Claretta fällt fast vom Glauben ab, als Spadaro ihr das Protokoll diktiert. Nach Feierabend macht sie sich am Tatort selbst ein Bild - und stößt auf einige Ungereimtheiten, die dem Capitano bei der Aufklärung des Falls nützlich sein könnten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Julia Bruns
Schwarze Zitronen
Ein Amalfi-Krimi mit Claretta Lépore
Kampa
Eins
»Ich sollte nicht hier sein. Nein, das sollte ich nicht. Wenn ich doch nur einen Moment länger über das alles nachgedacht hätte. Eine Woche. Was ist denn schon eine Woche? Für eine solche Entscheidung? Nichts. Emilio hat damals fast ein halbes Jahr gebraucht, um mich zu fragen, ob ich seine Frau werden will. Dabei war alles Wesentliche bereits passiert, also all das, was er dafür gehalten hatte. Wenn ich nur daran denke. Meine arme Mutter. Und der Prete Desiderio erst. Wenn die wüssten.« Sie bekreuzigte sich flüchtig. »Aber es ist ja alles gut gegangen.« Sie hob und senkte die Schultern. »Irgendwie. Emilio war eben noch nie ein Mann von schnellen Entschlüssen. Bei allen wichtigen Dingen. Aber sechs Monate? Nein, so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Ich muss einfach etwas unternehmen. Aber ist das hier richtig? Womöglich ist es sogar zu gefährlich? Wieso weiß man eigentlich nicht vorher, was richtig oder falsch ist? Ich sollte gehen und noch einmal darüber schlafen. Das würde das Beste sein, gewiss. Vielleicht könnte ich mit dem Prete darüber reden, am Sonntag nach der Heiligen Messe?« Sie blickte wie gebannt auf die in ihrem Schoß liegenden Hände und streckte unter Zuhilfenahme von Daumen und Zeigefinger ihrer linken die Finger der rechten Hand. »Und Emilio? Ach, mein guter Emilio.« Sie ließ den Kopf noch tiefer auf ihre Brust fallen, neigte ihn leicht, senkte die Lider und verzog ihren Mund zu einem sehnsüchtigen Lächeln. Dann seufzte sie tief und war in Gedanken so weit weg, dass das unterdrückte Kichern von zwei Frauen, die ihr gegenübersaßen, nur von Ferne zu ihr drang. Vorsichtig öffnete sie die Augen und wagte es dabei kaum aufzusehen. Sie hatte doch nicht etwa laut gesprochen? Schon allein bei dem Gedanken daran spürte sie, wie ihr das Blut in die Wangen schoss, was den beiden natürlich nicht verborgen blieb. Sie lehnten aneinander, die Köpfe zusammengesteckt, und versteckten krampfhaft ihre Münder hinter den Händen, als könnten sie damit ihr Amüsement verbergen. Ihre durch die nach oben gedrückten Wangen, die schmalen, ein wenig glasig glänzenden Augen und die von der Beherrschung angespannten Körper verrieten sie jedoch.
Die dumme Fischertochter Claretta hat sich wieder einmal bis auf die Knochen blamiert, schalt sie sich, wohlbedacht, den Mund dabei fest geschlossen zu lassen. Unbehaglich rutschte sie auf ihrem Stuhl hin und her, strich die Falten aus ihrem Kleid und faltete die Hände. Dann besann sie sich. Womöglich war sie nur ein Fischermädchen aus dem kleinen Amalfi, aber dafür war sie ein stolzes Fischermädchen aus dem kleinen Amalfi. Claretta übte sich in einem ordentlichen Augenaufschlag, drückte ihren Rücken durch und hob ihr Kinn, nur ein wenig, aber immerhin so viel, dass sie aussah wie eine junge Frau, die etwas zu bieten hatte. Dabei funkelte sie die beiden Frauen böse an, was zu ihrer eigenen Überraschung Wirkung zu zeigen schien. Die beiden, Claretta schätzte sie auf kaum zwanzig Jahre alt, ließen den Blick verstohlen umherwandern. Nun waren sie es, die einen ziemlich unsicheren, ein wenig nervösen Eindruck machten. Das konnte aber auch an dem großgewachsenen, adretten Carabiniere liegen, der unbemerkt im Türrahmen aufgetaucht war und die beiden aus seinen dunklen Augen fast schon unverschämt musterte, während er eine von ihnen bat, ihn zu begleiten. Claretta beäugte deren unter dem lindgrünen Taftstoff davonwackelnden Hintern, bewunderte die wie mit dem Lineal gezogenen Nähte ihrer Strümpfe und die ebenfalls grünen Pumps, deren Absätze ihr für einen ganz normalen Wochentag ziemlich kess erschienen. So schicke Sachen kannte sie nur von den reichen Amerikanerinnen, die hin und wieder an der Strandpromenade entlangflanierten. Neugierig schaute sie auf das allein verbliebene junge Mädchen, das nun alles daransetzte, sie zu ignorieren, und sich dazu mit schier grenzenloser Hingabe daranmachte, ihren tiefroten Lippenstift im Spiegelbild eines goldenen Taschenspiegels nachzuziehen. Sie trug ihre gebleichten Haare in runden Föhnwellen, die ihrem hübschen Gesicht mehr Geltung verliehen. Ihr Kleid war gelb, mit einem eckigen, weiß drapierten Kragen, und verjüngte sich so sehr auf der Höhe ihrer Taille, dass sie kaum Luft zu bekommen schien und damit der darumgebundene weiße Gürtel nicht mehr als eine Zierde sein konnte. Auf dem Spann ihrer Schuhe, die ebenfalls perfekt auf ihre Erscheinung abgestimmt waren, steckten sogar kleine Schleifchen. Das Mädchen war einfach nur wunderschön. Claretta biss sich auf die Unterlippe. Und was war sie? Emilio würde spontan sagen flachbrüstig, aber das konnte außer ihnen beiden niemand weiter wissen, denn zum Glück wusste sich Claretta hier mit etwas Mull zu behelfen. Aber es stimmte schon. Für eine Frau war sie ein wenig zu knabenhaft geraten, dünn, wenn auch nicht knochig, eher muskulös, und mit einer Haut, die jeden einzelnen Sonnenstrahl in sich aufsog. Ihre Haare waren tiefschwarz, und obwohl sie nichts damit anstellte, außer sie jeden Morgen zu einem strengen Knoten an ihrem Hinterkopf zusammenzubinden, hatten sie einen solchen Glanz, dass die anderen Frauen im Dorf sie darum beneideten. Ja, ihre Haare konnte sie getrost vorzeigen, auch wenn die Frisur, die sie trug, dafür kaum prädestiniert schien. Claretta jedoch empfand sie als praktisch, und nur das zählte. Ansonsten jedoch mochte sie ihr Äußeres nicht sonderlich. Vor allem ihre dichten Augenbrauen, die viel zu nah beieinanderstanden und sie zuweilen strenger wirken ließen, als sie eigentlich war. Ganz abgesehen von ihren Lippen, viel zu schmal, um sie mit einem Lippenstift hervorheben zu können. Versucht hatte sie es natürlich, irgendwann einmal heimlich, und war sich dabei vorgekommen wie ein Clown im Zirkus. Das fehlte noch, wenn sie sich jeden Tag erst das Gesicht anmalen müsste. Was das an Zeit kostete, da hatte sie wahrlich Besseres zu tun. Zögerlich zupfte sie an ihrem bis zu den Ellenbogen reichenden Ärmeln ihres Kleides. Der derbe Stoff gab kaum unter ihren Bewegungen nach, und auch die Farbe – ein dunkles Braun, das an den Falten, an denen sie das Plätteisen ein wenig zu fest daraufgedrückt hatte, matt glänzte – war kaum etwas, was mit den jungen Dingern hier mithalten konnte. Emilio hatte das Zeug von irgendeinem Fronturlaub mitgebracht, angeblich aus Paris. Nun war Claretta zwar eine liebende Frau, aber sie wusste sehr wohl, dass Emilios Einheit bis Rom, eventuell höchstens bis nach Mailand gekommen war. Die französische Hauptstadt hatte der Halunke niemals gesehen. Deswegen, und da das Zeug nun wirklich nichts war, was eine Frau gern tragen mochte, hatte sie kurzerhand beschlossen, ihm und den Jungs ein paar Hosen daraus zu nähen. Aber das Leben verlief eben nun manchmal anders, als man es für sich festlegte, und so besaß Claretta nun dieses selbst geschneiderte Kleid, das sie vielleicht nicht besonders modisch, aber in jedem Fall ordentlich kleidete.
Ihr Gegenüber hatte mittlerweile aufgehört, sich zurechtzumachen, und nun ihrerseits begonnen, Claretta gründlich und nicht ohne den Anflug eines leichten Naserümpfens zu begutachten. Schließlich blieb ihr überheblicher Blick demonstrativ an ihren Schuhen hängen, zu lange, als dass Claretta es nicht auffallen konnte. Die Atmosphäre in dem kleinen Kabuff hätte frostiger nicht sein können, als in einiger Entfernung eine Tür etwas zu schwungvoll ins Schloss fiel und das eilige Klappern von Absätzen laut wurde, begleitet von ein paar undefinierbaren Schluchzern. Kurz darauf stand der Carabiniere erneut vor ihnen und nickte der jungen Frau auffordernd zu, worauf sie von Clarettas Schuhen abließ und dem Polizisten folgte. Die Bewegungen ihres Gesäßes waren dabei noch ausladender als die ihrer soeben verschwundenen Freundin. Claretta lehnte sich zurück, streckte die Beine und atmete befreit aus. Aber was war das? Staubige Schuhe. Dio mio! An ihren Füßen musste der gesammelte Dreck des Berges haften. Von dem weinroten Leder war so gut wie nichts mehr zu sehen. Wieso bemerkte sie das erst jetzt? Dabei hätte sie es wissen müssen. Nach knapp drei Kilometern Fußmarsch bis hinunter in die Stadt war der Glanz dahin. Ihr fielen die Worte von Nunzia, ihrer Großmutter, wieder ein. Ein Blick auf die Schuhe genügte und man erkannte, welche Art von Frau man vor sich hatte, sagte sie immer. Schuhe waren wichtig. Vor allem, wenn man nur ein einziges Paar Ausgehschuhe besaß. Normalerweise stand es poliert im Kleiderschrank und wurde nur zu besonderen Anlässen herausgeholt, zum sonntäglichen Kirchgang oder am 27. Juni, zum Fest des Schutzheiligen Andreas. Und heute. Aber das war etwas anderes. Mit einer schnellen Bewegung schob sie ihre Beine so weit wie möglich unter ihren Stuhl.
Claretta war noch nie auf einer Comando Stazione Carabinieri gewesen. »Gott bewahre!«, entfuhr es ihr. Verstohlen schaute sie sich um, stellte fest, dass sie ganz sicher niemand gehört hatte, und gluckste erheitert. Claretta führte gern mal Selbstgespräche, aber das musste ja nicht unbedingt jeder mitbekommen. Dann fiel ihr ein, dass man den Allmächtigen nicht wegen jeder Belanglosigkeit anrufen sollte. Damit er ihr diese in ihrer jetzigen Situation vollkommen überflüssige Bitte nicht krummnahm, bekreuzigte sie sich rasch. »Ich weiß, ich weiß, Emilio, eine Frau hat hier nichts zu suchen, erst recht nicht allein«, murmelte sie und schaute verstohlen in Richtung Zimmerdecke, um auch ihn noch zu besänftigen. Emilio war ihr Ehemann. Und er war im Himmel. Aber was noch viel schlimmer war, sie lebte mit der absoluten Gewissheit, dass er sie von dort unentwegt kritisch beobachtete und mit vielem ganz und gar nicht einverstanden war, was er sie auch spüren ließ. »Ich weiß genau, was ich tue«, schob sie noch schnell nach, wohl wissend, dass es eine Lüge war, und ließ es dann dabei bewenden. Emilio war nie ein Mann der vielen Worte gewesen. Sollte er jetzt doch selbst einmal erleben, wie sich so etwas anfühlte.
Der Comando Stazione der Carabinieri befand sich mitten in der Stadt. Die Wache stand nahezu frei, was bei den ansonsten engen Gassen und Plätzen des Ortes recht ungewöhnlich war, und wies mit seinen fünf Stockwerken eine beachtliche Höhe auf; aufgrund der schmalen Fassade wirkte sie immer so, als stünde sie auf wackligen Beinen, hatte aber dennoch etwas Einschüchterndes und Imposantes. Das lag vielleicht aber auch an den Fenstern, vor denen schwere, rostige Gitterstäbe angebracht waren, oder an der breiten, von einem steinernen Bogen überspannten Eingangstür, vor der links und rechts zwei Polizisten mit grimmigen Mienen Wache schoben. Die Köpfe der Männer überragte ein Balkon, der im Laufe der Jahre einen Großteil seines Putzes, aber auch einige zierende Kantensteine eingebüßt hatte und der offenbar niemals benutzt wurde. Bis hinauf zur Dachrinne, in der hier und da Unkraut spross, setzte sich dieser Verfall fort, wobei offenbar ab und zu Handwerker versucht hatten, mit Mörtel in unterschiedlichen Grautönen Ausbesserungen vorzunehmen (seit dem Abzug der Amerikaner war kein neuer Mörteltupfer hinzugekommen). Und dann waren da natürlich die eingestaubten Carabinieri. Jedes Mal, wenn sie bei der Dienstelle vorbeiging, waren sie nicht zu übersehen, die Reste des Fassadenputzes, die sich wie eine dicke Schicht Schuppen auf den dunkelblauen Uniformen der Wachposten ablagerten. Dabei war sie des Öfteren in Versuchung geraten, die Polizisten wieder in Ordnung zu bringen. Natürlich wäre sie niemals ernsthaft auf die Idee gekommen, fremde Männer anzusprechen, geschweige denn sie zu berühren, aber insgeheim bedauerte sie deren Ehefrauen, die jeden Abend den Dreck eines ganzen Tages aus dem schweren Stoff bürsten mussten.
So ungefähr jeder in der Kleinstadt kannte das Gebäude und betrachtete es lieber aus einiger Entfernung, als in die Nähe zu kommen oder sogar hineinzugeraten. Ihre Großmutter war der Überzeugung, das wäre eine Sache des Blutes. Die Amalfitani waren auf dem Meer zu Hause, und damit liebten sie nun mal die Freiheit und Unabhängigkeit. Beides ließ sich, davon war sie überzeugt, keineswegs mit Uniformen und staatlichen Regeln in Einklang bringen, erst recht nicht, wenn auf den Hauptwegen der Küste noch immer ein paar deutschsprachige Wegweiser oder in den Speisekammern der Bewohner Vorräte an amerikanischem Büchsenfleisch zu finden waren. Ihre Großmutter jedenfalls hasste sowohl die Kartoffelköpfe als auch die Amerikaner aus tiefstem Herzen. Eindringlinge waren nicht erwünscht. In dieser Haltung sowie auch in allem anderen war ihre Nonna konsequent. Claretta hingegen hatte sich darüber nie Gedanken gemacht, ebenso wenig wie über die Carabinieri. Wer eine Polizeistation neben einem Friedhof einrichtete, der wird schon seine Gründe gehabt haben. Deswegen jedenfalls war sie öfter in der Gegend. Ziemlich oft sogar, denn ihr Emilio hatte, was seine Grabpflege anging, genaue Vorstellungen gehabt, und so stieg sie seit 1943 einmal in der Woche, immer Samstagabend, von ihrem Dorf ins Tal hinab, wunderte sich über die schmutzigen Uniformen und besuchte ihren Mann.
Heute allerdings war nicht Samstag, sondern Dienstag. Emilio würde umsonst auf sie warten. Sie hatte all ihren Mut zusammengenommen und sich in die Wache hineingewagt, mit weichen Knien und gesenktem Kopf, aber immerhin, sie hatte es geschafft. Das Haus war von innen nicht hübscher als von außen. Der Eingangsflur lag dunkel da, und das gelb-grüne Fliesenmosaik auf dem Fußboden war an manchen Stellen so ausgetreten, dass sie aufpassen musste, nicht zu stolpern. Die Schreibstuben befanden sich rechter Hand, fünf dicht nebeneinanderliegende geschlossene Türen, deren Oberlichter kleine Lichtkegel auf den Steinfußboden warfen und die wenig einladend wirkten. Die halbhohe Holzvertäfelung der Wände, die sich über das enge Treppenhaus bis hinauf in den kleinen Flur der ersten Etage zog – dort hatte man ihr einen Platz angeboten –, war mit Rissen und Schadstellen übersät, was nicht einmal die spärliche Beleuchtung ungesehen machen konnte. Der Geruch nach Stiefelwichse, Tabak und Knoblauch, den sie sofort bei ihrem Eintreten bemerkt hatte, verstärkte sich hier oben noch. Irgendwann flog eine Tür auf, und sie hatte überrascht festgestellt, dass der Schreibtisch fast das gesamte Zimmer einnahm, so winzig waren die Räume. Ihr pummeliger Emilio jedenfalls hätte schon allein deswegen niemals zu den Carabinieri gehen können. Der Gedanke belustigte sie. Abgesehen davon hatte Emilio die Polizei nie sonderlich leiden können. In dieser Abneigung war er konsequent gewesen. So wie in einigem anderen leider auch, aber darauf konnte sie nun keine Rücksicht nehmen, was sie ihn in Gedanken auch wissen ließ. Emilio schwieg sich aus. Womöglich war er gerade anderweitig beschäftigt. Das sollte ihr recht sein, denn wenn er mitbekam, unter welchen Bedingungen sie hier warten musste, würde er ziemlich böse werden. Der Raum, in dem sie saß, hatte kein Fenster und glich eher einer Abstellkammer, zumindest musste sie nur die Hand ausstrecken, und ihre Fingerspitzen hätten die ihr gegenüberstehenden, nun glücklicherweise unbesetzten Stühle berühren können. Das Kehrblech und der Besen, die in einer Ecke standen, unterstrichen den Eindruck, die nackte Wand aus Backsteinen und die Glühbirne ebenfalls, die von der Decke baumelte und in deren gelbem Licht die dicken Fäden einer Spinnwebe zu sehen waren. Wenn es hier oben schon so aussah, dann wollte sie nicht wissen, wie die Gefängniszellen im Keller beschaffen waren. Sie nahm zumindest an, dass es dort welche geben müsste, auch wenn sie diese ganz gewiss nicht kennenlernen wollte. Wenigstens fehlte der Kammer, in der sie saß, die Tür, sodass sie das Geschehen auf dem Flur verfolgen konnte, sofern es etwas zu sehen gab. In den letzten drei Stunden war nicht viel passiert, bis auf den Abgang der mit ihr wartenden Bewerberinnen. Je länger sie aber hier ihren Nachmittag verstreichen ließ, umso mehr beschlichen sie die Zweifel. Die Frauen, die sie hier angetroffen hatte, waren so ganz anders als sie selbst. Womöglich hatte sie irgendetwas durcheinandergebracht oder nicht richtig verstanden? Das konnte schon einmal vorkommen, denn auch wenn sie zweifelsohne die beste Absolventin von Signorina Albertinas Haushaltsschule gewesen war, hinsichtlich einer richtigen Anstellung brachte sie keinerlei Erfahrung mit. Ihr Bauch fing an zu kneifen, und ein paar Schweißtropfen rannen ihr den Nacken hinunter. Sie wagte einen zögerlichen Blick hinauf zu Emilio, aber der blieb wie immer stumm, wenn es darauf ankam.
»Signorina! Der Capitano wartet.« Ohne dass sie ihn bemerkt hatte, stand unerwartet ein anderer, deutlich jüngerer Carabiniere im Türrahmen. Er mochte kaum sechzehn oder siebzehn Jahre alt sein. Offenkundig wuchs er so schnell, dass man ihm aus purer Sparsamkeit eine Uniform zugeteilt hatte, die erst in ein paar Monaten seinen Körpermaßen entsprechen würde. Der Rock und die Hose schlackerten an seinem großgewachsenen, hageren Körper, was jede seiner Bewegungen fast ein wenig lächerlich gemacht hätte, wenn da nicht sein selbstbewusster Gesichtsausdruck und die Entschiedenheit in seiner Stimme gewesen wären.
»Signora, bitte«, antwortete sie leise und mit einem sanften Lächeln, streifte die Oberseiten ihrer Schuhe eilig an den nackten Waden ab und fasste nach ihrer Handtasche. Bei alledem schaute sie den jungen Carabiniere unverwandt an, nur um sicherzugehen, dass der ihren Blick ebenfalls erwiderte und nicht zufällig ihr peinliches Tun um ihre schmutzigen Schuhe mitbekam.
Der junge Mann schien sich für ihr Schuhwerk nicht zu interessieren. Stattdessen hatte ihn wohl ihr Einwand aus dem Konzept gebracht, denn er schaute sich in dem leeren Raum um, als könnte sich noch jemand irgendwo versteckt haben, und bat sie dann, ihm zu folgen. Mit schnellen schlaksigen Schritten steuerte er auf eine der Türen zu, hielt kurz davor inne, als müsste er überlegen, ob sein Eintreten erwünscht war, und klopfte schließlich so zögerlich und angespannt gegen das dunkle Holz, als stapele er rohe Eier. Obwohl ihre Nervosität während der letzten Stunden etwas nachgelassen hatte, übertrug sich die Angespanntheit des jungen Mannes unversehens auf sie. Was auch immer sie hinter dieser Tür erwartete, es würde kein Sonntagsspaziergang werden. Sie atmete tief durch und bekreuzigte sich im Geiste.
»Herein!«
Die Antwort, die durch die geschlossene Tür dröhnte, erinnerte sie im Tonfall an die übermütigen Schreie der Fischer, die sich, wenn sie nach einem langen Tag auf dem Meer in den Hafen einfuhren, einander ihre Erfolge zuriefen. Sooft es ging, war sie früher hinunter zum Kai gelaufen, um sich an den Albernheiten der Männer zu erfreuen. Ihr Emilio war immer der Lauteste von allen gewesen, ein richtiger Aufschneider hatte er sein können. Zugegeben, dafür hatte er meist auch die besten Fänge mit den Netzen eingeholt. Wenn sie allein an die dicken Tintenfische dachte und wie stolz er sie allen präsentiert hatte. Emilio war ein Fischer durch und durch gewesen. Aber diese Zeit war lange vorbei. Heute ging sie nur noch selten zum Hafen. Eigentlich nur dann, wenn etwas Besonderes anstand und die Großmutter Nunzia ihre berühmte saure Fischsuppe zubereiten wollte, für die sie frischen Fisch brauchte. Früher hatte es die einmal in der Woche gegeben, aber da waren Fische und Meeresfrüchte auch nichts gewesen, was sie hatten teuer bezahlen müssen. Der alte Alfredo, der einzige Fischer, der noch regelmäßig hinausfuhr, legte zwar für sie immer noch einen Extrafisch obendrauf, aber er selbst besaß nicht so viel, dass man seine Großzügigkeit überstrapazieren konnte. Ein Krieg veränderte nun einmal alles. Nicht nur ihr Leben.
Mit Ertönen des Befehls schlug der Allievo – ein Schüler, denn etwas anderes konnte der Bursche noch nicht sein – noch auf dem Flur die Hacken zusammen, öffnete die Tür, soweit ihm das mit vorgebeugtem Oberkörper möglich war, und schaute sie hilfesuchend an. Seine Füße bewegten sich keinen Millimeter. »Capitano Spadaro«, hauchte er voller Ehrfurcht.
Sie nickte verhalten und huschte vorsichtig an ihm vorbei ins Zimmer. Nachdem sie eingetreten war, knallten die Absätze seiner schweren Lederschuhe erneut, und hinter ihr wurde leise die Tür ins Schloss gezogen. Sie drehte sich um und sah, dass der Junge verschwunden war.
»Signorina, treten Sie näher!«, sagte der Capitano mit tiefer Stimme und nickte ihr auffordernd zu.
Sie grüßte höflich, vergaß aber vor lauter Aufregung, seiner Bitte zu folgen, geschweige denn sich vorzustellen. Mit großen Augen schaute sie sich um. Noch nie hatte sie eine so weiträumige Amtsstube gesehen. An der Frontseite hatte es vier Fenster plus eine zweiflüglige Tür, die auf den Balkon hinausführte. Rechts und links davon, am jeweiligen Ende des Raumes, zogen sich zwei Einbauschränke über die gesamte Wand, wobei beide sowohl offene Regalflächen als auch abschließbare Türen besaßen. Davor stand jeweils ein Schreibtisch. Der kleinere von beiden, der mit seinen schmalen Beinen eher einem wackeligen Küchentisch glich, war bis auf einen Stapel graues Papier und ein paar Bleistifte leer. Der andere aber war so lang, dass er sie an die große Tafel erinnerte, die ihr Vater immer aufbaute, wenn die gesamte Familie zu Besuch kam, einschließlich aller Cousins und Cousinen dritten Grades. Er stand auf gedrechselten dicken Füßen, war aus schwerem Holz gearbeitet, und bis auf eine dicke lederne Unterlage, einen Telefonapparat, eine Karaffe mit Wasser und den Füßen des Capitano, die in schwarzen, auf Hochglanz polierten Lederstiefeln steckten, befand sich nichts darauf. Er trug eine dunkelblaue Reiterhose mit rotem Längsstreifen, die ab den Knien in die Stiefelschäfte mündete, und einen bis zum Hals zugeknöpften Rock, dessen mit Gold verzierter Kragenspiegel deutlich mehr hermachte als die einfache Kluft des Allievo. Die Knöpfe des Capitano hatten vor allem auf der Höhe seines runden Bauches so einiges auszuhalten. Die Jacke klaffte so weit auf, dass hier und da sogar sein weißes Unterhemd durchblitzte. Sein Kopf war erstaunlich groß und so kugelrund wie eine Wassermelone. Aber der liebe Gott hatte vorgesorgt und ihm einen ebenso stämmigen Hals geschenkt, der solch eine Last problemlos tragen konnte. Die Bürde des Capitano schien allerdings insgesamt so schwer zu wiegen, dass sein Gesicht angestrengt dunkelrot leuchtete. Dagegen strahlten seine Augen wie die eines Mannes, der voller Lebensfreude und Tatendrang steckte und dabei die Welt um sich herum nicht ganz so ernst zu nehmen schien. Die Wölkchen jedenfalls, die er nach jedem Zug an seiner Zigarre mit spitzem Mund fast schon kunstvoll in die Luft blies und an denen er sich mit kindlicher Unbeschwertheit erfreute, unterstrichen diesen Eindruck. Bei alledem war der Capitano kein Mann, dessen Alter man mühelos schätzen konnte. Der ergraute altmodische Schnauzbart, den er von König Viktor Emanuel III, dem letzten richtigen italienischen König, entliehen haben musste, ließ ihn etwas gesetzter erscheinen, was womöglich beabsichtigt war. Auch seine extrem kurz geschnittenen Haare und der hohe Haaransatz erinnerten ein wenig an den Monarchen, allerdings in dessen jüngeren Jahren. Später hatte Viktor einen Kahlkopf gehabt, aber damit würde der Capitano aller Wahrscheinlichkeit nicht geschlagen werden.
»Signorina, kommen Sie«, wiederholte er in herzlichem Singsang und mit einer für seine kräftige Statur ein wenig zu hohen Stimme. Dabei winkte er ihr mit seiner rechten Hand zu, zwischen deren Zeige- und Mittelfinger die brennende Zigarre steckte, was Asche auf sein Hosenbein rieseln ließ. Er bemerkte es und klopfte ohne hinzusehen mit der anderen Hand kurz auf den Stoff, sodass sich jetzt alles auf den abgewetzten Dielenbrettern des Fußbodens verteilte. Den breit getretenen grauen Flecken nach zu urteilen passierte es ihm jedoch öfter und war ihm augenscheinlich vollkommen gleichgültig.
Schüchtern folgte sie seiner Bitte und ging ein paar Schritte auf ihn zu. Etwa zwei Meter vor seinem Schreibtisch verharrte sie. »Signora, bitte«, sagte sie scheu und fixierte dabei ihre Schuhspitzen mit den Augen. Der Staub darauf schien ihr angesichts des fleckigen Fußbodens nicht mehr ganz so schlimm. Dafür war der Geruch nach frischem Knoblauch mittlerweile so intensiv, dass sie mit sich kämpfen musste, nicht niesen zu müssen. Wie jeder andere Amalfitani liebte sie das Lauchgewächs über alles, aber bei ihr führte sein Duft zu unabwendbaren Reizungen der Nasenschleimhäute, die durchaus in einem fulminanten Niesanfall enden konnten. Da eine solche Attacke die Peinlichkeit ein paar ungepflegter Schuhe aus ihrer Sicht noch übertroffen hätte, atmete sie, so flach es ging, und wartete, was nun passierte.
Der Capitano stutzte, ließ sich aber ansonsten keine weitere Verwunderung anmerken. »Sie möchten hier arbeiten?«, fragte er, als böte er ihr ein Glas Wein an. »Deswegen sind Sie doch hier, oder?«
»Ja.« Ihre Antwort war so leise, dass sie sie selbst kaum vernehmen konnte. Natürlich wusste sie, dass es unüblich war, wenn eine Signora und keine Signorina nach einer Arbeit fragte. Vor der Hochzeit, da mochte das noch halbwegs akzeptabel sein, vorausgesetzt, man bekam in dem kleinen Fischerdorf überhaupt eine Beschäftigung. Mehr als Zimmermädchen in einem der wenigen Hotels oder Aushilfe bei der Weinlese war nicht drin. Für beides eignete sie sich nicht. Nachdem man aber verheiratet war, gab es nur noch die Familie. Eine gute Ehefrau kümmerte sich um ihren Ehemann, die Kinder, die Großeltern und Urgroßeltern sowie um das Haus, und wenn sie Pech hatte, auch noch um das Vieh. Ihr Los war dahingehend etwas leichter, denn ihr Haushalt, wenn man das unter dem Regiment von Großmutter Nunzia überhaupt so sagen konnte, bestand nur aus ihren vier Söhnen, ihrem Vater Michele, ihrem Bruder Giovanni und selbstverständlich ihrer Großmutter. Nicht zu vergessen die zwei Ziegen, aber denen durfte sich niemand ohne Nunzias Erlaubnis auch nur auf weniger als einen Meter nähern.
»Sind Sie da ganz sicher?«, fragte er und machte dabei den Eindruck, als wäre es ihm lieber, wenn sie eine der Frauen wäre, die um eine pflegliche Behandlung ihres kriminellen Mannes oder Bruders ersuchen würde.
Nein, natürlich nicht. Sie ist ein Weib! Emilios Worte kamen so unerwartet, dass sie zusammenfuhr. Er war überaus ungehalten, aber sie hatte nichts anderes erwartet. Abgesehen davon hätte er sich auch vorher melden können. Jetzt saß sie hier und musste sich erklären. Angesichts von Emilios boshaftem Einwurf drohte ihr die Antwort jedoch im Hals stecken zu bleiben. Hätte sie den Zettel mit dem Gesuch noch ein paar Mal mehr lesen sollen? Was um alles in der Welt hatte sie nur nicht mitbekommen? Auf dem Weg zu Emilio war das löchrige Informationsbrett, das an der Ecke der Comando Stazione angebracht war, in sicherer Entfernung zu den grimmigen Wachposten, eine interessante Abwechslung. Jede Woche studierte sie es aufmerksam. Hier wurden Zeugen gesucht, Fundstücke, und vor einer Woche stand hier auch, dass der Capitano der hiesigen Carabinieri eine Sekretärin rekrutierte. Deswegen war sie da.
»Na gut, dann müssen wir jedoch zunächst einen entscheidenden Punkt klären«, erwiderte der Capitano und klang dabei wie ein väterlicher Freund, der ihr einen Ratschlag fürs Leben erteilen wollte und nicht so recht wusste, wie er das am höflichsten vorbringen sollte.
Sie erschrak. Jetzt war also alles vorbei, die Warterei, der lange Weg hier hinunter, die verdorbenen Schuhe, alles umsonst. Wut machte sich in ihr breit. Wie hatte sie überhaupt auf die Idee kommen können, dass sie bei den Carabinieri … in einem richtigen Büro? Gesù! Sie kämpfte mit den Tränen. Selbstverständlich musste man für so eine wichtige Arbeit ausgebildet sein. Nonna Nunzia, die Einzige in ihrer Familie, die sie eingeweiht hatte, hatte sie gewarnt, aber was ihre Sturheit anging, konnte sie es mit jedem Maultier aus Kampanien aufnehmen. Sie drehte ihren Kopf und warf einen verstohlenen Blick auf den kleinen leeren Schreibtisch. Das war kein Kessel voller schmutziger Wäsche und auch kein Nudeltopf. Damit hätte sie sich ausgekannt. Vor ihrem geistigen Auge tauchte erneut Emilio auf. Zu spät, war alles, was ihm über seine Lippen kam. Das war mal wieder typisch für ihn. Zu allem Überfluss stand auf seinem Gesicht die pure Genugtuung. »Sei still!«, zischte sie erbost.
Der Capitano hob den Kopf. »Was meinen Sie, meine Liebe?«
»Nichts, nichts«, beeilte sie sich zu sagen und versuchte ihre Worte mit einem heftigen Schütteln ihres Kopfes zu unterstreichen. Ihre Ohren glühten vor Scham.
»Nun, dann habe ich mich geirrt. Was soll’s?« Er lächelte so breit, dass sich seine fleischigen Wangen nach oben schoben und die Augen fast komplett verschluckten. Dann räusperte er sich. »Können Sie einen Knopf annähen, Wäsche aufbügeln, Lederstiefel polieren und vor allem«, er machte eine andächtige Pause, »anständige Spaghetti kochen? Gerade Letzteres ist keine einfache Sache, auch wenn alle Welt behauptet, sie verstünde etwas davon.« Auf seinem gutmütigen Gesicht lag nun eine unübersehbare Ernsthaftigkeit. »Heutzutage achten die jungen Frauen lieber auf ihr Äußeres als auf den richtigen Garpunkt der Pasta. Was für eine Welt ist das nur geworden?«
Ihr blieb fast der Atem weg, und ihre Gedanken überschlugen sich. Sie bezweifelte, ob das alles so seine Richtigkeit hatte. Aber das musste es wohl, denn der Signore war der Capitano der hiesigen Carabinieri und stand damit fast auf einer Stufe wie Prete Desiderio, der ihr einmal in der Woche die Beichte abnahm. Jedenfalls bekam sie keinen Ton heraus, und zu mehr, als ihre Lider langsam zu schließen und wieder zu öffnen, war sie nicht fähig.
Der Capitano wertete das offenkundig als Zustimmung. Er nickte erfreut. »Gut. Gut. Das ist das Wichtigste. Alles andere wird sich finden.« Er hielt inne. »Nur eines noch. Bevor Sie anfangen, müssten Sie noch einmal mit Ihrem Mann wiederkommen.« Er wackelte schwerfällig mit seinem Kopf hin und her, als wäre ihm diese Bitte unangenehm. »Wir sind schließlich eine staatliche Behörde, und da dürfen wir uns kein Gerede erlauben.«
Emilio war dagegen, selbstverständlich war er das. Deswegen brauchte sie ihn nicht fragen, und unter normalen Umständen wäre er niemals mitgekommen. Aber die Umstände waren nun einmal alles andere als normal. Das Geld, was ihr Bruder Giovanni mit seinen Aushilfsarbeiten verdiente, reichte vorn und hinten nicht. Abgesehen davon wusste man nie, wie lange es Giovanni irgendwo aushielt. Er war zu Größerem berufen, zumindest behauptete er das immer. Das Größere war nichts Geringeres als eine eigene Pizzeria in New York. Großmama Nunzia behauptete, diese fixe Idee hätte Giovanni mit dem Weißbrot aufgenommen, das er in amerikanischer Gefangenschaft bekommen hatte, aber Claretta hielt ihren Bruder einfach nur für einen heillosen Träumer. Und Papa Michele? Der trauerte nicht nur seiner geliebten Frau, ihrer Mutter, sondern auch noch seinem alten Fischerboot hinterher, sodass er zu nichts weiter mehr die Kraft hatte, als den ganzen Tag am Ufer zu sitzen, auf das Meer hinauszustarren und auf die großen Weltmächte zu schimpfen. Die nämlich waren schuld am Krieg, der den Fischfang am Tyrrhenischen Meer wegen Minengefahr komplett zum Erliegen gebracht hatte und in dessen letztem Jahr Clarettas Mutter an Tuberkulose gestorben war. »Mein Mann Emilio fiel am 27. September 1943 in Avellino. Er kann nicht kommen«, sagte sie mit fester Stimme.
Der Capitano ließ die Mundwinkel fallen und schaute sie betroffen an. »Oje, Sie armes Ding«, murmelte er. »1943, so ein Pech aber auch.« Er schüttelte mitgenommen den Kopf. »So ein Pech.«
Es war nicht meine Schuld, mischte sich Emilio ein.
»Ja, das war wohl so«, murmelte sie. Einen Tag später waren die Alliierten in Avellino einmarschiert und hatten den Krieg beendet. Aber wer konnte so etwas schon vorherwissen? Dabei war Emilio nie besonders vom Glück verfolgt gewesen, jedenfalls solange er sich auf dem Land befand. Auf dem Wasser war das anders, da machte ihm niemand etwas vor. Aber kaum hatte er einen Fuß wieder auf den festen Boden gesetzt, ging das Pech los. Hatte er ein Netz voller Langusten gefischt, fielen just an diesem Tag die Preise für Krebse, schwor er auf die Regierung Mussolini, wurde der Duce gestürzt. Die Kette ließ sich nahezu endlos fortführen. Am fatalsten jedoch war die Entscheidung gewesen, seine Truppe unerlaubt zu verlassen. Emilio war desertiert und nichts, wofür sie sich schämen musste, im Gegenteil. Er hatte die Sinnlosigkeit des Krieges erkannt und daraus seine Schlüsse gezogen. Und dann traf ihn ausgerechnet in dem Moment, in dem er sich auf den Weg nach Hause machen wollte, ein Querschläger eines Kameraden direkt ins linke Ohr. Die schlechte Ausrüstung des königlich italienischen Heeres war ihrem Emilio zum Verhängnis geworden. Aber dafür war er in Ehren gefallen. Dass Italien nur einen Tag später kapitulierte, gehörte zweifelsohne zu den schlechten Scherzen, die sich der liebe Gott mit ihrem Emilio erlaubt hatte.
Der Capitano schien zu überlegen. »Dabei sind Sie noch so jung«, sagte er irgendwann. »Keine dreißig, würde ich schätzen.« Er neigte seinen Kopf nachdenklich, hob ihn aber umgehend wieder und ergänzte: »Na dann. Wenn das so ist.« Mit diesem Satz kam die Fröhlichkeit auf seinem Gesicht zurück. »Hauptsache, Sie wissen, worauf es bei einer Frau ankommt.« Er nickte liebenswürdig.
Claretta dachte an die Spaghetti und lächelte verhalten.
»Mit dem Geld und den Arbeitszeiten sind Sie einverstanden, ja?«, flötete er herzlich. »Normalerweise verhandele ich das mit den Ehemännern, aber in Ihrem besonderen Fall …« Er schüttelte sich, als wäre ihm eingefallen, dass dies kein netter Kommentar gewesen war. »Da will ich mal nicht so sein.«
Sie hatte keine Ahnung. Und mit Emilio hätte der Capitano auch zu Lebzeiten nicht über Finanzielles reden können, davon verstand er so viel wie von Feldfrüchten. Wenn es in ihrer Familie um Geldangelegenheiten ging, dann wurde Großmama Nunzia zurate gezogen, aber die war augenblicklich nicht zugegen. Gerade als sie all ihren Mut zusammennehmen wollte, um ihn danach zu fragen, hämmerte jemand ungestüm an die Tür. Bevor der Capitano reagieren konnte, stand ein etwa vierzigjähriger Sergente im Raum, der aufgebracht seine Wangen aufblies und sich bemühte, zwischen den holprig herausgestoßenen Atemzügen ein paar verständliche Worte herauszubekommen.