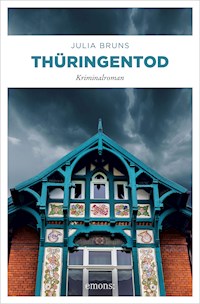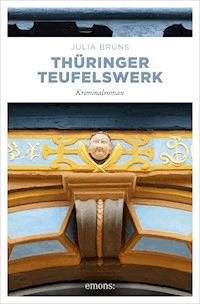Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OKTOPUS by Kampa
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Weinfamilie Saottini
- Sprache: Deutsch
Viel ist es nicht, was dem Steinsetzer Biagio Macre zum Leben bleibt. Zumeist sind die Mägen leer in seinem bescheidenen Haus am Rand des kleinen Ortes Lonato oberhalb vom Gardasee. Immerhin drei der Töchter sind zufriedenstellend verheiratet – nur um die Zukunft seiner Jüngsten, bei deren Geburt die Mutter starb, sorgt sich Biagio. Ist es um Lucia, immerhin das schönste Mädchen im Dorf, wirklich so übel bestellt, dass sich in ganz Italien kein Heiratskandidat finden lässt? Auch Antonino Grazioli hätte mit seinen vierundzwanzig Jahren den elterlichen Hof lange verlassen sollen. Aber wohin gehen, wenn nichts auf einen wartet? Wenngleich es vor den Toren der Stadt nur eine Handvoll Bauernhöfe gibt, braucht es eine List der Frauen von Lonato, damit sich Lucias und Antoninos Wege kreuzen und sie ihr Glück finden – bis Antonino 1915 in den Krieg ziehen muss. Als der italienische Staat 1917 ein Dekret erlässt, nach dem die Soldaten aus der Armee entlassen werden, die bereit sind, einen Bauernhof zu pachten, nimmt die resolute Lucia ihr Schicksal selbst in die Hand: Antonino will Kühe halten und Getreide anbauen, Lucia jedoch träumt von einem Weingut – es wäre das erste der Region ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Bruns
Das Weingut am Gardasee
Roman
Oktopus
PrologCantina Grazioli, 1986
Der Tanaro war zwei Tage blutrot.«
»Sie haben den Wein in den Fluss gekippt?« Rosa konnte es nicht glauben. »Onkel Fulvio, bist du sicher?«
Fulvio bejahte, ganz in Gedanken vertieft. »Das gepanschte Gesöff. Ja. Irgendwo müssen sie es ja loswerden. Filippo hat es gesehen. Er sagt, es wären mehr Fernsehteams und Fotografen dort gewesen als bei der Wahl von Papst Johannes Paul II.«
Rosas besorgter Blick fiel auf Bisnonna Lucia. Die leeren Augen der Greisin ruhten irgendwo auf der gegenüberliegenden Wand. Jeden Tag, der verging, schien sie sich mehr und mehr von dieser Welt zu verabschieden. Manchmal wusste sie nicht einmal mehr, wer sie war. Gerade verspürte Rosa jedoch erstmals so etwas wie Erleichterung darüber. Wie düster die Wolken über dem Weingut Grazioli auch aufziehen würden, die geliebte Urgroßmutter durfte davon nichts erfahren.
Tante Valentina bekreuzigte sich. »Die ganze Welt wird sich über uns totlachen. Der italienische Wein, nichts weiter als Zucker, Leitungswasser, Rinderblut und billiger Alkohol.« Ein höhnisches Lächeln huschte über ihr Gesicht.
»Nicht über die Graziolis«, widersprach Fulvio seiner Frau kategorisch.
»Wann begreifst du endlich, dass die großen Zeiten der Graziolis vorbei sind, sollte es die jemals gegeben haben?« Valentina funkelte ihn aus bösen Augen an. »Das halbe Leben hat man sich krummgeackert. Für was, frage ich dich? Seit zwanzig Jahren fahre ich mit der schäbigen Karre umher, Rimini kenne ich nur von Postkarten … Und wenn die alte Röhre nicht durchgebrannt wäre, hätte ich heute noch keinen Farbfernseher.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, das Weingut zu verkaufen. Womöglich wartet irgendwo ein Dummkopf, der uns noch ein paar Lire dafür gibt. Deine Söhne sind übrigens auch einverstanden.«
Fulvio trank schweigend seinen Kaffee.
»Papa Angelo würde sich im Grabe herumdrehen. Gut, dass er das nicht mehr erlebt«, sagte Elena leise. »Unser schöner Wein! Die, die das zu verantworten haben, sollten sich schämen.«
Rosa fasste nach der Hand ihrer Mutter und drückte sie fest.
Valentina verdrehte die Augen. »Beschwer dich in Brüssel«, sagte sie lapidar.
»Womöglich sollten wir das tun«, entgegnete Elena gleichmütig. »Immerhin wollen die auch nicht, dass das viele Geld, das sie in den Weinbau geben, einfach so versickert.«
»Es versickert! Jeden Tag, wenn du einen Fuß in den beschissenen Weingarten setzt, ist es schon weg«, echauffierte sich Valentina. »Wann begreift ihr endlich, dass Landwirtschaft keine Zukunft hat!«
»Valentina!«, herrschte Fulvio seine Frau an. »Wir haben Verantwortung. Die Familie. Das Weingut ist unser Auskommen. Vergiss das nicht!«
»In den Sechzigern haben wir es auch geschafft. In der Weinwirtschaft gibt es immer Krisen«, warf Elena fast schon rebellisch ein. »Außerdem ist unser Wein sauber. Das müssen wir nur jedem erzählen.«
Valentina lächelte gekünstelt, dann sprang sie auf. »Ihr seid naiv! Euer Weingut liegt doch nicht auf dem Mond. Wenn die in München den Fernseher anmachen, kriegen die italienische Weinbauern hinter schwedischen Gardinen vorgeführt. Dazu drei Vergiftete, eine Liste an Toten und Flüsse voller Wein. Womöglich legen die irgendwo noch ein paar verendete Fische auf den Tisch. Das ist ein Skandal von unermesslichem Ausmaß. Und ihr werdet in Sippenhaft genommen. Was denn auch sonst!«
»Wir wissen das alles«, entgegnete Fluvio kalt.
Valentina stutzte.
»Und wir werden kämpfen. Ganz so, wie wir es immer getan haben«, ergänzte Elena.
»Die Geschwister Elena und Fulvio Grazioli retten die italienische Weinwirtschaft. Ein Halleluja auf die ewig gestrigen Romantiker.« Wutschnaubend stürzte Valentina aus dem Zimmer.
»Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, wie wir das überstehen sollen«, sagte Fulvio mit gedämpfter Stimme. »Vorhin hat unser wichtigster Großhändler aus Deutschland angerufen. Die Bestellung ist bis auf Weiteres storniert. Damit brechen langsam, aber sicher unsere Einnahmen weg.«
»Ich möchte in den Weinkeller«, sagte Lucia in das nun entstandene Schweigen hinein.
Fulvio schaute seine Großmutter aus müden, aber gütigen Augen an.
»Ich komme mit.« Rosa erhob sich eilig. Sie warf ihrer Mutter und ihrem Onkel einen fragenden Blick zu. Niemand schien etwas dagegen zu haben. Dann löste sie die Bremsen von Lucias Rollstuhl.
»In den richtigen«, sagte die Nonna beim Hinausfahren.
»Aber Nonna, da unten tummeln sich seit Jahren nur noch die Mäuse. Unser Wein liegt doch drüben, im Neubau.« Fulvio war nun ebenfalls aufgestanden.
»In den alten Schafstall der Familie Macre. Dort lagert der Wein«, widersprach Lucia erzürnt.
»Aber die Treppe … wie willst du?« Fulvio startete einen weiteren Versuch. Nachdem Lucia ihn nicht einmal ansah, ließ er es bleiben und gab sich geschlagen. Alte Leute und ihr Starrsinn.
Wenig später stand Rosa vor dem kleinen heruntergekommenen Haus. Es musste gut und gern zwanzig Jahre her sein, dass sie das letzte Mal hier gewesen war. Als Kind hatte es keinen besseren Ort für die Versteckspiele mit ihren Brüdern gegeben. Das ehemalige Wohnhaus ihrer Urgroßeltern lag etwas abseits vom Trubel des Weingutes und damit auch aus dem Sichtfeld ihrer Eltern. Irgendwann in den fünfziger Jahren hatte Nonno Angelo ein neues Haus gebaut, inklusive eines großen Wirtschaftsbereiches. Von da an war der alte Schafstall der Macres mehr und mehr als Abstellplatz für alles Mögliche verkommen, was man nicht mehr benötigte. Schließlich verfiel er zusehends. »Ich habe keinen Schlüssel«, sagte Rosa und betrachtete eine Eidechse, die es sich auf dem sonnigen Fensterbrett gemütlich gemacht hatte.
»Biagios Haus ist offen, schon immer«, entgegnete Lucia und quälte sich keuchend aus dem Rollstuhl. Mit zittrigen Beinen, Rosa stützte sie, überwand sie die beiden Stufen am Eingang. Die Tür knarzte, ließ sich aber ohne Probleme öffnen. Lucia lehnte zwischen Rosa und dem Türrahmen. Sie sah traurig aus. Rosa betrachtete die kleine, im Dunkeln liegende Küche. Ein vom Ruß der Jahrzehnte schwarz gefärbter Herd, eine schmale Bank, ein Tisch, zwei Stühle. Dass es mal einen Schrank gegeben hatte, verrieten nur die helleren Stellen, gegen die sich der Kalkputz abhob. Dafür türmten sich leere Weinkisten und allerlei Krimskrams in den Ecken. »Komm, weiter!«, sagte Lucia irgendwann.
Rosa erblickte die Kellerluke, die ihr als Kind wie der Eintritt in ein fürchterliches Verlies vorkommen war. Nicht ein einziges Mal war sie da unten gewesen, obwohl ihre Brüder sie sogar mit Bonbons gelockt hatten.
Lucia hatte sichtbar Mühe, ihre Füße über den staubigen Holzboden zu schieben. »Gib mir einen Stuhl, bitte«, sagte sie nach Luft ringend.
Rosa beeilte sich.
»Jetzt öffne die Klappe für mich«, bat Lucia.
Rosa tat auch das. Mit dem Aufnehmen der schmalen Brettertür stieg kühle, ein wenig feuchte Luft zu ihnen herauf. Lucias Brust entfuhr ein leiser Seufzer.
»In der hintersten Ecke im Keller, unter dem Regal, steht eine Holzkiste«, sagte Lucia schwerfällig und griff an die Kette um ihren Hals. Kraftlos zog sie das daran hängende Amulett unter ihrer Schürze hervor und hielt es ihrer Urenkelin entgegen. Rosa zögerte kurz. Dann fasste sie behutsam nach dem Anhänger, klappte das winzige Häkchen um und öffnete ihn. Ein vergilbtes und mit feinen Rissen übersätes Foto ihres Urgroßvaters Antonino erschien. Darauf lag ein Schlüssel. Sie schaute Lucia fragend an, doch die Bisnonna schien wieder weit weg zu sein. Mit einem mulmigen Gefühl im Bauch kletterte Rosa die schmale Stiege hinunter und suchte nach dem Lichtschalter. Schließlich fand sie ihn, und eine nackte an der Decke baumelnde Glühbirne begann zu glimmen. Der Raum war nicht halb so gruselig, wie sie sich ihn immer vorgestellt hatte. Vielleicht ein bisschen ekelig. Sie schlug mit den Händen die Spinnweben weg, um sie nicht ins Gesicht zu bekommen. Fast wäre sie gegen ein paar leere Weinflaschen getreten, die auf der Erde herumlagen. »Hier ist kein Regal mehr«, rief sie nach oben.
»Unter der Treppe. Ganz hinten«, hörte sie Lucias schwache Stimme.
Rosa drehte sich um. Irgendjemand hätte einmal die Glühbirne wechseln sollen. Heutzutage gab es welche, die wesentlich stärker waren. Mit zusammengekniffenen Augen und ausgestreckten Händen fand sie schließlich etwas, was sich wie ein Regal anfühlte. Sie hockte sich hin. Um sie herum lag nichts als Dunkelheit. Widerstrebend tastete sie über das klamme Erdreich unter dem Möbel. Es dauerte etwas, bis sie einen Gegenstand aus Holz zu fassen bekam. Das Teil war größer als vermutet und ließ sich nur äußerst schwer bewegen. Schließlich gelang es ihr, die Kiste unter den Lichtschein der Lampe zu schieben. Sie wischte mit ihrer Handfläche eine dicke Staubschicht weg. Das Holz wies hier und da ein paar Stockflecken auf, ansonsten schien es intakt. Der Schlüssel passte. Mit etwas Druck schnappte der Deckel auf.
»Das ist Wein«, rief sie zu Lucia hinauf. »Sechs Flaschen.« Sie nahm eine auf. Es war ein Barolo aus dem Jahr 1914. Ungläubig betrachtete sie das Etikett. Daneben lag noch einer. Auch von 1914. Cantine Volpi. Zwei weitere Flaschen stammten aus dem Jahr 1917. Die letzte jedoch trug die Jahreszahl 1890. Rosa verfügte über genug Sachverstand, um zu wissen, dass hier im Keller des alten Macre-Schafstalls ein Vermögen schlummerte. Eine ganze Weile hockte sie einfach nur so da und betrachtete den Schatz. Welche Katastrophe nun auch immer über das Weingut der Graziolis hineinbrechen würde, mit diesem Fund hätten sie eine Chance, sie zu überstehen. Sie beschloss, Lucia erst zurückzubringen, die sicherlich erschöpft war. Dann würde sie eine Flasche nach der anderen holen.
Überwältigt von dem Geheimnis, das Lucia fast ihr ganzes Leben gehütet haben musste, stieg sie nach oben. »Du hast niemals etwas davon erwähnt«, sagte sie lächelnd, kaum dass ihr Kopf wieder über den Rand der Luke im Fußboden herausguckte. »Bisnonna Lucia. Das könnte unsere Rettung sein. Wo hast du den Wein her?«
Lucia reagierte nicht.
»Bisnonna Lucia? Hörst du! Du hast die Cantina Grazioli gerettet«, wiederholte sie noch einmal während sie sich aufrichtete und an sie herantrat. Behutsam fasste sie nach ihrem Arm. »Bisnonna?«
Und da begann Lucia zu erzählen …
EINS
Frühjahr 1914
»Da ist schon wieder ein neues Licht.« Mit den Wor-ten des Vaters wehte zugleich eine leichte Brise in die Küche.
»Wie schön.« Lucia wandte sich kurz der offenen Tür zu, aber der Lufthauch war nicht mehr zu spüren. Eilig wischte sie sich mit dem Handrücken über die schweißige Stirn. Der Vater wartete auf sein Abendessen.
»Ja, ein neues Licht. Ich würde auf Desenzano tippen. Es kann aber auch aus Padenghe kommen«, redete der Vater weiter.
Dort gab es nur drei Häuser und vier Fischer, dachte Lucia, die annehmen würden, der Heilige Geist wäre über sie gekommen. Der Frevel war kaum in ihrem Kopf aufgeblitzt, da bereute sie ihn auch schon. Dass sie ihre Gedanken einfach nicht im Zaum halten konnte. »Oh! Verzeih mir, Herr. Ich habe es nicht so gemeint«, murmelte sie eilig. Dann griff sie zum Schürhaken. Mit nur wenigen Bewegungen verwandelten sich die klimmenden Holzscheite in lodernde rötlich gelbe Flammen. Die Hitze, die sich rasch in der kleinen Küche ausbreitete, nahm ihr fast den Atem.
»Nein, nein. Desenzano«, sagte der Vater. »Die haben eine weitere Glühbirne bekommen. Dabei haben die schon mindestens drei, also, nach allem, was ich von hier sehen kann. Aber das wird schon seine Richtigkeit haben.« Er freute sich. »Wenn das so weitergeht, können wir irgendwann sogar bei völliger Finsternis die Umrisse des Sees erkennen und die anderen Dörfer. Ob so etwas wohl möglich ist? Nehmen wir mal an, man könnte all die schönen Dinge sogar in der Nacht sichtbar machen. Die Leute würden schlagartig begreifen, wie es mit unserem Land aufwärtsgeht.« Er grunzte voller Begeisterung. »Wir strahlen dann bis nach Österreich-Ungarn. Geschieht denen recht.«
Lucia seufzte. Die Leute brauchten kein Licht, um zu sehen, dass ihre Mägen leer waren. Der größte Fortschritt nutzte nichts, wenn er das Dasein im Kleinen nicht erträglicher machte. Was der Vater sich immer so zurechtdachte. Hoffentlich ging er mit dem Einfall nicht wieder gleich zum Bürgermeister. »Die Suppe braucht noch einen Moment, Vater.«
»Ich zähle ohnehin erst noch einmal durch«, erwiderte er. »Man muss ja auf dem Laufenden sein bezüglich der Elektrizität. Den Bürgermeister interessiert das bestimmt auch.«
»Natürlich, Vater.« Lucia ließ eine Handvoll Buchweizen in den Topf mit der Milch gleiten und rührte langsam mit einem Holzlöffel. Von den paar Körnern würden sie nicht satt werden, vor allem der Vater nicht. Obwohl sie wusste, dass der Tontopf mit Getreide leer war, zog sie ihn noch einmal von dem über der Kochstelle befindlichen Steinsims, hob den Deckel an und schaute hinein. Vermutlich hätte sie ihn sich nebenan bei ihrer Nachbarin Angelina vollmachen lassen müssen, letzte Woche schon. Sie musste es vergessen haben.
»Vier, fünf, sechs … erstaunlich!«, freute sich der Vater. »Wie der See leuchtet, und wir haben nicht einmal Vollmond.«
Lucia starrte auf die Milch. Auf ihrer Oberfläche schwammen bereits kleine Bläschen, die eines nach dem anderen aufplatzten, um an einer anderen Stelle wieder neu aufzutauchen. »Immer umrühren. Immer umrühren«, mahnte sie sich. Der Vater war genügsam, aber der Geschmack von angebrannter Milch würde sogar ihn ungehalten werden lassen, zumal womöglich wirklich nicht viel dazugehörte, eine Buchweizensuppe zuzubereiten.
»Weißt du, was ich heute in der Zeitung gelesen habe?«, fragte er.
So langsam wollte der Vater bestimmt essen, nur dass die Suppe vermutlich noch nicht so weit war.
»Weißt du, was ich heute in der Zeitung gelesen habe?«, wiederholte er die Frage noch einmal.
Lucia hatte vor lauter Anspannung über das dumme Getreide vergessen zu antworten. »Nein«, erwiderte sie brav. »Im Corriere della Sera?«
»Natürlich! Wo denn sonst?«, entgegnete der Vater prompt. »Eine andere Zeitung würde ich niemals auch nur anfassen!«
Über Lucias Gesicht legte sich ein liebevolles Lächeln. Schon als sie noch ein Kind war, hatten sie jeden Abend dieses Spiel gespielt. Damals durfte sie dazu auf seinen Schoß klettern, um dicht bei ihm hinter der hochgehaltenen Zeitung zu sitzen. Auf sein Geheiß musste sie dann ihren Finger unter der Zeile langfahren lassen, die er gerade laut vorlas. Seinerzeit wusste Lucia noch nicht, dass der Vater nicht in der Lage war, auch nur zwei Buchstaben miteinander zu verbinden. Signore Biagio Macre, Steinsetzer aus Lonato einer kleinen Stadt oberhalb vom Gardasee, hatte nie gelernt zu lesen. Trotzdem verwendete er einen unbändigen Eifer darauf, jedem das Gegenteil weismachen zu wollen. Dazu versäumte er keine Gelegenheit, mit der Gazette unter seinem Arm herumzulaufen, oder – wenn er sich irgendwo niederließ – sie sichtbar neben sich zu platzieren und bei Bedarf wichtig daraus zu zitieren. Das Bild, das die Leute von Biagio Macre hatten, war stets das eines Mannes mit einer Zeitung. Für ihn war es nicht weniger als das eines Mannes von Welt. So sah man ihn zeitig am Morgen zur Arbeit gehen und abends zurückkommen. Er trug den Corriere bei sich, wenn er einmal in der Woche in der hiesigen Taverne Station machte, wenn er sich zur Nachtruhe legte, und sogar bei der sonntäglichen Heiligen Messe. Dann schob er ihn in die Jackentasche seines einzigen Anzuges, der ein wenig in die Jahre gekommen war. Darauf hatte der Prete bestanden. Der Geistliche glaubte, so ein weltliches Druckerzeugnis auf einer Kirchenbank könnte den Herrn erzürnen. Denn das Wort und dessen einzige Wahrheit lag doch zu allererst bei ihm. Der Prete war selbstredend im Gegensatz zu seinen Gemeindemitgliedern des Lesens mächtig, und man glaubte ihm unbenommen. Nun ja, alle bis auf Biagio Macre. Aber der würde sich eher die Zungenspitze abbeißen, als das laut auszusprechen. Immerhin hatte es ihm seine Rosa verboten. Die war zwar nun schon bald zwanzig Jahre tot, aber da das für Biagio keinen Zustand, sondern lediglich einen Ortswechsel bedeutete, musste er auf der Hut sein. »Die könnten im Corriere ruhig mal schreiben, wie viele Häuser bei uns nun schon Strom haben«, sagte Lucia.
»Ich zähle doch jeden Abend«, erwiderte der Vater verwundert. »Außerdem müssen die mit dem Platz haushalten. Papier ist teuer. Da können nur Dinge von großer Bedeutung erwähnt werden, zum Beispiel Viktor Emanuel III., unseren König.«
»Natürlich, Vater.« Lucia rührte noch immer im Abendessen, aber so sehr sie sich auch mühte, die Suppe würde wohl nicht dicker werden. Ihr Blick streifte den auf dem Tisch stehenden Korb. Den darin liegenden Kanten hatte sie für das morgige Frühstück aufgehoben. Sie schob den Topf vom Feuer und füllte zwei Schalen. Dann nahm sie das Brot, brach es in zwei Hälften und versenkte eine davon in der Portion des Vaters. Die andere legte sie zurück. Ein Mann, der den lieben langen Tag Steine bearbeitete, hatte Hunger.
»Da bist du ja schon! Kann es sein, dass du immer flinker wirst?«, rief er fröhlich und ohne nur das kleinste Anzeichen von Ungeduld, als sie aus dem Haus trat. »Setz dich und schau dir die Lichter an.« Der Vater nahm die Zeitung aus Lucias Sichtweite, eine Vorsichtsmaßnahme, die er penibel einzuhalten pflegte. Biagios Schlagzeilen von gestern blieben nämlich auch die von morgen. Seine Lektüre wechselte nicht ganz so regelmäßig, wie man es für ein täglich erscheinendes Blatt meinen sollte. Kurzum, manchmal vergingen Tage, seltener auch Wochen, bis er es zu einem aktuellen Exemplar brachte, was seinen täglich rezitierten Nachrichten keinen Abbruch tat. Biagio Macre kaufte seine Zeitung nicht wie andere Leute in einem Laden oder bei einem Zeitungsburschen. Den Preis von fünf Centesimi konnte er schlichtweg nicht aufbringen. Er musste auf die flinken Finger seines Freundes Francesco vertrauen. Vorausgesetzt natürlich, Francesco ließ sich von dem Anblick der fremden Schönheiten, die in Desenzano flanierten, nicht zu sehr ablenken. Dann kam es vor, dass er vergaß, ihren Begleitern die Zeitung zu stehlen.
»Willst du nun hören, was ich heute in der Zeitung gelesen habe?«, fragte der Vater, kaum dass sie ihm sein Essen gereicht und sich neben ihm niedergelassen hatte.
»Was stand denn so Wichtiges darin?«, fragte Lucia, den Blick auf den fernen See gerichtet.
»Im Corriere della Sera stehen nur wichtige Dinge«, entgegnete der Vater, während er die Schale zu seinem Mund führte und die Suppe daraus schlürfte. Dann kaute er angetan, als handelte es sich um Sonntagsnudeln mit frischem Käse aus Dickmilch. »Der Mann, der dich einmal bekommt, kann sich glücklich schätzen. Gut gemacht, Lucia.«
Lucia betrachtete das abgeschlagene Gefäß in ihren Händen, von dem ihr der süßliche Duft der Milch entgegenströmte. Hätte sie das Ganze nicht noch ein wenig salzen müssen? Vielleicht gehörte auch etwas Gartengemüse hinein? Wer konnte das schon so genau wissen? Zögerlich nahm sie ihren Löffel und probierte. In ihrem Mund breitete sich der Geschmack von warmer Ziegenmilch aus. Genau das, was sie gekocht hatte. Erstaunlich.
»Was ist das für eine Suppe?«, wollte der Vater schmatzend wissen. Lucia konnte hören, wie die Getreidekörner zwischen seinen Zähnen knackten.
»Eine Art Minestrone, wie sie die Mutter immer zubereitet hat, mit Buchweizen«, antwortete Lucia, um dem Vater eine kleine Freude zu bereiten. Dazu genügte allein die bloße Erwähnung ihrer Mutter. Außerdem stimmte die vermutlich auch seinen Gaumen etwas milder. Biagio Macre war ein durch und durch ausgeglichener und liebenswürdiger Mensch, aber was Lucia Abend für Abend zubereitete, hätte unbenommen dazu getaugt, einen Mann in Raserei zu versetzen. Hätte sie eigentlich die Körner weich werden lassen müssen?
»Ah!«, rief der Vater angetan aus. »Sehr gut. Wirklich sehr gut.« Er hielt kurz inne, pulte sich mit dem Zeigefinger etwas aus den Zähnen und aß weiter. »Wie ich immer sage, wenn jemand des Lesens mächtig ist, steht ihm die Welt offen und das Kochbuch deiner Mutter.« Er lächelte versonnen. »Bevor ich sie heiraten durfte, musste sie ein ganzes Heft mit Rezepten vollgeschrieben haben. Jedes einzelne davon hat sie ausprobiert, nur um gut genug für mich zu sein. Das war sie zweifelsohne. Deine Mutter war ein Engel. Und sie war über alle Maßen klug.« Er hielt kurz inne, trank einen Schluck Suppe und fuhr fort. »Dass sie so einen Dummkopf wie mich überhaupt genommen hat.« Sein Kopfschütteln verdeutlichte, dass er sich darüber wohl selbst am meisten wunderte. »Eine Frau, die ihren Kopf nicht nur zum Frisieren auf dem Hals trägt, mit der kann man etwas anfangen. Schau dir allein unser Haus an. Ich habe meine Rosa noch an ihrem Hochzeitstag über die Schwelle eines alten Schafstalles getragen. Das hat sie schließlich daraus gemacht.« Er deutete mit der Hand hinter sich. »Alle haben uns damals ausgelacht …« Ein lauter Seufzer verließ seine Brust. »Der halb verfallene Schafstall des Großvaters, mehr hatte ich ihr nicht zu bieten. Was wissen die Leute schon!« Biagio schien sich ebenfalls darüber zu belustigen. »Aber wo acht Schafe einen Unterschlupf gefunden haben, passen auch acht Söhne rein, habe ich ihnen zugerufen.« Er hob und senkte die Schultern. »Nun, vier Töchter sind es geworden. Immerhin kenne ich keinen in unserer Gemeinde, der das hinbekommen hat.« Sein trotziger Stolz war unüberhörbar. »Mal abgesehen von den beiden Ziegen. Die waren übrigens zuerst da. Rosa hat darauf bestanden. Erst eine Ziege, dann ein Kind, hat sie gesagt. In ihrer Sturheit hätte es deine Mutter mit jedem Maultier aufnehmen können. Jedenfalls wollten wir eine Ziege auf dem Markt kaufen, das abgezählte Geld bis auf den letzten Centesimo schon in der Tasche. Was macht meine Rosa? Die erstbeste, die sie sieht, führt sie nach Hause. Ich habe noch gesagt, du musst vergleichen, Rosa. Bevor man nicht alle gesehen hat, kann man nicht wissen, ob man auch die beste bekommt. Aber mit deiner Mutter reden war zwecklos, die Ziege und basta. Nur ein paar Tage später, ich komme von der Arbeit und will nach dem Tier gucken, springt oh Wunder ein frisch geborenes Zicklein durch den Stall. Sie hat es gewusst, meine Rosa, aber sie hat niemandem auch nur ein Sterbenswörtchen verraten. Immerhin hätte der Verkäufer eines der Viecher zurückfordern können. Soll er nur kommen, der Kerl, hat sie ausgerufen. Was kann ich denn dafür, wenn es der Ziege so gut in meinem Stall gefällt, dass sie gleich zwei Mal da sein will?« Das Lachen des Vaters schallte durch die aufkommende Dunkelheit. »So war sie, meine Rosa. Habe ich dir die Geschichte schon erzählt?«
»Nein, Vater«, versicherte Lucia. »Noch nie!« Die Anekdoten konnte vermutlich jede Macre-Tochter so textsicher herbeten wie das Vaterunser.
»Hast du noch Nachschlag?«, wollte der Vater wissen. Wie zum Beweis, dass es ihm geschmeckt hatte, wischte er sich mit dem Unterarm über den Mund. »Das mit dem Gesetz war absolut richtig von unserem König. Kinder sollten in die Schule gehen dürfen. Wie sonst hättest du mir so ein köstliches Mahl zaubern können?« Biagio strahlte über das ganze Gesicht.
Lucia zweifelte nicht an der Entscheidung des Königs, erst recht nicht, wenn der Vater der gleichen Meinung war. Ihre dünne Buchweizenbrühe hatte damit allerdings nichts zu tun, genauso wenig wie das Heft der Mutter. Rosa Mace hatte nicht ein einziges Rezept niedergeschrieben. Es war Pater Michele gewesen, Gott hab ihn selig, der die Zeilen mit frommen Sprüchen für die armen Kinder gefüllt hatte. Alles hatte er als besser empfunden als ein Leben ohne Bibel. Rosa hatte zeitlebens keinen Stift angerührt und ihr Geheimnis mit ins Grab genommen. Dafür hatte sie dem liebenden Mann mit dem einzigen Buch, das die Familie Macre jemals besessen hatte, eine ganz besondere Erinnerung beschert.
Lucia stand auf und ging ins Haus. Sie würde nebenan bei Angelina nach dem Rezept für die Suppe fragen. Vielleicht konnte aus warmer Milch tatsächlich eine anständige Mahlzeit werden. Erstaunt betrachtete sie den im Topf verbliebenen Rest. Die Suppe hatte sich in einen Brei verwandelt – wenn das immer so einfach ging, würde sie das Kochen vermutlich doch noch lernen. Mit flinken Händen tat sie dem Vater auf und trat wieder hinaus.
»In der Zeitung haben sie geschrieben, dass in Desenzano schon wieder ein neues Hotel gebaut wird«, sagte der Vater, nachdem sie zurück war. »Das gäbe dann noch ein weiteres Licht.«
Lucia hob den Kopf und blickte in Richtung Gardasee. Das wunderschöne Panorama, das sich ihr am Tag bot, wurde langsam von der Dunkelheit verschluckt. Nur hier und da blitzten in der Ferne ein paar schwache Lichter auf. Sie zählte. »Ein sechstes«, sagte sie.
»Genau«, bestätigte der Vater. »Aber der Fortschritt ist wie eine Gams. Kaum entdeckst du eine vor dem einen Felsvorsprung, taucht eine weitere schon hinter dem nächsten auf. In einem halben Jahr können vielleicht schon zehn oder sogar zwanzig neue Lampen da unten brennen. Womöglich verfügt der komplette See sogar bald schon über Elektrizität. Dann wird es nicht mehr lange dauern, bis wir drankommen! Wie wir dann wohl leben werden? Stell sich einer mal vor! Ich müsste nicht mehr nachts im Dunkeln über den Hof.« Der Vater jauchzte so begeistert wie immer, wenn er sich als Teil einer großen Vorwärtsbewegung begriff. »Wir müssen unserem Viktor Emanuel dankbar sein, jeden Tag!«
Lucia bemerkte, dass sie kaum noch die Hand vor Augen erkennen konnte. Sie wollte dem König gern für alles Mögliche dankbar sein, aber die Elektrizität war es derzeit noch nicht. Strom würde um die armen Leute zunächst einen weiten Bogen machen, wie so vieles andere auch. Abgesehen davon erschlossen sich ihr dessen Vorzüge bislang noch nicht. Sie ging ins Haus, um die Petroleumlampe anzuzünden, und trug sie anschließend vorsichtig hinaus zum Vater, der noch immer von der Zukunft schwärmte. »Wird es nicht langsam zu kühl für dich?«, fragte sie besorgt. »Mit einem Frühjahrsschnupfen ist nicht zu spaßen.«
Der Vater wollte offenkundig nichts davon wissen. »Zwanzig Fremdenzimmer soll das neue Hotel übrigens haben«, rief er aus und warf den Kopf voller Begeisterung nach hinten. »Zwanzig! Und alle sollen sie so eine Waschkommode bekommen. Du weißt schon, einen Schrank, in den man das Wasser füllt, um sich zu waschen. Das Wasser wollen sie aus der Wand kommen lassen. Francesco hat angeblich so etwas schon mal gesehen, aber die Feriengäste … Mhm? Darüber noch eine Lampe, und die Sache ist perfekt. Dann sieht man auch, was man wäscht. Nachher erschrecken sich die Fremden noch, wie luxuriös es bei uns in Italien zugeht.« Er lachte. »Aber recht so! Die können ruhig jedem erzählen, wie modern das Land von Viktor Emanuel ist. Die Österreicher sollen platzen vor Neid.«
Lucia dachte an Francesco, den Freund des Vaters. Er war das größte Tratschmaul, mit dem das Südufer des Sees aufzuwarten hatte. Und das faulste noch dazu. Die Geschichte mit dem Hotel konnte der Vater nur von ihm haben. Aber seit wann interessierte er sich für die Angelegenheiten am See, erst recht wenn sie die Fremden betrafen? Biagio Macre zählte nicht zu denjenigen, die den Fremdenverkehr verteufelten, und davon gab es bestimmt so einige. Er gehörte für ihn lediglich zu dem Teil der modernen Welt, den er nicht verstand. Denn wenn man sich glücklich schätzen konnte, ein eigenes Bett zu haben, welchen Sinn machte es dann, in einem fremden zu schlafen? »Haben sie dich für die Fußböden bestellt?«, fragte Lucia, die sich nur vorstellen konnte, dass eine Anstellung das Interesse des Vaters geweckt haben könnte. Es war zwar erst April, doch wenn erst der Herbst kam, hatten die Leute umso weniger für einen Steinsetzer zu tun. In den Wintermonaten verdiente er sogar fast nichts. Dann schnitzte er kleine Flöten aus Olivenholz und allerlei anderes Kinderspielzeug, das er auf dem Markt zu verkaufen versuchte. Immerhin brachte ihnen das in den meisten Wochen wenigstens einen Laib Brot ein. Alles in allem genügte es jedoch kaum für einen allein.
»Du bist schon immer die pfiffigste von all meinen Töchtern gewesen«, freute sich Biagio, wiegelte aber fröhlich ab. »Das wird man sehen, ob die jemanden wie mich gebrauchen können. Das schreiben sie dann ganz sicher in der Zeitung. Mit etwas Glück gehöre ich zu den Ersten, die die vornehme Herberge betreten dürfen. Aber das ist nicht so wichtig. Ich habe mir da etwas überlegt, was ich mit dir …« Er unterbrach sich und schien nun erst die neben ihm auf der Bank stehende Portion zu bemerken. »Du hast wohl auch eine Süßspeise gemacht? Löblich!«
Gut, dass ich das Salz vergessen habe, dachte Lucia.
»Ich sehe schon, du wirst bald einen Ehemann und eigene Ziegen bekommen«, redete der Vater munter weiter. »Das Fundament jedenfalls haben wir gelegt. Der liebe Gott und deine Mutter waren dabei auch nicht ganz untätig. Immerhin bist du das schönste Mädchen im Dorf.« Pause. »Und du kannst lesen. Dafür danken wir unserem geliebten König.«
Lucia fragte sich, was der Buchweizenbrei mit ihren Aussichten auf dem Heiratsmarkt zu tun hatte. Hoffentlich nichts, denn der wäre wohl eher ein schlechtes Vorzeichen. Auch die Sache mit dem Lesen erschien ihr nicht ganz rund. Sie wusste zwar noch nicht viel über die Männer, aber dass sie einer Frau in etwas nachstehen konnten, hatte ihr noch niemand berichtet. Was sollte das aber dann geben in einem Dorf voller Analphabeten? Nach Lucias Einschätzung würde ihre Schönheit allein wohl nicht genügen, um ihre Makel wettzumachen. Im Frühjahr war sie neunzehn Jahre alt geworden, und dass sie in naher Zukunft einen Burschen finden musste, ließ sich vermutlich nicht vermeiden. Maximal ein, vielleicht zwei Jahre würden ihr die Leute noch geben, dann begannen sie zu reden. Erst heimlich, hinter ihrem Rücken, aber irgendwann fielen alle Hemmungen. Lucia wusste, wenn die letzte Stufe erst erreicht war, behielt sie ein Schandmal, das sich nicht mehr ausmerzen ließ. Von ihr würde es ein Leben lang heißen, dass sie über die Zeit war, eine Verschmähte mit einem Menetekel, für die sich am guten Schluss irgendein ahnungsloser Tölpel erbarmt hatte. In dem großen Lauf der Dinge, nach dessen Regeln sich das Leben nun einmal bewegte, gehörte ein Gatte unweigerlich dazu. Verlobung, Hochzeit, Kindstaufe, die christlichen Pflichten einer Frau waren vorgezeichnet. Lucia haderte nicht mit ihrem Schicksal, das hätte ohnehin nichts genützt. Nur manchmal fragte sie sich insgeheim, ob es da nicht noch mehr geben könnte. Immer wenn sie sich diesen Gedanken hingab, stellte sich wie auf Kommando eine andere Sorge ein, ganz so, als ob der liebe Gott ihr die Unverfrorenheit heimzahlen wollte. Lucia befürchtete, Gottes Plan nicht gerecht werden zu können. Dafür sah sie nur einen Grund, aber der erschien ihr ziemlich triftig: Für sie gab es keinen Bräutigam. Immerhin war die Liebe ganz und gar nichts Selbstverständliches. Sie kam oder sie kam nicht. Im zweiten Fall würde sie unmöglich heiraten können. Ihr war durchaus bewusst, dass sie damit auf verlorenem Posten kämpfte. Ein Mädchen musste das tun, was der Vater für richtig hielt. Aber sie konnte nicht versprechen, sich einfach zu fügen. Ihr Kummer jedoch war nichts, was den Vater momentan umtreiben sollte. Er sorgte sich auch so schon genug darum, wohin bloß mit ihr. Bei ihren Schwestern dagegen hatte sich das mit der Ehe irgendwie gefügt. Alles in allem konnte man wohl behaupten, sie hatten es nicht schlecht getroffen. Frederica war mit Lorenzo gegangen, der vom größten Hof der Gegend stammte, was sogar seinen schiefen Mund und das schüttere Haar liebenswert machte. Auch über seine Trägheit beklagte Frederica sich nicht. Je mehr Zeit Lorenzo brauchte, umso schneller hatte Frederica die Dinge gerichtet, was es mit sich brachte, dass sie die Hosen anhatte. Raffaela hatte Claudio genommen, einen ansehnlichen Kerl mit dicken schwarzen Locken und einem Zwinkern in den Augen. Dass ihm seine Kuh kurz nach der Hochzeit die oberste Zahnreihe ausgetreten hatte, fiel fast nicht auf, vielleicht nur, wenn er übertrieben lächelte. Das tat er immer beim Anblick einer schönen Frau, aber dank der Kuh musste das Raffaela nun kein Kopfzerbrechen mehr bereiten. Und dann waren da noch Petronella und Mattia. Mattia war kein schlechter Kerl, aber Mattia war nun einmal … nun ja, Mattia. Der Kerl war schlichtweg anders gestrickt. Schuld daran war wohl sein Vater, der 1859 in der Schlacht von Solferino gekämpft und von dort vor allem seine Macke mit nach Hause gebracht hatte. Die Leute behaupteten, Mattia musste sich irgendwann bei ihm angesteckt haben, anders konnten sie sich seine Absonderlichkeiten nicht erklären. Petronella hatte ihn trotzdem heiraten müssen. Lieber jemanden wie Mattia nehmen, denn als alte Jungfer zu enden, hatte der Vater gesagt. Dabei hätte sie so viele andere haben können, sie hätte nur zugreifen müssen, aber keiner war ihr gut genug. Manchmal wartete man die Dinge vermutlich einfach schlecht. Was nicht bedeuten sollte, dass Lucia die Meinung der Leute über ihren Schwager Mattia teilte. Ganz und gar nicht. Mattia war ein ganz besonderer Mensch. Sie hoffte nur, dass das Petronella auch noch aufging. Trotzdem wollte sie nicht warten, bis keiner mehr übrig blieb. Aber woher wusste ein Mädchen, welcher Mann der Richtige war? Und was war, wenn der nicht existierte?
»Ich halte schon eine geraume Zeit die Augen nach einem geeigneten Ehemann für dich offen«, sagte der Vater, nachdem er auch das Schüsselchen restlos geleert hatte. Dann nestelte er an der Tasche seiner Weste. Ein bis auf das Kleinste zusammengefaltetes Stück Papier kam zum Vorschein. Gewichtig klappte er es vor Lucias Augen auseinander.
Sollte der Vater etwas aufgeschrieben haben? Aber wie? Lucia machte einen langen Hals. Der Vater bemerkte es und rückte ein wenig von ihr ab.
»Ich habe eine Liste gemacht«, fuhr er wichtig fort. »Alle heiratsfähigen jungen Männer aus unserer Gegend stehen darauf geschrieben, zugeordnet habe ich sie auch.«
»Wie zugeordnet?«, fragte Lucia nach.
»Na, ob sie brauchbar sind oder nicht«, entgegnete der Vater. »Man muss sie ein wenig vorsortieren, weißt du? Das macht die Entscheidung leichter.« Er betrachtete den speckigen Zettel, als hätte er ein Wunderwerk vollbracht. Dabei bemerkte er nicht, wie Lucia sich zu ihm herüberbeugte, um nun einen Blick erhaschen zu können. Da standen keine Namen, Spitznamen oder Abkürzungen. Die Aufstellung des Vaters bestand nur aus einzelnen Strichen, die linker Hand unter einem großen Minus und rechter Hand unter einem großen Plus zugeordnet waren.
»Es ist aber auch wie verflixt«, redete der Vater weiter.
Das konnte selbst Lucia erkennen. Es gab nur einen einzigen Strich unter dem Pluszeichen. Dementsprechend dürftig musste ihre Auswahl an Heiratskandidaten sein.
»Entweder sind die Burschen schon einer anderen versprochen oder haben zu wenig zu bieten. Weißt du, ich denke, arm sind wir allein. Das bisschen, was wir besitzen, solltest du nicht noch teilen müssen. Dann steckst du am Ende in einem noch größeren Elend fest. Wir können da nicht jeden nehmen.«
»Es ist noch Zeit, Vater«, erwiderte Lucia, um ihn ein wenig zu beruhigen. »Irgendwann wird der Richtige kommen und mit ihm die Liebe.« Daran glaubte sie fest, zumindest dem Vater zuliebe. In ihrem Innersten jedoch sah das anders aus. Bis jetzt war nicht ein einziger Kandidat für sie beim Vater vorstellig geworden. Nicht ein einziger!
»Du weißt, Lucia …«, der Vater hob den krummen Zeigefinger, »… wer zu lange ausharrt, bekommt einen Mattia.«
Lucia wusste darauf nichts zu sagen. Musste man nicht die Wahl haben, um wählerisch sein zu können?
Ohne die Augen von seiner Sammlung zu lassen, kratzte er sich gedankenverloren das stoppelige Kinn. »Es spricht sich nun eben rum, dass du, na ja, du weißt schon. Ich kann sie ja auch nicht zwingen«, murmelte er leise. »Wie denn, ohne eine anständige Mitgift?«
Lucia hatte es befürchtet. König Viktor Emanuel hätte sein Augenmerk auf andere Dinge legen müssen, statt Mädchen in die Schule zu schicken. Pasta kochen und Socken stopfen war bei den Männern eher gefragt, und wegen dem König würde sie noch als alte Jungfer enden. Der Mutter musste das klar gewesen sein. Deswegen hatte sie die Schwestern nicht zur Schule geschickt, doch mit dem Kind, für das seine Frau im Wochenbett geblieben war, hatte Biagio alles richtig machen wollen. Sie sollte etwas Besonderes sein, ganz so wie seine Rosa es gewesen war. Das hatte sie nun davon.
»Außerdem kannst du nicht ewig bei mir bleiben«, redete der Vater weiter. »Du sollst dein eigenes Leben haben, und dir soll es besser gehen. Darauf muss ich als Vater bestehen. Was soll denn deine Mutter von mir halten?«
Der Vater klang nun wie jemand, der sich selbst von seiner eigenen Meinung überzeugen musste. Lucia fragte sich derweil, wer hinter dem einen annehmbaren Strich steckte? Ganz offenkundig gab es für ihren Vater einen Kandidaten, nur hätte sie gern auch gewusst, welchen Namen er trug. »Aber gibt es denn nicht einen einzigen, der infrage kommt?«, fragte sie scheinbar arglos.
Die Stirn des Vaters legte sich in Falten. »Tja«, brummte er, und seine Augen klebten förmlich an dem Zettel. »Das könnte schon sein. Heutzutage wird in Liebesdingen sicherlich so einiges überbewertet.« Er zog den Mund breit. »Harmonie ist wichtig, vor allem wenn Mann und Frau zu verschieden sind. Das liegt dann in den Händen der Frau. Mit etwas Mühe, ja, doch, schon irgendwie. Man rauft sich einfach zusammen. Im Alltag verlaufen sich die Gegensätze. Die sichtbaren vielleicht nicht so. Aber was weiß ich schon. Man kann sich ja auch aus dem Weg gehen. Dann muss man auch nicht so viel reden. Es ist ja ohnehin nicht gut, aus allem so eine Gefühlsduselei zu machen.«
Lucia verstand nicht, was der Vater ihr sagen wollte. Mittlerweile fragte sie sich, ob der eine Strich nicht ganz aus Versehen unter die Habenseite geraten war. Vielleicht hatte der Vater nur den Bleistift ausprobieren wollen? So ungeschickt, wie er damit umging, war das denkbar. Sie wartete, was er noch zu sagen hatte. Er ließ sich Zeit damit. Biagio Macre haderte mit sich. Das konnte sie deutlich erkennen.
»Es gäbe da vielleicht noch eine andere Möglichkeit«, hob der Vater schließlich zögerlich an. »Wir müssen ja nichts übers Knie brechen. Manchmal muss man einfach verschwinden, um wiederkommen zu können. Auch die Wiedergeburt des Königreichs Italien war nichts anderes, und sie beruhte auf einer klugen Strategie. Oder meinst du, ohne unseren Sieg bei Solferino gegen die Österreicher wäre Italien wiedervereinigt worden?«
Eine Eheanbahnung war also auch nichts anderes als ein militärischer Schachzug, dachte Lucia. Sie verstand von dem einen so wenig wie von dem anderen. Aber was meinte der Vater mit »verschwinden«? Wo sollte sie denn hin? In den Nachbarorten brauchten sie nicht fragen. Die Leute redeten schneller, als sie verstanden.
»Ich bin ein Anhänger der Moderne und des Fortschrittes«, fuhr der Vater bedeutungsschwanger fort. »Ganz so wie die Männer, die die Seiten des Corriere della Sera füllen.«
Amerika. Lucia durchzuckte es. Letzte Woche wollte der Vater erst einen Artikel über die wachsende Zahl der Auswanderer gelesen haben. »Moderne Menschen, die ihr Glück in der neuen Welt suchten …«, hatte er sie mehrfach genannt. Das war es also. Sie sollte ein moderner Mensch sein und einen Dampfer nach Amerika besteigen. Allein drei Familien aus den umliegenden Höfen hatten sich vor Kurzem erst dazu entschlossen, die Reise nach Amerika zu wagen, wo das Leben so viel besser sein sollte. Immerhin hatte man noch nie von jemandem gehört, der zurückgekommen war, dann musste man das wohl glauben. Womöglich betraf das auch die Auswahl der Männer. War es das, was der Vater wollte? Sie suchte sich in Amerika ihren Ehemann? Grundgütiger! So übel war es also um sie bestellt, dass sich in ganz Italien niemand finden ließ. Hoffentlich hatte der König das bedacht, als er sich das neue Schulsystem ausgedacht hatte. Aber vermutlich konnte der Plan des Vaters aufgehen. Das Land jedenfalls sollte riesig sein, viel größer als das Königreich Italien.
»Manchmal ist der scheinbar gerade Weg nun mal nicht der beste«, murmelte der Vater nachdenklich. »Das Leben schlägt einem so viele Haken. Man weiß doch nie, was einem widerfährt. Das Glück lässt sich durchaus auch herausfordern, also muss man es versuchen. Und man darf nicht zimperlich sein.« Er musterte sie von der Seite.
Er sprach von Amerika, ganz eindeutig. Aber wie sollte Lucia bei den vielen Menschen einen Italiener finden? Sie sprach kein Englisch, um nach einem fragen zu können. Nachher verliebte sie sich in einen Ausländer? Wie nannte man eigentlich Ausländer im Ausland? Konnte man sich in jemanden verlieben, dessen Sprache man nicht verstand? Immerhin hatte der Vater gesagt, dass eine Ehe auch ohne reden funktionierte.
»Hör bitte auf damit«, sagt der Vater streng.
»Ich habe nichts gemacht«, gab Lucia zurück.
»Die Luft in deinem Kopf wirbelt wieder durcheinander. Ich habe es deutlich gesehen«, erwiderte der Vater. »Verrückter Kram.« Er seufzte.
Lucia senkte das Kinn auf die Brust. Das sagte der Vater immer, wenn er der Meinung war, sie würde ihren Verstand ankurbeln, ohne dass etwas Sinnvolles dabei herauskam. Schon als Kind hatte Lucia sich die wildesten Sachen zurechtgedacht. Sie konnte nichts Falsches daran finden. Denn alles, was man sich vorstellen konnte, so ihre Überzeugung, war auch möglich. Dabei sprach sie im Gegensatz zu dem Vater ihre Luftgedanken niemals aus, erst recht nicht vor dem Bürgermeister. »Entschuldigung«, sagte sie leise.
Der Vater tätschelte ihr liebevoll den Arm. »Du musst das im Griff haben. So etwas mag kein Mann bei einer Frau, also, die meisten jedenfalls nicht. Es macht ihnen Angst.«
Das Denken verscheuchte die Heiratskandidaten, da hatte sie nun schon das nächste Ausschlusskriterium. »Aber du hast Mutter doch auch genommen«, antwortete Lucia. Sie bemühte sich, ihre Worte nicht trotzig klingen zu lassen, offenbar erfolglos.
Zwischen den Augenbrauen des Vaters zeigten sich zwei dicke Falten. »Das ist etwas ganz anderes.« Der Einwand verwirrte ihn sichtbar. »Was wollte ich sagen?«
Lucia nahm sich vor, das Denken einzustellen, zumindest bis nach der Hochzeit.
»Ach so.« Der Vater hatte offenbar den Faden seiner Überlegungen wiedergefunden. »Du sollst ja auch nicht für immer weg sein«, versicherte er ihr liebevoll. »Nur bis … na ja … bis das Ziel erreicht ist …«
»… und ich mit einem Ehemann zurückkomme«, vervollständigte Lucia seinen Satz.
Er nickte erleichtert. »Du bist ein kluges Mädchen. Wie ich immer sage.« Er beugte sich leicht zu ihr herüber und fügte etwas leiser an: »Wenn es nicht auf Anhieb gelingt, ist das kein Beinbruch. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.«
»Das wird sicherlich sehr anstrengend«, erwiderte Lucia. »Es ist auch nicht ungefährlich.«
Der Vater stutzte. »Für die Männer vielleicht.« Dann lachte er aus vollem Hals. »Wir kennen dich ja.«
Lucia ärgerte sich über den Scherz des Vaters. Wenn sie schon die einzige Macre-Tochter war, um die die Männer einen Bogen machten, dann konnte sie auf Spott gern verzichten.
»Du nimmst eine Stellung in einem Hotel an«, sagte er irgendwann halblaut. »Es werden gerade Mädchen gesucht. So gefährlich kann das gar nicht sein.«
»In dem neuen Hotel? In Amerika?«, fragte Lucia erstaunt.
Der Vater stutzte. »In Desenzano. Im Hotel Mayer. Das steht dort seit 1824.«
Immerhin war Desenzano nicht ganz so weit weg wie Amerika. Sechs Kilometer, anderthalb Stunden Fußmarsch also. Mayer? Der Name sagte Lucia nichts. Aber sie war in ihrem Leben höchstens erst drei Mal dort gewesen. Ganz gewiss nicht, um ein Hotel zu besuchen. Erst recht nicht eines, das einem Signore Mayer zu gehören schien. Das klang nicht nach einem Landsmann, Lucia würde auf einen Österreicher tippen. Der Vater wollte seine jüngste Tochter zu einem Österreicher schicken? Dass es wirklich so arg um sie bestellt sein musste, dass der Vater bis zum Äußersten ging, hatte sie nicht erwartet. Selbst über die Kriegserzählungen des Vaters hinaus hörte man von denen grundsätzlich nichts Gutes. Tante Loredana kannte eine Frau, die jemanden getroffen hatte, der mit einem Österreicher verheiratet war, eine ganz üble Geschichte. Oder mit einem Schweizer?
Der Vater schien abzuwarten, bis sich die Luft in ihrem Kopf wieder beruhigt hatte.
»Ich habe gedacht, du könntest dort als Zimmermädchen arbeiten.« Nachdem seine Überlegung raus war, schien es Biagio leichter ums Herz zu sein. In höchster Eile schob er die niederschmetternde Gespons-Liste in seine Weste zurück und schlug dreimal mit der flachen Hand dagegen, als hätte er einen bösen Geist besiegt. Dann lächelte er frohgemut. »Du bekämst ein schickes Kleid, regelmäßiges Essen und jede Woche eine Lohntüte. Die musst du natürlich bei mir abgeben, also, zu deiner eigenen Sicherheit. Geld verführt jede junge Frau zu Dingen, die man haben kann, aber nicht braucht. Du weißt schon.«
»Eine Arbeit … in der Stadt«, murmelte Lucia nachdenklich. Das kam ihr fast noch abwegiger vor als Amerika. »Desenzano? Unten am See?«
Biagio hob abwehrend die Hände. »Das ist kein schlechtes Pflaster, glaube mir. Dort arbeiten viele junge Mädchen, habe ich mir sagen lassen.«
Francesco muss es ja wissen, dachte Lucia.
»Du sagst ja gar nichts?« Der Vater musterte sie besorgt. »Du willst mich nicht allein lassen«, schlussfolgerte er. »Ich komme zurecht. Problemlos. So eine Suppe kann ich mir allemal … also, ich meine … verhungern werde ich jedenfalls nicht, notfalls sind da ja noch Angelina und Francesco. Außerdem hättest du auch freie Tage, an denen du zu Hause bist, um mir zur Hand zu gehen, womit auch immer … Die Arbeit auf dem Feld ist ohnehin nicht so deine Sache. Die Bohnen muss man am Strauch suchen, und die Tomaten, na ja … Kartoffeln, mhm? Und die Ziegen, die versorge ich jetzt schon nebenbei.« Er lachte gequält auf, was in einen schmerzhaft verzogenen Mund überging. »Deine Begabungen sind nun einmal verrutscht, wohin, wird sich hoffentlich noch herausstellen.«
So, wie das klang, hatte der Vater die Entscheidung schon getroffen. Die vielen guten Worte galten zweifelsohne ihm und seinem schlechten Gewissen. Lucia jedenfalls brauchte sie nicht, ihr gefiel die Vorstellung fast noch besser als die Sache mit Amerika. Sie wusste zwar nicht, wie genau ihre Aufgaben in einem Hotel aussehen sollten, aber das würde sie herausfinden. Eine Anstellung zu haben, war vielleicht die moderne Form einer alten Jungfer. Wer konnte das schon wissen? Vielleicht würde der König sogar mal ein Gesetz erlassen, nach dem unverheiratete Frauen nicht schief angesehen werden dürfen? Oder eines, das die große Liebe vorschrieb. Sie hätte nichts dagegen. Der Vater jedoch hatte offenkundig etwas ganz anderes im Sinn.
»In so einem Hotel gehen viele Leute ein und aus …« Biagios Hände wanderten nervös durch die Luft. »Wohlhabende Geschäftsmänner, Handwerker, auch Leute mit Einfluss.« Pause. »Womöglich findest du dort einen Mann. Mit der Häuslichkeit ist es bei dir … nun, das lernst du dort bestimmt. Die Betten richten, das ist ja nun kein Hexenwerk. Manieren hast du auch. Jedenfalls bist du viel zu schön und klug, um bei Alessandro … äh … nein … ich meine, um bei irgendeinem Bauernlümmel hier oben zu versauern. Du musst fortschrittlich denken, Lucia. Deine Mutter hätte das auch so gewollt.«
Das einzige Plus auf der Liste des Vaters hatte also einen Namen. Alessandro Venturi, Sohn der Nachbarsleute Angelina und Francesco Venturi. Francesco versuchte seit Jahren, seinen einzigen Sohn unterzubekommen. Die Idee konnte also nur auf seinem Mist gewachsen sein. Pech nur, dass der arme Alessandro in allen wesentlichen Dingen nach seinem Vater kam, in allen unwesentlichen auch. Um vor dem Einfaltspinsel fortzulaufen, wäre Lucia sogar bis nach Amerika geschwommen. Der Vater begnügte sich ganz offenkundig mit Desenzano, um seinen ältesten Freund nicht vor den Kopf stoßen zu müssen. Hoffentlich ging sein Plan auf. Wenn die Neuigkeit aus Desenzano nicht so alt war wie die Zeitung, die der Vater aktuell mit sich trug, konnte es klappen. Lucia würde etwas von der Welt sehen. Ihr einziger Strich auf der Kandidatenliste, also der dümmliche Alessandro, konnte ihr dann auch gestohlen bleiben. Aber das tat er ohnehin.
»Du sollst auf das Feld gehen und deine Arbeit machen!« Alfonso Grazioli schnaufte vor Wut. »Das Getreide muss eingebracht werden. Wir sind keine reichen Leute, die ihre Nase nur so zum Spaß in die Sonne halten können. Aber was macht mein feiner Herr Sohn? Er sitzt mit einer Gazette bei den Hühnern und starrt Löcher in die Luft. Guckst du dir immer vorher an, mit was du dir den Hintern wischst? Zeigst du es dem Federvieh? Wollen die womöglich auch so ein vornehmes Papier? Was soll man dazu noch sagen? Mein Sohn tut vor den Hühnern wichtig. Na ja, vermutlich kannst du bei dem Viehzeug Staat machen, bei einem Weibsbild offenkundig schon mal nicht. Vor denen fürchtest du dich ja!« Er lachte hämisch, was im nächsten Augenblick in ein abschätziges Mustern seines Erstgeborenen umschlug. »Ach so, du versuchst zu lesen«, zischte er bösartig. »Absolute Zeitverschwendung! Was immer du dir davon versprichst, es wird nichts daraus. Du bist ein Grazioli, die lesen nicht. Niemals! Wenn das vernünftig wäre, dann hätte ich dich und die anderen Tölpel zur Schule geschickt. Oder meinst du, ein Mann wie ich weiß nicht, was für seine Söhne am besten ist? Du hältst dich wohl für schlauer? Aber lass dir eines gesagt sein.« Er fuchtelte mit seinem ausgestreckten Zeigefinger in der Luft herum. »Ein Mann wird nicht besser, nur weil er eine Zeitung in der Hand hält, ganz im Gegenteil. Lesen verdirbt den Charakter. Das hat man schon hundertfach erlebt. Such dir lieber eine Anstellung, dann habe ich immerhin einen Esser weniger am Tisch. In deinem Alter hatte ich mir lange das hier alles aufgebaut. Aber dazu muss man arbeiten wollen und nicht nur schlaue Buchstaben studieren. Vermutlich kann dir das Federvieh ja dabei helfen.« Ein erneutes Lachen folgte. »So etwas habe ich großgezogen. Für was? Himmel, Herrgott, Sakrament!« Alfonso spuckte vor sich aus und stapfte mit festen Schritten davon, dass unter seinen Schuhen der Boden nur so stob. Noch aus einigen Metern Entfernung hörte man ihn wettern. Das tat er vermutlich auch noch, nachdem er in Enzos Taverne am Ende der Straße angekommen war, wo er unter dem Gelächter der Saufkumpane die Geschichte seines lesenden Sohnes zum Besten geben würde. Das eigene Nest zu beschmutzen, darum war Alfonso Grazioli noch nie verlegen gewesen. Für ein Viertel-liter Wein tat er fast alles.