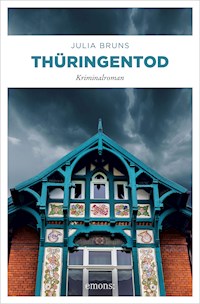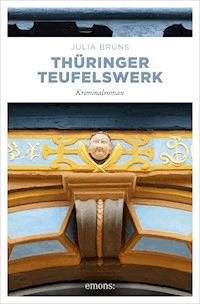Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Küsten Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Kapitel ostdeutscher Geschichte – spannend und authentisch erzählt. Im Ostseebad Sellin wird nach einem Brand in einem Kurhotel ein Toter gefunden, verborgen in einem verschlossenen Schrank. Es ist der seit zwei Wochen vermisste Eigentümer des Traditionshauses, das kurz vor dem Abriss steht. Für Hauptkommissarin Anne Berber beginnt mit der Suche nach dem Täter eine Zeitreise in die jüngere Geschichte der Insel – die ihr ein schreckliches Geheimnis offenbart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Bruns studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie an der Universität Jena. Nach ihrer Promotion im Fach Politikwissenschaft arbeitete sie viele Jahre als Redenschreiberin und in der Öffentlichkeitsarbeit. Heute lebt sie als freie Autorin in Thüringen.www.julia-bruns.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Scott Wilson/Alamy
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-704-0
Küsten Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog, Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Prolog
Hotel Frieden, Sellin, im Sommer 1955
Verehrter Herr Rosenblum,
bitte entschuldigen Sie vielmals meine jüngste Zurückhaltung bezüglich der brieflichen Korrespondenz. Das lag mitnichten an unserer fehlenden Verbindung. Vielmehr hatte mich eine Krankheit an das Bett gefesselt, was mir meinen normalen und überaus geschätzten Tagesablauf über längere Zeit unmöglich machte. Die sich daraus ergebenden Unannehmlichkeiten werden unglücklicherweise auch noch eine Weile anhalten. Es gibt nun einmal Dinge, die der liebe Gott uns auferlegt und unter denen wir, zur Untätigkeit verdammt, auf seine Gnade hoffen müssen.
In Gedanken sehr oft bei Ihnen und Ihren Lieben, hoffe ich, dass Sie alle wohlbehalten sind. Meine gute Emma hat das Schicksal auf einen neuen Weg geschickt, aber ich behalte sie stets in meinem Herzen.
Die liebe Marion dagegen erfreut mich jeden Tag. Sie ist schon fast ein richtiges Fräulein und mir eine große Stütze. Erstaunlich, wie sehr sie die Bedeutung des Ganzen selbst in ihren jungen Jahren einzuschätzen weiß.
Der Sommer zeigt sich in diesem Jahr wieder einmal von seiner schönsten Seite, fast könnte man glauben, die Sonne habe niemals zuvor so wundervoll und lange gestrahlt, wie sie es dieser Tage tut. Manch einer meint, dass dies schon fast zu viel des Guten ist, aber wir Rüganer wissen die unvermeidbaren Herausforderungen unseres Daseins seit jeher aufrecht und unverdrossen zu nehmen, selbst wenn es sich dabei nur um eine Kapriole des Wetters handelt.
Was immer die Zeit uns bringen mag, der liebe Gott wird ein Auge auf uns haben.
Behalten Sie sich wohl!
Ihre Freundin
EINS
»Diese Insel hat etwas Magisches. Allein das Licht. Und die energetischen Schwingungen. Das ist ja auch absolut nachvollziehbar, also ich meine, wenn die intensive Kraft der Sonne auf die geballte Stärke des Meeres trifft. Bam!« Sie ballte ihre linke Hand zur Faust und boxte damit in die Luft, was die vielen bunten Armreifen an ihrem Handgelenk unter mächtigem Klappern bis zum Ellbogen hinabrutschen ließ. »Sellin ist der perfekte Kraftort für uns. Ich bin mir sicher.« Versonnen streichelte sie über die Blätter einer der Fächerpalmen, die zwischen den Tischen des Frühstückssalons aufgestellt waren, um für mehr Behaglichkeit und etwas Privatsphäre zu sorgen.
»Deine Tasse«, sagte ihr Begleiter streng, ohne von dem vor ihm aufgestellten iPad aufzusehen.
Sie redete einfach weiter. »Wir müssen so nah wie möglich ans Meer, aber das ist ja klar. Meine Kunden brauchen diesen Spirit.« Sie zeichnete mit ausgestreckten Armen zwei große Kreise in die Luft, wandte den Kopf zur Seite und schaute verträumt lächelnd durch die Scheiben des Wintergartens hinaus in den Garten.
Der Mann, der ihr am Tisch gegenübersaß, schenkte ihr kurz seine Aufmerksamkeit, indem er sie ansah und seine rechte Augenbraue nach oben zog. »Du guckst in den Garten. Das Meer ist auf der anderen Seite.« Dann widmete er sich wieder den Nachrichten auf seinem Tablet.
Sie griff nach ihrer Tasse, beugte sich ein wenig über den Tisch und fragte: »Hast du schon ein geeignetes Objekt gefunden?«
»Deine Tasse, Marga, oder wie lange soll der Herr hier noch stehen?«, maulte er nun zunehmend ungehalten. »Es gibt schließlich noch andere Gäste. Ich bezweifle zwar, dass die von deinem speziellen Tee probieren möchten, aber der Kellner wird trotzdem noch ein paar andere Aufgaben haben, als für dich die Kanne zu halten.« Er nickte und schloss kurz die Augen, eine Geste, die Hilgert offenkundig zeigen sollte, dass er die Sache regeln würde.
Sören Hilgert verzog keine Miene. Er wusste, auf sein »Pensionslächeln«, wie er den Ausdruck, der während der Arbeit auf seinem Gesicht lag, scherzhaft nannte, konnte er sich verlassen. Hilgert war schon immer ein Meister der Selbstbeherrschung gewesen. Das, was in seinem Kopf vorging, war seine Privatsache, und niemals, nicht einmal in seinen schwächsten Momenten, würde er seine Mimik zur Projektionsfläche seines Innersten machen. Durchschaubarkeit bedeutete Gefahr, und auch wenn das für ihn als Eigentümer und Betreiber der Pension »Seevilla« am Selliner Hochuferweg mitnichten in dem Maße zutraf, wie es in seinem einstigen Beruf als Kriminalhauptkommissar des Berliner LKA der Fall gewesen war, so konnte er einfach nicht aus seiner Haut. Für ihn spielte es keine Rolle, ob er einen übel riechenden Gesundheitstee ausschenkte oder in den Lauf einer Glock 26Kaliber 9 blickte, die äußere Gelassenheit blieb stets dieselbe. Wobei er dem zu allem bereiten Georgier, den sie damals im Tiergarten wegen des Mordes an seinem Geschäftsfreund festgenommen hatten, fast noch mehr Sympathie entgegenbringen konnte als dieser exaltierten, nervtötenden Frau hier. Der Georgier hatte immerhin relativ schnell ein Einsehen gehabt – zweifelsohne ausgelöst durch Eces gezielten Schuss in seinen Oberschenkel, aber man musste eben wissen, wo die persönlichen Grenzen lagen.
Sie hatten den Georgier zuvor ohne große Umwege als Täter identifiziert, denn er war ziemlich stümperhaft vorgegangen, aber dann war er abgetaucht, und es hatte drei Tage gedauert, bis eine Streife ihn eher zufällig im Tiergarten entdeckte. Er hatte dort ein paar Kindern beim Spielen zugesehen. Wie sich später herausstellte, war eines der Mädchen seine kleine Tochter. Vor seiner Flucht ins Ausland hatte er sich von ihr verabschieden wollen. Hilgerts Leute waren schneller gewesen. Er konnte sich noch gut erinnern, wie Ece ihn wegen seines kompromisslosen Vorgehens angegangen hatte. Letztendlich hatte sie sich seiner ausdrücklichen Anweisung widersetzt und dem Mörder zwei Worte mit seinem Kind gewährt, aus dem Krankenwagen heraus und in Handschellen gelegt. Er, der knallharte Ermittler, der er damals gewesen war, hatte das als törichten und vor allem überflüssigen Blödsinn abgetan und sie entsprechend gemaßregelt. Für ihn hatte es keine Sentimentalitäten geben dürfen. Ece war darüber hinweggegangen, genau wie über viele andere seiner unverständlichen Reaktionen auch. Im Nachhinein betrachtet, konnte er sich glücklich schätzen, dass sie so viel Geduld mit ihm als ihrem Vorgesetzten gehabt hatte. Hilgert war in dem letzten Jahr seiner Dienstzeit nicht er selbst gewesen. Ece wusste das, nur er hatte es da noch nicht sehen wollen. Der Mensch konnte vieles ausblenden, die Dosis an Psychopharmaka musste nur hoch genug sein.
Hilgert atmete tief. Wieso war er eigentlich von dieser Frau hier auf den Georgier gekommen? Er wusste es nicht. Aber seit einiger Zeit ergriffen ihn die düsteren Erinnerungen wieder öfter, ohne erkennbaren Auslöser und hartnäckiger als sonst. Er spürte, dass die Vergangenheit nicht abgeschlossen war, höchstwahrscheinlich würde sie das nie sein. Irgendwann würde er mit Ece reden müssen. Ihr war er eine Erklärung schuldig, nur ihr. Aber nicht jetzt. Irgendwann einmal. Ganz sicher. Er schob das Gewesene gedanklich beiseite und lächelte weiter, als wäre dieser Ausdruck in sein Gesicht eingemeißelt.
Was die Dame am Tisch anging, die nun schon seit einer Woche zwischen seiner Pension und der Seebrücke hin und her tänzelte, »um ihre Chakren zu harmonisieren«, wie sie jeden hier wissen ließ – für den Umgang mit ihr brauchte er ebenso viel Geduld wie Gelassenheit, und von beidem hatte er glücklicherweise genug, seitdem er wieder auf der Insel war. Sie und ihr Mann suchten nach einer Immobilie für ein Yogazentrum, das hatte sie ihm noch während des Eincheckens wortreich erklärt. Hilgert wusste, dass dies in Sellin schwierig werden würde. Zumal bei den unrealistischen Vorstellungen, die die Frau hatte. Eine Alleinlage mit direktem Meerzugang zu einem erschwinglichen Preis stand mit hundertprozentiger Sicherheit in keinem der Seebäder auf der Insel mehr zur Verfügung. In seiner freundlich-zurückhaltenden Art hatte er versucht, ihr diese Illusion zu nehmen, aber die Frau schien in ihrer Euphorie immun gegen jegliche Einwände ihrer Mitmenschen zu sein. Die Gereiztheit ihres Mannes nahm dementsprechend täglich zu. Er war in seinem Verdruss sogar schon so weit gegangen, horrend hohe Angebote für Hilgerts Seevilla zu machen, die er jeden Morgen beim Gang zum Frühstücksbüfett noch einmal überbot. Aber Hilgert gelang es natürlich, auch diese Unverfrorenheit wegzulächeln. Immerhin hatte ihm die Aussichtslosigkeit des Vorhabens eine Verlängerung der Buchung des Paares um eine weitere Woche beschert, was angesichts des wetterbedingt holprigen Saisonstarts ein guter Anreiz war, die Dame weiter zu ertragen.
Im nunmehr zweiten Jahr der Verwirklichung seines Lebenstraums als Pensionswirt war der Berg an Schulden nicht wesentlich kleiner geworden. Dafür waren die bei einem so alten Haus erforderlichen Investitionen und, das musste er sich zweifelsohne eingestehen, seine Ansprüche an einen guten Gastgeber einfach zu hoch. Aber er hatte es bereits – nicht zuletzt auch durch sein einnehmendes Wesen – zu einigen Stammgästen gebracht, die seine Leidenschaft für dieses besondere Haus teilten und ihm wenn auch kein üppiges, so doch ein regelmäßiges Einkommen bescherten. Den Vergleich zum Salär eines Berliner Kripobeamten müsste es mehr als scheuen, aber Hilgert stellte diese Überlegung niemals an, denn das Kapitel LKA war abgeschlossen und ein Zurück für ihn undenkbar.
Nachdem der Mann seine Frau zwei weitere Male dazu aufgefordert hatte, trank sie ohne jede erkennbare Eile die letzten beiden Schlucke ihres sicherlich längst erkalteten Tees und reichte Hilgert schließlich mit gönnerhafter Geste die Tasse. Vorsichtig goss er nach, erkundigte sich, ob die Herrschaften noch etwas wünschten, und widmete sich nach ihrer dankenden Verneinung den beiden älteren Damen am Nachbartisch.
»Für einen Kellner ist der neckisch«, urteilte die Frau nach seinem Weggang mit jauchzender Stimme und gedrosselter Lautstärke, die für Hilgerts Ohren allerdings noch hervorragend zu verstehen war. »Gepflegt und durchtrainiert. Dabei ist der bestimmt schon über fünfzig.« Sie schnalzte mit der Zunge. »Du könntest auch mehr für dich tun.«
»Soll ich dir nun eine Yogahütte kaufen oder in einer Muckibude herumturnen?«, blaffte ihr Mann unwirsch. »Hier, schau dir das mal an, klingt nicht schlecht, und Wasser hast du dort auch.«
Hilgert, der mit den Damen über das Wetter plauderte, spürte die Blicke der Frau im Rücken und ging ebenso souverän darüber hinweg wie über ihr einfältiges Geschwätz. Wenn die Menschen für etwas bezahlten, meinten sie mitunter, das befreie sie von jeglichem Anstand gegenüber dem Personal. Er war abgeklärt genug, um dem keine Bedeutung beizumessen. Alles hatte neben guten auch schlechte Seiten. Nur die Gewichtung musste stimmen.
»Hier spielt die Musik!«, fauchte der Mann.
»Selliner See?« Hilgert konnte ihr Naserümpfen aus den beiden Wörtern deutlich heraushören. »Kein Meer? Undenkbar für mein Vorhaben«, keifte sie, und ihre Stimme steigerte sich um mindestens drei Oktaven. »Du hast mal wieder keine Ahnung, worum es mir geht. Wenn du dich nur ein Mal mit meinen Wünschen auseinandersetzen könntest, nur ein Mal!«
Hilgert konnte hören, wie sie mit Schwung ihren Stuhl zurückschob und hastig den Frühstückssalon verließ. Er trat an das Büfett, rührte in den Schüsseln mit Joghurt, Quark und Bircher Müsli, bis alles wieder wie frisch eingefüllt aussah, legte die Löffel auf den dafür vorgesehenen Tellerchen ab, zupfte ein paar Servietten zurecht und schickte sich an, frischen Kaffee aus der Küche zu holen, als sein Blick eher zufällig in den Garten fiel. Eine dicke dunkelgraue Rauchwolke ließ ihn kaum noch das nur wenige Meter entfernte Nachbarhaus erkennen. Eilig trat er an das Fenster heran. Er brauchte nicht lange, um die Quelle auszumachen. Die großen orangeroten Flammen, die aus den Fenstern des Gebäudes schlugen, waren deutlich auszumachen.
Das Hotel Kurhaus Sellin brannte lichterloh.
***
Der Anblick des Mannes hatte etwas Schauerliches. Das mochte bei einer Leiche nichts Ungewöhnliches sein, aber in diesem Fall war es anders. Es war befremdlich und zugleich auch irgendwie faszinierend. Anne Berber konnte nicht anders, als einfach nur dazustehen und ihn anzuschauen. Selbst in ihren vielen Jahren beim Kommissariat Stralsund war ihr so ein Anblick noch nie begegnet. Und hier auf Rügen, im Polizeihauptrevier Bergen, ohnehin nicht. Seitdem sie sich vor mehr als zwei Jahren nach Hause auf die Insel hatte versetzen lassen, gehörten Gewaltverbrechen nicht mehr in ihre Zuständigkeit. Die Leidenschaft für ihre Arbeit als Kriminalhauptkommissarin hatte wegen der Liebe zurückstecken müssen. Nun war die Liebe weg, Anne die Leiterin des Reviers, und der tote Mann ging sie offiziell absolut nichts an. Trotzdem war da dieser Kick, das Adrenalin, das förmlich durch ihre Blutbahn schoss. Anne war eine Ermittlerin, auch wenn in ihrer Dienstpostenbeschreibung etwas anderes stand.
»Danke, dass du gleich gekommen bist«, sagte jemand.
Sie drehte sich langsam um, als würde sie befürchten, dass ihr dadurch etwas entgehen könnte. Hinter ihr stand ein Feuerwehrmann, den sie kannte. Anne, die sich Gesichter hervorragend merken konnte, aber Namen so schnell vergaß wie den Wetterbericht des vergangenen Tages, brauchte eine Weile, um zu realisieren, wer sie angesprochen hatte. Es war Max Peters, ein alter Schulkamerad. Anne lächelte schmal, um nicht ganz und gar unhöflich zu erscheinen. Mit Sicherheit hatte Max ihr Zögern bemerkt, und nichts lag ihr ferner, als jemanden zu kränken, nur weil ihr ein paar soziale Fähigkeiten abgingen. Ihr Gegenüber blickte sie jedoch mit unveränderter Miene an. Er schien sich nicht ganz schlüssig zu sein, ob er erleichtert oder entsetzt sein sollte. Max trug einen Schutzanzug, hatte den Helm unter seinen Arm geklemmt und wischte sich immer wieder mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.
»Ich dachte, es ist besser, wenn ich dir Bescheid gebe«, sagte er fast schon ein wenig schüchtern, nachdem sie nicht weiter reagierte. »Er ist doch ein Selliner. Und jeder weiß, dass du hier …«
Ohne abzuwarten, was er sagen wollte, drehte ihm Anne den Rücken zu. Wenn sie zu einer Leiche gerufen wurde, wollte sie nicht reden, sondern ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Situation richten, um sie in ihrem Gedächtnis abzuspeichern. Ein Selliner sollte der Mann gewesen sein? Aber das spielte keine Rolle, denn Anne war sich sicher, dass man sie in jedem Fall alarmiert hätte. Seit sie im letzten Jahr den Mord an Peter Klart, einem Selliner Honoratior, aufgeklärt hatte, war sie in der Gemeinde so etwas wie eine kleine Berühmtheit geworden. Jeder schien sie zu kennen, und, was sie noch mehr erstaunte, die Menschen brachten ihr Vertrauen entgegen. Was, so vermutete Anne zumindest, hauptsächlich daran lag, dass sie eine Rüganerin war und die Insulaner allem und jedem, was von jenseits des Sunds kam, seit jeher misstrauten. Das galt auch für den Kriminaldauerdienst aus Stralsund, der seit einigen Jahren als schnelle, flexible Eingreiftruppe die Mordermittlungen in der Region übernahm und der von Annes altem Teampartner und engem Freund Erik geleitet wurde. Sobald sich der Verdacht auf Fremdverschulden auch nur andeutete, waren Eriks Leute zuständig, aber Anne war überzeugt, dass die bisher von niemandem informiert worden waren. Stattdessen schien die halbe Insel über ihre private Handynummer zu verfügen, zumindest hatte Max sie vor einer Dreiviertelstunde auf diesem Wege kontaktiert, und sie konnte sich beim besten Willen nicht erinnern, sie ihm irgendwann einmal gegeben zu haben. Immerhin hatte sie ihn das letzte Mal bei ihrer Abiturabschlussfeier gesehen, und die lag mehr als zwanzig Jahre zurück. Dass Max Peters schon in der Schule eine furchtbare Labertasche gewesen war, ließ bei ihr hinsichtlich des Leichenfundes zudem sämtliche Alarmsignale angehen.
»Das hier ist kein Thema für den Stammtisch, nur dass du’s weißt.« Der Satz war nicht nur unvermittelt, sondern auch härter rübergekommen, als sie es beabsichtigt hatte. Wenn sie Max gegen sich aufbrachte, erreichte sie womöglich nur das Gegenteil von dem Gewollten. Unbeholfen versuchte sie, sich aus der Situation zu manövrieren. »Ich wusste nicht, dass du noch auf Rügen lebst«, sagte sie milde, aber es gelang ihr dabei nicht, den Blick von dem toten Mann abzuwenden. »Wer ist der Mann, kennst du ihn?«
»Seit einem halben Jahr bin ich wieder da«, antwortete Max in einem Tonfall, der deutlich machte, dass er froh über ein wenig Small Talk war. »Lübeck war auf die Dauer nichts für mich. Ein Insulaner braucht eine Insel, das sagt ja schon der Name.« Seine Stimme wurde immer euphorischer. »Seitdem bin ich auch Wehrführer bei unserer Freiwilligen. Man muss seinem Ort ja auch etwas zurückgeben. Aber so einen Einsatz wie heute …« Er stoppte, und das Timbre veränderte sich wieder. »Ich bin mir nicht sicher, aber das hier … ich meine, wir waren doch nicht zu spät, und er ist erstickt?« Er atmete tief ein. Dass dies bei dem noch immer im Haus hängenden Brandrauch ein Fehler war, hätte er sich denken können. Aber angesichts des Leichnams vor ihnen schien er es schlichtweg vergessen zu haben. Er begann zu husten, bis sein Kopf knallrot angelaufen war, hob die Hand zum Gruß und verschwand, ohne auf Annes zweite Frage einzugehen, nach draußen.
Anne blieb allein zurück, vor ihr, in einem Schrank, der Tote. Er schien, soweit man das in seiner sitzenden Position beurteilen konnte, extrem groß zu sein. Und er war auffallend hager. Er trug eine dunkelgraue Breitcordhose, ein im selben Ton gehaltenes Hemd und eine farblich darauf abgestimmte Tweedweste, aus der ein gelbes Einstecktuch herausragte. An den Hemdsärmeln blitzten silberne Manschettenknöpfe mit den Initialen »GV«. Auf den ersten Blick schien der Körper komplett unversehrt zu sein. Auch an seiner Kleidung ließen sich keine Spuren des Feuers ausmachen. Seine weißen Haare waren kurz geschoren und zeigten eine leichte Rotfärbung. Sein ledrig braunes Gesicht war eingefallen, was den Dreitagebart an Kinn und Wangen deutlich hervortreten ließ. Auch die Fingernägel wiesen eine für einen Mann ungewöhnliche Länge auf. Dafür erweckten die Nasenspitze und das Kinn den Anschein, als hätte sie jemand platt gedrückt. Das Schlimmste allerdings waren die Augen. Weit geöffnet starrten sie Anne an, glanzlos, trüb. Dicke schwarze Streifen zogen sich quer über beide Augäpfel.
»Der Blick. Man kann gar nicht hinsehen.« Max war zurück. Sein Gesicht war noch immer rot, und auf seiner Stirn stand der Schweiß. »Wie in einem Zombiefilm, aber da weiß man, dass es nicht echt ist. Anders als hier, das ist echt, oder?« Er räusperte sich und sprach mit belegter Stimme weiter: »Das ist übrigens Georg Vetterich, der Eigentümer des Hotels. Auch wenn er jetzt etwas anders aussieht als damals, habe ich ihn gleich wiedererkannt. Wir haben letztes Jahr den achtzigsten Geburtstag meiner Großmutter hier im Hotel gefeiert, musst du wissen, da habe ich ihn kennengelernt.« Max schaute sich um, so als suchte er etwas, das seine Aussage unterstreichen würde. »Das erste Haus am Platz, na ja, du weißt ja, wie die alten Leute sind. Für meinen Geschmack war die Hütte etwas zu altbacken, aber nun ist ja ohnehin Schicht im Schacht.« Er zuckte mit den Schultern. »Ach, und Anne«, er wartete, bis sie ihn kurz ansah, »ich bin ein Profi. Soll heißen, ich kann den Mund halten. Grundsätzlich und überhaupt.«
Anne lief vor dem Schrank auf und ab und fotografierte den Toten aus den unterschiedlichsten Perspektiven mit ihrer Handykamera. Das Geplapper ihres einstigen Schulkameraden überhörte sie dabei geflissentlich. Die einzig wichtige Information war die Identität des Opfers. Georg Vetterich. Der Name sagte ihr nichts, aber von den Hoteliers der Gemeinde kannte sie nur wenige persönlich. Dafür wusste sie, dass das Hotel Kurhaus Sellin seit Weihnachten geschlossen war. Wenn man dem Buschfunk Glauben schenken durfte, stand ein Verkauf an. Manche sprachen auch von einer Generalrenovierung und einer Neueröffnung zur Sommersaison. In jedem Fall war das Haus nach dem zu urteilen, was Anne bisher gesehen hatte, fast vollständig ausgeräumt und machte einen entsprechend traurigen Eindruck. »Wer hat den Mann gefunden?«, fragte sie Max.
»Ich«, entgegnete er zögerlich. »Gemeinsam mit Oliver, meinem Kameraden. Er ist draußen und kotzt Galle. Das passiert öfter, wenn er sich heftig erschrickt. Seinen Magen will ich jedenfalls nicht haben.«
»Das verstehe ich nicht«, antwortete Anne gedankenverloren, wobei sie das Mobiltelefon verstaute, sich Gummihandschuhe anzog und die Hosentaschen des Toten zu durchsuchen begann. Bis auf ein Zellstofftaschentuch hatte er nichts bei sich. Sie fasste nach dem Mantel, der neben ihm an der Garderobenstange hing. Er war braun, von schwerem Material und, wie Anne anhand des Etikettes mutmaßte, musste ziemlich teuer gewesen sein. Dass er tatsächlich dem Opfer gehörte, war unschwer auszumachen. Er passte nicht nur zu dessen Kleidungsstil, sondern unter dem Namensetikett des italienischen Schneidermeisters stand auch in schnörkeligen gestickten Buchstaben »Georg Vetterich«. Eine Maßkonfektion war nichts, was Anne jeden Tag zu sehen bekam. Aber auch in den Manteltaschen fand sich bis auf ein paar Halsbonbons nichts Brauchbares. Max beobachtete jeden ihrer Handgriffe, sie spürte seine neugierigen Blicke im Rücken. Als sie fertig war, trat Anne einen Schritt zurück und schaute ihn fragend an.
Max wirkte ein wenig verdattert, erklärte dann aber umgehend das Verhalten seines Kameraden: »Ich bitte dich. Der Anblick kann einem schon auf den Magen schlagen. Der sieht aus wie eine geräucherte Makrele.« Er verzog das Gesicht. »Wir werden zu einem Brand gerufen, und da sitzt der Kerl mit seinen schwarzen Augen im Schrank und guckt uns an. Gruselig.« Sein Anzug raschelte bei jeder Bewegung. »Wenigstens stinkt er nicht. Obwohl wir das mit unseren Atemmasken ja gar nicht mitbekommen hätten, also zunächst, jetzt allerdings …« Er winkte ab. »Egal. Nun bist du ja da.«
»Und trotzdem verstehe ich da was nicht«, wiederholte Anne energisch. Sie schaute sich um. Die Bar, in der sie sich befanden, war von den Flammen verschont geblieben, wirkte aber ansonsten ziemlich trostlos. Dass sich hier einmal das Nachtleben des Hotels abgespielt hatte, war nur noch an der aus Kirschbaumholz gefertigten großen Theke zu erkennen. Die war sicherlich mal der letzte Schrei gewesen, aber diese Zeit lag mindestens drei Jahrzehnte zurück. Hinter dem Tresen gab es ein Wandregal gleicher Bauart, das bis zur Decke reichte und in dem noch einige Spirituosenflaschen standen. Die waren allesamt nicht einmal mehr halb voll und wirkten wie die nach einer ausschweifenden Party übrig gebliebenen Neigen, nur dass sie nicht wild durcheinander irgendwo herumstanden, sondern ordentlich eingeräumt waren. Vereinzelt gab es auch noch ein paar Gläser, die Reste unterschiedlicher Sets, die ebenso vergessen wirkten wie der Schnaps, aber trotzdem in Reih und Glied gruppiert waren. Gegenüber dem Ausschank standen drei ebenfalls in Kirschbaumoptik gehaltene, fest installierte halbrunde Sitzgruppen. Ansonsten war der Raum leer. Bis auf den Garderobenschrank. Und darin saß der tote Georg Vetterich.
»Ihr habt den Mann genau so vorgefunden?« Anne deutete mit einer Handbewegung, die auch die nähere Umgebung des Leichnams mit einschloss, auf den Toten.
»Im Schrank, jawohl«, bestätigte Max, begleitet von hektischem Nicken. Er stockte. »Also fast. Die Schranktüren waren zu. Abgeschlossen«, gestand er kleinlaut, wobei die Spitzen seiner Ohren zu glühen anfingen.
Anne, die sich die ganze Zeit gefragt hatte, wieso sich jemand zum Sterben in einen Schrank setzte oder – und das schien ihr das wahrscheinlichere Szenario zu sein – gesetzt wurde, schaute Max fragend an. »Er war verschlossen?« Sie machte einen Ausfallschritt nach links, betrachtete das Möbel eingehend und bewegte die Schiebetür, bis die Leiche vollständig dahinter verwunden war. Dann schob sie die beiden anderen Türen auf.
Der Schrank war an der Wand befestigt, etwa drei Meter lang und verfügte über drei identische Türen. Sein Innerstes war ebenfalls dreifach unterteilt und die Trennwände fest verschraubt. In jedem Abschnitt gab es eine Garderobenstange und eine Hutablage. Mehr nicht. Anne griff nach der Tür, hinter der sich Herr Vetterich befand. Sie hatte einen in das Türblatt eingelassenen ovalen Beschlag, durch den man sie leichter führen konnte. In dessen Mitte gab es einen kleinen, beweglichen Hebel, den Anne bislang nur für eine Zierde gehalten hatte, der aber, wie sie nun feststellte, zum Abschließen des Schrankes gedacht war. Das Schließsystem wiederholte sich an den beiden anderen Türen.
»Schließ mich ein!«, forderte sie, und noch ehe Max reagieren konnte, verschwand sie linker Hand im Schrank. »Aber zieh den an.« Sie zog den Gummihandschuh von ihrer rechten Hand und reichte ihn Max. Als er die Tür zuschob, wurde es um sie herum stockdunkel. Dann hörte sie das leise Klicken des Schlosses und die zeitgleiche Bestätigung von Max, dass er die Tür jetzt verriegelt habe. Anne fummelte ihr Handy aus der Tasche und betätigte die Taschenlampenfunktion. »Da hätte ich auch vorher drauf kommen können«, murmelte sie. »In einem Schrank ist es dunkel.«
An der Innenseite der Tür gab es nichts, wonach man fassen konnte. Das hätte auch keinen Sinn ergeben, denn im Normalfall musste sich niemand aus einem verschlossenen Garderobenschrank befreien.
»Soll ich aufmachen?«, hörte sie Max fragen.
»Einen Moment noch.« Sie drückte ihre Hand gegen das Türblatt, stemmte sich auch gegen die Wände und den Einlegboden über ihrem Kopf. Nichts davon gab nach. »Okay«, rief sie, als sie ganz sicher war, dass der Mann keine Chance gehabt hatte, hier aus eigener Kraft herauszukommen. »Du kannst aufmachen.«
Max beeilte sich, dies zu tun. »Er hätte sich nichts selbst befreien können«, sagte er betroffen und streckte den Arm aus, um Anne behilflich zu sein. Sie tat so, als hätte sie es nicht gesehen, denn Anne hasste nichts so sehr, wie von fremden Menschen angefasst zu werden.
»Sieht nicht danach aus«, entgegnete Anne. »Wie seid ihr aber darauf gekommen, den Schrank aufzumachen? Der Brandherd befand sich nicht in diesem Raum, und selbst wenn, seit wann geht die Feuerwehr los und –«
»Hinten in der Küche, genau«, fiel ihr Max ins Wort. »Alles deutet auf eine defekte Notbeleuchtung hin, das ist aber noch nicht ganz sicher. Wir konnten verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Die Küche allerdings ist hinüber, sollte das überhaupt noch jemanden interessieren.«
»Mich interessiert es«, sagte Anne. »Wieso habt ihr den Schrank aufgemacht?«
»Äh, wieso?« Max schien von ihrer Frage überrascht zu sein. »Na, wir mussten doch sichergehen, also wegen des Brandes.« Er schien es dabei belassen zu wollen, doch Anne reichte diese Antwort noch nicht. Sie wartete und bemühte sich, dabei nicht mit ihrem Fuß zu wippen. Offenkundig hatte er Sorge, etwas Falsches zu sagen. Die Ungeduld, die gerade in ihr aufkam, hätte Max noch mehr verunsichert.
»Das Notlicht, der Strom …«, stammelte er ein wenig irritiert. »Mensch, wir mussten an den Sicherungskasten, um die Hütte lahmzulegen«, platzte er schließlich heraus. »Wer kann denn wissen, ob nicht irgendwo in diesem riesigen Kasten noch ein Kabel durchschmort.«
»Und der Sicherungskasten ist in dem Schrank?«, fragte Anne mit nach oben gezogenen Augenbrauen. »Das wusstet ihr?«
Max trat an den Schrank, schob die rechte Tür auf und bedeutete Anne, dass sie sich selbst überzeugen solle. In der Tat. Im oberen Drittel der Rückwand war ein aus demselben Holz gefertigter Rahmen mit abnehmbarer Verkleidung aufgesetzt. Dahinter verbargen sich zwei Dutzend mit kantigen Buchstaben beschriftete Sicherungen.
»Die Küche hat einen eigenen Kasten. Der hier ist nur für den Barbereich, den Eingang, die Toiletten und die Abstellräume«, erklärte Max.
»Und das wusstest du?«, wiederholte Anne ungeduldig, wobei sie sich fragte, ob dem Mörder das auch klar gewesen war. Hätte er Georg Vetterich nämlich in den Schrankteil mit den Sicherungen gesperrt, hätte dieser sich durch Ein- und Ausschalten des Lichtes womöglich bemerkbar machen können.
»Wie gesagt, meine Oma hat hier gefeiert, und ich bin immer für die Klamotten der alten Herrschaften zuständig. Wenn du geschlagene zwanzig Minuten vor einem Schrank stehst, weil die Alten ihren Schal nicht finden können oder nach ihrem Schirm suchen, kennst du den nach einer Weile in- und auswendig.« Max machte nicht den Eindruck, als ob er sich die Geschichte gerade ausgedacht hatte.
Anne ließ dennoch nicht locker. »Und trotzdem hast du vorhin auch die anderen beiden Türen geöffnet und sicherheitshalber noch mal in alle Fächer geguckt?«
»Oh Mann, Anne! Du bist ja noch schlimmer als damals in der Schule.« Max blies die Wangen auf und ließ die Luft hörbar entweichen. »Oliver hat den Auftrag bekommen, die Sicherungen rauszudrehen, und ich habe nur gesagt: ›Im Schrank‹. Zufrieden?«
Anne wollte etwas erwidern, als zwei seiner Kameraden die Bar betraten, um sich zu erkundigen, ob alles in Ordnung sei. Sie waren für die Brandwache eingeteilt und wollten am Küchenausgang Position beziehen. Einer von ihnen, er schien den Toten vorher noch nicht gesehen zu haben, stieß bei Vetterichs Anblick einen unschönen Fluch aus. Max ging zu den beiden rüber und gab ihnen Anweisungen.
Für Anne war das Eintreffen der Feuerwehrleute der Moment, in dem ihr mal wieder aufging, dass das hier keine One-Woman-Show war. Sie hätte die Kollegen vom Kriminaldauerdienst längst in Kenntnis setzen sollen. Natürlich kannte sie die Notwendigkeiten und auch die Vorschriften, aber schon früher hatte sie diese gern ausgeblendet und war auf eigene Faust losgezogen. Dass dies nicht erwünscht war und in Bezug auf einen schnellen Ermittlungserfolg zudem kontraproduktiv sein konnte, daran hatte sie ihr Teampartner Erik mit schier grenzenloser Geduld immer wieder erinnert. Erik war allerdings in Stralsund geblieben und hatte dort einen Karrieresprung gemacht, den er ohne Annes Weggang sicherlich niemals vollzogen hätte. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätten sie beide bis zur Pensionierung Seite an Seite gearbeitet – und mehr. Aber vor allem zu Letzterem war Anne nie bereit gewesen.
Sie musste es nicht lange klingeln lassen, bis Erik sich meldete.
»Einen Mordfall auf Rügen kann ich jetzt so gut gebrauchen wie einen Kreuzbandriss«, sagte er, noch ehe sie ihn begrüßen konnte. »Aber da du ansonsten nicht anrufst, wird es das wohl sein.«
»Wir haben erst letzte Woche miteinander telefoniert«, widersprach Anne mit gedämpfter Stimme, wobei sie sich langsam durch den lang gezogenen, verwinkelten Raum bewegte, um nach Fenstern Ausschau zu halten. Wie in den meisten Bars gab es jedoch keine.
»Es war der 24. Februar, und das Gespräch hat keine zwei Minuten gedauert, denn du hattest wie immer keine Zeit. Abgesehen davon hast du mich nicht angerufen, um dich nach meinem Wohlergehen zu erkundigen oder mit mir zu plaudern. Es war ein dienstliches Anliegen, und ich könnte dir auch genau sagen, welches, aber ich schenke mir das. Es bleibt der Fakt, dass ich einen Monat nichts von dir gehört habe.« Erik sprach schnell und betont geschäftsmäßig wie immer. Trotzdem gelang es ihm nicht, seine Enttäuschung über Annes Verhalten zu verbergen.
Jetzt erinnerte Anne sich wieder. Grund für den Anruf war die Sache mit den Pfarrhauseinbrüchen gewesen, die erst auf Usedom und dann in verschärfter Form auch auf Rügen verübt worden waren. Dabei hatten es die Täter nur auf die kleinen Gemeinden abgesehen gehabt, und seltsamerweise war niemals etwas entwendet worden. Allerdings hatten die Einbrecher ziemlich viel Geduld bewiesen, indem sie sämtliche Schränke des Hauses akribisch durchsucht und letztlich ein mächtiges Chaos hinterlassen hatten, vom Sachschaden durch das gewaltsame Eindringen einmal ganz abgesehen. Anne hatte geglaubt, das Muster, nach dem sie vorgingen, wiederzuerkennen. Vor einigen Jahren waren Erik und sie an einer ähnlichen Geschichte dran gewesen, nur dass es sich bei den Zielobjekten um Gemeindeämter gehandelt hatte, in die eingebrochen wurde, um den jeweiligen Bürgermeistern Angst einzujagen. Ein von den Gemeinden angestrebter Kläranlagenbau war den Tätern ein Dorn im Auge gewesen. Erik, der über ein Elefantengedächtnis verfügte, hatte alle Informationen auf Abruf parat gehabt, doch bei der »Pfarrhausserie«, wie Annes Mitarbeiter auf dem Revier die Vorfälle getauft hatten, gab es keine derartige Verbindung zwischen den Gottesmännern oder Kirchengemeinden, und die Täter hatten noch immer nicht dingfest gemacht werden können. »Ich hatte viel zu tun«, flunkerte sie. »Du weißt doch, dass ich für den ganzen Papierkram länger brauche als andere, und als Revierleitung ist der enorm.«
Eriks ausbleibende Reaktion verriet ihr, dass ihn das nicht überzeugte, er aber keinen Streit vom Zaun brechen wollte. »Wie kann ich dir helfen?«
»Eine männliche Leiche im verschlossenen Schrank eines leer stehenden Hotels«, antwortete sie, während sie sich durch den Wirrwarr aus Türen einen Weg zur Küche bahnte. Sie hatte keine Ahnung, wo sie sich befand, aber das musste sie auch nicht. Je stärker das Brennen in der Lunge wurde, umso näher musste sie ihrem Ziel sein.
»Wie lange wird das Haus schon nicht mehr betrieben?«, wollte Erik wissen, und Anne konnte an seiner zögerlichen Sprechweise hören, welcher Film da gerade in seinem Kopf ablief.
»Nein, nein, so schlimm ist es nicht. Er sieht noch gut aus, ein bisschen wie eine Mumie, aber sonst ganz okay«, entgegnete sie schnell. »Der Tod kann noch nicht so lange her sein, und im Schrank war es trocken und sicherlich auch luftig. Aber die Augen. Ich habe so etwas noch nie in echt gesehen.«
»Die eingetrocknete Hornhaut, ich weiß«, antwortete Erik und atmete erleichtert aus. »Dir geht es also gut?«, fragte er und schien umgehend zu bemerken, wie blöd sich diese Frage in Annes Ohren anhören musste. Sie war weder neu in dem Job, noch war sie so zartbesaitet, dass sie den Anblick eines vertrockneten Leichnams nicht abkonnte. Aber Erik wähnte sich schon immer in der Rolle von Annes großem, starkem Beschützer, und seit sie nicht mehr zusammenarbeiteten, befürchtete er, dass sie nicht zurechtkommen könnte. »Ich meine, soll ich mit meinen Mannen über den Sund geeilt kommen, um dir zur Seite zu stehen?«, schob er übertrieben locker nach. »Der Kerl wird sich ja nicht freiwillig in den Schrank gehockt haben.«
Vor allen Dingen konnte er sich nicht selbst darin einsperren, dachte Anne. »Ich brauche die KTU«, sagte sie nur. Anne wollte diesen Fall, und Erik würde das verstehen.
Erik schwieg für einen kurzen Moment. »Wie geht es Martin Kaminski?«, fragte er, und Anne wusste, dass er sie hier machen lassen würde.
»Sollte ich ihn mal zufällig treffen, könnte ich ihn fragen, aber ich glaube, auch dann würde ich nicht drauf kommen«, sagte Anne – wohl wissend, dass Erik lediglich abcheckte, ob sie standhaft geblieben war. Zu ihrem Noch-Ehemann Martin pflegte Anne seit ihrem Auszug vor etwa drei Monaten ein Nichtverhältnis, und daran wollte sie auch nichts ändern. Trotzdem mochte sie nicht darüber reden. Erst recht nicht mit Erik, der Martin ohnehin nie hatte leiden können und dessen Abneigung sich mit Martins zunehmenden Eskapaden über die Jahre in ein fast schon krankhaftes Feindbild verwandelt hatte.
»Habt ihr nun endlich die Scheidung eingereicht?«, bohrte er weiter. »Wenn du ihn nicht unbedingt hättest heiraten müssen, wäre das nun nicht notwendig, aber unter den gegebenen Umständen würde ich sagen, je eher, desto besser.« Eriks Stimme hatte nun wieder diesen insistierenden Klang erreicht, den Anne absolut nicht ausstehen konnte, daher entgegnete sie nichts. »Habt ihr?«
Anne hatte auf einmal ihre Hochzeit wieder vor Augen. Es war ein schrecklich dunkler, nebliger Tag gewesen, ihre Eltern und Erik hatten Gesichter wie auf einer Beerdigung gemacht, und Martin war so sehr in den Flirt mit der Standesbeamtin vertieft gewesen, dass er nach dem »Jawort« fast vergessen hätte, sie zu küssen. Der Tag ihrer Scheidung konnte also nur besser werden. »Wieso? Willst du kommen und feiern?«
Anne konnte förmlich spüren, wie Erik überlegte, ob sie die Einladung ernst meinte. »Bratkartoffeln und Hering sind immer drin«, schob sie feixend nach.
»Du weißt, dass ich dieses Armeleute-Inselessen hasse«, gab Erik hörbar enttäuscht zurück. »Hast du nun alles in die Wege geleitet oder nicht? Wie ich dich kenne, drückst du dich wieder um den Papierkram. Dafür gibt es aber Anwälte, Anne, die können das. Im Fall deines Ex kann ich dir nur dringend dazu raten, dir einen zu suchen. Dem …«, er verkniff sich das Wort, »ist alles zuzutrauen.«
Anne hatte die Küche erreicht. Die Tür stand ein Stück offen, und mit einem leichten Fußtritt wurde der Spalt so groß, dass sie hindurchschlüpfen konnte. Das Bild, das sich hier bot, war grauenhaft. Von der Einrichtung war abgesehen von den Edelstahlelementen, die typischerweise in Gastroküchen zu finden waren, nicht mehr viel zu erkennen. Die große Hitze hatte die Scharniere der Schranktüren verbogen, sodass sie herunterbaumelten oder ganz herausgefallen waren. Das Innere der Schränke war schwarz. Die gefliesten Wände waren ebenfalls von einer dicken Schicht Ruß überzogen, und auch wenn Anne vermutete, dass sie einmal weiß gewesen sein mussten, war von dieser Farbe nichts mehr auszumachen. Die einstige Deckenvertäfelung hing in dicken Fetzen von der Decke oder lag in schwarzen, verklebten Klumpen auf den Arbeitsflächen und dem Fußboden. Sollten noch Lebensmittel in den Regalen gewesen sein, so waren sie nur noch unkenntliche Aschehaufen.
Durch die zersprungenen Fensterscheiben drang frische Luft in den Raum, was ein halbwegs normales Atmen möglich machte. Die Hintertür stand offen, und Anne sah, wie die Feuerwehrleute, die eben mit Max gesprochen hatten, über den Hof liefen. Zufrieden registrierte sie, dass Max die Burschen offenkundig nicht an dem toten Vetterich vorbeigelassen hatte. Möglicherweise war er ja doch erwachsen geworden. Sie schaute den Jungs zu, wie sie ein rot-weißes Absperrband quer über den Platz zogen, als hinter den beiden Fritz Friesen, der hiesige Streifenpolizist, auftauchte.
»Anne?« Erik wartete am Telefon noch immer auf ihre Antwort.
»Noch keinen Termin«, murmelte Anne geistesabwesend. Friesen hatte sie entdeckt und kam mit erstauntem Blick auf sie zu. »Die KTU, danke. Ich muss jetzt«, schob sie hastig nach und drückte Erik weg.
»Frau Berber? Aber …« Friesen stieg über den verkohlten Schutt, als balancierte er über Glatteis. »Habe ich was verpasst? Wollen Sie den Brand aufnehmen?«, fragte er und konnte seine Irritation über Annes Anwesenheit nicht verbergen. »Ich wusste nicht, dass Sie auch hier sind. Dann hätte ich doch –«
»War es Brandstiftung? Wissen Sie schon Näheres?«, fragte Anne. Natürlich hatte sie das von Max erwähnte kaputte Notlicht nicht vergessen, aber angesichts des nur wenige Meter weiter sitzenden toten Hotelinhabers brauchte sie eine endgültige und vor allem genaue Aussage zur Brandursache. Immerhin war es möglich, dass derjenige, der den Mann in den Schrank befördert hatte, nichts dagegen gehabt hätte, wenn Vetterich mit dem gesamten Hotel in Flammen aufgegangen wäre.
Friesen stutzte, und Anne vermutete, dass ihre forsche Art der Grund dafür war. Sie würde ihn noch früh genug einweihen, aber bevor sie das tat, wollte sie etwas von ihm hören. Fritz Friesen war ein netter Kerl, doch sobald er auf sie traf, schien ihm das Herz in die Hose zu rutschen. Bereits bei ihrer ersten Zusammenarbeit am Neujahrstag war ihr das aufgefallen. Dabei hatte sie damals selbst jeden Schritt, den sie in der Mordermittlung Klart gehen wollte, dreimal abgewogen. Wie eine Anfängerin hatte sie sich gefühlt, und das absolut grundlos. Ihr notorisch untreuer Ehemann hatte ihr kontinuierlich das Selbstbewusstsein ausgesaugt wie ein Vampir seinem Opfer das Blut. Und sie war die ganze Zeit der Ansicht gewesen, dass ihre Gehemmtheit von ihrer Auszeit als Mordermittlerin oder dem Fehlen ihres Teampartners Erik herrührte. Anne hatte bis heute keine Erklärung dafür, wie sie sich diesen ausgemachten Blödsinn hatte einreden können, außer vielleicht, dass das typisch weibliche Verhalten schuld war. Eine Frau zweifelte zuallererst einmal an sich selbst, bevor sie das Verhalten der anderen hinterfragte. Das mochte eine genetische Prädisposition sein oder nicht, in jedem Fall war es ein schwerer Fehler. Anne war eine gute Polizistin, und ihr unerwarteter Ermittlungserfolg hatte ihr das glücklicherweise rechtzeitig genug wieder vor Augen geführt.
»Brandstiftung?« Friesen massierte sich mit Daumen und Zeigefinger seiner rechten Hand die Augen. »Äh, nein, also nach Aussage der Kameraden ist das sehr unwahrscheinlich.« Er deutete auf die Überbleibsel einer Lampe in der unteren Ecke neben der Hintertür. »Seit Weihnachten schaltet sich nachts eine Notbeleuchtung an, zur Sicherheit, Sie wissen schon. Irgendetwas muss daran durchgeschmort sein.«
Anne ging hinüber, um sich das genauer anzusehen. »Eine Zwanzig-Watt-Birne in einer Fliesenwand mit ein bisschen Plastik drum herum?«, fragte sie skeptisch.
Friesen nickte eilig und wischte sich dabei angesichts der Wärme, die das verkohlte Interieur noch immer abstrahlte, mit dem Unterarm über das Gesicht. »Die Jungs meinen, da hätten Kästen oder so etwas davorgestanden. In jedem Fall was Brennbares. Der Gutachter ist auf dem Weg.«
»Gut. Den brauchen wir dringend«, antwortete Anne.
Friesen gab ihr recht.
»Wieso stellt man ein Notlicht zu?«, überlegte Anne laut. »Vor allem hier, in direkter Nähe zum Hintereingang. Wenn man sich vor einem Einbruch fürchtet, schirmt man das Licht, das die Einbrecher abhalten soll, doch nicht ab.« Anne trat zur Tür hinaus auf den Hof des Gebäudes und schaute sich um. Von den umliegenden Häusern gab es nur wenige Blickwinkel, die eine freie Sicht auf den Hintereingang erlaubten. Allerdings handelte es sich dabei weitestgehend um Hotels und Pensionen, und da jetzt im Frühjahr nur wenige Gäste hier waren, war es durchaus möglich, ungesehen in das Hotel zu gelangen. Sie drehte sich um und betrachtete die Tür. Das Türblatt sowie auch das Schließblech waren stark beschädigt. Sie wandte sich Friesen zu und registrierte dabei, dass die beiden Feuerwehrmänner sie verstohlen von der Seite beäugten.
»Es wurde nicht eingebrochen«, beeilte sich Friesen zu sagen. »Die Tür war unversehrt, das sagen zumindest die Freiwilligen. Sie mussten gewaltsam rein. Die Riegel der Fenster hier unten sind intakt, das habe ich geprüft.« Er schaute sie an, als erwartete er ein Lob.
Mit einem schnellen Blick zu den Fenstern fand Anne Friesens Aussage bestätigt. Auch die Glastür des Haupteinganges, durch die sie vorhin gekommen war, wies keine Schäden auf. »Gibt es noch andere Möglichkeiten, ins Gebäude zu kommen?«
Friesen überlegte. »Ein paar ungesicherte Fenster vielleicht und womöglich der Eingang der Tiefgarage. Ich schaue mir das gleich an. In Ordnung?«
»Mhm.«
»Wenn hier ab und zu mal jemand nach dem Rechten gesehen hätte, wäre das Schwelen möglicherweise bemerkt worden, aber offenkundig war dem nicht so.« Er kratzte sich ein wenig verlegen an der Stirn. »Wenn ich meine Meinung sagen dürfte?«
Anne lächelte ihn ermunternd an.
»Die haben beim Ausräumen den Müll oder Ähnliches neben der Tür abgestellt und ihn dann dort vergessen. Das kann passieren. An die Notbeleuchtung hat dabei keiner gedacht. Dumm gelaufen.« Seine Wangen röteten sich vor Eifer. »Es ist ja nichts weiter passiert.«
»Wer hat den Brand gemeldet?«, fragte Anne, die seine Erklärung durchaus für schlüssig hielt, aber trotzdem zunächst wissen wollte, was der Gutachter zu allem sagen würde.
Friesen hielt einen Moment inne. »Sören, also Herr Hilgert«, entgegnete er sodann kaum vernehmbar und mit scheelem Blick zu den Feuerwehrleuten. Er zog einen kleinen Block aus seiner Reverstasche, klappte ihn auf und las halblaut vor: »Anruf acht Uhr zehn, Pension Seevilla, Flammen schlagen aus den Fenstern im Erdgeschoss, starke Rauchentwicklung.« Der Block verschwand umgehend wieder.
Anne nickte. Hilgert war der direkte Nachbar und mit etwas Glück auch ein Zeuge. Vermutlich wäre sie als seine Langzeitmieterin selbst zur Zeugin geworden, hätte sie die Seevilla heute zu ihrem größten Bedauern nicht bereits vor seinem köstlichen Frühstück verlassen müssen. Ihre Mutter kannte keine Gnade, wenn sie den Stralsunder Markt besuchen wollte. Anne hatte sich breitschlagen lassen, sie nach Bergen zum Bahnhof zu bringen. Warum, das war ihr klar geworden, kaum dass ihre Mutter im Auto gesessen hatte. Das Gespräch von Mutter zu Tochter war denn auch eher einseitig gewesen. Martin Kaminski war nun einmal kein Thema, über das Anne sich austauschen wollte. Ihr näheres Umfeld, Erik selbstverständlich eingeschlossen, schien indes ein dringendes Bedürfnis danach zu haben. Anne dachte an Hilgert. Ob er wohl schon von der Leiche wusste? Nein, ausgeschlossen. Selbst einer wie Sören Hilgert konnte nicht durch geschlossene Wände sehen.
Sie sah Friesen an, der ihrem Blick sofort auswich. Natürlich war ihr der seltsame Ausdruck in seinem Gesicht bei der Erwähnung von Hilgerts Namen nicht entgangen, aber da stand sie drüber. Je länger sie in der Seevilla wohnte, umso mehr spekulierten die Leute über ihr Verhältnis zu dem allein lebenden Mann. Dabei war sie nichts weiter als ein normaler Gast, der es seit einem Vierteljahr nicht geschafft hatte, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Als ob das in Sellin auch so einfach wäre. Abgesehen davon wusste sie noch nicht einmal, was sie genau wollte. Nach dem zu urteilen, was sich hier andeutete, würde sie darüber in der nächsten Zeit auch nicht allzu intensiv nachdenken können.
***
»Verdammte Sache! Ich erreiche ihn nicht«, schimpfte Dombrowski, kaum dass er die Küche der Seevilla betreten hatte. Vor lauter Rage, die man ihm an seinem knallroten, runden Gesicht deutlich ansehen konnte, war ihm sogar der Morgengruß durchgeflutscht. Genervt schob er sein Mobiltelefon in die Gesäßtasche seiner Jeans.
»Wen?«, fragte Hilgert und warf dabei einen flüchtigen Blick auf Felix, den Pinscher, den er zur Pflege hatte, seit Lothar Baum wegen Mordes im Gefängnis saß. Dass der alte Baum den Hund niemals würde zurücknehmen können, darüber machte sich Hilgert keine Illusionen. Mit Mitte achtzig inhaftiert, dürfte er seine Entlassung wohl kaum mehr erleben. Felix hatte es dagegen gut getroffen, auch wenn Anne Berber Hilgert erst davon hatte überzeugen müssen, dass ein Hund hervorragend zur Pension Seevilla passte. Mit Dombrowski stand der Pinscher allerdings auf Kriegsfuß und suchte sofort das Weite, wenn er auch nur dessen Stimme hörte. So hatte Felix sich denn auch gewohnheitsmäßig unter dem Spülschrank verzogen und wartete dort mit der treuherzigen Geduld, die nur ein Hund aufbringen konnte, bis der Krawallnachbar verschwunden war.
Dombrowski murmelte etwas Unverständliches, und Hilgert verspürte keinerlei Bedürfnis, noch einmal nachzufragen. Er sortierte gleichmütig das Frühstücksgeschirr in die Spülmaschine. Seine Gäste hatten sich inzwischen alle ihrer Tagesbeschäftigung hingegeben, und so konnte er das Seinige tun. Natürlich hatte er beim Abräumen des Büfetts immer wieder zum Nachbarhotel hinübersehen müssen. Wenn man ein Unglück direkt vor der Nase hatte, kamen einem die seltsamsten Gedanken, vor allem solche, die mit dem Glück des Selbst-nicht-Betroffenseins zu tun hatten. So war sie nun einmal, die menschliche Natur. Hilgert war zunehmend erleichtert gewesen, als die Feuerwehr den Brand relativ zügig unter Kontrolle gebracht hatte. Er hatte sie eine Weile beobachtet, weniger aus Neugier, sondern eher aus Sorge um sein eigenes Hab und Gut, das kaum zwanzig Meter vom Kurhaus Sellin entfernt lag. Jetzt, nachdem alles glimpflich abgelaufen war, trieb ihn etwas anderes um. Er glaubte, Anne Berber im Innenhof des Hotels gesehen zu haben, nur flüchtig zwar, aber er war sich ziemlich sicher. Und sie hatte nicht den Eindruck gemacht, zufällig dort zu sein.
»Ich nehme einen Kaffee«, forderte Dombrowski. »Und mach mir gleich einen Klaren rein. Ich kriege Stress.«
Hilgert schaute seinen Nachbarn abwartend an. Dombrowskis Getränkewunsch war nichts Ungewöhnliches, nicht einmal in den Vormittagsstunden. Was ihn verwunderte, war eher der Umstand, dass Dombrowski noch mit keinem Wort den Brand im Kurhotel erwähnt hatte. Wennemar Dombrowski, dem in Sellin nichts entging, vor allem nichts, was mit dem Hotelwesen zu tun hatte, und der immer und überall seine Nase hineinstecken musste, den juckte es nicht, wenn in seiner unmittelbaren Nachbarschaft die Feuerwehr einrückte? Das war einfach nicht zu glauben. Er betätigte die Kaffeemaschine und ging zum Kühlschrank, um die Milch herauszuholen.
»Schwarz, ein echter Potti mag nur schwarz. Das solltest auch du dir irgendwann einmal merken können«, unkte Dombrowski. »Aber du bist und bleibst ein lausiger Gastgeber.« Er lachte schallend.
Hilgert war nicht bei der Sache gewesen. Dabei kam Dombrowski mehrmals täglich auf einen Kaffee vorbei, um sich etwas zu borgen oder Hilgert um Hilfe zu bitten. Manchmal auch nur, um zu tratschen oder sich über seine Frau Claudia zu beschweren. Dombrowski fand immer einen Grund, sich vor der Arbeit in seinem eigenen Hotel, dem »Seetang«, zu drücken. Er betrieb das Hotel seit mehr als dreißig Jahren und rühmte sich selbst des Öfteren damit, einer der ersten westdeutschen Glücksritter gewesen zu sein, die hier auf Rügen das große Geld gemacht hatten. Wo die Kohle allerdings geblieben war, darüber schwieg er sich konsequent aus. Für Dombrowski selbst, der über Jahr und Tag alte abgewetzte Jeans, billige karierte Oberhemden und geschenkte Flipflops aus dem Sonnenstudio trug, konnte das Vermögen jedenfalls nicht draufgegangen sein. Auch im Hotel sparte er an allem, angefangen bei der Einrichtung bis hin zu den Lebensmitteln, die seine Claudia für das Frühstück der Gäste einkaufen durfte. Nichtsdestotrotz brummte Dombrowskis Laden. Wo sonst konnte man auch für nicht einmal dreißig Euro auf Rügen ein Zimmer beziehen und bekam Sellins Bestlage vis-à-vis der Seebrücke noch obendrauf?
Dombrowski schlürfte seinen Kaffee. »Ich verstehe das alles nicht. Georgi hat mich noch nie hängen lassen. Ausgerechnet jetzt, wo doch morgen früh die Polen auf der Matte stehen. Claudi macht mich alle, wenn das nicht klappt.« Er wuchtete seinen Hintern auf den Vorbereitungstisch und ließ die Beine baumeln. Dabei quoll sein Bauch so weit über den Hosenbund, dass dieser gänzlich verdeckt wurde. Dombrowski sah aus, als hätte er schon wieder einiges an Gewicht zugelegt. Das konnte aber auch täuschen, denn die Klamotten, die er trug, entstammten nicht nur einem anderen Jahrzehnt, sondern hatten auch eine Konfektionsgröße, die mindestens eine Nummer unter seinen gegenwärtigen Maßen lag. »Ausgerechnet jetzt. Ich habe die Penunzen doch schon fest einkalkuliert.«
Was auch immer Dombrowski gerade für abenteuerliche Geschäfte machte, Hilgert würde ihn nicht danach fragen. Er nahm sich ebenfalls einen Kaffee und dachte an Anne Berber. Sie hatte heute gegen ihre Gewohnheit nicht gefrühstückt. Das könnte bedeuten, dass sie es eilig gehabt hatte. Aber das ging ihn nichts an. Sicher war jedenfalls, dass die Feuerwehr sie angerufen hatte. Wieso sollte sie sonst da drüben herumlaufen? Für die routinemäßige Aufnahme des Brandes genügte Fritz Friesens Anwesenheit. Also musste mehr dahinterstecken. Womöglich war es ein Einbruch mit Brandstiftung gewesen? So etwas konnte passieren, wenn ein Haus zu lange leer stand. Zumal jeder vorbeischlendernde Passant durch die große Glasfassade neben dem Haupteingang einen Blick ins Gebäude werfen konnte. Dabei wirkte das, was man im Inneren geboten bekam, eher wie das Ergebnis einer unkontrollierten Flucht als eines geordneten Rückzugs. Genau das war aber vielleicht das Problem. Denn dort, wo es schon nichts mehr zu holen gab, stieg die Bereitschaft zu Vandalismus. Hilgert war in den letzten Wochen täglich an diesem altehrwürdigen Haus vorbeigekommen, und bei dessen Anblick hatte ihn immer Wehmut erfasst. Aber womöglich ging jedem Neuanfang eine Phase des Vergessenwerdens voraus. Wer konnte das schon sagen?
»Du hast ihn auch nicht gesehen, oder?«, fragte Dombrowski, während er wie wild auf seinem Handy herumtippte. »Irgendwann muss dieser Kerl doch mal seine Nachrichten lesen. Ich muss das jetzt wissen, Mensch, nicht dass die Polen für umme hier anrücken, und der gute alte Dombrowski darf die Brieftasche trotzdem aufmachen.«
»Von wem redest du?«