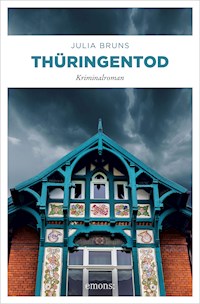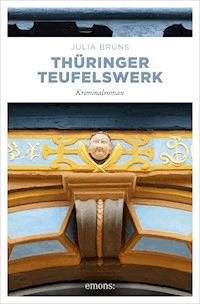Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Bernsen und Kohlschuetter
- Sprache: Deutsch
Thüringens bekannteste Krimiautorin legt nach. Zwei Mitarbeiterinnen der Oberweißbacher Bergbahn, eine der beliebtesten Touristenattraktionen der Region, werden ermordet an der Talsperre Leibis-Lichte gefunden. Hat es hier jemand auf das traditionsreiche Bahnunternehmen abgesehen? Bernsen und Kohlschuetter lernen bei ihren Ermittlungen die berühmte Sommerfrische im Schwarzatal kennen, treffen auf militante Eisenbahnliebhaber, geheimnisvolle Kräuterfrauen und den angeblichen Geist des "Schwarzen Doktors", der noch sehr lebendig ist ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Bruns studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie an der Universität Jena. Nach ihrer Promotion im Fach Politikwissenschaft arbeitete sie viele Jahre als Redenschreiberin und in der Öffentlichkeitsarbeit. Heute lebt sie als freie Autorin in Thüringen.
www.julia-bruns.com
www.thueringen-kommissare.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Thomas Abé: Fotografie
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Marit Obsen
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-612-8
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur Editio Dialog,
Dr. Michael Wenzel (www.editio-dialog.com).
Für Thomas,
Prolog
Januar 1986, Bergbahnstation Lichtenhain im Schwarzatal
»Da ist jemand.«
Er streichelte ihren Arm.
»Da, hinter dem weißen Schleier.« Sie hob ihre Hand und vollführte kreisende Bewegungen. »Elfen. Tanzende weiße Elfen, ganz zart. Sie schweben. Schau, wie schön.« Sie fing leise an zu summen, lächelte glückselig und stieß hin und wieder ein auf ihn beängstigend entrückt wirkendes Jauchzen aus.
Er hielt sie fest im Arm. Ihre Wange lag an seiner, sie glühte. Lieber Gott, wenn es dich gibt, steh uns bei, dachte er und schaute hinaus in die Dunkelheit. Der Schnee peitschte in dicken Flocken gegen das Fenster, blieb daran kleben und rutschte, wenn das Gewicht zu schwer wurde, an dem glatten Glas hinab. Für kurze Zeit war das gelbe Licht einer Straßenlampe zu sehen, dann hatte der Schnee die Außenwelt wieder eingehüllt.
Sie fing an zu zittern. »Wir werden es doch schaffen?«, fragte sie mit schwerer Zunge. »Es ist … wir müssen doch …« Tränen kullerten über ihre Wangen.
Er beugte sich vor, schaute sie an. Sie sah ihn gar nicht, ihr glasiger Blick irrte wild umher, sie klammerte sich an seinen Arm. Irgendwer brachte eine Decke. Er wickelte sie darin ein.
»Der Schnee zwischen den Seilrollenkästen ist zu hoch. Wir können unmöglich losfahren«, hörte er wie aus weiter Ferne jemanden sagen. »Die Männer schaufeln, aber er ist zu fest. Es ist aussichtslos.«
»Was ist mit der Feuerwehr? Die müssen ausrücken«, erregte sich ein anderer. »Ein LPG-Fahrzeug? Verdammte Scheiße, so eine verdammte Scheiße!«
»Sei ruhig! Bei dem Wetter kommt keiner durch. Mit etwas Glück morgen früh.«
Er sah ihre verstohlenen Blicke, ihre Angst. Dann war er wieder mit ihr allein.
Irgendwann, er hatte sein Kommen nicht bemerkt, stand ein Mann vor ihnen, beugte sich zu ihm herunter und flüsterte: »Die Einzige, die Ihnen jetzt noch helfen kann, ist Lina. Ich hole sie.« Er fasste nach seiner Schulter und drückte sie fest.
In den Augen des Fremden sah er so viel Mitleid, dass er am liebsten davongerannt wäre. Er wusste nicht, was er sagen sollte, nickte nur verhalten, woraufhin der Mann mit ratlosem Blick wieder hinausging.
»Lieber Gott …« Er kannte kein Gebet, stammelte das, was ihm einfiel, drückte sie fester an sich. Draußen heulte der Wind, schlug heftig gegen die Scheiben wie ein Ungetüm, das ihnen nach dem Leben trachtete.
Er war schuld. Er hätte sie gestern ins Krankenhaus bringen müssen. Dort wäre sie in Sicherheit gewesen. Jetzt war es zu spät. Er schluckte, kämpfte mit den Tränen. Nein, nein, es durfte nicht sein.
Sie zuckte zusammen. »Da, da!« Über ihre Stirn lief der Schweiß. »Er kommt. Er will mich holen.« Sie lallte. Die Worte überschlugen sich. Sie versuchte sich aufzurichten, hatte jedoch nicht genügend Kraft. »Wir müssen weglaufen. Schnell.« Sie fing an zu weinen, schob ihn von sich fort, presste ihre Hände gegen die Fensterscheiben, als könnte sie sich dadurch vor irgendetwas schützen. »Da ist er. Siehst du den Hund? Diese großen Augen. Er schaut mich an.« Sie warf den Kopf hin und her, schlug die Hände vor das Gesicht. »Nein. Nicht. Ich habe nichts getan.«
Er zog sie noch fester an sich.
Sie wehrte sich. Schaute ihn mit wirrem Blick an. »Geh weg. Ich kenne dich. Du trägst deinen Kopf unter dem Arm. Du bist es. Du bist der Schwarze Doktor. Du bist der Teufel.«
»Beruhige dich doch bitte«, flehte er mit der gesamten Liebe, die er hatte. »Ich bin es nur. Ich passe auf dich auf. Ich passe immer auf dich auf. Wir sind gleich im Krankenhaus. Gleich.«
»Ich will nicht. Lass mich!« Ihre Fäuste hämmerten auf ihn ein. Schließlich sackte sie in sich zusammen.
Er umfasste ihre Oberarme und rüttelte an ihr. »Bleib bei mir. Bitte!«, flehte er. »Verlass mich nicht. Du bist doch das Einzige, was ich habe.«
EINS
August 2020, Erfurt
»Aber selbstverständlich hat die Gästetoilette ein Fenster.« Der Mann im beigen Leinenanzug echauffierte sich auf gekünstelte Weise. »Gnädige Frau, wir reden hier über hundertundfünfundsechzig Quadratmeter reinsten Luxus über den Dächern der Landeshauptstadt. Allein der Blick zum Dom«, er seufzte, »unbezahlbar.«
Die Rotfeder rutschte aufgeregt auf ihrem Stuhl hin und her, fasste nach Bernsens Oberschenkel und drückte ihm ihre Finger fest ins Fleisch. »Siehst du, Friedhelm, sogar mit Blick auf den Dom.«
»Ich bin Protestant. Die katholischen Hütten interessieren mich nicht«, maulte er mit widerwillig vor der Brust verschränkten Armen und betont abweisender Mimik.
»Du bist gar nichts«, zischte sie, woraufhin sie dem Makler ihr freundlichstes Lächeln schenkte.
»Das Loft, wie ich die Wohnung nenne, hat sogar zwei miteinander verbundene Balkone, also quasi umlaufend, wenn Sie verstehen. Sie wandern einfach mit der Sonne mit, wenn Sie draußen sitzen und Ihren Kaffee genießen oder wie in Ihrem Fall Tee, wie ich meinen würde. Alle Damen mit Stil trinken Tee.« Er zwinkerte der Rotfeder aufdringlich zu.
»Nein, wie herrlich«, entgegnete sie mit schriller Stimme und kicherte.
»Alle Damen mit Stil trinken Tee«, äffte Bernsen den Makler nach.
Die Rotfeder verpasste ihm unter dem Tisch einen Tritt.
Er zuckte nicht einmal.
»Und damit Sie Ihren Tee auch angemessen zubereiten können, verfügt das Loft über eine Einbauküche, natürlich mit allem Schnick und Schnack.« Er wischte mit wachsweicher Hand durch die Luft. »Die ist im Preis enthalten, wir haben ja schließlich eine Berufsehre zu verlieren.«
»Mit allem Schnick und Schnack«, wiederholte die Rotfeder angetan.
Alle Damen mit Stil trinken Tee, dachte Bernsen, allein der Satz kostet schon einen Hunderter extra. Solche Typen kannte er zur Genüge. Maulhelden, die ihren Mitmenschen das sauer verdiente Geld aus der Tasche ziehen wollten. In diesem Fall sein Geld, das machte es noch schlimmer. Abgesehen davon hasste die Rotfeder jegliche Art von Tee. Aber diesem Kalfakter der Immobilienfirma widersprach sie natürlich nicht.
»Und wie ist das mit einem Fahrstuhl, also ich bin ja noch fit«, die Rotfeder wandte Bernsen leicht den Kopf zu, »aber wir …«
»Teuerste, ich verkaufe Ihnen doch kein Loft«, er spitzte die Lippen, »ohne einen Fahrstuhl. Das ist absoluter Standard in der gehobenen Klasse.« Die flache Hand auf seine Brust gelegt, drückte er das Kinn nach unten und machte ein betroffenes Gesicht. »Da können Sie uneingeschränkt auf mich vertrauen.«
Verkaufen? Wieso verkaufen? Bernsen runzelte irritiert die Stirn. Er musste irgendetwas nicht mitbekommen haben. Bisher war immer nur die Rede von einer kleinen Mietwohnung gewesen, in der die Rotfeder ihn auch mal besuchen könnte, ohne dass sie sich gleich zu sehr auf die Pelle rückten. Seit sie auf Sylt zur Kur gewesen war, wollte die Rotfeder, dass sie an ihrer Beziehung arbeiteten. Dafür müssten sie sich auch öfter sehen, hatte sie festgelegt. Die Zeiten seiner glücklichen Wochenendehe sollten damit dem Ende entgegengehen.
Bernsen hatte an dieser Offenbarung eine ganze Weile zu knabbern gehabt, immerhin ging es hier um seine Freiheit als Ehemann. Spätestens mit seiner Pensionierung käme diese »Wir-sind-immer-zusammen-und-glücklich-Zeit«, wie die Lebensberatungstante seiner Frau, die fiese Klimakterium-Tussi, es betitelte, jedoch ohnehin auf ihn zu. Da war so ein bisschen Eingewöhnungszeit möglicherweise gar nicht schlecht, quasi ein sanfter Einstieg in die gnadenlose Unterjochung.
Abgesehen davon hatte er in Erfurt ja noch einiges selbst in der Hand. So könnte es schon einmal vorkommen, dass er abends länger Dienst schieben oder auch einfach nur bei Andras in seiner Lieblingspizzeria abhängen musste. Ein Herausschieben seines Ruhestandes wäre auch nicht ausgeschlossen. Die Kollegen brauchten ihn dringend. Vor allem Kohlschuetter, der Jungspund, war ohne ihn doch absolut aufgeschmissen. Momentan machte er daher gute Miene zum bösen Spiel und hoffte, dass die Rotfeder die Lust an diesem Beziehungsauffrischungsquatsch wieder verlieren würde. Thüringen war nichts für seine Bremer Deern. Wenn sie erst mal ein paar Tage hier war, würde sie schon von selbst darauf kommen. Dann kehrte wieder Ruhe ein, und Bernsen konnte zu seinem geschätzten Trott zurückkehren. Ihm genügte seine vierzig Quadratmeter große möblierte Einraumwohnung unter der Woche voll und ganz. Es hatte zwar ein bisschen etwas von betreutem Wohnen mit der Marwitz, seiner Putzfrau, und der Vollverpflegung durch den von Andras im Erdgeschoss geführten Pizzadienst, aber das war ja nicht unbedingt etwas Schlechtes. Ganz im Gegenteil, wenn er sich manchmal abends keine Pizza holte, kam Andras rauf und schaute nach dem Rechten. Die Fürsorge war in den acht Euro fünfzig für die Tonno inbegriffen. Und immer donnerstags sorgte die Marwitz dafür, dass er keine Salmonellen oder Schlimmeres bekam, indem sie die Reste seines Essens entsorgte. Da konnte dieser schmierige Gockel hier mit seinem uneingeschränkt vertrauensvollen Service nicht mithalten.
»Wir haben für all unsere Objekte eine Art Concierge-Dienst. Putzen, Bügeln, kleine Handwerksarbeiten und sogar eine Seniorenbetreuung oder einen Hunde-Gassi-Service können Sie bei uns buchen.« Er schnalzte angeberisch mit der Zunge.
Die Rotfeder schlug sich begeistert die Hand vor den Mund. »Also wirklich, das ist ja toll.«
»Brauchen wir nix von«, kommentierte Bernsen. »Wie wir auch die ganzen hundertfünfundsechzig Quadratmeter der Schickimicki-Bude nicht brauchen. Haben Sie nicht etwas Kleines in der Erfurter Nordstadt? Vielleicht in der Nähe von ›Andras Pizza und Co.‹. Ich möchte keine langen Laufwege.« Was meinte dieser schmierige Glühweinverkäufer eigentlich, was ein Thüringer Polizeibeamter verdiente, noch dazu, wenn dessen Ehefrau den Großteil der Kohle jeden Monat beim Hundefriseur ließ?
Der Makler beugte sich leicht zurück, blähte die Nasenflügel auf und schaute Bernsen an, als ob dieser ihm eine Ohrfeige verpasst hätte. »Wie meinen?«
»Friedhelm!«, fauchte die Rotfeder. »Wir ziehen natürlich nach Weimar.«
Mit einer zackigen Bewegung wandte sich der Makler wieder der Rotfeder zu und wackelte hektisch hin und her. In seinen Augen stand Entsetzen. »Verehrteste … Weimar«, haspelte er. »Aber der Dom steht in Erfurt, also von wegen des Tees auf der Sonnenterrasse.« Während er das sagte, gewann er seine arrogante Gelassenheit zurück.
Bernsen grinste frech. »Da kann gern irgendjemand anderes mit seinem Pfeffibeutel in der Tasse auf den Turm glotzen und sich über sein verschwendetes Vermögen ärgern.«
Die Rotfeder war nun ebenfalls etwas aus dem Konzept. »Kein Dom? Aber im Fernsehen haben sie gesagt, dass Weimar die Stadt ist, in der gut betuchte Senioren ihren Lebensabend verbringen. Dort bauen sie sogar schon ebenerdige Ladeneingänge, in der ganzen Fußgängerzone. Und die Restaurants und Cafés sollen vorwiegend Seniorenteller anbieten, von den halben Preisen für das Theater und die Museen mal ganz abgesehen.«
Bernsen steckte sich seinen Zeigefinger ins Ohr und versuchte durch intensives Wackeln, den Hörsturz, den er offenkundig zu haben schien, zu beseitigen. Gut betuchte Senioren?
»Auf Sylt haben alle von Weimar geschwärmt. Die Frau des Fabrikanten«, sie schaute auf Bernsen, »von der habe ich dir erzählt. Die hat sich ein Haus am Park bauen lassen. Direkt in der Innenstadt. In Weimar soll alles fußläufig zu erreichen sein. Du wolltest doch kurze Wege, Friedhelm. Und Bernd mag Parks so gern. Da kann er dann mit Mutti …« Sie stockte.
Bernsen befummelte sein anderes Ohr. Nichts veränderte sich.
»Verehrteste«, flötete der Makler und tänzelte dabei hinter seinem Schreibtisch hervor. »Sie haben absolut recht. Weimar ist noch viel besser als Erfurt. Wir haben ein zauberhaftes Objekt mit Blick auf das Theater, eigener Dachterrasse, Loggia und zwei nebeneinanderliegenden Schlafzimmern. Dann sind Sie immer gleich zur Stelle, wenn mit Ihrer lieben Mutter etwas sein sollte.«
Die Rotfeder wurde nervös und wiegelte ab. »Das weiß ich noch nicht, also … mal sehen.«
Bernsen saß steif da und starrte den Makler an.
»Lassen Sie sich nicht allzu viel Zeit, gnädige Frau. Die Luxuswohnungen in Weimar sind heiß begehrt. Die Silver High Society, wenn Sie wissen, was ich meine«, er lachte schmierig, »überrennt unsere Stadt der Dichter und Denker quasi.«
Sie nickte eilig. »Wir bleiben bis Mittwoch in der Stadt. Mutti ist schon ganz aufgeregt. Bis dahin haben wir einen schönen Altersruhesitz in Thüringen für uns gefunden, nicht wahr, Friedhelm?«
Bernsen hatte nicht zugehört. Die Passanten, die am Maklerbüro vorbeiliefen, waren interessanter. Und der Duft, der ihm soeben in die Nase gestiegen war. Irgendwo musste es frischen Backfisch geben. Es wurde Zeit für ein zweites Frühstück.
***
Und noch ein Herzchen.
Das Piepen des Handys signalisierte, dass die Nachricht rausgegangen war. Verflixt, Kohlschuetter hatte den Kussmund vergessen. Flink huschte sein Daumen über das Display. Zack, und fort war das nächste Liebes-Emoticon. Er starrte eine Weile auf sein Mobiltelefon und wartete.
Vierzehn Nachrichten hatte er Anni, seit sie sich gestern Morgen verabschiedet hatten, bereits geschickt. Keine davon hatte sie gelesen, geschweige denn beantwortet. Womöglich hatte sie wieder ihr Handy verlegt. Das war in den vier Wochen, die sie sich inzwischen kannten, häufiger vorgekommen. Na ja, heute war Freitag, und sie waren sowieso verabredet. Aber sie sollte nicht sagen, er hätte nicht an sie gedacht.
Anni, die süße Maus, die er beim Schuhkauf in der Erfurter Innenstadt getroffen hatte, und die ihm auf nassforsche, aber durchaus charmante Weise die grünen Sneaker ausgeredet hatte. Es war das Mindeste gewesen, sie nach dieser Stilberatung auf einen Kaffee einzuladen. Seitdem sahen sie sich mehrmals die Woche, und Kohlschuetter musste sich eingestehen, dass ihr Temperament ihm guttat. Er schmunzelte versonnen bei dem Gedanken an ihr fröhliches Wesen.
»Ist Friedhelm Bernsen noch immer nicht da?«, kreischte Claudia Muschke, die Sekretärin des Chefs, die ihren runden Kopf zur Bürotür hineinsteckte und dabei eine fette Wolke ihres grauslichen Parfüms verbreitete.
»Guten Morgen, Frau Muschke«, brummte Kohlschuetter überzogen abweisend, ohne von seinem Telefondisplay aufzusehen. »Nein, der Kollege Bernsen ist noch nicht da, oder meinen Sie, ich hätte ihn unter dem Schreibtisch versteckt?«
»Tss.« Das Knallen der Tür signalisierte das Ende des Gespräches.
Aufgeblasene Kuh, dachte Kohlschuetter. »Friedhelm Bernsen«, dass ich nicht lache. Sonst war er immer der gute Friedi. Sogar Bernsen schien in Misskredit geraten zu sein.
Seit Susis missglückter Verlobung stand Kohlschuetter mit Claudia Muschke auf Kriegsfuß. Nicht dass die beiden vorher ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt hätten, mitnichten, aber seit der schrecklichen Verlobungsparty in Neudietendorf brauchte die Muschke bloß einen Tagesgruß abzusetzen, und Kohlschuetter war auf hundertachtzig. Der Abend war ein absolutes Fiasko gewesen, vor allem für Susi, die im Kreise ihrer Familie, ihrer Freunde und aller Kollegen durch den peinlichen Auftritt eines guten Dutzends halb nackter Verflossener ihres Verlobten Lary vollkommen bloßgestellt worden war. Auf die Idee musste man erst einmal kommen. Die Exfreundinnen, von denen die eigene Verlobte keine Ahnung hatte, zum Schaulaufen zu bitten. Das Problem mit Susis Unkenntnis hatten die Chicas allerdings vortrefflich gelöst, indem sie Namen und Kopulationszeitraum auf ihren T-Shirts vermerkten, die überdies fast das Einzige gewesen waren, was die Damen angehabt hatten. Die Mädels wenigstens hatten dabei ihren Spaß gehabt. Lary nicht. Der Punch von Susi hatte gesessen. Lary war im Schlagzeug gelandet, direkt auf einem Tomtom. Sein Kopf hatte die tiefen Mitten des Instrumentes wunderbar herausgespielt, hätte Kohlschuetters früherer Musiklehrer gesagt.
Abgesehen vom exzellenten Klang hatte es auch beeindruckend ausgesehen, wie Larys Nasenbein am Trommelfell zerbrochen war, zumindest erinnerte sich Kohlschuetter immer wieder gern daran. Im Grunde hätte es nicht besser laufen können. Die Feier war so tot gewesen wie die Verlobung an sich. Susi war frei. Doch dann wendete sich das Blatt. Und nun war sie stinksauer auf ihn. Dabei hatte er nichts weiter gemacht, als Larys Weiberschar in ein Taxi zu verfrachten, um dafür zu sorgen, dass Susi nicht noch mehr Anzeigen wegen Körperverletzung an den Hals bekam. Das, und nichts weiter, hatte die Muschke, die alte Tratsche, gesehen. Aber wie das so war bei dicken, unglücklichen Frauen mit übertriebenem Hang zur Selbstdarstellung, am Ende hatte sie überall herumerzählt, Kohlschuetter hätte die Frauen bestellt, um Susi und Lary auseinanderzubringen.
Er spürte, wie ihre bloße Erscheinung ihn wieder wütend werden ließ. Rache war ein kaltes Gericht, und die Muschke würde davon probieren, aber nicht zu knapp.
»Moin.« Die Tür flog auf, und Bernsen schlurfte herein. In seiner Hand hielt er zwei von öligem Fett durchdrungene Brötchentüten. »Kann ich Kaffee?«
»Kochen, vertragen, mahlen, auskotzen? Was? Kriegt der Satz vielleicht auch noch ein Verb, oder ist selbst das mittlerweile zu viel verlangt?«, blaffte Kohlschuetter ungewohnt barsch.
Bernsen schaute ihn entgeistert an. »Trinken«, pfefferte er zurück. »Wenn Sie mal mitdenken würden, wären Sie allein darauf gekommen.« Er hielt in seiner Bewegung inne. »Und wenn Sie sich gegenüber Claudi nicht so unmöglich benommen hätten, stünde mein Kaffee schon hier, von einem Stückchen Kuchen mal ganz abgesehen.«
Der Vorwurf prallte an Kohlschuetter ab. Er deutete wie nebenbei auf die Maschine hinter Bernsens Schreibtisch, in deren Glaskanne der frisch gebrühte Kaffee dampfte. Dann widmete er sich wieder seinen Akten.
Die Muschke war erledigt. Darauf konnte sie Gift nehmen.
Die Tüten raschelten, als Bernsen sie behutsam auf seiner Schreibtischunterlage ablegte. Eine Schranktür klapperte. »Wo ist meine Seehundtasse?«, fragte er sauer.
Kohlschuetter hob betont langsam den Kopf und schaute Bernsen aus schmalen Augen an. »Damit habe ich Ihrer pummeligen Freundin das Lügenmaul gestopft. Dabei muss sie wohl kaputtgegangen sein. Tut mir aufrichtig leid.« Er wusste, dass dies harte Worte waren, aber er hatte von dem Tratsch der Muschke die Nase voll. Zumal Bernsen diesen Schwachsinn auch noch für bare Münze zu nehmen schien. Er machte jedenfalls keinerlei Anstalten, diesen Unsinn zu unterbinden. Dabei hatte er direkt neben Kohlschuetter gestanden, als der das Taxi und nicht die Mädchen bezahlt hatte.
Bernsen reagierte nicht auf seinen Wutausbruch. Er zog das oberste Fach seines Schreibtisches auf, brummte zufrieden und förderte seine Seehundtasse daraus zutage. Da in der Tasse offenkundig noch die Kaffeereste von gestern waren, kippte er das Gesöff an die vertrocknete Orchidee auf seinem Schreibtisch und goss schließlich randvoll frischen Kaffee ein. Dann schmiss er sich auf seinen Stuhl, fummelte ein Brötchen aus der mitgebrachten Tüte, biss kräftig hinein und legte die Füße auf seinem Schreibtisch ab. Zwei Bissen später sprach er Kohlschuetter erneut an. »Sie sollten sich bei Claudi entschuldigen. Dann müssten Sie keinen Kaffee mehr für mich kochen. Mir würde es damit auch besser gehen. Claudis Kuchen schmeckt echt lecker. Der fehlt in meinem Speiseplan.« Er schob seinen linken Daumen in den Bund seiner Jeans und prüfte die Weite.
Im Büro verbreitete sich ein aufdringlicher Geruch nach frisch frittiertem Fisch.
Kohlschuetter pumpte, erhob sich und öffnete einen der großen Fensterflügel. »Den Kaffee koche ich für mich, nicht für Sie. Ich bin nur so freundlich, Ihnen welchen abzugeben.«
»Na ja, Claudi hat trotzdem eine Entschuldigung verdient.«
»Das ist ja wohl eher andersherum.«
»Sie neigen dazu, die Dinge zu verdrehen.«
Kohlschuetter war kurz vorm Platzen.
»Jeder weiß, dass Ihnen die Sache mit Susi und Lary gestunken hat. Aber so eine krasse Nummer wie mit den Nutten hätten Sie nun wirklich nicht abziehen müssen.« Bernsen schaute ihn tadelnd an. »Das passt doch überhaupt nicht zu Ihnen.«
»Es gab keine Nutten!«, schrie Kohlschuetter.
»Wie nennt man Frauen, die man bezahlt?«, fragte Bernsen gespielt nachdenklich.
»Ich habe das Taxi bezahlt. Sonst nichts!«
»Susi sieht das nicht so.«
»Ein Dutzend Nutten als Verlobungsgeschenk an den Bräutigam, und das vor den Augen der Braut? Für wie blöd halten Sie mich? Ich hatte die Frauen noch nie zuvor gesehen, und ganz bestimmt habe ich ihnen kein Geld gegeben«, ereiferte sich Kohlschuetter. »Außerdem, wieso sollte ich diesem dämlichen Torten-Lary etwas schenken?«
»Oh, oh, oh, da zeigt aber jemand sein wahres Gesicht. ›Dämlicher Torten-Lary.‹« Bernsen schnalzte mehrfach hintereinander mit der Zunge. »Es hat doch übrigens niemand behauptet, dass Sie die Schnecken kannten. Sie finden ja bei Ihrem Charme auch so genug Bräute, die ihnen einen Gefallen tun wollen. Noch. Irgendwann, wenn sich das in diesem kleinen Land herumgesprochen hat, macht da keine mehr freiwillig mit.« Er schmatzte selbstzufrieden. »Ich verstehe ohnehin nicht, was die Frauen an Ihnen finden.«
»Noch was?«, schnauzte Kohlschuetter ihn an.
»Die Entschuldigung bei Claudi. Wenn Ihnen schon nicht an einem anständigen Klima am Arbeitsplatz gelegen ist, dann tun Sie es wenigstens für mich. Diese negativen Energien behindern mein Denken.« Er pustete in seine Tasse, als gäbe es nichts Wichtigeres auf der Welt.
»Aber sonst ist bei Ihnen noch alles knusprig?«, fragte Kohlschuetter in Brass.
Bernsen ignorierte die Frage, schmiss die Füße vom Tisch und schaltete seinen Computer an. »Wollen wir doch mal gucken, was die Kollegen im Freistaat gerade so zu tun haben.« Er lehnte sich entspannt zurück, kaute genussvoll und klickte auf seiner Maus herum. »Claudi ist nachtragend. Sagen Sie nachher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt«, nuschelte er. »Und solange wir keine Sekretärin oder so was Ähnliches haben, ist sie manchmal auch echt hilfreich. Wenn wir ab jetzt immer alles selbst machen müssen … oje, dann gute Nacht, Marie.« Er machte ein betroffenes Gesicht.
»Sie könnten sich auch zur Abwechslung einmal selbst um Ihre Aufgaben kümmern. Ich mache ohnehin die ganze Schreibarbeit. Zum Beispiel könnten Sie das Protokoll zum Tankstellenüberfall gegenlesen«, sagte Kohlschuetter und fragte sich, wieso Bernsen schon wieder nichts zu tun hatte. Es gab genügend Delikte zu bearbeiten. Bernsen jedoch saß bloß die Zeit bis zum nächsten Mord ab. Das war von jeher das Einzige, was ihn zu interessieren schien. Der Rest landete bei Kohlschuetter und, das musste er zugeben, bei der Muschke. Aber die würde er nicht mehr um Unterstützung bitten, egal, wie sehr sie auch mit Arbeit zugeschüttet wurden. Die nicht. »Wieso ist die Muschke eigentlich auf Sie sauer?«, fragte er neugierig.
»Mhm. Versteh einer die Frauen«, nuschelte Bernsen. »Dönerläden in Erfurt ausgeraubt, so, so. Na, Hauptsache, die laufen nicht bei Andras auf. Ich mag keine Störungen in meinem Tagesablauf. Und ungewohnte Nahrungsmittel auch nicht, nicht auszudenken, wenn Andras kurzzeitig keine Pizza backen dürfte. Mannomann. Und was haben wir da noch? Fünfzehnjähriger dreht sich in Suhl einen Joint vor den Augen der Polizei. Nicht schlecht. Hätte er mir auch mal einen machen können.« Er kicherte. »Die Telefonbetrugsmasche läuft immer noch. Vielleicht könnten die auch mal bei dem Püschelweib anrufen.«
»Bei Ihrer Schwiegermutter? Wieso das? Um sie dann auszurauben?« Kohlschuetter begriff nicht.
»Entführung«, murmelte Bernsen. »Nicht wiederbringen.« Er grunzte. »Hier im wilden Osten hopsgenommen und dann auf Nimmerwiedersehen nach Polen verschleppt, wie die Autos.« Jetzt schüttelte ein derbes Lachen seinen schmächtigen Körper. »Ich würde einen Teufel tun und nach der alten Beißzange suchen.«
Natürlich nicht. Dann müsste er sich ja bewegen, dachte Kohlschuetter. »Ach, Sie haben also gerade lieben Familienbesuch?«, säuselte er schadenfroh. »Gibt es einen besonderen Anlass, oder sind das immer noch die Nachwirkungen der Syltkur?«
»Das ist nichts, worüber ich mit Ihnen reden möchte. Das ist privat«, entgegnete Bernsen schroff.
Abwarten, dachte Kohlschuetter. Wenn die Rotfeder und deren Mutter in der Stadt waren, würde es nicht lange dauern, und der Kollege drehte am Rad.
»Na, sieh mal einer an«, sagte Bernsen wenig interessiert. »Kennen Sie die Oberweißbacher Bergbahn?«
Kohlschuetter hob den Kopf. »Ja, wieso? Was ist mit der?«
»Da werden zwei Mitarbeiterinnen vermisst. Sie sind heute Morgen beide nicht zum Dienst erschienen. Die Mail von der Zentrale kam gerade rein. Bei der Bahn ist man seit den letzten Anschlägen offenbar vorsichtig geworden und reagiert nun schneller. Aber das ist ja lächerlich. Jetzt klauen die schon die Lokführer? Dieser Fachkräftemangel nimmt Ausmaße an, erstaunlich.« Bernsen lachte.
Kohlschuetter sprang so abrupt auf, dass sein Schreibtischstuhl nach hinten sauste und mit Karacho gegen einen Aktenschrank knallte. Im nächsten Moment stand er hinter Bernsen. »Zeigen Sie mir das. Auf der Stelle«, forderte er.
»Was denn, was denn? Nun mal langsam mit den jungen Pferden! Was juckt uns Oberweißbach? Wo ist das überhaupt?«, fragte Bernsen verdattert.
»Im Schwarzatal, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt«, antwortete Kohlschuetter, während er die Nachricht auf dem Bildschirm las. »Es gibt bei der Bergbahn nicht so viele Triebfahrzeugführerinnen. Anni ist eine davon.«
»Und?«, fragte Bernsen unbedarft und schaute ihn mit großen Augen an.
»Deswegen beantwortet sie keine meiner Nachrichten«, hauchte Kohlschuetter.
»Jetzt sagen Sie nicht … Scheiße!«
***
»Einen halben Tag frei?« Der Chef stutzte. »Und der Psycho… äh Bernsen auch?« Man konnte hören, wie er rauchte. »Seit wann sind Sie beide so unzertrennlich? Hören Sie, Kohlschuetter, dass Sie mir nur ja nicht so werden wie der. Zu viel Nähe ist nicht gut.«
»Chef, der Freisprecher ist an«, sagte Kohlschuetter. »Er kann Sie hören.«
»Es macht mir nichts aus, wenn ihr in meinem Beisein über mich in der dritten Person sprecht«, warf Bernsen ein. »Die Rotfeder und ihre Mutter handhaben das auch immer so.« Er schaute demonstrativ desinteressiert aus dem Fenster des Dienstwagens in die Landschaft.
»Kohlschuetter, Kohlschuetter, Sie sind einer meiner besten Männer. Machen Sie keinen Quatsch.« Der Chef redete weiter, ohne sich an dem Einwand zu stören. »Wenn Sie den Kollegen in eine Anstalt bringen müssen, können Sie mir das ruhig sagen. Ich rechne es Ihnen als Dienstzeit an.«
»Mhm. Beim nächsten Mal«, entgegnete Kohlschuetter ausweichend. »Wir sind auf dem Weg ins Schwarzatal.« Man merkte ihm an, dass er darüber eigentlich nicht reden wollte, sich aber vom Chef dazu genötigt sah.
»Zur Sommerfrische? Oder was wollen Sie da?« Ein dröhnender Husten drang aus dem Lautsprecher. »Und da nehmen Sie den mit? Das könnten Sie aber auch schöner haben.« Es folgte ein lautes Grunzen.
»Ich bin gar nicht da«, sagte Bernsen, wobei er sich fragte, wieso der Jungspund dem Alten eigentlich immer alles brühwarm weitererzählen musste. Was sie beide in ihren paar freien Stunden trieben, ging den Chef überhaupt nichts an. Aber Kohlschuetter, die Schleimsau, musste sich ja bei jeder erdenklichen Gelegenheit Liebkind machen. Als ob sie das nötig hätten.
»Die Kollegen dort haben eine Vermisstenmeldung von der Deutschen Bahn vorliegen. Na ja, eher ein Hilfeersuchen, eine richtige Anzeige ist es noch nicht. Die stehen dort wohl ganz schön unter Druck. Es geht um zwei Triebfahrzeugführerinnen der Bergbahn. Eine davon könnte meine Freundin sein.«
Bernsen schnaufte und murmelte: »Schwätzer.«
Der Chef reagierte nicht sofort, er war kurz abgelenkt. Man hörte, wie er mit jemandem sprach. Dann räusperte er sich. »Frau Muschke steht gerade hier bei mir. Wenn ihr schon einmal in der Gegend seid, na ja, an der Talsperre Leibis-Lichte hat man anscheinend gerade zwei Leichen gefunden. Das muss aber ja nichts heißen, Kohlschuetter«, wiegelte er ab, bleiben Sie cool.«
Bernsen konnte nicht recht deuten, ob der sorgenvolle Tonfall echtes Mitgefühl für den Kollegen oder die Angst war, dass sie beide wieder in fremden Gefilden ermitteln könnten.
»Zwei Leichen?«, fragte Kohlschuetter betroffen nach. »Frauen?«
»Na, sauber«, knurrte Bernsen. »Das hat nun gerade noch gefehlt.« Aber irgendwann hatte es ja mal eine treffen müssen, bei dem Durchsatz, den Kohlschuetter hatte. Ich muss ihn irgendwie dazu bringen, dass wir nur gucken und dann wieder nach Hause fahren, dachte er. Die Kollegen vor Ort sollen das übernehmen. Kohlschuetter, das Weichei, packt das nicht. Oder doch? Nein, sicher nicht. Aber er könnte … Wenn sie ermittelten, wäre ein Wochenenddienst drin. Bernsen überlegte angestrengt.
»Wir wissen noch nichts Genaues«, ergänzte der Chef.
»Wo genau? Die Talsperre ist groß«, fragte Kohlschuetter.
Bernsen schaute zu ihm rüber. Der Kollege ließ sich nichts anmerken, er verzog keine Miene. Nur seine Kieferknochen verrieten, unter welcher Anspannung er stand.
»Frau Muschke schickt Ihnen alles. Ich spreche mit den Kollegen.« Der Chef brummte ungehalten. »Wenn die nur nicht immer so schwierig wären da unten in Saalfeld. Das ist aber auch … Und ihr seid quasi schon vor Ort?«
»Die Kriminaler sitzen in Rudolstadt«, wandte Kohlschuetter ein.
»Ja, ja. Das ist doch da draußen alles eine Soße«, antwortete der Chef. »Wollt ihr nicht zurückkommen? Ist vielleicht sinnvoller. Das erspart mir einige Diskussionen. Und für Sie ist es auch besser, Kohlschuetter, also, wenn das Ihre Freundin sein sollte.«
Im Hintergrund hörte man, wie Claudi auf den Chef einredete.
»Ja, ja, ja«, knurrte der Alte. »Ist ja schon gut. So habe ich es nicht gemeint. Nichts für ungut, Kohlschuetter. Ihre Freundin wird ein paar Tage verreist sein, eine kleine Luftveränderung. Wie sollte die auch von Oberweißbach an die Talsperre kommen? Das sind ja immerhin ein paar Kilometer …«
»Höchstens zehn«, hörte man die Muschke sagen.
»Ach, na ja, das muss alles nichts zu sagen haben. Und Bernsen müssen wir ja auch irgendwie beschäftigen, sonst spinnt er noch mehr.« Dem Chef fehlten die Argumente, das konnte man deutlich hören. Er seufzte. »Meine Güte, hätte ich nicht einen anständigen Beruf lernen können, bei dem ich mich mit vernünftigen Leuten umgeben kann, etwas Ruhiges, Nettes … Vielleicht was mit Kindern oder Hunden. Beeilen Sie sich. Tschüss.«
Kohlschuetter drückte das Gespräch weg.
»Das ist keine leichte Situation, noch dazu, wenn wir mal davon ausgehen, dass Ihre Freundin nicht freiwillig abgetreten ist, sondern umgebracht wurde«, sagte Bernsen. »Der Alte hat etwas von einer Talsperre verlauten lassen, Wasser also. Sicherlich ein übler Ertrinkungstod. Schön sieht Ihre Gutste dann jetzt auch nicht mehr aus. Wasserleichen sind doch so blass, und dann diese verschrumpelte Haut. Hoffentlich haben sich nicht schon Algen gebildet, bei dem Wetter möglich, oder schlimmer noch, sie könnte angefault sein.« Bernsen schüttelte sich.
Kohlschuetter schwieg und stierte auf die Straße.
»Nun gut, ich vermute mal, so lange kennen Sie sich noch nicht.« Er wiegte den Kopf hin und her. »Vier Wochen, allerhöchstens sechs? Viel mehr wäre da ohnehin nicht mehr gekommen. Bislang hat bei Ihnen ja doch keine die Vierteljahresmarke übersprungen. Sie liegen demnach gut in der Zeit. Womöglich wäre die Dame ohnehin nicht die Richtige gewesen, also, um die drei Monate voll zu machen, meine ich. Dann können Sie das Ganze hier ziemlich entspannt sehen. Sie wollen doch ermitteln, oder?« Bernsen betonte den letzten Satz nachdrücklich, damit der Kollege verstand, was er von ihm hören wollte.
Kohlschuetter antwortete nicht, sondern stieg unerwartet hart auf die Bremse. »Sie haben Psychologie mit Auszeichnung abgeschlossen, was?«
»Ich versuche lediglich, Sie etwas aufzubauen«, konterte Bernsen beleidigt.
»Anni hat damit nichts zu tun«, stellte Kohlschuetter leise fest.
»Das sage ich ja die ganze Zeit.«
»Absolut überzeugend.« Kohlschuetter nickte. »Kompliment. Und Ihr Interesse an diesem Fall hängt nicht möglicherweise damit zusammen, dass die Rotfeder und Ihre Schwiegermutter übers Wochenende hier sind und Sie einen Grund suchen, die Zeit nicht mit den beiden verbringen zu müssen?«
»Also, da will man mal nett und einfühlsam sein, und dann passt Ihnen das auch nicht. Immer werde ich verkannt«, entrüstete sich Bernsen übertrieben künstlich. »Sie wollten doch unbedingt nach Ihrer Freundin suchen. Es war nicht meine Idee. Ich habe mich jedoch freundlicherweise bereit erklärt, Ihnen behilflich zu sein, opfere sogar ein paar Überstunden dafür. Undank ist der Welten Lohn.«
»Sie hätten sie geopfert, nun ist es ja wieder Dienstzeit«, entgegnete Kohlschuetter starrsinnig. »Hat die Muschke schon was geschickt?«
Bernsen tippte auf seinem Handy herum. Laut las er vor: »›Von Deesbach kommend beim Übergang von der Vorsperre Deesbach zur Leibis-Lichte-Talsperre, aber schon auf der Seite der echten Talsperre.‹ Wie viel Wasser gibt es denn da, Mensch?« Bernsen kratzte sich am Kopf. »Claudi schreibt, wir müssen von Deesbach aus zu Fuß gehen. Autos sind dort verboten. Trinkwasserschutzgebiet.« Er verzog das Gesicht und schaute aus dem Fenster. »Was denkt die sich denn bei solchen Anweisungen? Das artet noch in Anstrengung aus, zumal es draußen mindestens dreißig Grad sind. Nichts da, wir fahren bis ran. Sie kennen doch garantiert einen Schleichweg?«
»Nein!«
»Also wirklich, ich fasse es nicht …«, moserte Bernsen.
»Was schreibt die Muschke noch?«
»Die Kollegen aus Rudolstadt sind auch auf dem Weg dorthin.« Pause. »Und sie will wissen, seit wann Sie denn eine neue Freundin haben. Und ob die schon bei Susis Verlobung am Start war. Ach, seit wann ich davon weiß, fragt sie auch noch.« Er blickte Kohlschuetter fragend an. »Was soll ich antworten?«
»Dass mein Privatleben die Muschke einen Scheißdreck angeht«, blaffte der Kollege.
»Mit diesem aggressiven Ton kommen wir nicht weiter. Das würde Claudi gar nicht gefallen. Ein bisschen mehr soziale Kompetenz hätte ich Ihnen schon zugetraut. Geben und Nehmen, mein Lieber. Schließlich wollen Sie ja auch mal wieder was von ihr. Ganz sicher sogar. Sonst müsste ich ja alles selbst machen.« Bernsen überlegte. »Ich schreibe einfach, dass Sie seit fünf Wochen zusammen sind, sich auf einer Wanderung kennengelernt haben und dass ich … wie hieß sie noch?« Er wartete, und als von Kohlschuetter keine Antwort kam, fuhr er fort: »Dass ich die Neue nicht kenne. Schließlich hatten wir in den letzten Wochen so viel Stress, dass wir zu keiner privaten Plauderei gekommen sind. Das wird sie fürs Erste zufriedenstellen.« Er grinste überheblich. »Und wenn sie erkennt, dass ich ihr nichts verschweige, klappt das auch wieder mit meinem Kuchen.« Zufrieden tippte er die Nachricht in sein Handy. »Jetzt noch ein ›Gruß, dein Friedi‹, und die Welt ist wieder in Ordnung.«
»Aha«, meinte Kohlschuetter beiläufig.
»Also wie gesagt, wenn Sie in der Sache ermitteln wollen, bitte schön«, hob Bernsen erneut an. »Aber ich kann das auch allein übernehmen. Private Verquickungen trüben den Ermittlerblick. Ich würde mir dann allerdings übers Wochenende in der Gegend ein Zimmer nehmen. Bei einem Doppelmord muss man schon vor Ort sein. Das spart ja auch jede Menge Fahrzeit.«
»Ach, Frau Püschel schläft demnach auch in Ihrer Wohnung?«, fragte Kohlschuetter spitz.
»Die Rotfeder wollte Geld sparen. Sylt hängt ihr noch nach«, murmelte Bernsen. »Sehr schön«, jubilierte er dann, auf sein Handy blickend. »Claudi hat uns bei der Talsperrenverwaltung eine Zufahrtsgenehmigung besorgt. Wir dürfen deren Wirtschaftsweg nutzen. Wer sagt es denn.« Mit seiner linken Hand klatschte er auf seinen Oberschenkel. »Sie fragt, wie es Ihnen geht.«
Bernsen schaute Kohlschuetter prüfend an, dann tippte er wieder eifrig auf seinem Handy herum.
»Ich schreibe: ›Den Umständen entsprechend gut‹. Und dass Sie sehr gefasst sind und professionell Ihrer Arbeit nachgehen. Habe ich noch etwas vergessen?« Kurzes Überlegen. »Ja, genau. Außerdem haben Sie in mir einen empathischen Kollegen, der Ihnen in jeder Lebenslage zur Seite steht. Sehr gut.«
»Sagen Sie mal, was wird das eigentlich?«, wollte Kohlschuetter nun sichtlich genervt wissen.
»Ich ermögliche uns ein harmonisches Arbeitsleben«, erwiderte Bernsen überzeugt.
»Indem Sie die Muschke anlügen?« Kohlschuetters Kopfschütteln verriet, was er darüber dachte.
»Frauen brauchen das. Solange sie das Gefühl haben, dass sie alles kontrollieren können, sind sie handzahm. Dann aktivieren die auch wieder ihre häuslichen Instinkte.« Bernsen lehnte sich zurück. »Wären Sie verheiratet, wüssten Sie das.«
»Mir geht es ganz gut ohne Kaffee, Kuchen und den Tratsch im Büro, all das, wovon Sie seit Susis Verlobung abgeschnitten sind«, sagte Kohlschuetter. »Und das nur, weil die gute Claudi glaubt, wir stecken unter einer Decke, was die Nutten angeht.«
»Sie sollten sich nicht damit belasten, in Ihrer Situation«, bemerkte Bernsen. Dann schnellte er nach vorn und fuchtelte mit dem Zeigefinger vor Kohlschuetters Nase herum. »Sie geben es also doch zu.«
»Wenn Sie in meiner Gegenwart noch einmal auf diesen Blödsinn zu sprechen kommen, setze ich Sie hier irgendwo im Wald aus und überfahre Ihr Telefon«, schrie Kohlschuetter.
Ausgedehntes Schweigen.
»Verdammt viel Wald hier.«
***
Die Strahlen der Sonne ließen die Wasseroberfläche funkeln. Das tiefblaue Gewässer lag eingebettet zwischen dunkelgrünen Waldhängen und erinnerte eher an einen Jahrtausende alten verwunschenen See, denn an eine künstlich errichtete Trinkwassertalsperre. Der Himmel zeigte sich in einem auffallend satten Blau, wie man es ansonsten eher nach einem schweren Sommergewitter sah. In der Ferne war das ausdauernde Klopfen eines Spechtes zu hören. In der Luft lag der Duft des vom Morgentau feuchten Waldbodens, erdig schwer und doch wunderbar frisch und lebendig.
Die Landschaft war so wohltuend beschaulich und idyllisch, dass sie aus einem Werbeprospekt stammen könnte. Sie wirkte wie aus der Zeit gefallen. Und doch war das Thüringer Schiefergebirge echt.
Die beiden Männer, die auf dem asphaltierten Weg, der die Talsperre umrundete, standen, waren es auch. Schon aus der Ferne konnte man die zwischen ihnen herrschende Anspannung sehen. Der Ältere, ein schlanker Mann in Kniebundhosen aus Breitcord, einem karierten Oberhemd und dunkelroten Wollsocken, führte das Wort. Immer wieder deutete er dabei auf die Talsperre. Der junge Mann, der nicht nur bezüglich seiner Kleidung eine auffällige optische Ähnlichkeit zu seinem Gegenüber aufwies, schien ihm dabei andächtig zuzuhören. Nur hin und wieder nahm er, ohne den Blick von dem älteren Mann abzuwenden, einen Schluck aus der Wasserflasche, die er in der Hand hielt.
Kohlschuetter ließ den Wagen im Schritttempo ausrollen, bremste schließlich kurz vor den beiden Männern und schaltete den Motor aus. Ihm war mulmig zumute. Was, wenn er tatsächlich Annis Leiche finden würde? War seine Sorge überhaupt berechtigt? Sie hatte sich nicht bei ihm gemeldet, aber das musste ja nichts zu bedeuten haben. Womöglich war das ihre Art, ihn abzuservieren. Am Mittwoch hatte sich diesbezüglich zwar noch nichts angedeutet, aber so was konnte erfahrungsgemäß aus heiterem Himmel über einen kommen. Deshalb musste sie nicht tot sein. Er sah Gespenster, ganz sicher. Sie hatte mit ihm Schluss gemacht, weiter nichts. So musste es sein.
Die Fundstelle war von hier nicht zu erkennen. Da das Baden und andere Arten des Wassersportes in der Talsperre verboten waren, hatte man die Übergänge zum Wasser in ihrer natürlichen Form belassen, schroff, steinig und wenig einladend. Der zuweilen dichte Bewuchs machte das Gelände unzugänglich und vom Weg aus nahezu uneinsehbar. Er war unschlüssig, was zu tun war. Dabei stellte sich diese Frage im Grunde nicht. Er war Polizist. Er würde also aussteigen, zu den Leuten da drüben gehen und die beiden Toten in Augenschein nehmen. Danach würde er die gewohnte Maschinerie in Gang setzen. Fertig. Und Anni? Er griff zum Telefon und wählte ihre Nummer.
»Halt!« Der ältere Mann sprang mit einer abwehrenden und deutlich aggressiv wirkenden Handbewegung vor das Auto. »Sie fahren keinen Meter weiter«, beschied er Kohlschuetter aufgebracht durch das Seitenfenster. »Wie sind Sie überhaupt hierhergekommen? Da sind überall Schilder. Können Sie nicht lesen?« Er wandte sich zu dem Jüngeren um und forderte ihn in gebieterischem Ton auf, die Polizei zu benachrichtigen.
Während Kohlschuetter wie gebannt auf dem Fahrersitz hocken blieb, kletterte Bernsen unwillig aus dem Auto. Betont langsam trottete er auf die beiden Wanderer zu, zog seinen Ausweis aus der Gesäßtasche und hielt ihn dem Mann unter die Nase.
»Na und? So ein Teil spuckt jeder Farbdrucker aus«, sagte der Mann bockig, nun allerdings deutlich leiser. »Das ändert nichts daran, dass hier die Trinkwasservorräte für ganz Ostthüringen lagern, also für fast vierhunderttausend Menschen. Wir befinden uns in einem Trinkwasserschutzgebiet, da darf man nicht einfach so herumfahren. Das wäre ja noch schöner.« Er stemmte die Hände in die Hüften und schaute Bernsen mit entschiedenem Blick an.
»Vater, bitte.« Sein Begleiter war herangetreten. »Die Herren sind sicherlich wegen unseres Anrufs hier.« Er schaute verstohlen hinunter zum Ufer. »Die Polizei kann doch nicht eine Stunde durch den Wald marschieren.«
»Die KTU und der Notarzt auch nicht. Kurzum, hier gibt es gleich einen gewissen Durchgangsverkehr«, ergänzte Bernsen. »Und deswegen beruhigen wir uns mal wieder.«
Kohlschuetter, der immer noch im Auto saß und alles mit anhörte, beobachtete im Rückspiegel, wie sich ein weiteres Auto näherte. Das mussten die Rudolstädter Kollegen sein. Erneut wählte er Annis Nummer. Die Mailbox ließ ihn einmal mehr wissen, dass sie nicht erreichbar war. Es blieb ihm nichts anderes übrig, er musste aussteigen und sich der Situation stellen. Nur so konnte er Gewissheit erlangen.
Nein, Anni war nicht tot, ganz sicher nicht.
Langsam kletterte er aus dem Auto.
»Das hier ist Trinkwasser«, insistierte der Mann aufs Neue. »Dass die Toten da unten liegen, ist schlimm genug. Motorenöl braucht es da nicht auch noch.«
Der Sohn ignorierte den neuerlichen Einwand. Er nickte Bernsen und Kohlschuetter zu und bedeutete ihnen, ihm zu folgen. Vorsichtig kletterten sie über das Geröll in Richtung Wasser. Am Ufer, nur wenige Zentimeter davon entfernt, lagen zwei Frauenleichen. Kohlschuetter stoppte, bemerkte dann jedoch Bernsens fragenden Blick und ging weiter.
Annis pechschwarze Haare glänzten in der Sonne. Kohlschuetters Beine schienen ihren Dienst zu versagen, und doch ging er mit festem Schritt weiter auf sie zu, als wäre das hier ein ganz normaler Job. Er glaubte ihr Parfüm in der Nase zu haben, hörte ihr Lachen. Dann stand er neben ihr. Annemarie Klansch, die Frau, in die er sich hätte verlieben können, war tot. Sie lag einfach so vor ihm auf der Erde und war tot. Er spürte, wie sich alles in ihm zusammenkrampfte, glaubte, sich nicht mehr bewegen zu können, zu keiner Handlung fähig zu sein. Und trotzdem arbeitete es in ihm. Automatisch scannte er die Fundsituation, begutachtete die Leiche, als läge zu seinen Füßen eine Fremde. Der Polizist in ihm war stärker als der Privatmensch. Er würde gewinnen und ihren Mörder finden. Daran bestand kein Zweifel.
»Kollege?« Bernsen schaute ihn fragend an.
Kohlschuetter ignorierte ihn und betrachtete stumm die Frauen. Ihre Körper lagen eng beieinander. Sie hatten keine erkennbaren Verletzungen und waren vollständig angezogen. Beide trugen Arbeitskleidung, also helle Blusen, dunkelblaue Hosen und dazu passende Westen, an deren linker Brustseite das rot-weiße Logo der Bahn prangte. Dem Aussehen nach zu urteilen, konnten sie noch nicht lange hier liegen. Leichen, die bei mehr als dreißig Grad Lufttemperatur für lange Zeit im Freien lagen, sahen anders aus. Darüber hinaus gab es keinerlei Spuren von Tierfraß, keine Fliegen und Würmer. Nein, Anni sah noch genauso schön aus wie gestern früh, als er sich von ihr verabschiedet hatte.
Er zuckte zusammen. Fast. Was war das dort an ihren Ohren? Er beugte sich tief über Anni, aber wagte es nicht, sie zu berühren oder ihren Duft einzuatmen.
»Annemarie Klansch und Sieglinde Self, beide Fahrerinnen bei der Oberweißbacher Bergbahn«, sagte Kohlschuetter, als er sich wieder aufrichtete.
Bernsen nickte übertrieben mitfühlend.
»Sehen Sie die Ohrläppchen der beiden?«, fragte Kohlschuetter, angestrengt bemüht, die eigene Stimme zu beherrschen.
Bernsen stutzte und beugte sich nun ebenfalls zu den Frauen hinunter. »Löcher wie auf einer dutzendfach verwendeten Schießscheibe«, murmelte er. »Soll das so sein?«, fragte er mit Blick auf Kohlschuetter.
»Es sieht aus wie mit einer Lochzange beigebracht.« Kohlschuetter biss sich auf die Zunge. »Aber das ergibt keinen Sinn, wieso …« Er überlegte und staunte, dass er dazu überhaupt noch in der Lage war. »Fahrkarten«, platzte er heraus. »Genau. Die Löcher scheinen von einer Fahrkartenzange zu stammen. Du liebe Güte. Das ist ja schrecklich.« Er schluckte.
»Wie kommen Sie denn darauf?«, entgegnete Bernsen ungläubig. »Kriegt man bei der Bergbahn anstelle von Fahrkarten die Ohrläppchen entwertet?« Er hob zu einem Lacher an, stockte aber unversehens und bemühte sich um ein betroffenes Gesicht.
»So einfach scheint das nicht gewesen zu sein, so gequetscht, wie die Ohrläppchen aussehen.«
»Herrjemine.« Bernsen schüttelte sich. »Was soll uns das denn sagen? Ich hasse verschlüsselte Botschaften. Also wirklich, das gehört sich nicht.«
»Es ist ein Hinweis auf die Bahn«, antwortete Kohlschuetter in Gedanken.
»Darauf, dass die Frauen vorschriftsmäßig ihre Fahrkarte in den Tod gelöst haben, oder was?«, moserte Bernsen. »Hier ist doch weit und breit kein Bahnhof, ein Gleis habe ich auch nicht gesehen.« Er schaute angestrengt auf die beiden Leichname und stutzte. »Wieso sind die Sachen der älteren Frau eigentlich komplett durchnässt? Auch die Haare, schauen Sie sich nur einmal die Frisur an.«
Jetzt fiel es Kohlschuetter auch auf. Er hatte für Sieglinde, Annis Kollegin und mütterliche Freundin, noch kein Auge gehabt, aber ja, natürlich, sie musste im Wasser gelegen haben.
Der jüngere der beiden Wanderer atmete tief durch und bedachte seinen Vater mit einem vorwurfsvollen Blick.
»Wieso? Wieso?«, fragte der Ältere aufgebracht. »Ich habe sie bloß aus dem Wasser gezogen.«
Kohlschuetter bückte sich und betrachtete die Haut der Frau. Sie zeigte die deutlichen Symptome eines längeren Aufenthaltes im Wasser. »Es sah nicht danach aus, als würde sie noch leben und gerettet werden müssen?«
Der Mann schaute verdutzt. »Wie? Nein. Sie war längst mausetot. Das war schon von Weitem zu erkennen. Sie hing halb schräg mit ihrem Becken da vorn auf dem großen Stein, hier in dem Flachwasserbereich, sehen Sie.« Er zeigte mit dem Finger auf die Stelle.
»Mein Vater wollte nur helfen«, warf der jüngere Mann beschwichtigend ein.
»Aha«, ereiferte sich Bernsen schroff. »Helfen. Indem er an einem möglichen Tatort herummanipuliert.«
»Tatort? Das sind zwei Selbstmörderinnen, dachte ich.« Der ältere Mann beugte sich leicht nach vorn, als würde das seinen Worten mehr Nachdruck verleihen. »Das hier ist eine Trinkwassertalsperre, jegliche Verunreinigung kann eine absolute Katastrophe auslösen. Ich werde doch nicht am Ufer stehen bleiben und warten, bis der Leichnam das Wasser in meiner Talsperre verseucht. Sie wissen selbst sehr genau, was ein toter Körper so alles ausscheidet.« Über seiner Nase stand eine Zornesfalte. »Sie hätte sich ja auch von dem Stein lösen, raustreiben und untergehen können. Den Aufwand, sie suchen und bergen zu müssen, wollte ich uns allen ersparen«, rechtfertigte er sich.
»Ihre Talsperre?«, fragte Bernsen mit hochgezogener Braue.
Der Mann streckte das Kinn nach vorn und wackelte voller Stolz mit dem Kopf. »Ich war der zuständige Planungsingenieur. Leibis-Lichte ist die zweitgrößte Talsperre in Deutschland. Die Staumauer hat eine Höhe von hundertzwei Metern. Wenn diese Pfeifen in der Politik damals nicht gekniffen hätten, wäre sie noch anderthalb Meter höher. Aber nein, wir mussten unter den Maßen der Rappbode-Talsperre bleiben. Dafür sind wir der letzte Talsperrenbau in Deutschland.« Die Toten schienen vergessen.
»Das weißt du doch gar nicht, Vater«, widersprach sein Sohn.