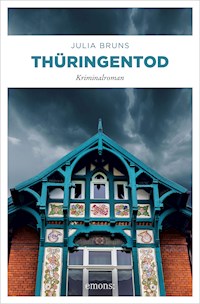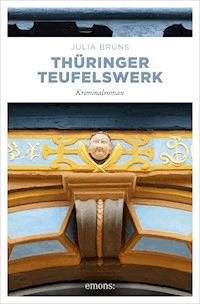Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kommissar Bernsen und Kohlschuetter
- Sprache: Deutsch
Im thüringischen Weißensee wird eine Leiche gefunden - drei Tage vor dem traditionellen Bierfest zur Erinnerung an das erste deutsche Reinheitsgebot von 1434. Dass der Tote ein Bayer ist, mit dessen Landsleuten die Weißenseer seit Jahren um die ältesten Bierrechte streiten, macht die Sache noch brisanter. Als dann auch noch das Reinheitsgebot verschwindet, ruft der Bier- und Heimatverein den "Bierkrieg" aus - und Hauptkommissar Bernsen und sein junger Kollege Kohlschuetter geraten zwischen die bayerisch-thüringischen Bierfronten aus Tradition, Stolz und lange gehüteten Geheimnissen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Julia Bruns wurde 1975 in einem kleinen Dorf mitten in Thüringen geboren. Die promovierte Politikwissenschaftlerin arbeitete viele Jahre als Redenschreiberin und in der Öffentlichkeitsarbeit. Heute schreibt sie als freie Autorin. Wenn sie sich nicht gerade allerlei Geschichten ausdenkt, streift sie mit dem Familienhund durch die Wälder oder kocht Marmelade.www.juliabruns.comwww.thueringen-kommissare.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Holger Leue/LOOK-foto Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-772-7 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Christian
Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott den Menschen liebt und ihn glücklich sehen will.
Benjamin Franklin
PROLOG
Frieda Schmidtke zog die Tür ihres kleinen Hauses in der Johannesstraße mit einem dumpfen Knall hinter sich ins Schloss, und der eisige Ostwind fuhr unbarmherzig in den Kragen ihres Pelzmantels. Mit steifen Fingern, die jedoch mehr ihrem fast achtzigsten Lebensjahr als den sibirischen Temperaturen geschuldet waren, nestelte sie an ihrem Schal, bis er ordentlich saß und die Kälte abwehrte. Dann tastete sie mit den Händen von außen über beide Manteltaschen, um sich zu vergewissern, dass sie auch alles Notwendige bei sich trug. Wenn sie sich schon auf den weiten Weg zur Fischerstraße machen würde, wollte sie am Ende nicht feststellen müssen, dass sie ihn umsonst gegangen war. In ihrem Alter konnte man immer weniger auf die Kraft der eigenen Beine vertrauen. Noch dazu bei diesem Wetter.
In der Nacht hatte es in Oberhof zwanzig Zentimeter Neuschnee gegeben. Und auch für Mittelthüringen erwarteten die Meteorologen im Laufe des Tages Niederschlag. Auf den Wetterbericht des MDR Thüringen war Verlass. Drei Mal hatte sie heute Morgen schon die Vorhersagen im Radio gehört, um sieben, um acht und um neun Uhr. Dazu hatte sie mehrfach entschlossen genickt. Heute war ein guter Tag.
Der Brief stand seit einer Woche auf ihrer Küchenkommode. Sie konnte ihn von ihrem Platz am Fenster aus gut sehen. Wie magnetisch wurde ihr Blick immer wieder davon angezogen, als befürchtete sie, er könnte spurlos verschwinden. Um kurz nach neun hatte sie den letzten Schluck des längst kalt gewordenen Schonkaffees aus ihrer gold geränderten Sammeltasse getrunken und beschlossen, die Sache heute endlich zu Ende zu bringen. Morgen schon könnte es wieder schneien. Und übermorgen könnte sie tot sein. In ihrem Alter musste man täglich damit rechnen, vom lieben Herrgott abberufen zu werden.
Nein, heute war der richtige Tag. Sie hatte schon viel zu lange gewartet.
Mit kleinen, wackeligen Schritten marschierte sie in Richtung Marktplatz. Schneegriesel wehte über das holprige Kopfsteinpflaster, sammelte sich in den unterschiedlich dicken Fugen und verdeckte damit die gefährlichsten Kanten, die einer alten Dame begegnen konnten. Doch Frieda Schmidtke dachte keine Sekunde daran, dass sie stürzen könnte. Sie fixierte den bronzenen Rücken des Walther-von-der-Vogelweide-Denkmals am Ende des Marktplatzes. Wenn ich dort angekommen bin, schaffe ich auch den Rest, dachte sie und atmete tief durch. An der Marktstraße gab es wenigstens einen ordentlichen Fußweg, und zur Not konnte sie sich an den Häuserwänden festhalten.
Hoffentlich hatte die junge Frau mit den grellroten Fingernägeln – dass sie neuerdings welche hatte, davon hatte ihr die Nachbarin erzählt– nicht gerade heute einen Friseurtermin oder war nur mal schnell nebenan Brötchen holen, wie es gern hieß, wenn die Ladentür mal wieder geschlossen war. Den jungen Dingern heutzutage fehlte es einfach an der notwendigen Disziplin. Was war das nur für eine Welt, in der man nicht einmal mehr auf die Öffnungszeiten einer Postfiliale vertrauen konnte? Aber wenigstens gab es in Weißensee noch eine. Die Bilzingslebener hatten es da schon schlechter getroffen, zumindest hörte man das immer.
Wie lange war sie eigentlich schon nicht mehr dort gewesen? Es musste Jahre her sein. Was sollte sie da aber auch? Zu Hause hatte sie doch alles, was sie brauchte, und in ihrem Alter war man eben nicht mehr so agil. Für ihre Generation gehörte es schon zu den aufregenden Abwechslungen des Lebens, wenn man in das Sömmerdaer Kreiskrankenhaus eingeliefert wurde.
Ein beklemmendes Kratzen in ihrem Hals, hervorgerufen von der eisigen Luft, ließ Frieda Schmidtke innehalten. Sie blieb stehen, hüstelte zweimal in den Handschuh ihrer linken Hand, streifte dabei wie zufällig ihre Manteltasche mit dem Kuvert darin und schaute sich fast schon ängstlich um. Die kalte Luft brannte in ihren Lungen wie ein doppelter Nordhäuser in der Speiseröhre. Sie kämpfte gegen ihre Kurzatmigkeit und verfluchte den Tag, an dem sie beschlossen hatte, der Wahrheit Genüge zu tun.
Nur langsam gewöhnten sich ihre Lungenflügel an die ungewohnt hohe Dosis Sauerstoff. Minuten vergingen, in denen sie, auf den kondensierten Nebelhauch ihrer Atmung konzentriert, allein auf dem Weißenseer Marktplatz stand und hoffte, dass dieser auch weiterhin so menschenleer bleiben würde. Dabei war ihre Anwesenheit hier nicht auffälliger als die eines jeden anderen, der sich am Morgen ein paar frische Brötchen holte oder als Tourist den Marktplatz besuchte, wobei die Touristen zu dieser Jahreszeit freilich nur selten in der alten Landgrafenstadt zu sehen waren.
Sie sehen, was ich vorhabe, dachte sie ängstlich. Alle können es sehen!
Und wenn sie angesprochen wurde? Was sollte sie dann sagen? Dass sie nach vierundzwanzig Jahren ihr Gewissen erleichtern musste und nur deshalb so lange geschwiegen hatte, weil sie ihr Leben lang zu feige gewesen war? Weil ihr doch ohnehin niemand geglaubt hätte? Dass sie das, was sie an jenem Abend gehört hatte, selbst nicht glauben konnte oder wollte? Sie hatte es verdrängt, obwohl seither kein Tag vergangen war, an dem seine Worte nicht in ihren Ohren widergeklungen hatten, als wäre es gestern gewesen.
Wie sie diesen Abend verfluchte, den Alkohol, der seine Zunge gelockert und ihr sein düsterstes Geheimnis offenbart hatte! Ausgerechnet ihr. Fast schon hastig lief sie weiter. Dabei entfuhr ihr ein ungewollt lautes: »Das ist doch Blödsinn!«
Als wäre sie beim Äpfelstehlen erwischt worden, zuckte sie für einen Moment zusammen, erschrocken über ihren eigenen Ausbruch. Spätestens nach diesem Selbstgespräch würde man sie endgültig für eine senile alte Schachtel halten. Aber das störte sie nicht. Sollten ruhig alle denken, Frieda Schmidtke sei gaga.
Manchmal hat die Gebrechlichkeit des Alters durchaus etwas für sich, dachte sie und lächelte verschmitzt in sich hinein.
Der Hintern von Walther von der Vogelweide schien bereits zum Greifen nah, als ein weißer Lieferwagen neben ihr auftauchte und stoppte. Das Fenster der Fahrertür wurde herabgelassen, und ein junger, kahlköpfiger Mann um die dreißig grüßte freundlich. »Asiatischer Großhandel« stand mit dicken roten Buchstaben quer über das Fahrzeug geschrieben. Noch bevor der Mann nach dem Weg fragen konnte, was er zweifellos vorhatte, zeigte Frieda Schmidtke auf den Eingang zum Chinesischen Garten in ihrem Rücken. Auch wenn ihr Körper die gesamte Bürde ihrer neunundsiebzig Lebensjahre trug, hatte die Natur vor ihrem Kopf haltgemacht. Ihr Geist war so klar wie eh und je.
Der junge Mann lächelte erleichtert und legte fast schon schneidig die linke Hand zum militärischen Gruß an seine Schläfe. Die Belehrung, zu ihrer Zeit habe man dafür noch die rechte Hand genommen, lag ihr auf der Zunge. Doch sie schwieg. Stattdessen nickte sie kurz und heftete ihren Blick noch für ein paar Sekunden an den seltsamen Ohrring ihres Gegenübers. Riesenpflöcke wie diesen hatte sie so bisher nur bei afrikanischen Stammeshäuptlingen in ihrer Lieblingsreportage »Kronzucker unterwegs« gesehen.
Der Motor des Lieferwagens heulte auf, und der ungewöhnliche Ohrschmuck verschwand aus ihrem Blickfeld. Wieder ruhig und gleichmäßig atmend, ging sie weiter. Die Lieferung für die »Tee& Kaffee-Terrasse« im Chinesischen Garten hatte ihr ein paar zusätzliche Minuten Verschnaufpause verschafft.
Ein chinesischer Garten, und ausgerechnet in der alten Residenzstadt der Landgrafen von Thüringen. Früher gab es so etwas nicht, dachte sie und bog endlich in die Marktstraße ein. Da sind wir über die Dörfer zum Tanz oder zum Paddeln auf den Gondelteich. Und die Nächte verbrachten wir im Burgkeller.
Frieda Schmidtke seufzte leise in ihren von der Atemluft feuchten Schal. Ihr lieber Herr Schmidtke, Gott hab ihn selig, hatte im Burgkeller öfter mal einen über den Durst getrunken, und meistens musste sie ihm auch noch sein Bier bringen. Fast vierzig Jahre lang hatte sie nicht nur ihren Mann, sondern die ganze Stadt bedient. Apoldaer Bier, Bockwurst mit Brötchen, Fassbrause, Hackepeter, Soljanka, Club-Cola, Würzfleisch, Goldbroiler, Strammer Max und im Sommer Softeis aus der Softeismaschine. Dann war die Mauer gefallen, und alle hatten nach den Segnungen des Westens in Form von Warsteiner und echtem Cordon bleu gegiert. Wenn die Gäste überhaupt noch kamen, denn den Westen gab es nicht zum Preis für den Osten.
Niemals würde sie das Gesicht von Heinz, dem Wirt, vergessen, als er die Zapfanlage in Betrieb nahm und das letzte Apoldaer in ein Glas laufen ließ. Mit Warsteiner und echtem Cordon bleu in den Frühruhestand, ohne Aufgabe und ohne den geliebten Klatsch und Tratsch einer rauchigen Bierkneipe. Jetzt seufzte Frieda Schmidtke noch tiefer. Die Wehmut legte sich wie ein Pfund Blei auf ihr Herz. Und ohne dass sie es verhindern konnte, lief die Vergangenheit wie ein alter, knittriger Schwarz-Weiß-Film vor ihrem inneren Auge ab. Vor allem jener Abend vor vierundzwanzig Jahren, den sie so oft und mit aller Kraft aus ihrem Kopf zu streichen versucht hatte und der sie an diesem Morgen zu körperlichen Höchstleistungen antrieb.
In der Postfiliale brannte Licht, und auch die Tür, gegen die sich Frieda Schmidtke mit ihrer ganzen Zierlichkeit stemmte, gab ohne Weiteres nach. Eine junge Frau mit blondierten Haaren und einem Kurzhaarschnitt, der gerade modern zu sein schien, schaute sie erwartungsvoll an. Frieda Schmidtke schnaufte. Die Luft in dem kleinen Lädchen, das ein buntes Sammelsurium der Dinge des täglichen Bedarfs anbot, war schwer vom würzig aromatischen Duft einer echten Thüringer Leberwurst. Der stammte augenscheinlich vom angebissenen Brötchen neben der Kasse. Die Verkäuferin, die Frieda Schmidtkes missbilligenden Blick bemerkt hatte, zuckte nur kurz mit den Schultern, wobei sie das Wort »Frühstück« murmelte, um dann mit geschäftiger Miene zur Tagesordnung überzugehen.
»Wie kann ich Ihnen helfen?« Sie lächelte freundlich über den Ladentisch.
Frieda Schmidtke befreite ihre Hände von den Handschuhen, schob ihre linke Hand in die Manteltasche und griff entschlossen nach dem Brief. Dabei fixierte sie die junge Frau, die mit einem fast schon herzlichen Lächeln gänzlich entspannt abwartete, was für eine Aufgabe wohl auf sie zukommen würde. Gerade als Frieda Schmidtkes Mut am größten war, öffnete jemand die Ladentür und grüßte mit einem kräftigen, sonoren »Guten Morgen«.
Die Stimme erkannte sie unter Tausenden.
Wie vom Blitz getroffen drehte Frieda Schmidtke sich um und starrte den Eintretenden mit weit aufgerissenen Augen an.
»Frieda, du schaust ja, als hättest du einen Geist gesehen.«
Das konnte kein Zufall sein. Der Teufel höchstpersönlich war ihr auf den Fersen! Was sollte sie jetzt bloß machen?
Geistesgegenwärtig stopfte sie ihre Handschuhe in die Manteltasche, als hätte sie das von Anfang an vorgehabt.
»Ich höre etwas spät«, log Frieda Schmidtke. »Du kannst vorgehen. Ich habe vergessen, was ich brauche, und muss noch einen Moment überlegen.« Auch das war eine Lüge, aber nur so würde sie den Brief unbemerkt abgeben können, ohne morgen noch einmal wiederkommen zu müssen.
Ihr kleiner Trick funktionierte. Zwei Minuten später stand sie wieder allein vor der Ladentheke.
»Der muss heute noch raus«, wies Frieda Schmidtke die junge Frau viel zu barsch an und schleuderte den frankierten Brief über den Tisch.
»Aber den hätten Sie doch einfach in irgendeinen der Postbriefkästen werfen können.«
»Nein, hätte ich nicht. Briefe gibt man persönlich auf.« Frieda Schmidtke zog ihre Handschuhe wieder an, machte kehrt und marschierte, so schnell es ihre Beine erlaubten, in Richtung Ausgang.
»Der geht heute Vormittag noch raus. In zwei Stunden wird er abgeholt«, rief ihr die Blondierte nach. Doch Frieda Schmidtke stand schon wieder auf der Straße.
Drinnen schaute sich die junge Frau den Brief einmal kurz von beiden Seiten an, um ihn kurz darauf lustlos in die Postbox zu befördern.
EINS
»Ach, Schatz, was für ein herrlicher Morgen. Der Mai ist doch immer noch der schönste Monat.« Frank Adler ließ die Thüringer Allgemeine, die er jeden Morgen während des Frühstückes intensiv studierte, für einen kurzen Moment sinken und lächelte seine Frau Sabine glücklich an. Er war kein unhöflicher Mensch, und daher war ihm durchaus bewusst, dass sein Frühstücksritual seiner Gattin im Gegenzug seit fast fünfundzwanzig Jahren den Anblick des Mantelteils der Regionalzeitung bescherte. Doch als stolzer Bürgermeister der Stadt Weißensee sah er es als seine Pflicht an, allzeit über das politische Geschehen im Land informiert zu sein. Ein Amt wie das seine verlangte nun mal einen gewissen Tribut.
Und den zollte vor allem Sabine Adler. Denn für Frank Adler spielte es keine Rolle, ob er eine Millionenmetropole oder nur eine Dreitausend-Seelen-Gemeinde regierte, wie er sich ausdrückte, seine Leidenschaft und das Engagement für seinen Beruf kannten fast keine Grenzen. Adler kämpfte für sein Weißensee, wenn es sein musste, an den Wochenenden, im Urlaub, zu Familiengeburtstagen, ja sogar am Heiligen Abend. Erst die Politik, dann die Familie, sagte er immer. Und Sabine hielt ihm verständnisvoll den Rücken frei.
»Ein traumhaftes Wetter für unser Bierfest.« Frank Adler klappte die Thüringer Allgemeine zusammen und schob sie seiner Frau über den Tisch. »Im strahlenden Sonnenschein präsentiert sich Weißensee von seiner schönsten Seite. Da können die Leute von der UNESCO-Kommission gar nicht anders, als uns den Titel zu verleihen. Und die Bayern werden aus dem Staunen nicht herauskommen.« Seine Augen funkelten schelmisch. Dann griff er zu seinem Kaffeepott, dessen Vorderseite ein kleiner schwarzer Adlerkopf zierte, und trank ihn in einem Zug leer.
»Ich dachte, die kommen wegen des Reinheitsgebotes.« Sie lächelte, jedoch nicht ohne einen gewissen Anflug von Ironie um ihre Mundwinkel.
»Wir haben das ältere, da gibt es keinen Zweifel«, erwiderte Frank Adler umgehend. Seine Euphorie war nicht zu bremsen, und so bemerkte er die kleine Spitze seiner Frau nicht einmal. Seit Monaten ließ ihm der Gedanke an den bislang sensationellsten historischen Fund in seiner Heimatstadt – das erste und damit älteste städtische Reinheitsgebot in Deutschland– keine ruhige Minute mehr. Mit dem Weltkulturerbestatus der UNESCO-Kommission wollte er alle Zweifler endlich eines Besseren belehren. Und tatsächlich sah alles danach aus, dass sein Plan aufging.
Sabine Adler wollte gerade etwas entgegnen, da ertönte eine immer lauter werdende Polizeisirene im Duett mit einem Martinshorn, die beide ziemlich genau unter dem Küchenfenster des Bürgermeisterehepaares verstummten.
»Was ist da denn los?« Frank Adler sah aus dem Fenster und entdeckte an der Stelle, an der sich seine Augen sonst an dem von zwei Löwen flankierten Eingang seines zweiten Lieblingsprojektes, dem städtischen »Garten des Ewigen Glücks«, erfreuen konnten, den Dienstwagen der Polizei neben einem Krankenwagen. »Das gibt es doch nicht. Was wollen die denn?«
Im nächsten Moment war er zur Tür hinaus.
»Sabotage, Terroristen, Gasexplosion…«, hörte seine Frau ihn mit bebender Stimme schreien, während er auch schon die Stufen im Treppenhaus hinunterpolterte. Wenige Sekunden später sah Sabine Adler, wie er mit seinen karierten Birkenstocksandalen in den Chinesischen Garten stürzte.
»Wir haben doch überhaupt keinen Gasanschluss im China-Garten«, flüsterte sie.
***
»Tot, leider.« Der Notarzt schaute die Polizeibeamten bedauernd an und richtete den Blick dann wieder auf den Mann, zu dessen Rettung er vor zehn Minuten gerufen worden war. »Den Totenflecken nach zu urteilen, bereits seit mindestens acht Stunden«, fügte er hinzu und erhob sich schwerfällig aus seiner knienden Position. »Zur Todesursache kann ich leider nichts sagen. Äußere Wunden sind nicht erkennbar. Ich würde ›unklar‹ vermerken.«
»Wie, tot, seit Stunden, unklar? Wir haben doch noch nicht einmal geöffnet«, empörte sich Frank Adler. Der ungewohnte Sprint quer durch den Chinesischen Garten und das Entsetzen über den schrecklichen Fund machten ihn kurzatmig.
Eine kleine, zierliche Polizistin zog ihn ein Stück zur Seite. »Herr Bürgermeister, ich möchte Sie bitten, wieder nach Hause zu gehen«, sagte sie leise und mit ruhiger Stimme. Dabei richtete sie den Blick auf die karierten Birkenstocks an seinen Füßen. »Wir müssen hier unsere Arbeit machen.« An ihren Kollegen gewandt, sagte sie etwas lauter: »Bitte ruf unsere Männer in Erfurt an. Sicher ist sicher.«
»Kripo?« Frank Adler schnaufte wie nach einem Hundert-Meter-Lauf, besann sich dann aber darauf, eine gewisse, seinem Amt angemessene Würde an den Tag zu legen. »Sie machen Ihre Arbeit. Ich mache meine. Immerhin stehen wir hier im Chinesischen Garten der Stadt Weißensee, in dem ich, wie es das Gesetz besagt, als Bürgermeister das Hausrecht innehabe.«
Die Polizistin nahm dies ohne Gegenwehr zur Kenntnis. Sie bat Adler, etwas Abstand zu halten, damit die Kollegen ihre Arbeit tun konnten, und veranlasste alles Weitere. Knurrend folgte er ihrer Bitte und ging zurück zum Haupteingang, um dort unruhig vor dem Kassenautomaten auf und ab zu laufen.
Wenig später verließ der Notarzt das Gelände, nickte ihm kurz zu und stieg in sein Auto. Frank Adler sah dem abfahrenden Wagen hinterher, als ihm jemand auf die linke Schulter tippte, während gleichzeitig ein Paar braune Mokassins direkt vor seiner Nase auftauchten.
»Ich denke, die sehen unter diesen Umständen besser aus«, hörte er Sabine leise und in verschwörerischem Tonfall sagen.
Kurz darauf war seine Frau mit den bunten Birkenstocks auch schon wieder hinter der Orchideenzucht ihres Küchenfensters verschwunden.
»Wenn ich dich nicht hätte«, murmelte Adler.
Zeit zu überlegen, was er ohne seine Sabine tun würde, blieb ihm jedoch nicht, denn ein Großeinsatz dieser Art blieb in einer so kleinen Stadt wie Weißensee nicht lange unbemerkt. Daher musste er zunächst einmal all seine Autorität als politisches Oberhaupt geltend machen und die neugierigen Blicke einiger schaulustiger Weißenseer, die in den Garten drängen wollten, abwehren.
***
Der Opel mit Erfurter Kennzeichen fuhr langsam, im Schritttempo, den Marktplatz hinauf. Am Steuer saß der frischgebackene Hauptkommissar Timo Kohlschuetter in froher Erwartung auf seinen ersten eigenen Fall. Wenn es der Anstand nicht verboten hätte, er hätte vor lauter Vorfreude die Hits, die Antenne Thüringen über das Radio des Dienstwagens sendete, laut mitgeschmettert oder zumindest mitgepfiffen. Doch der Respekt vor den Toten und das hohe Maß an Pietät, das er gern in jeden weniger empathischen Kollegen transplantiert hätte, erlaubten ein solches Verhalten nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass sein neuer Kollege, der ältere Hauptkommissar Friedhelm Bernsen, sicherlich kaum Verständnis für derartigen Frohsinn gezeigt hätte, da er nicht einmal den Anschein von Temperament erweckte.
Seit sie in der Landeshauptstadt losgefahren waren, schaute der kleine, schmächtige Mann mit dem dicken weißblonden Haarschopf und den seltsamen Klamotten schweigend aus dem Beifahrerfenster. Nur ab und zu schüttelte er ungläubig den Kopf, um kurz darauf ein paar unverständliche Grunzlaute von sich zu geben. Jeglicher Versuch, ein Gespräch anzufangen, den Kohlschuetter in der letzten knappen Stunde unternommen hatte, war an dem neuen Kollegen abgeprallt. Jetzt, so kurz vor dem Ziel, wollte er es noch ein letztes Mal versuchen.
»Über die A71 ist man heutzutage richtig schnell hier, kein Vergleich zu früher.«
Pause.
»Ach, gab es die früher nicht?«, kam es mit einem unüberhörbaren norddeutschen Akzent vom Nebensitz, in einem Ton, der nicht das geringste Interesse an einer Antwort erkennen ließ.
Friedhelm Bernsen war nicht nach Reden zumute. Er hatte die erste Woche mit seinem Teamkollegen fast überstanden. Ohne besondere Vorkommnisse, wenn man von dem permanenten Gequatsche dieses Jungspundes absah. Und heute, ausgerechnet am Freitag, hatte irgendeiner dieser Hinterwäldler hier am Ende jeglicher Zivilisation eine Leiche gefunden. Konnte das nicht bis nach Pfingsten warten? Mann, wie er seinen ruhigen Innendienst vermisste– und das schon nach fünf Tagen.
Kohlschuetter gab auf. Immerhin konnte der neue Kollege sprechen. Es ist sicher was Gutes, wenn man ein Ermittlerteam bildet und wenigstens schon einmal die Stimme seines Teampartners vernommen hat, dachte er und lenkte den Wagen in die Einfahrt zum Chinesischen Garten, in der ein groß gewachsener, schlanker Mann wild gestikulierend auf einen Streifenpolizisten und ein paar Schaulustige einredete. Als sie ausstiegen, ließ der Mann von den Leuten ab und kam auf sie zugerannt.
»Guten Morgen. Adler, ich bin der Bürgermeister hier, und in meiner Stadt gibt es keine unnatürlichen Todesfälle«, polterte er schon von Weitem.
Drei Tage vor dem Bierfest eine Leiche im Chinesischen Garten liegen zu haben, hatte auf der Wunschliste des Bürgermeisters vermutlich nicht gerade ganz oben gestanden. Kohlschuetter war das große Werbeschild am Ortseingang nicht entgangen.
»Ach nee.« Bernsen verdrehte die Augen. »Das entscheiden immer noch wir.« Wenn er eines nicht leiden konnte, dann waren es aufgedrehte, wichtigtuerische Ossis, die ihm seine Arbeit erklären wollten. Seit fast vierzig Jahren war er nun schon bei der Polizei, vierundzwanzig davon bei der Kripo in Erfurt. Ja, nach der Wende, die Aufbauarbeit, das war was gewesen. Er hatte förmlich gespürt, wie die Menschen ihn brauchten und wie dankbar sie für die Hilfe waren; die hatten doch keine Ahnung gehabt, die armen Schweine hinter ihrer Mauer. Aber je mehr Jahre vergingen, umso aufmüpfiger waren sie geworden. Alles wollten sie selbst machen. Und jetzt, fünf Jahre vor der Pensionierung, schickte ihn der Schnösel von Landespolizeidirektionsleiter, ein typischer Aufsteiger-Ossi, zur Aufklärung in die Provinz. Lebe wohl, du schöne ruhige Zeit im Innendienst. Bernsen bemerkte nicht, dass die Gedanken auf seinem Gesicht einen mehr als unwirschen Ausdruck hinterließen.
Frank Adler schaute ihn nur verständnislos an, erstaunt über Bernsens Schroffheit. Kohlschuetter war das Benehmen seines Kollegen ein bisschen peinlich, doch er ließ sich nichts anmerken.
»Nun gut, mein Name ist Timo Kohlschuetter, und das ist mein Kollege Friedhelm Bernsen«, stellte er sie vor. »Kripo Erfurt. Bitte warten Sie hier.« Er wandte sich ab, ging auf den Streifenpolizisten zu, der etwas abseits stehen geblieben war, und begrüßte ihn freundlich.
Bernsen, der ihm folgte, begnügte sich mit einem Brummen und einem kurzen »Wo liegt die Leiche?«.
Der Streifenpolizist öffnete eine eher unscheinbare Nebeneingangstür direkt neben einem Drehkreuz, das nur nach bezahltem Eintritt betätigt werden konnte, und führte sie in den Garten.
»Wahnsinn«, entfuhr es Kohlschuetter, als sich die ganze chinesische Pracht vor ihnen auftat.
Bernsen zog den Mund breit, sagte aber kein Wort. Sein Blick schweifte über das Gelände. Die verschlungenen Wege, das plätschernde Wasser des riesigen Teiches mit seinen gelb leuchtenden Fischen, die roten Pavillons und natürlich die dicken Bambushecken, noch nie hatte er so etwas gesehen. Und das hier, in der Provinz. Die verbraten die Millionen, die bei uns im Westen fehlen, dachte er. Damit war seine Laune auf dem Tiefpunkt angekommen.
»Mehr als fünftausend Quadratmeter, in nur vier Monaten von richtigen Chinesen gebaut und, wie der chinesische Botschafter bei der Eröffnung sagte, der einzig stilechte chinesische Garten in Deutschland«, informierte sie der Streifenbeamte stolz.
Die Kommissare entgegneten nichts und folgten dem Kollegen, der sie auf einem geschlängelten Kiesweg an der Tee& Kaffee-Terrasse vorbei zu einem kleinen, offenen Pavillon führte, vor dem eine junge Polizistin auf sie wartete.
»Das ist der Pavillon der Freude. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick über den gesamten Garten«, erklärte der Beamte.
»Sind Sie Reiseführer oder Polizist?«, polterte Bernsen.
»Hier liegt der Mann«, antwortete der Beamte sichtlich beleidigt und zeigte in das Innere des Pavillons.
Kohlschuetter nickte der Polizistin zu, zog ein paar Latexhandschuhe aus seiner Jeans, streifte sie sorgsam über und betrat den Pavillon.
»Also, beim genaueren Hinsehen… ein Weißenseer ist das nicht.« Bürgermeister Adler, der den Polizisten in einigem Abstand gefolgt war, lehnte sich über das dunkelrot lackierte Holzgeländer und begutachtete die Leiche.
»Quarkbüdel«, presste Bernsen leise, aber für alle Anwesenden dennoch deutlich hörbar zwischen seinen Lippen hervor. Um nach einem dumpfen Grunzen ein versöhnlicher klingendes »Dann sein Sie man froh« nachzuschieben.
Bürgermeister Adler, der durch seine Arbeit allerlei Unflätiges gewöhnt war, zuckte nur mit den Schultern. Selbst wenn der seltsame Kommissar ihn gemeint haben sollte, konnte er sich darüber beim besten Willen nicht aufregen. Im größten und schönsten chinesischen Garten Deutschlands, in seinem Garten, lag drei Tage vor dem für die Stadt wichtigsten Ereignis des Jahres ein toter Mann. Eine Beleidigung war da sein kleinstes Problem. Wenn er Pech hatte, würde ihm die Kripo – zumindest dem Fischkopp ohne Kinderstube war dies durchaus zuzutrauen– den China-Garten für die Dauer der Ermittlungen dichtmachen. Das Bierfest konnte er dann vergessen. Und wie um alles in der Welt sollte er das den Vertretern der UNESCO-Kommission erklären? Schließlich vergaben die ihre Termine nicht einfach mal so zwischen zwölf und mittags. Die Bayern würden ihm den Titel des ältesten Reinheitsgebotes vor der Nase wegschnappen. Das durfte er nicht zulassen.
»Kann ich Ihnen einen grünen Tee oder vielleicht einen Aloedrink anbieten? Auf den Schreck brauchen Sie doch bestimmt eine Stärkung«, fragte er höflich.
»Welcher Schreck? Wir machen das doch nicht zum ersten Mal«, platzte es aus Bernsen heraus.
Bevor der Kollege sich noch mehr von seiner besten Seite zeigen konnte, ergriff Kohlschuetter das Wort und nahm das Angebot des Bürgermeisters dankend an. Der lächelte und eilte davon.
»Kollege, Sie haben eine interessante Art, mit den Menschen umzugehen«, sagte Kohlschuetter, während er die Leiche näher untersuchte.
»Nicht mein Problem«, antwortete Bernsen knapp. Dann wandte er sich den beiden Streifenpolizisten zu, die etwas unsicher neben dem Pavillon standen. »Hat hier schon jemand die Spurensicherung gerufen?«
Die junge Kollegin verneinte das schüchtern.
Mürrisch griff er nach seinem Handy, um die Erfurter Nummer zu wählen. Schließlich wollte er nicht den ganzen Tag in diesem Nest verdaddeln.
***
Susanne Summer, Abteilung4, Kriminaltechnik, hätte sich sicherlich etwas Schöneres vorstellen können, als mit Hauptkommissar Friedhelm Bernsen zu telefonieren. Der Bericht über die Arbeit ihres Teams hinsichtlich der Einbruchsserie auf dem Erfurter EGA-Gelände flimmerte fertig geschrieben auf ihrem Bildschirm. Sie hatte sich gerade einen Kaffee eingeschenkt und die Jalousie heruntergelassen, um ihren Weihnachtsstern vor den warmen Strahlen der Maisonne zu schützen, als das Telefon klingelte.
Seit Dezember stand der rote Topf mit den aufgemalten Schneeflocken nun schon auf der Fensterbank, und die Euphorbia pulcherrima darin wurde von Tag zu Tag prächtiger. Zugegeben, sie griff regelmäßig zu unlauteren Methoden in Form ihres Jenapharm-Pillenblisters, aber die Slupetzki aus Abteilung1 half bei ihrem Exemplar noch viel unlauterer nach, indem sie die Pflanze in regelmäßigen Abständen durch eine größere und schönere ersetzte. Ein Blick von Susanne Summer auf die Blumenerde genügte, um das zu erkennen, schließlich war sie nicht umsonst bei der Spurensicherung.
Seit zwei Jahren stand sie mit der Sekretärin des Abteilungsleiters in einem unausgesprochenen Wettstreit um den grünen Daumen, der ursprünglich nicht mehr als ein kleiner Spaß unter Kollegen gewesen war. Doch ihr Ehrgeiz war entfacht, gewiss eine Art Berufskrankheit.
»Summer, Kriminaltechnik«, meldete sie sich, nicht ahnend, dass gleich ein unverschämter Kollege seine gekränkte Eitelkeit an ihr auslassen würde.
»Bernsen. Männliche Leiche in Weißensee, Todesursache unklar. Beeilen Sie sich.«
»Ich wünsche Ihnen auch einen guten Morgen«, erwiderte Susanne Summer mit betont ruhiger Stimme und überlegte, woher sie den Namen dieses Kollegen kannte.
Einige Sekunden vergingen, doch Bernsen kam nicht einmal auf die Idee, ihre Grußformel zu erwidern. Er schwieg.
»Wie lautet die genaue Adresse des Fundortes?«, lenkte Susanne Summer ein.
»Chinesischer Garten. Ein Navi werden Sie doch wohl bedienen können?«
Susanne Summer schluckte. Bernsens Auftragsübermittlung glich einem Befehl auf dem Kasernenhof, wobei ihr die wenig vorteilhafte Rolle einer Rekrutin zukam. Einen solchen Umgangston war sie nicht gewohnt, zumal sie seit Kurzem die Spurensicherung leitete und von ihren Kollegen wegen ihrer Fairness, vor allem aber aufgrund ihrer Professionalität mehr als geschätzt wurde. So wähnte sie sich während der gesamten dreißig Sekunden dieses Telefonates – denn länger benötigte Bernsen für seine Anweisungen nicht– im falschen Film.
Nachdem der unflätige Kerl mit den Worten »Ich erwarte Sie in einer halben Stunde am Tatort« grußlos aufgelegt hatte, saß sie noch einen Moment lang regungslos auf ihrem Schreibtischstuhl und schaute auf den Weihnachtsstern.
»Bernsen«, murmelte sie immer wieder. Das war doch dieser unmögliche Mensch, der eine gefühlte Ewigkeit in Abteilung2 gearbeitet hatte. Glücklicherweise hatte sie mit dem bisher wenig zu tun gehabt. Der bildete doch jetzt mit Kohlschuetter das neue Ermittlerteam. Dann erwartete sie bei den Chinesen jetzt also nicht nur dieser Bernsen, sondern darüber hinaus auch Timo Kohlschuetter?
Der Tag hätte so schön werden können.
Wenig später raste sie mit ihrem Team über die A71 in Richtung Sömmerda – freilich nicht wegen Bernsen, sondern weil sie immer recht schnell fuhr– und grübelte darüber nach, wie sie Timo Kohlschuetter gleich am besten gegenübertreten sollte.
***
»War das Susi, äh, Frau Summer?« Kohlschuetter klopfte sich den Staub von den Knien.
Bernsen zuckte gleichgültig die Schultern. Er hatte sich noch nie großartig für seine Kollegen interessiert, erst recht nicht für ihre Namen. Und er würde so kurz vor der Pensionierung nicht mehr damit anfangen. Entscheidend war, dass der Job gut lief und dieser Aufsteiger-Ossi von Polizeichef nicht noch auf die Idee kam, ihn in die Bußgeldstelle nach Artern abzuschieben. Unbeeindruckt ging er zur Tagesordnung über. »Was gefunden?« Er wies auf die Leiche.
Kohlschuetter schaute Bernsen an und blies die Wangen auf, um die Luft dann langsam wieder daraus entweichen zu lassen. Sie waren erst seit knapp zwei Stunden ein Team, aber irgendetwas sagte ihm, dass er mit diesem Kollegen noch so einiges erleben würde. »Alfons Weidinger, zweiundvierzig Jahre, aus Ingolstadt. Außergewöhnlich gut gekleidet, allein die Jacke sieht verdammt teuer aus.«
Mit hochgezogener Augenbraue warf Bernsen einen Blick auf den Toten. Ein Mann, der viel Geld für Klamotten ausgab? Absolut unverständlich für einen sparsamen Nordfriesen wie ihn.
»Keine äußeren Verletzungen, neben etwas Bargeld und seinem Ausweis habe ich in seinen Taschen nur den Zimmerschlüssel eines Hotels gefunden. Die zwei Bier hier«, fuhr Kohlschuetter fort und zeigte auf die beiden Flaschen auf dem Fußboden, »könnte er vor seinem Tod getrunken haben. Allein oder mit jemandem zusammen. Sonst lässt sich nichts Besonderes feststellen. Aber wie ich Susi kenne, findet sie etwas, das uns weiterhilft.« Kohlschuetter schmunzelte vielsagend und in einer Weise zweideutig, dass sogar ein unbeteiligter Passant bemerkt hätte, was in der Luft lag. Selbiges galt jedoch nicht für Bernsen. Für solcherlei Wahrnehmung bedurfte es zweifelsohne ein Maß an sozialer Kompetenz, über das Bernsen nicht verfügte beziehungsweise verfügen wollte.
»Ein toter Bayer also«, bemerkte er sichtlich unberührt.
»Bayer? Haben Sie toter Bayer gesagt?« Bürgermeister Adler hätte fast den Aloesaft von dem kleinen Holztablett auf den Toten befördert. Mit weit aufgerissenen Augen starrte er Bernsen an, als hoffte er, sich verhört zu haben.
Doch Bernsen nickte erbarmungslos.
»Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.« Er drückte Kohlschuetter das Tablett in die Hand. »Ich kann hier wirklich keinen toten Bayern gebrauchen.« Verzweifelt raufte er sich die grau melierten Haare. Dann nahm er einen großen Schluck aus dem Aloeglas, das eigentlich für einen der beiden Kommissare bestimmt war.
»Ach, was hätten wir denn gern, einen Saarländer, Niedersachsen oder Sachsen-Anhaltiner?«, spottete Bernsen. »Gibt es nun bei Todesfällen schon Länderpräferenzen? Bitte einmal einen toten Hessen, zur Not geht auch ein Schleswig-Holsteiner, aber bloß keinen Bayern.« Genervt setzte er das andere Glas an, um kurz darauf den ersten und einzigen Schluck des grünlich gelben Saftes – begleitet von unappetitlichen Lauten– über die Brüstung des Pavillons zu spucken.
»Sind Sie irre? Das ist möglicherweise ein Tatort, Mann!«, schrie Kohlschuetter wütend.
»Das ist ein original chinesischer Aloetrunk!«, empörte sich Bürgermeister Adler.
»Mir doch egal. Ich lasse mich nicht vergiften. So was saufen bei uns nicht mal die Möwen«, antwortete Bernsen vollkommen unbeeindruckt. Er griff nach dem sichergestellten Hotelschlüssel und wedelte damit vor Adlers Nase herum. »Gibt es in diesem Dörfken ein Hotel?«
»In meiner Stadt gibt es zwei Hotels. Der Schlüssel stammt aus dem ›Promenadenhof‹, unserem ersten Haus am Platze.« Adler versuchte, den beleidigten Unterton in seiner Stimme zu unterdrücken. »Am Haupteingang links, die Nächste rechts, dann wieder links und immer der Straße folgen. Oder Sie gehen über die Promenade. Ich kann Sie auch hinbringen.«
Als Politiker war Adler es gewohnt, auch dann freundlich zu sein, wenn man ihm nicht dieselbe Höflichkeit entgegenbrachte, aber dieser Kommissar verlangte ihm dennoch einiges ab. Er musste sich zusammenreißen. Wenn der auf die Idee kam, ihm den China-Garten über Pfingsten dichtzumachen, hatte er ein Problem.
Am liebsten hätte er diesem schnöseligen Wessi einmal richtig die Meinung gegeigt. Es war doch vollkommen klar, was hier los war. Dass manche aber auch wirklich nie dazulernten. Der sieht uns auch nach über zwanzig Jahren immer noch im Trabant601 sitzen und unserem Begrüßungsgeld entgegenfahren, dachte Adler grimmig. So ein Hinterwäldler.
Er nahm einen weiteren Schluck von dem Aloetrunk. Irgendwie musste er seine Nerven beruhigen. Und für ein Weißenseer Ratsbräu war es eindeutig zu früh, zumindest würde das seine Frau so sehen.
»Nett, dass Sie das anbieten. Aber wir finden den Weg«, beeilte sich Kohlschuetter zu sagen, bevor sein Kollege den nächsten Spruch raushauen konnte. »Wenn Sie sich nachher noch für ein Gespräch bereithalten könnten? Und bitte sorgen Sie dafür, dass der Garten erst einmal geschlossen bleibt.«
Adler nickte widerwillig und verschwand in Richtung Rathaus. Der Morgen präsentierte sich ihm nun gar nicht mehr so hell und strahlend wie noch vor wenigen Stunden.
Was für ein furchtbarer Tag, dachte er, als er seiner Frau, die noch immer am Küchenfenster stand, im Vorbeigehen zuwinkte.
Timo Kohlschuetter war unterdessen auf die junge Beamtin zugegangen, die als Erste vor Ort gewesen war und mit ihrem Kollegen das Gelände abgesperrt hatte.
»Wer hat den Toten eigentlich gefunden?«, wollte er von ihr wissen. Dabei leuchteten seine Augen in einer Art und Weise, die nichts mit seiner Frage, sondern eher mit der Attraktivität der jungen Kollegin zu tun hatte.
»Ein Herr Werner Podeiske. Er arbeitet hier als eine Art Hausmeister«, antwortete sie etwas schüchtern. »Er war sehr aufgeregt, und ich habe ihn da drüben in den Teepavillon gebracht, damit er sich ein wenig beruhigt.« Die junge Frau zeigte auf einen großen Pavillon direkt gegenüber, zu dessen rechter Längsseite sich ein lang gezogener Teich erstreckte.
»Das war sehr mitfühlend von Ihnen. Gute Arbeit«, flüsterte Kohlschütter verschwörerisch und zwinkerte ihr zu. Mit rotem Kopf wich die Polizistin seinem Blick aus.
Kohlschuetter war sich der Wirkung, die er auf Frauen hatte, durchaus bewusst. Und er nutzte sie, wo er nur konnte. Die Damenwelt war einfach nicht in der Lage, den Reizen seines großen, sportlich durchtrainierten Körpers und den stahlblauen Augen unter pechschwarzen, kurz rasierten Haaren zu widerstehen. Sie wartete förmlich darauf, erobert zu werden. Ein Wunsch, dem Kohlschuetter mit größtem Vergnügen nachkam. Selbstbeschränkung, wie er es nannte– mit anderen Worten: sesshaft werden–, kam ihm dabei überhaupt nicht in den Sinn. Mit seinen achtunddreißig Jahren lag das ganze Leben noch vor ihm.
Da sich auf dem geschlängelten Kiesweg, über den die Kommissare vorhin gekommen waren, gerade die Spurensicherung näherte, beschloss Kohlschuetter, den kürzesten Weg zum Teepavillon zu nehmen, um Werner Podeiske zu befragen und Bernsen die Zusammenarbeit mit den Kollegen zu überlassen. Susi würde schon mit ihm zurechtkommen. Außerdem nahm sie es ihm bestimmt noch übel, dass er sie letzte Woche beim Italiener versetzt hatte.
Frauen konnten so grausam sein, und er nahm es hin, wenn er es verdient hatte. Aber doch bitte nicht während der Arbeitszeit und vor den Augen des neuen Kollegen.
***
»Das ist eine Katastrophe, eine furchtbare Katastrophe«, schrie Frank Adler, als er sein Büro in der ersten Etage des frisch restaurierten Rathauses betrat. »Bea, ich sage es dir, eine einzige Katastrophe.« Laut hörbar ließ er sich in den dicken schwarzen Bürosessel hinter seinem Schreibtisch fallen.
Bea Meier, die seit über zwanzig Jahren das Vorzimmer des Bürgermeisters managte, kam neugierig auf ihren viel zu hohen Absätzen angewackelt. Jeden Morgen gehörte es zu ihren ersten Amtshandlungen, die Büro-High-Heels aus der untersten Schublade ihres Schreibtisches zu ziehen und ihre Füße für den gesamten Arbeitstag darin zu parken. Die kleine rundliche Frau liebte dieses Ritual, das insgeheim von allen Mitarbeitern im Rathaus belächelt wurde. Denn die Schuhe verschafften ihr weder die erhofften schlanken Fesseln, noch konnte sie darin auch nur wenige Meter am Stück laufen, was in einem Rathaus aus dem 12.Jahrhundert für die meisten ein wirkliches Problem darstellen würde. Doch Bea Meier war findig genug, um mit der passenden Ausrede immer irgendjemanden dazu zu kriegen, ihr die unliebsame Lauferei abzunehmen, im Zweifel sogar Frank Adler selbst.
»Was ist denn los?«, fragte sie und sah zur Bürotür des Bürgermeisters herein.
Und Bea Meier wäre nicht Bea Meier, wenn sie die Antwort nicht bereits seit mindestens einer Stunde kennen würde. Schließlich ging sie mit offenen Augen und Ohren durch ihre Stadt; als Sekretärin des Bürgermeisters war sie quasi von Amts wegen dazu verpflichtet. Ihr entging kaum eine Neuigkeit– und war das wider Erwarten doch einmal der Fall, schaffte der tägliche Morgenkaffee mit Margit Müller, der Chefin des Bau- und Ordnungsamtes, Abhilfe. Bis zehn Uhr am Vormittag war demzufolge auch dieses seltene Manko wieder ausgeglichen.
Der tote Bayer im Chinesischen Garten jedenfalls konnte sie heute Morgen nicht mehr schocken. Gespannt, ob der Chef vielleicht schon etwas mehr wusste, schaute sie Frank Adler an.
»Unser Bierfest, wir können alles vergessen, absagen, du kannst, musst alles absagen«, stammelte der. »Niemals werden die uns den Titel verleihen. Sie werden sagen, wir haben den Bayern erschlagen, wegen unseres Bieres.« Während er sprach, fuhr er mit der Hand immer wieder über seinen grau melierten Oberlippenbart, als müsste er ihn von sämtlichen Kekskrümeln dieser Welt befreien.
Erschlagen, dachte Bea Meier. Also tatsächlich ermordet, interessant. Damit haben es diese Fanatiker nun aber wirklich übertrieben.
»Vielleicht trinkst du erst einmal einen grünen Tee. Dann sehen wir weiter.« Sie drehte sich auf ihren zehn Zentimetern um die eigene Achse, wobei sie sich behutsam am Türrahmen abstützte, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, und ging zurück zu ihrem Schreibtisch.
Kurz darauf bekam eine junge Auszubildende einen Anruf aus dem Vorzimmer des Bürgermeisters. Es wurde Teewasser benötigt.
»Bea, verbinde mich bitte mit dem Verein«, verlangte Frank Adler zehn Minuten später, seine Tasse mit dem dampfenden Grüntee am Mund. Die letzten beiden Worte zog er in die Länge, was unmissverständlich deutlich machte, dass nur einer der vielen Vereine der Stadt gemeint sein konnte. Als Bea den Anruf durchstellte und das Telefon des Bürgermeisters schrill zu klingeln begann, fiel am anderen Ende seines riesigen Schreibtisches eine Porzellanvase klirrend zu Boden.