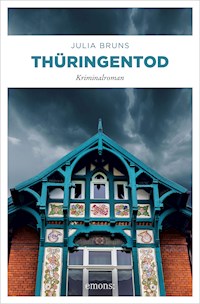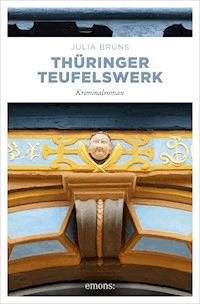9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Krimi
- Serie: Seniorenkrimi-Serie
- Sprache: Deutsch
Garantiert nicht sterbenslangweilig – ein Ostseetrip mit Leiche Im Seniorenheim herrscht Chaos. Nach dem Mord an der Küchenhilfe Selma kann nur eines die Gemüter beruhigen: Tapetenwechsel. Also macht sich Frau Mehltau, die Heimleiterin, mit ihren fünfundzwanzig Schützlingen auf den Weg an die Ostsee. Doch nicht nur überfüllte Raststätten, blähende Fertiggerichte und das Verbot, das WC im Bus zu benutzen, bringen Helmut, Margot und Co. an ihre Grenzen. Als endlich die schöne Ostsee in Sicht kommt, ist das Leid der letzten Stunden fast vergessen. Aber eine Kleinigkeit stört dann doch: Warum sitzt Erwin eigentlich tot im Strandkorb? Helmut Katuschek (Kriminalkommissar a. D.) muss ran – denn die Langeweile stirbt bekanntlich zuletzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Den ersten Urlaub seit seiner Gefangenschaft in einem Seniorenheim hatte sich Helmut Katuschek (Kriminalhauptkommissar a. D.) anders vorgestellt. Denn auch wenn eine Busreise mit Senioren nicht direkt eine Luxuskreuzfahrt ist: Überleben kann man es. Nun ja, alle außer Erwin zumindest, der schon bei der Ankunft an der Ostsee tot auf der Rückbank sitzt. Doch das wirklich Alarmierende daran ist, dass jemand nachgeholfen haben muss. Und so haben Helmut und seine ehemalige Kollegin Frau Dr. Böttcher alle Hände voll zu tun, dem Mörder auf die Schliche zu kommen.
Von Julia Bruns sind bei dtv außerdem erschienen: Die Rache der Weihnachtsgurke Der Weihnachtsgurkenfluch Die Langeweile stirbt zuletzt Donnerstag ist Schnitzeltag
Julia Bruns
Tote brauchen keinen Strandkorb
Band 2 Ein Seniorenkrimi
Alte Leute frieren immer. Angeblich liegt das an der schlechteren Durchblutung. Wenn ich mich so umschaue, muss ich sagen, das scheint heute unser Glückstag zu sein. Was der Blutkreislauf nicht schafft, erledigt der Busfahrer, indem er sich weiterhin weigert, die Klimaanlage anzustellen. Ich vermute nur, dass die Sache irgendwann kippt. Ich weiß nicht, ob das jemand von dem Personal einkalkuliert hat. Eher nicht. Denn es gibt momentan erheblichere Probleme als vierundzwanzig vor Hitze kollabierende Senioren.
Nummer fünfundzwanzig in Gestalt von Rolf Jürgen schafft die Treppe nicht. Vermutlich rettet ihm das sogar das Leben. Ich gebe zu, es hätte eine gewisse Situationskomik, wenn der über Neunzigjährige und damit Älteste unseres Seniorenheims der Einzige ist, der diese alberne Reise überlebt. Frau Mehltau, unsere Heimleiterin, und die Pflegerin Monika jedenfalls haben die Sache nicht im Griff, sonst hätten sie ihn in der letzten halben Stunde höher gehievt als bis auf die erste Stufe. Rolf Jürgen sieht das gelassen. Er pfeift einen alten Hans-Albers-Schlager und gibt schlüpfrige Witze zum Besten. Gertrude und Auguste, seine beiden derzeitigen Favoritinnen, hingegen haben die Anmut zweier arthrotischer Cheerleader, die mal weinerlich, mal hysterisch ihren Helden von der zweiten Bank aus zu Höchstleistungen anfeuern. Wenn das so weitergeht, muss eine von ihnen vor Aufregung auf die Toilette. Das kennt man ja. Und dann gibt es kein Halten mehr, denn mit den dringenden Bedürfnissen verhält es sich im Altersheim wie mit Kopfläusen in einer Kindergartengruppe. Das ist dann eine Sache von Sekunden. Ich weiß nicht, ob Frau Mehltau und die brave Monika Rolf Jürgen dann wieder aus dem Weg zerren oder die Massen ihn einfach auf den Gehweg stoßen – das bleibt abzuwarten. Jedenfalls scheint es sicher zu sein, dass der Busfahrer nicht in der Lage ist, sich hier sinnvoll einzubringen. Schon der Knopf für den Öffnungsmechanismus der Hintertür überfordert ihn offenbar. Das würde das Einsteigen des übrigen Personals erheblich erleichtern, von dem frischen Sauerstoff mal abgesehen. Man könnte doch tatsächlich meinen, der Kerl hätte es darauf angelegt, die Tour abbrechen zu können. Dabei sind wir noch nicht einmal losgefahren. Ich vermute, die haben keinen gefunden, der unsere Siechenkommune chauffieren will. Dann musste die Aushilfe ran, und die versprüht so viel Herzlichkeit wie eine Bahnschwelle unter der Fallrohrtoilette der Deutschen Bahn. Der Umgang mit Greisen ist nun einmal nicht jedem in die Wiege gelegt. Vielleicht ist das heutzutage auch normal. Wer will schon nur von alten Leuten umgeben sein? Ich jedenfalls nicht. Aber im Gegensatz zu dem Bürschchen da vorn habe ich keine Wahl. Ich bin verheiratet. Noch dazu mit Margot. Vor sechsundvierzig Jahren, einem Monat und drei Tagen haben wir uns das Jawort gegeben. Seitdem werde ich das Gefühl nicht los, dass meine Uhr der Lebensfreude rückwärtsläuft. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Margot ist keine schlechte Frau. Sie war sogar einmal recht hübsch anzusehen. Ich glaube, davon habe ich mich blenden lassen. Bei uns war es wohl wie bei dieser Spinne, der Schwarzen Witwe. Die sollen die Männchen während des Balzrituals so betören, dass es den Kerlen egal ist, ob sie nach der Paarung gefressen werden. Mir war es nicht egal. Mich hat einfach keiner gefragt. Immerhin ist unsere Ehe bis jetzt ganz passabel gelaufen. Harmonie durch Unterordnung lautet Margots Prinzip. Da ich früher kaum zu Hause war, ist mir das überhaupt nicht so aufgefallen. Ich war bei der Kripo. Neunundvierzig Jahre. Rückblickend würde ich sagen, das war die beste Zeit meines Lebens. Bei Margot verhält es sich genau entgegengesetzt. Sie sagt, sie hätte nur auf den Ruhestand gewartet, um das versäumte Leben nachholen zu können. Ich weiß nicht, was Margot versäumt hat, das Frühstücksfernsehen und den Tratsch mit den Nachbarn jedenfalls nicht. Die paar Jahre, die sie halbtags bei der Post war, fallen kaum ins Gewicht. Alles, was danach kam, lag allein in ihrer Hand. Eine Frau ihres Standes könne nicht durch die halbe Stadt rennen und bei fremden Leuten klingeln, um ihnen die Sachen nachzutragen, hat sie immer gesagt. Für gewöhnlich tun Briefträger so etwas. Margot nicht. Die war als Kriminalhauptkommissarsehefrau per se etwas Besseres, und mit meinem a. D. hat sich Margots Dünkel noch mal ordentlich potenziert. Infolgedessen hat sie entschieden, dass unser Reihenhäuschen nicht mehr standesgemäß sei. Ich weiß nicht, inwieweit dies auf ein Seniorenheim zutreffen kann, aber dort bin ich jetzt. Seit dreihundertneunzig Tagen, acht Stunden und drei Minuten befinde ich mich auf dem bislang tiefsten Punkt der Rudimente meiner Daseinsfreude. Derweil bekommt Margots Begeisterung schon pathologische Züge.
»Eine Auszeit an der Ostsee. Was uns in unserer reizenden Residenz alles geboten wird, ist überaus superb«, sagt sie mit spitzen Lippen, während sie sich neben mir sitzend mit einer dieser Frauenzeitschriften, die sie immer mit sich herumträgt, Luft zuwedelt.
Reizend und superb, diese beiden Wörter gehören neuerdings zu Margots Lieblingswortschatz. Früher hat sie nie so geschwollen dahergeredet. Sie meint, unsere Lebensumstände hätten das auch nicht hergegeben. Ich ärgere mich darüber. Wir hatten es nett, allein in unserem Häuschen, mit so normalen Dingen wie dem Alltag, meinem Schachfreund Herbert Grusche und dem Sportkanal. Das Leben war einigermaßen gut, ohne diese kranke Gruppendynamik, die hauptsächlich zwischen Fressneid und dem brennenden Interesse an der Farbe, Beschaffenheit und Konsistenz des Stuhlgangs des anderen schwankt, also bis vor dreihundertneunzig Tagen.
»So eine Sommerfrische am Meer ist schon etwas Herrliches«, setzt Margot ihre Selbstgespräche fort. »Auch noch an die Ostsee. Da hat man ja sogar immer Wasser. Wie superb.«
Obwohl sie seit der Entzweiung mit ihrer Busenfreundin Hannelore deutlich mehr Worte für mich übrig hat, heißt das nicht zwingend, dass ich angesprochen bin. Das wäre mir auch zu anstrengend, die meiste Zeit höre ich ohnehin nicht zu, und sie erwartet in der Regel keine Antwort.
»Dass ich erst jetzt in diesen Genuss komme …«
Sie seufzt, und ich brauche sie nicht anzusehen, um den vorwurfsvollen Augenaufschlag in meine Richtung zu bemerken. Genau das meine ich.
»Aber wenn man einen vielbeschäftigten Mann in leitender Position an seiner Seite hat, muss man sich einfach zurücknehmen.«
Ich frage mich, wann Margot sich jemals zurückgenommen hat. Als das passiert ist, war ich sicherlich gerade im Büro.
»Zeit für Urlaub hat es bei uns jedenfalls kaum gegeben.« Sie zuckt mit den Schultern. »Ein, zwei Mal für ein paar Tage nach Österreich, mhm, nicht der Rede wert.«
Ihre Unterlippe verdeckt nun die Oberlippe völlig. Das macht sie immer, wenn sie sich als Opfer einer schrecklichen Ungerechtigkeit präsentieren will. Auf dem Standesamt muss sie damit angefangen haben. Jedenfalls ist es mir vorher nicht aufgefallen.
»Richtige Auszeiten waren mir einfach nicht vergönnt.«
Siebenundzwanzigmal Kaiserwirt in Bad Ischl. Achtzehnmal Pension Bergblick Hallstatt. Jeweils vierzehn Tage. Vollpension. Während meiner Ehe habe ich meine Mutter nicht so oft gesehen wie die Alpen. Erst seit meinem letzten Arbeitsjahr haben wir unseren Urlaub zu Hause verbracht, und das auch nur, weil Margot, wie sie jedem ungefragt erzählt hat, die Dinge vor dem neuen Lebensabschnitt richten müsse. Dabei war es mein neuer Abschnitt. Ich weiß nicht, was jemand richtet, für den sich doch eigentlich nichts ändert. Mittlerweile vermute ich, dass sie den Umzug ins Heim von langer Hand vorbereitet hat. Es dauert nun mal seine Zeit, wenn man das Sammelsurium eines dem Ende entgegengehenden Lebens aufräumen, aussortieren und entsorgen muss. Ich frage mich, wie lange sie wohl gebraucht hätte, wenn sie ihre eigenen Habseligkeiten auch so gründlich dezimiert hätte. Vermutlich wären wir dann immer noch zu Hause. Ich jedenfalls bin mit einem Koffer und zwei Plastiktüten in der Wartestation zum Friedhof angekommen. Bei Margot hingegen müssen es so zwanzig Kartons nebst Taschen, Beuteln und allerlei Kleinkram gewesen sein. Wenn ich mir irgendwann wieder eine eigene Bude nehme, vorausgesetzt Margot stirbt vor mir, kriege ich den Umzug wenigstens problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gewuppt.
»Nun könnt ihr alles nachholen, liebe Margot«, flötet Jutta zwischen den Sitzen hindurch. »Das Meer soll um diese Jahreszeit besonders schön sein. Ich freue mich schon, wenn wir alle gemeinsam baden gehen.« Ich sehe ihren roten wilden Haarschopf vorfreudig hin und her wackeln. »Ich bevorzuge den FKK-Strand. Es gibt doch nichts Sinnlicheres, als den Wind auf der nackten Haut zu spüren«, lässt sie uns noch wissen.
Ich versuche mich daran zu erinnern, ob ich meine Sonnenbrille eingepackt habe. Das braune Glas nimmt den schlimmsten Anblicken zumindest die Strahlkraft. Nur, falls ich zufällig in irgendetwas hineingerate. Mir wäre das äußerst unangenehm, zumal es in einem Seniorenheim an sich schon kaum Grenzen gibt. Wir essen gemeinsam. Wir sehen gemeinsam fern. Wir teilen uns die Wehwehchen und nicht zu vergessen Rolf Jürgen, Letzteres gilt zumindest für die ledigen Frauen, die siebzig Prozent der Insassen ausmachen. Der Großteil der Leute hier, insbesondere das Personal, nennt uns Heimfamilie. Um den Zusammenhalt zu unterstreichen, wird zusätzlich das Wörtchen »wir« konsequent missbraucht. Das treiben die so weit, dass eine normale Ansprache des Einzelnen nicht mehr möglich ist. »Haben wir gut geschlafen, Herr Helmut?« Ich weiß nicht, was diese grammatikalische Akrobatik soll. Und auch diese Verbindung der Vornamen mit der Anrede! Zu meiner Zeit jedenfalls gab es das nicht. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass sich die Gesellschaft eine eigene Sprache zum Umgang mit Senioren ausgedacht hat. So was in der Art wie dieses Kleinkind-Ballaballa. Das Muster, das dahintersteckt, ist jedenfalls eindeutig: Alt ist gleich schwer von Kapee. Die sollen bloß nicht denken, dass ich das nicht mitbekomme. Das Vertraulichkeitsgetue, mit dem sie alles zudecken, habe ich längst durchschaut. Von wegen Heimfamilie. Den Mund weit aufzureißen, wenn man außen steht, ist leicht. Meine Familie suche ich mir jedenfalls noch immer selbst aus. Oder Margot tut es. Für meine Begriffe ist unsere Siechenkommune nichts weiter als eine Art Justizvollzugsanstalt für Betagte: regelbasiert, kontrolliert und vom Leben abgeschnitten. Der Vorteil einer JVA gegenüber einem Seniorenheim ist nur der, dass da ab und zu jemand wieder rauskommt, lebend, versteht sich. Wenn künftig jedoch auch noch jegliche Hemmungen fallen und wir uns gegenseitig auf die Geschlechtsteile gucken müssen, gehe ich. Margot ist damit ganz sicher auch nicht einverstanden.
»Ein Nudistencamp! Einwandfrei!« Rolf Jürgens Wahrnehmung ist äußerst selektiv. Immerhin beflügelt diese Aussicht seine Kräfte, und die nächste Stufe ist Geschichte.
Im Schutze von Juttas Hinterkopf verdreht Margot die Augen. Dann schaut sie demonstrativ aus dem Fenster. Meine Frau verabscheut Nacktheit, insbesondere männliche. Aber vor allem ist sie sauer, weil man uns nur einen Platz in der vierten Reihe hinter dem Busfahrer zugewiesen hat. Das ist sozusagen eine Doppeldegradierung. Die wichtigen Leute gehören ihrer Meinung nach ganz nach vorn.
»Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass die Angestellten bevorzugt werden, aber das vertrocknete Ferkel und dann auch noch …« Sie deutet mit dem Kopf auf den Platz vor ihr und formt mit den Lippen ein angewidertes »Jutta«.
Das vertrocknete Ferkel, also Rolf Jürgen, steht kurz vor dem Durchbruch. Seine Singerei hält an, aber die Langmut von Frau Mehltau und Pflegerin Monika scheint so langsam nachzulassen. Kein Wunder, das Thermometer dürfte mittlerweile die vierzig Grad geknackt haben. Ich höre die beiden schnaufen und keuchen. Unseren Lehrjungen Peter Bause beeindruckt das nicht. Er lehnt entspannt außen am Bus und raucht. Sollte bei ihm mal so etwas wie Empathie aufkommen, dann steht irgendeine Mahlzeit an. Der Junge ist dahingehend klar konditioniert.
Der Busfahrer offenbar auch. Er scheint etwas auf seinem Handy entdeckt zu haben, das seine gesamte Aufmerksamkeit benötigt. Es gab in der Geschichte oft Zeiten, in denen die Frauen stärker gefordert waren. Aber da befanden wir uns im Krieg, und die Männer waren an der Front oder, schlimmer noch, tot. Wann die Gesellschaft falsch abgebogen ist, was die neue Männlichkeit angeht, weiß ich nicht. Wenn das da vorn aber die Prototypen sind, dann bin ich froh, dass meine Sanduhr bald durchgelaufen ist und ich die Schande nicht mehr miterleben muss.
»Möchtest du vielleicht lieber hier vorn sitzen?«, bietet Jutta an. »Ich tausche gern die Plätze. Ich bin da nicht so.«
Während sie das sagt, reicht sie uns zwei Piccolo nebst Plastikgläsern nach hinten.
Da Margot nicht reagiert, nehme ich die Sachen an mich. Ungezügelter Alkoholkonsum ist im Heim strengstens untersagt, aber womöglich sind Urlaubsreisen eine Ausnahme. Im normalen Leben holen die Leute in der Ferienzeit auch alles nach, worauf sie das ganze Jahr verzichten müssen. Jutta wird es wissen. Und ich hätte lieber ein Bier.
»Helmut und ich können uns dann ein bisschen unterhalten und du hast deine Ruhe«, bekräftigt sie ihr Angebot noch mal und blinkert dabei keck zwischen den Polstern hindurch.
»Das wäre ja noch schöner«, presst Margot hinter zusammengekniffenen Zähnen hervor und bedenkt mich dabei mit einem zutiefst vorwurfsvollen Blick. Margot glaubt, Jutta habe es auf mich abgesehen. Schuld daran bin natürlich ich, da ich sie angeblich ermuntere. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Aber Margot weiß es. Selbstverständlich. Aus meiner Sicht ist das alles Blödsinn, aber ich spare mir dennoch die Widerrede.
»Das fehlte noch, dass die sich mit ihrem dicken Hintern neben dich quetscht«, murmelt sie unter hektischem Zupfen an ihrem Ärmel. »Man weiß doch, wie so etwas endet. Noch dazu unter Alkoholeinfluss.«
Ich werfe einen verstohlenen Blick auf meine zweihundert Milliliter Sekt. Ich rechne nicht mit einem Rausch, zumindest nicht so, dass ich mich über Jutta hermache. Ausgerechnet Jutta.
»Jetzt muss man schon seinen eigenen Platz verteidigen«, raunt mir Margot ungehalten zu. »Als Ehefrau.« Das letzte Wort dehnt sie, als wäre es etwas Heiliges.
Ich glaube, Jutta wollte nur nett sein, und mir ist es egal, wem ich zugeteilt werde. Seit ich meine restliche Zeit hier absitze, bin ich nicht mehr besonders wählerisch. Irgendwann stumpft nun mal jeder ab. Aber Jutta ist grundsätzlich in Ordnung, also für jemanden, der vor Neugier und einem überbordenden Mitteilungsbedürfnis fast platzt. Auch glaube ich nicht, dass sie wahllos jeden nehmen würde, wie Margot ihr unterstellt, nur weil sie dreimal verheiratet war. Außerdem bin ich schließlich auch nicht für jeden zu haben. Margot habe ich mir immerhin auch mal selbst ausgesucht und verzichte jetzt auch charmant darauf, sie darauf hinzuweisen, dass Jutta nicht die Einzige in unserer Zwangs-WG ist, die aus der Rubensfraktion stammt. Margot ist ein prima Beispiel dafür, was Müßiggang und Streichkäse mit einem Menschen machen können.
»Jetzt sag doch auch mal was«, faucht sie mich an.
Ich bin sicher, das würde sie nicht hören wollen. Zumal ich langsam ein wenig ungehalten werde. Hauptsache, ich würge seit sechsundvierzig Jahren Magerjoghurt und Rahmersatz runter. Dabei bin ich nicht mal der Typ, der Fett ansetzt. War ich noch nie. Im Gegensatz zu Margot. »Mhm.«
Margot schmatzt so überheblich, wie sie es immer tut, wenn sie sauer auf mich ist. »Das ist ganz liebenswürdig von dir, meine liebe Jutta«, säuselt sie schließlich. »Aber ich muss mich um meinen Helmut kümmern.«
Ich blicke an mir hinunter, als wäre mir ein Gebrechen entgangen.
»Du kannst es dir ja überlegen. Wir sind ein paar Stunden unterwegs«, entgegnet Jutta fröhlich.
Ich staune immer wieder, wie sie sich in diesem Umfeld ihr sonniges Gemüt bewahren konnte. Aber das muss sie wohl, denn alle bei uns im Heim sind ihre potenziellen Kunden, und die muss man pflegen. Jutta ist da äußerst pragmatisch. Ich schätze, sie rechnet nicht mehr mit Ehemann Nummer vier und versucht jetzt, kraft ihrer eigenen Fähigkeiten über die Runden zu kommen. Für eine Ruheständlerin, deren Talente vorranging im Glücksspiel, im Okkultismus und in fragwürdigen Geschäftsbeteiligungen liegen, ist das sicherlich nicht so leicht. Auf der anderen Seite leben wir in einem Seniorenheim, und wenn sich nicht wildfremde Leute via Enkeltrick an allen hier bereichern, tut es eben Jutta.
»Jedenfalls ist es schön, dass wir alle noch mal was erleben«, frohlockt Jutta. »So ein Ortswechsel eröffnet ganz neue Perspektiven.«
»Haben Sie noch immer keinen Mann gefunden?«, ertönt die Stimme der Frau Doktor von Juttas Nebenbank.
Doktor Olga Maria Böttcher ist als Koryphäe der Rechtsmedizin eine langjährige, äußerst geschätzte Kollegin von mir gewesen und ebenfalls gegen ihren Willen hier kaserniert. Aber während mein Sargnagel neben mir sitzt, hat sich der Sohn der Frau Doktor seit ihrem Einzug bei uns nicht wieder blicken lassen. Womöglich ist es sogar besser, seinen Henker nicht tagtäglich zu Gesicht zu bekommen. Im Fall der Frau Doktor spielt das keine ganz so große Rolle, denn sie würde den undankbaren Spross ohnehin nicht konsequent zuordnen können. Ihr Gehirn gönnt sich immer mal wieder eine Pause. So was hat auch nicht nur Nachteile.
»Wieso nehmen Sie nicht Herrn Katuschek?«, fragt die Frau Doktor mit der Arglosigkeit eines Kindes, die sie immer dann erfasst, wenn ihre Synapsen Siesta halten.
Herr Katuschek, das bin ich. Helmut Katuschek. Und für den entwickelt sich die Angelegenheit hier gerade zum Problem.
»Helmut Katuschek, hast du mir vielleicht etwas zu sagen?«, keift Margot, und wenn Rolf Jürgen nicht gerade einen Schmerzensschrei ausgestoßen hätte, weil er das Auskugeln seines Arms vermutet, wäre dies auch zügig zu einem Thema für alle anderen geworden. Zwischenmenschliches ist hier hoch im Kurs, nach der Darmtätigkeit wohlgemerkt.
»Helmut! Wenn ich gewusst hätte, dass das eine Kuppelfahrt ist, hätte ich diesem Urlaub niemals zugestimmt. Wenn das hier so läuft, kann mir die Ostsee gestohlen bleiben«, erklärt Margot mit weinerlicher Stimme. Theatralik ist ihr in die Wiege gelegt. Dabei war sie es, die die Anmeldebögen für uns beide unterschrieben hat, ohne dass ich überhaupt von diesem Angebot Kenntnis hatte. »Dass mein Mann einmal feilgeboten wird, hätte ich mir nicht träumen lassen. Wie sauer Bier.« Sie bläht die Nasenflügel.
Soll ich jetzt auch noch froh sein, dass sie mich nicht mit den Brötchen vom Vortag vergleicht?
»Kollege Katuschek ist ein anständiger Mann«, redet die Frau Doktor weiter. »Nicht so wie mein Karl Heinz, aber der ist ja auch tot.« Etwas scheint sie umzutreiben. Jedenfalls kann ich sehen, wie sie immer wieder mit ihren Händen auf die Armlehnen schlägt. Dann beugt sie sich weit zu Jutta herüber. »Habe ich den eigentlich damals umgebracht? Können Sie sich vielleicht erinnern?«
»Wer weiß das schon so genau, meine Liebe«, entgegnet Jutta. »Nun machen wir uns erst einmal ein paar schöne Tage am Meer.«
»Und dort mache ich Sie mit Herrn Katuschek bekannt«, erwidert die Frau Doktor.
»Da freue ich mich drauf«, entgegnet Jutta und streichelt der Frau Doktor den Arm.
»Und ich mich erst«, flüstert Margot boshaft neben mir.
»Ich bin drin!« Rolf Jürgens Schrei hat etwas Animalisches. Vor lauter Begeisterung über seine Leistung reißt er, kaum dass Frau Mehltau und Schwester Monika von ihm abgelassen haben, die Arme hoch und genießt seinen wie auf Kommando aufkommenden Applaus. Ich wundere mich, dass die Leidensgemeinschaft bei der Hitze noch Lebenszeichen zeigt, aber sie scheinen härter im Nehmen zu sein, als ich vermutet hatte. Vielleicht sind sie aber auch nur erleichtert, dass es endlich losgehen kann. Auch alte Menschen verfügen nicht mehr über so viel Geduld, wie man vielleicht meinen möchte, noch dazu, wenn die Heimleitung allen eine Lunchbox für die Fahrt versprochen hat. Dafür muss man nur eben erst unterwegs sein.
»Da bist du ja, Liebster«, stellt Auguste das Offensichtliche fest, und es klingt, als hätte sie ihren Gespielen über Jahrzehnte nicht gesehen.
Gertrude macht es sich leicht und wiederholt den Satz ihrer Nebenbuhlerin einfach. In unserem Alter gibt es ohnehin nichts, was noch nicht gesagt wurde. Da lohnt sich die Mühe der Kreativität nicht. Noch dazu hat Rolf Jürgen des Öfteren Probleme mit seinen supermodernen Hörgeräten, und niemand weiß, wann er gerade auf Sendung ist. Ihm ist es womöglich nicht einmal selbst klar.
»Jetzt aber hurtig, Kameraden! Der Kommandant ist an Bord. Der Feldzug gen Norden kann beginnen«, fordert Rolf Jürgen, ohne dass er sich nur einen Millimeter von der Stelle bewegt hat.
Erst jetzt fällt mir auf, dass er seine normale Anstaltskleidung, einen hellgrauen Anzug aus schwerer Kunstfaser, gegen giftgrüne Boxershorts und ein geblümtes Hemd getauscht hat. Die Hose scheint noch der Restbestand seines vorherigen Lebens zu sein, vorausgesetzt, er war früher mal ein stattlicher Mann. Jedenfalls reicht das Beinkleid nicht nur hinunter bis über seine Knie, sondern es schlackert auch noch in einem Maße, dass man Sorge haben muss, er verliert es bei der erstbesten Bewegung. Das allerdings kann auch nicht schlimmer sein als der Anblick der dürren Stelzen, auf denen er unterwegs ist. Glücklicherweise sieht man von dem weißen Fleisch nicht allzu viel, da seine blauen Wollsocken bis weit über die Waden reichen. »Mädels, rafft schon mal die Röcke hoch. Der Rolfi ist im Anmarsch«, tönt er vollmundig. Allerdings scheint es der Rolfi damit nicht sonderlich eilig zu haben, denn er bewegt sich keinen Millimeter vorwärts. Stattdessen schwankt er nur bedenklich, aber nachdem ich seine Beine gesehen habe, erschreckt mich das nicht. Die Physik macht nicht mal vor dem Alter halt.
»Dieser ekelhafte alte Kerl«, echauffiert sich Margot und streicht dabei über die Blümchen ihres Sommerkleids, als wäre es ihr Rock, auf den Rolf Jürgen es abgesehen hat.
»Geht hier noch was, Opa?«, erhebt der Busfahrer unhöflich die Stimme.
Abgesehen davon, dass dies die ersten Worte sind, die er an seine Fahrgäste richtet, finde ich diese Anrede einfach nur unverschämt. Wir sind vielleicht etwas älter, aber wir sind auch Menschen.
»Gestern ging es noch«, kontert Rolf Jürgen und bleckt die dritten Zähne.
Ich befürchte, man muss ihm das sogar glauben. Dann setzt er sich voller Entschlossenheit in Bewegung. Für jemanden, der sich normalerweise nur mit der Hilfe des Pflegepersonals oder mittels seines Rollators fortbewegt und in der letzten Stunde körperliche Höchstleistungen vollbracht hat, ist das ein nahezu tollkühnes Unterfangen. Es scheitert. Rolf Jürgen verlassen die Kräfte. Er strauchelt und kippt in Richtung Fahrersitz. Der Blödmann, der darauf hockt, denkt jedoch nicht mal daran, dem Bedauernswerten zu helfen. Anstatt ihn aufzufangen, lehnt er seinen Oberkörper zur Seite, soweit es die Geräumigkeit des Busses zulässt, und hebt dabei die Hände, als wäre Rolf Jürgen eine heiße Kartoffel. Oder ein alter Mann, dem durch einen unglücklichen Sturz seine Hose in die Kniekehlen gerutscht ist. Dass diese Reise nicht durch eine Toilettenpause für unseren Heim-Methusalem unterbrochen werden muss, wissen nun alle. Rolf Jürgen trägt eine Windel.
»Wie lustig!«, jauchzt die Frau Doktor bei diesem Anblick. »Normalerweise sind alle nackten Männer, die ich seit über dreißig Jahren zu Gesicht bekommen habe, tot.«
Rolf Jürgen befindet sich zweifelsohne in einer Vorstufe dieses Zustands.
Wenn es so etwas wie eine durch Ekel ausgelöste Schockstarre gibt, dann hat sie unseren Busfahrer erfasst. Mit weit aufgerissenen Augen stiert er auf den schräg über seinem Lenkrad liegenden Rolf Jürgen, unfähig, irgendetwas zu tun. Wie sehr ihn der Anblick irritiert, steht ihm dabei im Gesicht geschrieben. »Ist er etwa to… to…t?«, stottert er konsterniert und bemüht, seinen Würgereiz zu unterdrücken.
An seiner Stelle würde ich mal nachsehen, zumal wir ansonsten nie loskommen. Aber wenn einem alles egal ist, kann man die Sache natürlich auch einfach laufen lassen.
»Rolf Jürgen ist noch nicht an der Reihe«, konstatiert Jutta unbeeindruckt. Sie muss es wissen, sie legt ihm jeden Morgen für fünf Euro das Tageshoroskop.
»Hä?« Der Busfahrer scheint ihr nicht recht glauben zu wollen. Sein Blick bleibt an Rolf Jürgen hängen. »So können wir aber nicht losfahren«, erklärt er schließlich.
Welche Art Schulabschluss ist heutzutage eigentlich notwendig, um fünfundzwanzig Senioren an die Ostsee zu kutschieren? Vermutlich keiner, denn im Zweifel geht unser Ableben als natürliche Auslese durch, und der Junge kommt mit einem Freispruch davon. Mit den Alten ist es wie mit unliebsamen Haustieren. Wenn sie weg sind, wird durchgelüftet.
»Die Leiche einfach in den Gang legen«, schlägt die Frau Doktor lapidar vor. »Die nimmt das nicht übel. Dann kann ich mir mit ihm während der Fahrt ein wenig die Zeit vertreiben.«
»So machen wir das«, entgegnet Jutta und tätschelt der Frau Doktor erneut den Arm. »Dann wird dir auch nicht langweilig. In unserem Alter ist es ganz und gar wichtig, eine Aufgabe zu haben. Das hält fit, vor allem im Kopf.«
Sollte das der Frau Doktor bewusst sein, wird sie es beherzigen. Der Busfahrer hat derweil Fluchtgedanken. Das sehe ich von Weitem. Die nützen ihm jedoch nicht viel, denn Monika Löwe versperrt ihm den Weg. Mit bleichem Gesicht steht sie auf der obersten Stufe und vergießt bittere Tränen. So wie ich unsere Pflegerin kenne, muss das nicht mal etwas mit Rolf Jürgens Ausfall zu tun haben. Bei Monika ist das sicher etwas Hormonelles. Sie heult andauernd, auch bei geringeren Anlässen. Aber vielleicht liegt es auch an ihrem deprimierenden Umfeld. Die geballten Auswüchse des Alters sind nun mal nichts für Weicheier. »Herr Rolf Jürgen, was machen wir denn?«, jammert sie.
Wenn niemand den Mann vom Lenkrad zieht, werden wir es nie erfahren, denke ich, verhalte mich aber still, da Margot nicht will, dass wir uns in die Angelegenheiten der anderen einmischen. Da alle abgelenkt sind, beschließe ich, den Sekt zu öffnen und Margot und mir einzuschenken. Wer weiß, wie lange das hier noch dauert. Womöglich hat sich die Reise nun auch ganz erledigt, und wir dürfen alle wieder aussteigen. Dann hatte ich wenigstens etwas Alkohol. Im Alter muss man es nehmen, wie es kommt, zumal man nie wissen kann, was noch kommt. Dieser seltsame Urlaub ist mir ohnehin suspekt. Ein Ortswechsel hält die Gebrechen auch nicht auf. Nur für unser Personal ist so eine Planänderung ein wenig blöd, oder besser gesagt: für den Ruf des Hauses. Alle Welt denkt doch heutzutage nur noch in Marketingeffekten. Aber die dürften nicht so rosig sein, wenn der erste Schutzbefohlene noch vor der Abfahrt zum Ereignis des Jahres abgängig ist. Da will man den alten Leuten etwas bieten, und stattdessen sterben sie weg. Wie undankbar. So etwas spricht sich doch herum. Um Rolf Jürgen täte es mir jedenfalls ein wenig leid. Er war der Einzige, den ich kenne, der so ganz ohne Konventionen durch die letzten Tage seines Lebens marschiert ist, politisch wie sexuell. Aber irgendwann hat nun einmal alles ein Ende. Während ich mit unseren Getränken beschäftigt bin, muss Hannelore, Margots neue Erzfeindin, an uns vorbei nach vorn gegangen sein. Jedenfalls sehe ich sie plötzlich hinter Frau Mehltau stehen.
»Ich nehme seinen Platz«, beschließt sie laut.
Frau Mehltau, eine durch und durch unsichere Frau, die sich gerade daranmachen wollte, nach Rolf Jürgen zu schauen, sieht Hannelore nur mit weit aufgerissenen Augen an.
»Wenn der im Gang liegt, ist sein Platz frei. Den nehme ich«, wiederholt Hannelore. »Alles andere ist Verschwendung.«
Ich bin sprachlos über diese eiskalte Schlussfolgerung. Aber eigentlich habe ich von Hannelore auch nichts anderes erwartet.
Margot bekommt den ersten Schluck Schaumwein in die falsche Kehle. Sie läuft dunkelrot an und hustet ganz furchtbar. Dennoch gelingt es ihr erstaunlicherweise, zwischen dem Gekodder noch ein paar Worte herauszubringen. »Dieses Biest«, krächzt sie. »Den besten Platz. Diese Hyäne.«
Hannelore, der das zweifelsohne nicht entgangen ist, dreht sich langsam um und grinst uns selbstgefällig an. Seit Hannelore ihre spontane Feindschaft gegenüber Margot entdeckt hat, tobt der Krieg zwischen den beiden Frauen. Warum bei Hannelore irgendwann der Schalter vom Zustand der symbiotischen Einmütigkeit und grenzenlosen Ergebenheit umgeschlagen ist, weiß ich nicht. Mir war dieses Weib mit ihren ständig herunterhängenden Mundwinkeln und ihrem zur Schau gestellten Todesdrang vom ersten Moment an unangenehm. Ich jedenfalls möchte niemanden in meinem Umfeld haben, der seine Tage damit ausfüllt, die eigene Beerdigung vorzubereiten. So etwas zieht einen doch runter, zumal dieses Weibsbild auch noch zu den Jüngeren bei uns zählt. Aber Margot weiß ja immer alles besser. Nun hat sie den Salat.
»Aber …?« Mehr bekommt Frau Mehltau nicht heraus, da hat sich Hannelore auch schon in der ersten Bank breitgemacht.
Margot stehen die Wuttränen in den Augen. Und ich werde auf dieser Reise, sollte sie irgendwann wider Erwarten starten, keine ruhige Minute mehr haben. Urlaub vom Seniorenheim haben unsere Vollzugsbeamten es genannt. Aber welchen Namen man einem hässlichen Kind auch gibt, es bleibt hässlich. Die Sinnfrage dieses Urlaubs brauche ich mir auch nicht zu stellen. Was würde das bringen? Ich sitze bereits im Bus. Widerstand jedenfalls sieht anders aus. Der hätte ohnehin nichts genützt. Auch Neinsager brauchen eine Alternative, und in meinem Fall sieht es damit schlecht aus. Unsere Residenz, wie alle unsere Wohnstatt nennen, wird renoviert. Ich glaube nicht, dass das schon notwendig war, aber Jutta glaubt es. Sie hat der gutmütigen Frau Mehltau eingeredet, dass wir alle das Trauma vom Tod unserer Küchenhilfe Selma nur überwinden können, wenn die Wände nicht mehr ockerfarben, sondern grün sind. Angeblich soll das die negativen Energien beseitigen. Selma und ich waren Freunde, und ich vermisse sie, egal, was die Anstreicher mit unseren Zellen anstellen. Aber Frau Mehltau möchte, dass wir uns alle wohlfühlen. Und Jutta kann hartnäckig sein, zumal einem ihrer Stiefenkel die Malerfirma gehört, die den Zuschlag bekommen hat. Dass Jutta an unserem Grün mitverdient, steht dabei wohl außer Frage. Im Ergebnis müssen wir alle eine Woche weg.
Ohne Tumulte ist diese Entscheidung natürlich nicht abgegangen. Alte Leute reagieren auf Veränderungen wie ein Ertrinkender auf Wasser. Aber nachdem die Mehrheit mitgeschnitten hat, dass wir nicht unter irgendeiner Brücke oder in eines dieser überfüllten staatlichen Heime abgegeben werden, war die Sache in Sack und Tüten. Der Rest ist bezüglich des Pflegebettstandorts nicht besonders wählerisch, Hauptsache am Fenster. Dabei muss ich zugeben, dass es uns womöglich schlechter hätte treffen können. Ein paar Tage Seeluft sind nicht übel. Auch wenn abzuwarten bleibt, was unsere Heimleitung unter »hervorragender Unterbringung und exzellenter Verpflegung« versteht. Die Frauen jedenfalls malen sich das Hotel, in dem wir untergebracht sein sollen, in den schillerndsten Farben aus. Ich dagegen bin schon froh, wenn es sich nicht um das nächstbeste Campingdorf handelt. Man weiß doch, wie die von der Pflegekasse ticken. Dass sich unser Eigenanteil wegen dieser Schnapsidee erhöht, können die zumindest schon mal vergessen. Mein Budget ist durch Margots Fußpflegesucht komplett ausgereizt.
»Wir hatten unsere schönste Zeit an der Nordsee, nicht wahr, Helmut.«
An der Art, wie Margot die Worte förmlich singt, merke ich, dass Gefahr im Verzug ist. Ich kenne meine Frau. Sie versucht die Rahmenbedingungen wegzureden, um nicht an die Decke zu gehen. Aber ich bin ein Ehemann und deshalb frei von Illusionen.
»Diese romantischen Abende im Sand. Erinnerst du dich?« Sie schiebt ihren Arm unter meinen.
Ich erinnere mich. Nur nicht an Margot. Im Sommer 1976 saß ich am Strand, mit Paula, der adretten Verkäuferin aus der Nachbarschaft meiner Eltern. Meine Mutter mochte das Mädchen, und wenn ich mich richtig erinnere, mochte ich sie auch. Sie hat nicht den Eindruck erweckt, als würde sie mich irgendwann einmal in ein Altenhaus verfrachten. Wieso ist das damals eigentlich nichts geworden?
Margot redet sich warm und scheint darüber Hannelores Pole-Position zu vergessen. »Wir haben uns ein Bier geteilt, in den Sonnenuntergang gesehen, und du hast mir Geschichten von deiner Arbeit erzählt. Das war alles so aufregend. Was du damals schon alles erlebt hattest. So interessant.«
Paula hat mir immer Mettbrötchen mit zu unseren Verabredungen gebracht und selbstgebackene Sahneschnitten. Und sie hat so wunderschön gelacht. Seit wann hört Margot mir eigentlich zu, noch dazu, wenn es um Berufliches geht?
»Und lustig war es. Dieser ganze Blödsinn, den deine Schüler angestellt haben …«
Die Erinnerungsstunde ist schlagartig beendet. Margot löst die Umklammerung, richtet ihren Kragen und leert ihr Glas mit einer zackigen Armbewegung. Dabei klebt ihre Nase förmlich an der Fensterscheibe.
»Welche Schüler?«, frage ich.
Margot hat es spontan die Sprache verschlagen.
»Nichts ist so erbaulich wie das, was man vor der Ehe erleben durfte«, kommentiert Jutta trocken, ohne sich zu uns umzusehen.
»Zwei Tage vor meiner Hochzeit habe ich ein Affenmännchen seziert, quasi als Übung«, berichtet die Frau Doktor stolz.
»Genau das meine ich«, bestätigt Jutta. »Das bleibt einem für immer erhalten.«
»So eine Eiterbeule am Anus kann einen das Leben kosten«, redet die Frau Doktor weiter.
»Da bin ich mir sicher, Liebes«, entgegnet Jutta.
»Ich wünschte, Karl Heinz hätte sich mal so etwas eingefangen«, antwortet die Frau Doktor. »Aber der musste sich ja nie mit einem Rivalen messen.«
»Interessant«, sagt Jutta. »Dann sind Sie eine sehr anständige Frau, liebe Olga.«
»Karl Heinz war einfach nicht besonders schlau«, entgegnet die Frau Doktor. »Wenn man dumm heiratet, kann man auch nur dumm bekommen.«
Darauf fällt selbst Jutta nichts mehr ein.
Ich kann förmlich sehen, wie es Margot in ihren Sitz zieht. Dann hören wir plötzlich ein Röcheln, ein unschönes Geräusch, das in etwa so klingt, als würde jemand ersticken.
»So ein Mist!« Hannelore reagiert zuerst.
Ich schließe daraus, dass Rolf Jürgen lebt. Frau Mehltau und Pflegerin Monika scheinen das zumindest auch anzunehmen, denn sie zerren den Körper eilig vom Lenkrad und schieben den alten Tattergreis auf seinen Platz. Jutta lag richtig: Rolf Jürgen ist noch nicht dran.
»Was dauert denn hier so lange?«, brüllt er wie von Sinnen. »Wir wollten zum Kaffeetisch da sein. Wieso meint das Jungvolk eigentlich immer, dass wir alle Zeit der Welt haben? Hört ihr es nicht ticken? Ignorante Bagage! Ich schreibe eine Eingabe an die Organisatoren.«
Ich vermute, Rolf Jürgen hat sich den Kopf gestoßen, aber das wird ihn nicht weiter behindern. Uns auch nicht. Die Reise kann also beginnen.
Dann kommt plötzlich Bewegung in die Sache. Frau Mehltau verlässt den Bus, und Janko Varga, unser Koch, taucht im Gang auf und verteilt in einem Affenzahn Provianttüten. Auf meiner Höhe angekommen, bleibt er kurz stehen und schaut mich mitleidig an, während er mir unsere Ration hinhält. »Sorry, Helmut«, murmelt er mit gesenktem Kopf, wobei er mir sanft mehrfach hintereinander auf die Schulter klopft. »Das wird schon.« Den Rest seiner Worte kann ich nicht verstehen, denn er ist schon weitergezogen.
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich meinen, Janko hätte sich für immer von mir verabschiedet. Dabei ist er nach Selma der einzige Mensch in diesem Siechenheim, mit dem ich mich auch mal über normale Dinge unterhalten kann, also alles jenseits von Speiseplan, TV-Programm, Krankheit und Tod. Jankos jugendliche Frische tut mir gut. Abgesehen davon mag ich sein Geschnetzeltes.
»Hoffentlich hat er an meinen Streichkäse gedacht«, meckert Margot, der ich umgehend beide Tüten reiche, damit sie den Inhalt inspizieren und sich das Beste heraussuchen kann. Ein wenig vorauseilender Gehorsam kann einem Mann das Eheleben durchaus erleichtern. »Schnitzelbrötchen!«, stellt sie voller Zufriedenheit mit dem ersten Blick fest.
»Es ist Donnerstag, natürlich«, bestätigt Jutta. »Was sollten wir denn sonst essen?«
Der Schnitzeldonnerstag ist bei uns im Heim etwas Heiliges, gegen das niemals verstoßen werden darf. Eine Abweichung vom Plan könnte Tumulte auslösen.
»Es ist Mittwoch«, widerspreche ich.
»Du musst dich irren, lieber Helmut«, erwidert Jutta. »Schnitzel gibt es nur am Donnerstag.«
Offenkundig nicht, denke ich und frage mich, wie groß das schlechte Gewissen unserer Heimleitung sein muss, wenn sie uns außer der Reihe das panierte Schweinefleisch vorsetzt. »Mittwoch«, wiederhole ich.
»Donnerstag«, flötet Jutta.
»Mi…«
»Helmut!«, faucht Margot mich an. »Das ist nicht von Belang.«
Wenn wir so an die Sache rangehen, steht es um uns noch schlimmer, als ich bislang angenommen habe.
»Der Donnerstag kommt neuerdings öfter vor«, bemerkt die Frau Doktor mit hörbarem Unbehagen. Sie hasst Schnitzel. Dann fängt sie an zu gackern. »An einem Donnerstag hat Karl Heinz sich aus der Wohnung ausgesperrt. Und am Mittwoch habe ich es bemerkt.« Sie freut sich über diese Erinnerung.
»Sehen Sie, liebe Olga, so hat jeder seinen ganz besonderen Wochentag«, antwortet Jutta und nimmt einen anständigen Bissen von ihrem Brötchen. Ich kann das gebratene Fleisch riechen und sie kauen hören. »Mhm. Lecker«, schmatzt sie. »Es geht doch nichts über ein ordentliches Schnitzel, am besten täglich.«
»Wir sind ja noch nicht mal losgefahren«, echauffiert sich Margot mit gedämpfter Stimme. »Wie kann man denn nur so verfressen sein. Etwas mehr Zurückhaltung würde ihr wahrlich guttun, bei der Figur.« Den letzten Satz formt sie quasi nur noch mit den Lippen, aber ich kenne sie lange genug, um ihn trotzdem zu verstehen.
»Haben Sie wegen des übermäßigen Fleischkonsums schon wässrigen Durchfall?«, will die Frau Doktor wissen.
Jutta stellt spontan das Mampfen ein und sieht die Frau Doktor mit hochgezogener Augenbraue an. »Du liebe Güte, wie unappetitlich.«
»Ich bin da nicht so zimperlich«, entgegnet die Frau Doktor. »Exkremente gehören zu meinem täglichen Geschäft. Ich sehe mir auch gern Ihr Zahnfleisch an. Das muss Ihnen nicht peinlich sein.«
»Bitte!« Das ist selbst für die hartgesottene Jutta etwas viel. »Warum mischen Sie sich in mein Mittagessen ein?«, fragt sie verschnupft.
»Darüber können wir später reden«, entgegnet die Doktorin. »Erst ist Ihre Mangelerscheinung dran! Die ist dringlicher.«
»Welche Mangelerscheinung?«, will Jutta wissen und wirkt dabei von dieser Unterhaltung noch immer etwas überfordert.
»Wer ernährt sich denn nur von Schnitzel?«, faucht die Frau Doktor. »Ohne eine ausreichende Vitaminversorgung geht in unserem Alter nichts mehr. Da gehen die Leute zum Arzt, aber dessen Meinung wollen sie trotzdem nicht hören.«
»Aber liebe Frau Olga«, entgegnet Jutta mit hoher Stimme, die ihre Erleichterung deutlich erkennen lässt. Offenkundig hat sie bemerkt, dass sie einem Missverständnis aufgesessen ist. »Schnitzel gibt es nur einmal in der Woche, am Donnerstag. Machen Sie sich bitte keine Sorgen.«
»Donnerstag ist ein guter Tag«, antwortet die Frau Doktor. »Da ist Karl Heinz verschwunden. Und ich habe seine beste Flasche Wein geköpft.«
»Na sehen Sie«, erwidert Jutta und widmet sich wieder ihrem Brötchen.
Ich grüble derweil. Das war doch nicht wirklich etwa Jankos ungelenke Art, sich von mir zu verabschieden? Er hätte auch einfach sagen können, dass er gekündigt hat. Womöglich haben die auch die Gelegenheit genutzt, ihn zu entlassen? Immerhin steht das Haus in der nächsten Woche leer. Keine Senioren, keine Schnitzel. Für Sparmaßnahmen beziehungsweise Umstrukturierungen ist das doch eine perfekte Gelegenheit. Womöglich lassen die unser Essen bald aus irgendeiner Großküche anfahren. Dann könnte das hier die letzte Gabe unseres Proviantmeisters gewesen sein. Unversehens nehme ich Margot die noch ungeöffnete zweite Tüte aus der Hand und mache mich daran, sie zu durchwühlen.
»Helmut, also wirklich. Es ist ja nicht so, als hättest du heute noch kein Frühstück gehabt. Meine Güte!«, erregt sich Margot. »Du bist ja genauso peinlich wie …« Sie deutet mit dem Kopf in Richtung Vordersitz.
Ich konzentriere mich auf den Inhalt des Brotbeutels. Immerhin kann es sein, dass mein Freund Janko mir eine Botschaft hat zukommen lassen. Ganz am Anfang meiner Karriere gab es mal einen Seriendieb. Bei jedem Bruch, den er gemacht hat, hat er uns irgendeinen Gegenstand hinterlassen. Kleine Puzzlesteine, die am Ende die wichtigsten Stationen seines Lebens ergeben sollten. Weiter als bis zur Grundschule ist er damit nicht gekommen. Wir waren bei unserer Verbrechersuche auch nicht ganz blöd. Der Mann hatte jedenfalls etwas zu sagen, das er anderweitig nicht loswerden konnte, eine schwere Kindheit in Bildern oder so. Janko spricht auch nicht viel. »Aha!«, rufe ich im Überschwang der Emotionen aus.
»Hast du auch Streichkäse bekommen?«, will Margot wissen.
Der Himmel bewahre. »Nein«, antworte ich und schließe daraus, dass sie vor lauter Käseeuphorie nicht dazu gekommen ist, den Inhalt meiner Tüte zu inspizieren. Das trifft sich sehr gut.
»Schade«, erwidert Margot enttäuscht.
Ich habe etwas viel Besseres als diesen blöden Käse, denke ich. Unser Koch hat mir einen Flachmann zukommen lassen, fein säuberlich in dickes Papier eingeschlagen. Trotzdem kann man die Flasche gut ertasten. Der gute Janko ist also der Meinung, dass ich etwas Hochprozentiges auf dieser Tour gebrauchen könnte. Interessant. Zufrieden schließe ich mein Paket und verstaue es im Netz am Rücksitz der Frau Doktor. Sie scheint das bemerkt zu haben und sich dadurch gestört zu fühlen.
»Huch! Das Boot schaukelt aber ganz schön«, jauchzt sie begeistert.
»Aber wie!«, frohlockt Jutta und lässt albern ihren Oberkörper kreisen. »Gefährlich!« Sie lacht.
»Auf der Titanic war es schlimmer«, kommentiert die Frau Doktor. »Glücklicherweise erinnere ich mich nicht mehr so genau an alles. Sonst wäre ich nicht mitgekommen. Ich mag Seereisen eigentlich überhaupt nicht.«
»Wenn einem vom Seegang nicht übel wird, ist doch alles fein«, entgegnet Jutta. »Wir sitzen aber in einem Bus, liebe Olga.«
Die Frau Doktor reißt den Kopf herum und starrt Jutta voller Abscheu an. »Eine Busreise?«
»Aufregend, nicht wahr«, entgegnet Jutta.
»Wie spießig. Lassen Sie sich bloß keine Heizdecke aufschwatzen. Es ist heiß genug«, entgegnet die Doktorin. Dann schlägt die Stimmung um. »Wo sind eigentlich die bettlägerigen Patienten?«, will die Frau Doktor hörbar besorgt wissen. Dazu blickt sie sich immer wieder suchend um. »Sind die schon evakuiert worden?«
»Die sind im Anhänger untergebracht«, antwortet Jutta mit absolutem Selbstverständnis.
»Dort, wo die Koffer sind?«, will die Frau Doktor schon deutlich beruhigter wissen. »Und Karl Heinz?«
»Genau«, bestätigt Jutta. »Und die Fahrräder.«
Ich unterdrücke den Drang, mich nach dem vermeintlichen Anhänger umzuschauen. Heutzutage kann man sich mit nichts mehr sicher sein. Glücklicherweise vergesse ich es umgehend wieder, denn Janko kommt zurück und nickt mir aufmunternd zu. Er versucht es zumindest, denn er kann mir kaum in die Augen gucken. Was um alles in der Welt habe ich nicht mitbekommen? Ich sehe ihm noch nach, aber ehe ich irgendetwas sagen kann, hat er im Laufschritt den Bus verlassen, und ich kann nur noch sehen, wie er im Haus verschwindet.
»Streichkäse. Zwei Portionen«, stellt Margot zutiefst zufrieden fest.
Hauptsache, ich muss das nicht zuzahlen. Seit wann werden eigentlich Extraportionen verteilt? Normalerweise zählen die doch sogar die Gurkenscheiben ab. Was um alles in der Welt hat Janko gutzumachen, sogar an Margot?
Im nächsten Augenblick taucht Irenka Kowalczyk auf. Der Anblick der adretten jungen Frau, die sich ihre Lippen immer so wunderbar rot anmalt, führt tatsächlich dazu, dass der Busfahrer seinen ersten Fahrgast wahrnimmt. Sein Stieren würde ich zumindest so deuten. Rolf Jürgen hingegen ist über die Phase des Augenkontakts lange hinaus. Er geht in die Vollen und versucht zu grabschen. In seinem Alter hat man eben nichts mehr zu verlieren. Irenka ist lange genug im Heim beschäftigt, dass sie die Entgleisungen des fossilen Schwerenöters kennt. Irenka? Was hat unsere Reinigungskraft eigentlich hier zu suchen?
Mir bleibt keine Zeit, darüber nachzudenken, da hüpft direkt hinter ihr Kai-Uwe in den Bus. Wieso muss sich ein unrechtmäßig im Fernsehraum eines Seniorenheims hausender Anfang zwanzigjähriger Taugenichts am Meer erholen? Die Heimleitung wollte ihn doch lange vor die Tür gesetzt haben? Wer bitte zahlt diese Extrawurst? Kai-Uwe garantiert nicht. Mit einem schmierigen Grinsen wartet er, bis Irenka Platz genommen hat, wobei er ihren Hintern nicht aus den Augen lässt. Schließlich schreit er freudestrahlend in die Runde: »Hey Leute! Was geht? Alle noch mal brav Pippi gewesen, bevor wir ganz easy zum großen Wasser cruisen?«
Diese Unverschämtheit bleibt selbstverständlich unbeantwortet, was ihn jedoch augenscheinlich wenig interessiert. Er schlurft entspannt los. Dabei lässt er es sich nicht nehmen, jeden mit Ghettofaust und irgendwelchen sinnfreien Kraftausdrücken zu begrüßen. Bei einigen von uns löst dieser ungewohnte Gruß sichtbare Verwirrung aus. Dass dieses Spielchen spätestens bei Frau Doktor Böttcher ein jähes Ende finden würde, hätte ich ihm sagen können. Ohne Vorankündigung rammt sie ihm das dicke Telefonbuch, dessen ausgiebiges Wälzen ihr in ihren schwierigen Phasen offenbar eine Hilfe ist, in die Magengrube. Kai-Uwe krümmt sich und schleicht an uns vorbei, was Margot wiederum beruhigt ausatmen lässt. Kai-Uwe bevorzugt die letzte Bank. Dass dort schon Erwin Zentgraf auf dem Mittelplatz sitzt und auf einer über seinem Schoß ausgebreiteten Straßenkarte die Fahrtstrecke einzeichnet, stört ihn nicht. Er klettert über Erwin hinweg, knallt sich in die Ecke und döst. Dann schließt sich die Tür, um schon im nächsten Augenblick wieder aufzugehen. Frau Mehltau stürzt herein. »Meine lieben, lieben Gäste«, sagt sie in dem für sie typischen Singsang einer Kindergartentante, wobei sie die Hände vor ihrer Brust faltet, als wollte sie ein Gebet sprechen. »Ich wünsche Ihnen eine ganz, ganz tolle Zeit. Sie werden sehen, wie gut Ihnen diese kleine Reise tun wird. Die Ostsee hat eine ganz besonders positive Energie. Saugen Sie diese bitte ganz, ganz fest auf. Und kommen Sie bloß alle gesund und munter wieder zurück. Wir brauchen Sie noch!« Sie schluckt sichtbar ein paar Tränen herunter.
Rolf Jürgen beugt sich daraufhin nach vorn und streichelt ihr die Wange. »Wenn Frauen beim Abschied weinen, schreien sie auch im Bett«, lässt er uns alle wissen.
Frau Mehltau nickt, als hätte sie seine Worte nicht verstanden. Mehr Zuspruch kann sie von einem Haufen bis zum Anschlag gespannter Alter auf dem Weg in die Fremde nicht erwarten. Sie bleibt noch eine Weile stehen und lächelt versonnen, dann dreht sie sich zu unserem Fahrer um und erklärt unter Zuhilfenahme ihres Zeigefingers: »Sie denken bitte daran, unsere Gäste wünschen keine Verkaufsveranstaltung. Wir haben Sie nur für den Transport gebucht. Das haben wir schriftlich. Ich muss mich da auf Sie verlassen können! Ich habe die Verantwortung.«
Der Busfahrer quittiert das mit einem nach oben gestreckten Daumen, wobei ich ihm ansehen kann, dass er liebend gern ein Extrageschäft mit uns gemacht hätte.
»Tschüssi!« Frau Mehltau winkt uns noch einmal und verschwindet.
Der Bus fährt an. Ich kann noch sehen, wie unsere Heimleiterin, ihr schmieriger Assistent Lennox Bergmann und der Auszubildende Peter Bause auf dem Gehweg zurückbleiben. Frau Mehltau winkt, wobei sie sich immer wieder über die Wangen wischt, um ein paar Tränen zu beseitigen. Bergmann hingegen kann seinen Triumph nicht verbergen und grinst von einem Ohr bis zum anderen, während sich Bause sichtbar leidenschaftslos eine Zigarette ansteckt. Da haben wir es also. Die haben sich abgesetzt und schicken uns mit der C-Garde ausstaffiert in die Fremde. Aber sei es drum. Ich werde seit sechsundvierzig Jahren das erste Mal wieder ans Meer fahren und wäre nicht mal erstaunt, wenn dies eine Reise ohne Wiederkehr werden würde.
Über Land wären wir schneller …« Erwin Zentgraf kommentiert jetzt seit einer geschlagenen Stunde unsere Fahrtroute. »Kollege, du hättest die letzte Ausfahrt einfach rausfahren müssen, dann über die Dörfer. Das bringt uns locker zehn Minuten.« Er kontrolliert das noch mal durch einen schnellen Blick auf die noch immer auf seinen Oberschenkeln liegende Karte. »Genau. Die letzte raus. Jetzt ist es zu spät.« Das Papier raschelt. »Nummer achtundzwanzig wäre noch machbar. Dann fahren wir einen kleinen Umweg, aber am Ende sind das noch immer mindestens acht Minuten Zeitgewinn.«
Auch wieder so ein Ding. Alte Leute können niemals ruhig sein oder ihre gut gemeinten Ratschläge für sich behalten. Besonders schlimm ist es, wenn sie, wie in unserem Fall, in Gruppen auftreten. Irgendeiner hat immer etwas kundzutun, ob sinnvoll oder nicht. Auch die Frage der Empfängerbereitschaft ist vollkommen nebensächlich. Hauptsache, die Worte sind in der Welt. Manchmal denke ich, es handelt sich um eine Art zwanghaftes Verhalten, ein Schrei nach Aufmerksamkeit, gepaart mit dem Hinweis auf die eigene Existenz. In einer Gesellschaft, die die älteren Generationen zumeist vollständig ausblendet, gehört das wohl dazu. Ganz erstaunlich finde ich es jedoch, dass die Alten nicht mal unter sich mit gutem Beispiel vorangehen. Kurzum, niemand im Bus nimmt Notiz von Erwins Verbesserungsvorschlägen.
»Und dann sind wir nach Dänemark rüber. Da ist ja nicht viel. Meine Fresse, die haben vielleicht blöd aus der Wäsche geguckt, als die uns gesehen haben.« Rolf Jürgen lehnt sich zurück, haut sich voller Begeisterung auf die dürren Schenkel, um sich dann sogleich wieder nach vorn zum Busfahrer zu beugen und weiterzureden. »Bursche, du kannst das nicht wissen, aber in zwei Tagen waren wir durch, und dann zack«, ein erneuter Schlag auf seine Beine folgt, »schon standen wir in Oslo. Kannst du dir das vorstellen? In zwei Tagen?« Er boxt in die Luft. »Da herrschte noch Zucht und Ordnung. Wenn die deutschen Jungs aufgelaufen sind, stand die Welt stramm.«
Der Busfahrer interessiert sich offenbar herzlich wenig für deutsche Jungs. Sein Blick klebt stur auf der Straße.
Hannelore sieht auch nicht besonders angetan aus. Zwischen sich und ihrem Banknachbarn hat sie ein Bollwerk aus Handtasche und Schuhbeuteln aufgebaut und ihm den Rücken zugedreht. Entsprechend genießt sie die Aussicht in der ersten Reihe nun über die Seitenscheibe. Das geschieht der alten Schachtel recht. Aber klein beigeben und sich auf ihren eigentlichen Platz zurückziehen, das kann sie einfach nicht.
»Da haben die Wikinger nicht gezuckt. Das kannst du glauben. Einen jungen deutschen Mann erkennst du überall auf der Welt.« Rolf Jürgen streckt beide Fäuste in die Luft und lässt sie mehrfach hintereinander nach unten sausen. »Disziplin. Schneid. Verantwortungsgefühl. Dass wir auch optisch bei den Mädels etwas hergemacht haben, versteht sich von selbst.« Er kichert lüstern. »Und das Beste: Das bewahrt man sich, das vergeht nicht. Niemals! Das sind unsere Gene. Etwas Besseres gibt es nicht auf der Welt.« Sein zufriedenes Lachen hallt durch den ganzen Bus.
Ich drehe mich zu Kai-Uwe um, unseren im Schlaf sabbernden Heimnomaden mit seinen fettigen Haaren, den unrasierten Wangen und zerschlissenen Hosen. Die deutschen Jungs sind auch nicht mehr das, was sie mal waren.