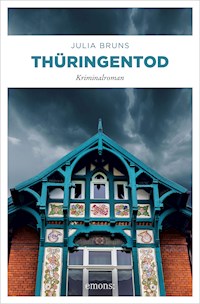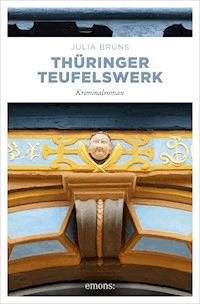Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Bernsen und Kohlschuetter
- Sprache: Deutsch
Aufruhr im beschaulichen Rudolstadt: Ein Mann ist während des Barockfestes aus dem Fenster von Schloss Heidecksburg gefallen. Oder wurde er gestoßen? Die Ermittlungen führen die Komm issare Bernsen und Kohlschuetter immer wieder zurück zur Burg – und mitten hinein in ein verworrenes Netz aus falscher Moral, Dünkel und Lügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Julia Bruns wurde in einem kleinen Dorf mitten in Thüringen geboren. Die promovierte Politikwissenschaftlerin arbeitete viele Jahre als Redenschreiberin und in der Öffentlichkeitsarbeit. Heute schreibt sie als freie Autorin, am liebsten Krimis aus ihrer Heimat Thüringen.
www.thueringen-kommissare.de.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden mit Ausnahme einiger historischer Personen. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Editio Dialog Literary Agency, Lille.
©2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: ©photocase.com/five Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Marit Obsen eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-978-3 Thüringen Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter
Für Carl Nikolaus
Tausend ähnliche besser und schlechter gegründete Vermutungen erzählte man sich als Wahrheiten, vertraute man sich mit geheimnisreicher Miene.
Johann Karl Wezel, »Herrmann und Ulrike«, komischer Roman, Leipzig 1780
Prolog
1882
Sie stand am Fenster. Zehn, vielleicht zwanzig Minuten schon. Die Sonnenstrahlen fielen durch die bunten Glasscheiben und färbten ihr ebenmäßiges Gesicht grün, ihr schlanker, eleganter Hals schimmerte rot. In Gedanken versunken strich sie mit den Fingern zart über das im Fenster eingelassene Wappen. Der schwarze doppelköpfige Reichsadler glänzte matt. Heute schien er ihr noch vertrauter als sonst, wie ein guter Freund, mit dem man ein Geheimnis teilt.
Sie hatte sich nach oben geschlichen, das Geländer mit beiden Händen fest umklammert, um auf der steilen Treppe den Halt nicht zu verlieren. Ihre nackten Füße hatte sie behutsam auf die Stufen aufgesetzt, dann knarrte das Holz am wenigsten, das wusste sie genau. Im Obergeschoss angekommen, war sie regungslos stehen geblieben und hatte mit angehaltenem Atem gelauscht. Nichts. Nur das wilde Rauschen der Schwarza und das Zwitschern einiger Vögel. Dann, nach einer ganzen Weile, hatte sie wieder zu atmen gewagt, nur ganz flach, denn sogar das konnte verräterisch sein. Langsam hatte ihre schmale Hand die gusseiserne Türklinke umfasst, sie mit ganzer Kraft nach unten gedrückt und die Tür zu der kleinen Wohnung vorsichtig, Millimeter für Millimeter, aufgeschoben.
Die Sehnsucht schien ihr hier oben noch unerträglicher. Kalter Zigarrenrauch mischte sich mit dem schweren, süßlichen Duft des Fliederstraußes, den Ida, die gute Seele des Hauses, heute Morgen auf den Schreibtisch gestellt hatte. Ida war die Einzige, die in die Wohnung durfte, nur für die Zeit des Herrichtens, nicht mehr. Niemand sonst, nicht einmal ihr Vater, betrat das Obergeschoss. Niemals würde er es wagen. Denn keiner im Haus wusste, wann er wieder hier sein würde. Manchmal flüsterte er ihr beim Gehen ein »In zwei Tagen« oder »Bis nächste Woche« zu. Doch sie wäre lieber gestorben, als jemandem nur ein Wort davon zu erzählen. Das war Teil ihrer Abmachung, unausgesprochen, aber allgegenwärtig. Das Risiko, ihn zu verlieren, war zu groß.
Natürlich ahnte der Vater etwas. Sein Blick verriet es ihr an jedem Morgen, der auf die viel zu kurzen Nächte folgte. Doch während all der Jahre – dreizehn, da war sie sich ganz sicher – hatte er nie ein Wort darüber verloren. Er sorgte sich um sie. Und um den Ruf der Familie. Ein fürstlicher Tiergärtner war schließlich nicht irgendwer. Die Leute würden reden, wenn auch nur der geringste Verdacht aufkäme. Doch das interessierte sie nicht, wenn sie nur bei ihm sein konnte. Sie wartete auf die eine, alles entscheidende Frage. Eine Frage, die niemals kommen würde.
Leise seufzend warf sie einen letzten zärtlichen Blick auf den Adler im Fenster. Heute würde er zurückkehren, so hoffte sie, vielleicht war er sogar schon unterwegs zu ihr. Dann nahm sie den Weg, den sie gekommen war, vorsichtig, damit sie niemand hörte.
***
Fürst Georg von Schwarzburg-Rudolstadt zwirbelte seinen Bart, bedeutete dem Stallmeister mit einem steifen, nur für das geübte untertänige Auge sichtbaren Kopfnicken seinen Dank und schwang sich auf »sweet heart«, sein Lieblingspferd. Kurz darauf flog der Sand unter den Hufen des Tieres auf, und Pferd und Fürst galoppierten durch das Nordtor der Heidecksburg, des Fürsten Residenz hoch über dem kleinen Städtchen Rudolstadt. Der Stallmeister rieb sich die Augen, schaute Ross und Reiter noch einen kurzen Moment lang unschlüssig nach und ließ seinen Blick dann über die eindrucksvolle Fassade des Hauptwohnsitzes seiner Herrschaft gleiten. Für einen Moment glaubte er, das Antlitz Elisabeths, Fürstin zur Lippe und Georgs Schwester, an einem der oberen Fenster des Südflügels gesehen zu haben. Doch er wagte nicht, sich zu vergewissern, sondern kehrte um und ging in den Marstall zurück.
Fürst Georg machte unterdessen einen kurzen Abstecher in den Hain und bog dann in die westliche Neustadt ein, um gemächlichen Schrittes durch die Augustenstraße zu reiten und sich die neu erbauten Villen mit ihren Erkern, Türmchen und einladenden Loggien anzusehen. Umgeben waren diese »Landhäuser«, wie sein alter Staatsminister von Bertrab immer zu sagen pflegte, von tiefen parkähnlichen Gärten, in denen die Dienerschaft der Hausbewohner auch allerlei Gemüse und Küchenkräuter anbaute.
Der volksnahe Georg blieb stehen und erfreute sich an einer lebhaften Diskussion zweier junger Mägde, die sich im Garten der Damm’schen Villa um die Zahl der von ihrer Herrschaft zu verspeisenden Mairüben stritten. Bei jeder sich ihm bietenden Gelegenheit beobachtete der Fürst das geschäftige Treiben seiner Untertanen, am liebsten unbemerkt von der Heidecksburg aus mit seinem Fernrohr. Interessiert betrachtete er den weitläufigen Garten des Hauses, der sich bis zur Großen Allee hinzog. Kaum fünf Jahre war es her, dass Konsul Damm, der sein Geld in den mexikanischen Silber- und Schwefelbergwerken machte, dieses prachtvolle Haus errichten ließ. Er war einer der zahlreichen Fabrikanten und Gewerbetreibenden, die es mit ihren industriellen Neugründungen nach Schwarzburg-Rudolstadt und mit ihren Wohnhäusern hinaus aus den engen Gassen der Altstadt ins ländliche Grün zog. Überall wuchsen Fabriken und Villen aus dem Boden und zeugten von dem Aufschwung des bis zu Georgs Amtsantritt im Jahr 1869 rückständigsten deutschen Fürstentums. Schwarzburg-Rudolstadt hatte sich unter seiner Regentschaft prächtig entwickelt.
Georg sah das mit Stolz, war er doch ein aufgeschlossener Förderer der Moderne. An diesem schönen Maimorgen stand ihm jedoch der Sinn nach etwas anderem. Er war auf dem Weg zur »Oppelei« im Schwarzatal. Am frühen Nachmittag wollte er sie erreichen. Georg schnalzte mit der Zunge, gab »sweet heart« etwas Zügel, touchierte den Bauch des Pferdes sanft mit seinem Reitstiefel und setzte seinen Weg fort. Er ritt zur Saale hinunter, folgte dem Fluss bis zur Mündung der Schwarza und bog dann, ohne das Ufer der Schwarza zu verlassen, in Richtung Bad Blankenburg ab.
Zwei Stunden später ritt er hoch erhobenen Hauptes in das Schwarzatal ein, saß ab, führte »sweet heart« an eine seichte Stelle des Flusses und genoss die klare Luft unter dem dichten Blätterdach der Bäume. Nur wenige Meter flussaufwärts standen ein paar Bauernburschen bis zu den Knien im Wasser. Die Nasen direkt über der Oberfläche, hielten sie ihre Hände unermüdlich in den kalten Lauf. Offensichtlich hofften sie, die Schwarza würde den einen oder anderen Flitter Seifengold hineinbefördern. Als sie den Fürsten bemerkten, rannten sie quer durch den Wald davon.
Georg schmunzelte erhaben, griff nach den Zügeln des Pferdes und setzte seinen Weg fort. Keine sechs Kilometer später tauchten zwischen den großen Fichten der Giebel und das weit überhängende flache Satteldach des holzverkleideten Obergeschosses der »Oppelei« auf.
Er liebte dieses Haus, das sein Onkel, Fürst Friedrich Günther, für den fürstlichen Tiergärtner eigens hatte erbauen lassen und in dessen Obergeschoss sein braver Staatsminister von Bertrab ihm – nicht ohne einen gewissen stillen Missmut – eine kleine Wohnung eingerichtet hatte. In der abgeschiedenen Ruhe der Natur, weitab von den Pflichten und Konventionen eines Fürsten, konnte er sich seiner Leidenschaft für die Jagd und seinen forstwirtschaftlichen Studien widmen. Später einmal, nach dem Ende der Monarchie, würde das Land Thüringen vor allem von Letzterem profitieren.
Georg lenkte »sweet heart« nach rechts und überquerte die Schwarza auf einer schmalen Holzbrücke. Schon von Weitem sah er sie. Mathilde, die Tochter seines Tiergärtners. Und als ob es seine Sehnsucht spüren konnte, galoppierte das Pferd über die alten trockenen Bretter zum anderen Ufer des Flusses.
Wie schön sie immer noch war mit ihren neunundzwanzig Jahren, ganz das junge Mädchen, das er damals bei einem Jagdausflug das erste Mal gesehen und in das er sich Hals über Kopf verliebt hatte.
Mathilde stand auf der Galerie des Hauses und schaute ihm entgegen. Sie lächelte verlegen. Georg grüßte fast schon herzlich, übergab dem heraneilenden Tiergärtner Oppel sein Pferd und ging ins Haus.
***
Elisabeth war lange vom Fenster zurückgetreten. Sie saß auf einem der Biedermeierstühle in ihrem Gemach und schaute Staatsminister von Bertrab sorgenvoll an.
»Der Fürst reitet aus«, sagte sie mit vollkommen ruhiger und gefasster Stimme, die keinerlei Rückschluss auf ihre Gefühle zuließ. Dann strich sie sanft mit der Hand über ihr Kleid.
Immer wenn sie auf dem Schloss ihres Bruders zu Gast war, was seit ihrer Hochzeit mit Leopold III. Fürst zur Lippe nur noch selten vorkam, trug sie ihr Tageskleid aus grünem Wollstoff, das mit schwarzen Schnur-Applikationen und Posamenten verziert war. Ein breites Samtband ließ ihre schlanke Taille noch schmaler erscheinen. Die dunklen Haare hatte sie elegant nach oben gesteckt. Ihr Alter sah man ihr nicht an. Einzig ihre müden Augen und die dicken Sorgenfalten auf ihrer Stirn ließen ihr Alter erkennen.
Elisabeth sorgte sich um die Zukunft der Fürstenfamilie. Vier Geschwister hatten die Eltern in der Familiengruft beisetzen müssen. Nur Georg und Elisabeth lebten noch und konnten das Blut der Schwarzburg-Rudolstädter weitertragen. Ihr selbst war dieses Glück nicht vergönnt gewesen, sosehr sie sich auch Kinder gewünscht hatte, und ihre ganze Hoffnung ruhte nun auf ihrem Bruder Georg. Schließlich trug er Verantwortung für sein Fürstentum.
»Ja, Hoheit. Zweimal in der Woche beliebt es dem Fürsten, nach Schwarzburg zu reiten.« Hermann Jakob von Bertrab verzog keine Miene. Mit durchgedrückten Schulterblättern saß der gealterte Staatsminister, der schon seit zwei Fürstengenerationen auf der Heidecksburg diente, auf seinem Stuhl und schaute die Fürstin unverwandt an.
»Zweimal in der Woche«, wiederholte sie, um nach einer kurzen Pause leise zu ergänzen: »Er ist bereits im vierundvierzigsten Lebensjahr.«
Von Bertrab nickte. Seit der geplatzten Verlobung mit Marie von Mecklenburg-Schwerin schien eine Heirat – ein Thronfolger gar – in weite Ferne gerückt zu sein. Es hatte seither keine eindeutigen Heiratsabsichten seines Landesherrn mehr gegeben, und der eine oder andere Fehltritt des lebensfrohen Fürsten ließ die erlauchte Damenwelt auf eine Einheirat ins schöne Rudolstadt verzichten.
»Der Fürst besuchte kürzlich die Richter’sche Fabrik, wurde mir zugetragen.« Elisabeth wechselte gekonnt das Thema. »Man soll dort Kinderspielzeug anfertigen.«
»Ja, Eure Hoheit, Baukästen.«
Von Bertrab berichtete ausführlich über »F. Ad. Richter & Cie. Fabrikation und Vertrieb chemisch-pharmazeutischer Präparate und Heilmittel«, dieses neue Unternehmen, das sich vor einigen Jahren, 1876, in der Stadt angesiedelt hatte und nun das erste Systemspielzeug der Welt produzierte. Detailverliebt beschrieb er die Vorzüge der Spielsteine, streng darauf bedacht, das unangenehme Thema des Familienstandes seines geschätzten Landesherrn zu vermeiden.
***
Mathilde wartete bis zum Einbruch der Nacht. Dann schlich sie sich in altbewährter Manier ins Obergeschoss. Die Tür stand einen Spalt breit offen, er erwartete sie. Ohne ein Wort trat sie ein. Schließlich durfte sie ihn bei seinen wichtigen Aufgaben nicht stören. Das mochte er nicht.
Georg stand mit dem Rücken zu ihr am Fenster und schaute in die Dunkelheit. Seine blaue Lieblingsuniform mit den schwarzen Aufschlägen der magdeburgischen Dragoner – 1876 hatte ihn der Kaiser zum Chef des Magdeburgischen Dragoner-Regiments Nr.6 der 21. Kavallerie-Brigade ernannt – hatte er ausgezogen und über einen Stuhl gehängt. Hinter ihm auf dem kleinen runden Tischchen mit den dicken geschwungenen Beinen stand eine schwere Weinkaraffe mit einer Silbermontierung in Form eines Löwenkopfes, dessen Maul über einen Klappdeckel geöffnet werden konnte. Eine brennende Kerze spiegelte sich in zwei Weingläsern, auf deren Kelchen das Spiegelmonogramm G für Georg eingraviert war. Das Feuer im Kachelofen knisterte behaglich. Die Mainächte konnten hier draußen im Wald ziemlich kühl werden.
Ohne sich umzudrehen, sagte er: »Du kommst spät, Mathilde.
»Ja, Hoheit«, flüsterte sie. »Die Eltern waren noch auf.«
»Du kannst mir einschenken. Dir auch«, beschied er sie in dem leicht verärgerten Ton, der ihr in all den Jahren so vertraut geworden war wie das Schnalzen seiner Zunge, nachdem er den ersten Schluck Wein probiert hatte.
Mit vorsichtigen Schritten, immer darauf bedacht, das Knacken der Dielen zu vermeiden, ging Mathilde zu dem Tischchen, nahm den Wein und schenkte ihm ein.
Erst als er den Löwendeckel wieder zuklappen hörte, drehte er sich langsam zu ihr um und schaute sie an.
Die stattliche Erscheinung dieses groß gewachsenen Mannes mit den ebenmäßigen Gesichtszügen und den sanften, gutmütigen Augen, dessen Gestik und Mimik der gesammelten Würde eines preußischen Offiziers entsprach, ließ ihre Wangen erglühen. Mit gesenktem Kopf reichte sie ihm das Glas.
Er griff danach, doch statt etwas zu trinken, stellte er es kurzerhand zurück neben die Karaffe. Dann machte er einen Schritt auf sie zu, umfasste fest ihre zarten Schultern und zog sie an sich. Sein fordernder Kuss dauerte eine gefühlte Ewigkeit und war nicht weniger leidenschaftlich als ihre erste Begegnung. Er führte sie in das Nebenzimmer und drückte sie zärtlich, aber mit sicherem Griff auf die dunkelgrüne schwere Chaiselongue hinab, um ihr sofort zu folgen, als könnte sie ihm andernfalls ihre Liebe verwehren.
Die fürstlichen Hosen fielen so schnell wie die französischen Truppen in der Schlacht von Sedan, und mit jedem seiner immer tiefer werdenden Atemzüge wähnte sich Mathilde ihrem Glück ein Stückchen näher. Nicht ahnend, dass sie sich mit dieser Nacht nur noch weiter davon entfernte.
1
»Wir haben uns verfahren«, murrte Bernsen voller Ungeduld. Er zog geräuschvoll seine Nase hoch. »Ich hab doch gleich gesagt, Sie sollen das Navi anschalten.«
Kohlschuetter antwortete nicht. Seit sie den Hohenfeldener Stausee passiert hatten, wiederholte sein reizender Kollege diese Worte alle fünf Minuten. Und er hatte einfach keine Lust mehr, darauf zu reagieren. Natürlich wusste er entgegen Bernsens Annahme genau, wo sie sich gerade befanden, auf der B85 nämlich, kurz hinter der kleinen Stadt Teichel, etwa zehn Kilometer vor Rudolstadt. Immerhin kannte er die schöne Floristin des Rudolstädter Nordfriedhofs und damit den Weg dorthin überaus gut, bis vor drei Wochen zumindest.
Da hatte sie beim Paulinzellaer Kulturfestival plötzlich neben ihm gestanden – und neben Nadine, der neuen Bedienung aus seiner Erfurter Stammkneipe. Die Situation war eigentlich vollkommen unverfänglich gewesen. Nadine hatte auf seinen Schultern gesessen und Axel Prahl und sein Inselorchester lautstark mit ihrer eigenen Interpretation seiner Lieder begleitet. Zwischendurch hatte sie einen Schluck aus dem Bierbecher genommen, den sie sich teilten. Mehr nicht. Irgendwie muss das wohl anders ausgesehen haben. Die Worte aus dem sonst so lieblichen Mund der süßen Floristin hatten jedenfalls keinen Zweifel daran gelassen. Nadines anschließender Abgang auch nicht.
»Großkochberg«, murmelte Bernsen auf dem Nachbarsitz, als sie ein Hinweisschild passierten. »Gibt es da ein Factory-Outlet oder so etwas?«
Kohlschuetters Blick ging nach rechts. Gerade noch konnte er aus dem Augenwinkel das kleine braune Schild mit der Aufschrift »Schloss Kochberg« erkennen. Er atmete erleichtert aus. Für einen Moment hatte er doch tatsächlich geglaubt, der ehemalige Landsitz der Familie von Stein könnte zweifelhaften Investoren zum Opfer gefallen sein. »Wieso Factory-Outlet?«
»Ich dachte nur. Der Name kam mir irgendwie bekannt vor.« Bernsen rülpste und fügte ein erklärendes »Was Falsches gegessen« hinzu.
Eine seltsame Art der Entschuldigung.
Diese Ignoranz treibt mich noch in den Wahnsinn, dachte Kohlschuetter. Laut sagte er: »Vielleicht haben Sie schon einmal vom Großkochberger Liebhabertheater gehört? Ach, und Goethe war natürlich auch hier. Er soll regelmäßig den ganzen Weg von Weimar bis hierher gelaufen sein, um seine geliebte Charlotte von Stein zu sehen.«
»Goethe? War der nicht mit Schiller verheiratet?« Bernsens Lachen hallte durch das Auto. »Aber mal ehrlich, zeigen Sie mir einen einzigen Ort in diesem Bundesland, in dem Goethe nicht gegen irgendeinen Gartenzaun gepinkelt hat. Der ist doch quasi euer Nationalheiliger.«
»Na ja, so etwas Ähnliches jedenfalls. Thüringen ohne Goethe und Schiller ist einfach nicht denkbar, da haben Sie recht. Abgesehen von den beiden war hier im 18.Jahrhundert aber auch sonst gut was los, dies war die Hochburg der Intellektuellen. Herder, Wieland…«
»Lange her.« Bernsen winkte ab. »Danach wurde es ziemlich dunkel.«
»So ein Blödsinn!« Kohlschuetter ereiferte sich zusehends über so viel Ignoranz. »Haben Sie eigentlich den Hauch einer Ahnung, für was dieses Land alles steht?«
»Bratwurst«, entgegnete Bernsen allen Ernstes.
»Ich hätte es wissen müssen. Thüringen ist gleich Bratwurst. Natürlich, diese Kenntnis ist ja auch vollkommen ausreichend für jemanden, der nur mit seinen Magenschleimhäuten denkt.«
»Was soll das denn heißen?«
»Mensch, Bernsen, bei uns gibt es so viel mehr. Schauen Sie sich doch mal um. Auf Schritt und Tritt Geschichte, Kultur und dazu diese herrliche Landschaft.« Kohlschuetter wies auf den Wald und die Wiesen zu beiden Seiten der Straße.
Bernsen blickte unmotiviert aus dem Beifahrerfenster.
»Allein im Umkreis von fünfzig Kilometern findet man alles, was Thüringen ausmacht.« Kohlschuetter hielt seine rechte Faust vor Bernsens Nase und ließ einen Finger nach dem anderen nach oben schnellen. »Arnstadt. Dort hatte Johann Sebastian Bach seine erste Organistenstelle. Bad Blankenburg. Friedrich Fröbel erfand den Kindergarten. In Ilmenau baute Professor Brandenburg den ersten MP3-Player der Welt, und…«
Ein undefinierbares Brummen seines Kollegen signalisierte das übliche Desinteresse. Dann machte sich ein übler Geruch im Wagen breit. Offenkundig gab es ein tief sitzendes Problem mit einer Fertigpizza oder einem Fischbrötchen aus dem Nordsee-Restaurant, dessen Produktvielfalt Bernsen unter der Woche ernährte. Was sollte er sonst gestern Abend allein in seiner Junggesellenhütte gegessen haben? Seine Frau würde ihm ja wohl kaum für die Woche vorkochen und das Ganze in Tupperdosen von Bremen in das entfernte Thüringen mitschicken. Nach allem, was er bis jetzt von der Rotfeder, also Frau Bernsen, gehört hatte, wagte er das zu bezweifeln. Dass Bernsen nach über zwanzig Jahren bei der Thüringer Polizei aber noch immer kaum eine Ahnung von diesem Land hatte oder zumindest immer so tat, das konnte er absolut nicht nachvollziehen. Kohlschuetter betätigte genervt den elektrischen Fensterheber und beendete die Heimatkundestunde.
»Was erwartet uns eigentlich in…« Bernsen kramte im Handschuhfach nach dem Notizzettel, auf den er nach Kohlschuetters Anruf mit der Begrüßung »Unser Typ wird verlangt« den Namen des Einsatzortes gekritzelt hatte. Es raschelte. »In Rudolstadt?«
»Wir sind von der Mordkommission, Bernsen. Demnach wohl sicherlich ein kleiner Ladendiebstahl«, presste Kohlschuetter zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Mann, konnte der einem auf den Wecker fallen.
»Sind wir aber heute mies drauf. Wohl Stress mit den Weibern?«
Kohlschuetter antwortete nicht.
»Ist das überhaupt unser Beritt?«
»Nein. Die Kollegen sind überlastet.«
»…und da holen sie die Besten.« Bernsen nickte zufrieden.
Kohlschuetter schmunzelte über diese Bemerkung. Das hätte er nach erst einem gemeinsam gelösten Fall niemals von ihrem Team behauptet. Natürlich schmeichelte es ihm. Nachdem er vor wenigen Monaten endlich seinen Traumjob bei der Erfurter Kriminalpolizei bekommen hatte, wollte er zu den richtig Guten gehören. Ob das mit seinem Teamkollegen Bernsen klappen würde, wagte er aber noch zu bezweifeln. Denn der legte sich für seinen pünktlichen Feierabend und regelmäßige Wochenenden eher ins Zeug als für eine Mordermittlung.
»Wieso sterben die bei euch in Thüringen eigentlich immer am Sonntag?«, moserte Bernsen soeben.
»Weil bei uns eben noch Ordnung herrscht«, entgegnete Kohlschuetter. »Sechs Tage in der Woche wird hart gearbeitet, am Sonnabend schmeißen wir den Badeofen an, um uns sonntagsfein zu machen, und danach ist Zeit für alles andere.«
Der Rudolstädter Nordfriedhof kam in Sichtweite, und Bernsen nickte abwesend. Vermutlich hatte er gar nicht zugehört. »Nur gut, dass dieses Wochenende sowieso schon versaut ist, da kommt es auf eine Leiche mehr auch nicht an«, brummte er.
»Das ist die richtige Einstellung.«
»Ich geb’s ja zu, ich wäre am Freitag nicht pünktlich zum Abendessen da gewesen«, redete Bernsen ungefragt weiter. »Aber das ist doch kein Grund, so etwas zu tun.« Er seufzte tief. »Wir hätten ja schließlich noch den Samstag und den ganzen Sonntag gehabt. Andere Leute haben auch nicht mehr Wochenende.«
Gut zu wissen, dass Bernsen seine Rückkehr nach Erfurt mal wieder nicht für den Sonntagabend geplant hatte, dachte Kohlschuetter. Er hätte Montag früh zu Dienstbeginn einmal mehr umsonst auf seinen Kollegen gewartet, weil dieser noch auf der A7 rumzuckelte.
»Wie kann sie mir das nur antun? Nach fast vierzig Jahren Ehe. Wie hartherzig die Frauen doch sein können. Meine Rotfeder.« Erneut ließ Bernsen einen herzzerreißenden Seufzer hören.
Kohlschuetter hatte da seine ganz eigenen Erfahrungen, aber er hütete sich, davon anzufangen. Stattdessen biss er sich auf seine Unterlippe und überlegte angestrengt, ob er seinen Kollegen fragen sollte, wann und mit wem seine Rotfeder davongeflogen war. Etwas anderes konnte wohl kaum geschehen sein, so wie sich sein Kollege gerade anstellte. Nach der kurzen Zeit, die sie sich kannten, schien ihm das aber zu indiskret zu sein. Außerdem redeten Männer nicht über Beziehungsprobleme, vor allem dann nicht, wenn sie nur Kollegen waren.
Kohlschuetter fuhr langsam über die Lengefeldstraße nach Rudolstadt hinein, ließ Schloss Ludwigsburg, den Sitz des Thüringer Landesrechnungshofes, links liegen, murrte einmal kurz an einer Baustelle auf der Ludwigstraße und bog dann nach rechts in die Anton-Sommer-Straße ein.
Bernsen saß leicht gebückt neben ihm, starrte durch die Frontscheibe auf die Straße und murmelte Unverständliches vor sich hin.
Als der Opel sich langsam die Schloßstraße hinaufquälte und der eindrucksvolle Westflügel des Fürstenhauses in Sicht kam, entfuhr Bernsen ein »Boah!«. Er drückte seinen Finger gegen die Scheibe. »Warum parken wir nicht direkt da vorn?«, schlug er mit Blick auf die Kutschenremise vor.
»Parkverbot, weil Feuerwehrzufahrt«, erwiderte Kohlschuetter knapp. Er lenkte den Wagen nach links eine kleine Böschung hinab, ließ das Wasser einer großen Pfütze aufspritzen und bremste scharf vor einer Leitplanke.
Bernsen brummte etwas von »Sport im Dienst, und das am Sonntag« und stieg mit gequälter Miene aus.
Die warme Septembersonne bahnte sich ihren Weg durch die Baumwipfel des Hains. Ein paar Vögel zwitscherten. Die Luft war jetzt, um kurz vor elf, noch kühl wie nach einem nächtlichen Gewitterguss. Kohlschuetter atmete tief ein und schaute sich um. Hier oben schien die Welt noch in Ordnung zu sein. So hoch über den Dächern Rudolstadts war ihm nach allem zumute, nur nicht nach Mord.
»Lassen Sie sich ruhig Zeit. Die Leiche läuft uns schon nicht weg«, erklärte Bernsen und ging voraus, an der alten Remise vorbei in Richtung eines großen grauen Tores. Auf Höhe des ehemaligen Teehauses blieb er stehen, stemmte die Hände in die dürren Hüften, legte den Kopf in den Nacken und beäugte interessiert den Westflügel des Schlosses. Die durch Lisene und Gesimse streng gegliederte dreigeschossige Fassade, in der genau mittig ein Risalit mit Dreiecksgiebel eingeschlossen war, hatte mehr als vierzig Fenster. Angestrengt versuchte Bernsen, die Inschrift über dem Torbogen zu entziffern. Als Kohlschuetter zu ihm aufschloss, ließ er davon ab und rief: »Nettes kleines Häuschen. Ihr Thüringer habt aber auch ein Zeug stehen. Donnerwetter!«
»Das Schloss Heidecksburg ist eines der prächtigsten Barockschlösser Thüringens. Von 1571 bis 1918 war es die Residenz derer von Schwarzburg-Rudolstadt«, antwortete Kohlschuetter mit etwas Wehmut in der Stimme. Die schöne Rudolstädter Floristin hätte ihm bestimmt noch mehr Kultur beibringen können.
»Wie viele dieser Kästen habt ihr eigentlich?«
»Schlösser und Burgen? Keine Ahnung, ich weiß nur, dass es nirgendwo in Deutschland so viele auf so engem Raum gibt. Schuld sind die häufigen Erbteilungen im Mittelalter. Bis zur Revolution von 1918 gab es neun Fürsten- beziehungsweise Herzogtümer: Das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, die Herzogtümer Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Sachsen-Gotha sowie Sachsen-Meiningen und die Fürstentümer Reuß, ältere und jüngere Linie, Schwarzburg-Sondershausen und Schwarzburg-Rudolstadt. Eine bedeutende Kulturlandschaft und eine Thüringer Besonderheit, aber ich glaube, das habe ich dem interessierten Publikum vorhin schon kundgetan.«
Bernsen zuckte mit den knochigen Schultern. »Ihr Ossis müsst es auch immer übertreiben.«
Kohlschuetter verstand den Zusammenhang nicht, sparte sich aber die Nachfrage. Es wäre ohnehin die pure Zeitverschwendung.
Bernsen trat vor und hämmerte mit der ganzen Kraft seiner rechten Faust gegen das Tor im Westflügel, den Haupteingang zum ehemaligen Fürstenhaus.
Im Schloss blieb es ruhig.
»Erst die Polizei rufen und sie dann nicht reinlassen«, moserte er. »Gibt es noch andere Eingänge?«, fragte er Kohlschuetter.
Der nickte. »Vier, einen zwischen Nordflügel und Marstall, das Tor an der Reithalle, dann den mit den Säulen bei der unteren Terrasse und den über die Alte Wache durch einen Tunnel unter dem Südflügel hindurch. Ich glaube, den Letzteren erreicht man aber nur von der Stadtseite her. Das hier ist der offizielle Eingang zur Museumskasse. Über die anderen kommen Sie auch nur auf den Schlosshof und nicht ins Gebäude.«
Schritte näherten sich, und eine kleine drahtige Frau um die fünfzig öffnete die Tür. Ihr Gesicht war kreidebleich, der Mund lag in tiefen Falten. In ihrem schwarzen, zum Pagenkopf frisierten Haar steckte eine altrosafarbene Brille. Kaum hörbar fragte sie: »Sind Sie von der Polizei?« Ihr Blick wanderte wie hypnotisiert von einem der Männer zum anderen. Die Antwort schien ihr egal zu sein, sie machte einen Schritt zur Seite, um sie vorbeizulassen.
Kohlschuetter, der seinen Ausweis schon in der Hand hatte, schob ihn zurück in die Gesäßtasche seiner Jeans, und die Kommissare traten ein.
Ohne ein Wort zu sagen, schloss die Frau ab und ging an ihnen vorbei auf den Schlosshof, blieb stehen und schaute sie mit versteinerter Miene an. Dann drehte sie nach rechts ab und lief auf eine Bank zu, die mit dem Rücken zum Eingang stand. Dort saß eine weitere Frau, von der Kohlschuetter und Bernsen nur die extrem kurz geschnittenen weißen Haare und einen schmalen Rücken sahen. Sie schien lautlos zu weinen.
Kohlschuetter betrachtete die weitläufige u-förmige Schlossanlage, deren Hof mindestens hundertfünfzig Meter lang sein musste und am östlichen Ende in die Terrassen der Gartenanlage mündete. Immer wieder eindrucksvoll, dachte er. Dann fiel sein Blick auf die zahlreichen Tische und Stühle, die in der Mitte des Hofes übereinandergestapelt waren, und auf drei kleinere Festzelte. Anscheinend hatte es hier eine Feier gegeben.
»Hey, Kollegen, schön, dass ihr auch schon ausgeschlafen habt«, brüllte es unvermittelt neben ihm. Bernsen hatte die Streifenbeamten der Rudolstädter Polizei entdeckt, die, etwas versteckt, die nördliche Toreinfahrt mit einem Absperrband versehen hatten und nun unschlüssig dort standen und auf sie zu warten schienen. »Da kommen die Profis extra aus Erfurt, und wo bleibt der Empfang?«
Fast gleichzeitig schauten die beiden Beamten hoch, und einer kam sogleich auf den krakeelenden Bernsen zugelaufen, wobei er immer wieder auf die Hausecke zwischen West- und Nordflügel zeigte. »Da. Sehen Sie doch. Da«, rief er.
Ein paar Meter links vom Toreingang lag jemand seltsam verrenkt bäuchlings auf dem historischen Kieselpflaster. Der Kopf dieser bedauernswerten Gestalt ruhte in ihrem Blut, das sich im Radius von über einem Meter gleichmäßig auf den Steinen und deutlicher noch in den Fugen des Pflasters verteilt hatte. Wie ein Spinnennetz, in dem eine chancenlose Beute ihr Ende fand. Es leuchtete hellrot, zumindest da, wo die dunkel gefärbten Sandfugen es nicht verschluckt hatten, und schien durch den Regenguss der letzten Nacht so sehr verdünnt zu sein, dass eine normale Gerinnung ausgeblieben war. Eine dicke weiße Lockenperücke, die, den rosafarbenen Flecken nach zu urteilen, ebenfalls einen Teil des Blutes aufgenommen hatte, war verrutscht und verdeckte das Gesicht des Toten.
Bernsen, der die Stelle zuerst erreicht hatte, streifte sich einen Latexhandschuh über, bückte sich und hob die Perücke vorsichtig an. Sie war ungewöhnlich schwer und genauso tropfnass wie die himmelblaue lange Jacke, die das Opfer außerdem trug. Was darunter zum Vorschein kam, hätte jedem Laien das Frühstück rückwärts die Speiseröhre hinaufbefördert.
Das Gesicht der Person schien mit dem Kieselsteinpflaster eins zu sein. Der Schädel war aufgerissen, und überall klebte geronnenes Blut. Ein vertrocknetes, klebriges rotes Rinnsal zog sich vom Ohr bis über das gequetschte Kinn.
»Und das bei meinen Magenbeschwerden«, schimpfte Bernsen lautstark, während er die Perücke angewidert sinken ließ. »Schöne Sauerei.« Er stand auf und wandte sich an den Streifenbeamten. »Irgendetwas Auffälliges entdeckt?«
»Nein. Nur die Leiche. Daraufhin haben wir sofort in Erfurt angerufen. Bei uns ist doch keiner…«
»…in der Lage dazu«, vollendete Bernsen den Satz und winkte ab. »Schon klar.«
Der Beamte schaute verdutzt, entgegnete aber nichts.
»Dann sperrt ihr Jungs mal schön weiter das Gelände ab, und wir machen hier unsere Arbeit. Ach, und ruft uns mal einen Arzt. Schließlich brauchen wir es schwarz auf weiß, dass der arme Tropf dort in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist.«
»Alles bereits erledigt. Wir bleiben ohnehin hier, denn wen interessiert schon ein Absperrband«, murmelte der Beamte, zog ab und gesellte sich wieder zu seinem Kollegen.
Bernsen wandte sich an Kohlschuetter. »Hände, Größe und Körperbau sprechen für einen Mann. Die Wangenknochen auch, soweit sie zu sehen sind. Nur bei der Strumpfhose kommen mir ein paar Zweifel, aber immerhin ist sie blau.«
»Er trägt ein Kostüm.« Kohlschuetter schaute von allen Seiten auf den Toten. »Der Allongeperücke, der Justaucorps und der Culotte nach zu urteilen, würde ich sagen, Barock.«
»Justawas?«
»Justaucorps, die knielange Jacke, typische Männermode im späten 17.Jahrhundert.«
Bernsen schaute Kohlschuetter ungläubig an. Der entgegnete knapp: »Meine Schwester ist Schneiderin.«
»Das fehlte noch. Ein Spinner, der hier auf dem Schloss den letzten Grafen spielt. Und dabei haben wir nicht einmal Fasching.« Bernsen ging wieder in die Knie.
»Wenn schon, dann den letzten Fürsten«, wandte Kohlschuetter ein.
Bernsen streifte ihn mit einem unbeteiligten Blick. »Mal sehen, ob Seine Lordschaft sich wenigstens ausweisen kann.« Vorsichtig durchsuchte er die Jackentaschen des Opfers. Ohne Ergebnis. Mürrisch stand er auf.
Kohlschuetter, der unterdessen ein ebenso kurzes wie unergiebiges Telefonat mit Susanne Summer von der Abteilung Kriminaltechnische Untersuchung des Landeskriminalamtes Erfurt geführt hatte – jedenfalls, was seine Einladung zum Essen anging–, bedeutete Bernsen, dass er nun vorhatte, die beiden Damen zu befragen, er solle hier auf ihn warten. Sein Kollege verstand das offensichtlich falsch, klatschte in die Hände und rief: »So, und nun zu euch, ihr Schätzchen.«
Die Damen drehten sich nicht einmal um.
Kohlschuetter griff nach Bernsens Arm und zog ihn mit wütendem Blick ein Stück zur Seite. Jetzt verstand auch der unmögliche Bernsen die Botschaft. Beleidigt biss er sich auf die Lippe, um kurz darauf ein »Weiber sind Ihr Ding, verstehe schon« abzusetzen. Danach lief er immer wieder große Kreise um die Leiche, blieb stehen, schaute nach oben, nach unten und zur Seite und lief weiter.
Kohlschuetter setzte sich schweigend zu den beiden Frauen. Die attraktivere, das war die mit dem Pagenkopf, hatte den Arm um die andere gelegt und redete pausenlos leise auf sie ein. Hin und wieder nickte die Weißhaarige, um kurz darauf wieder verzweifelt zu schluchzen. Minuten vergingen, bis Kohlschuetter es an der Zeit fand, sich vorzustellen und seine erste Frage zu formulieren.
»Wer von Ihnen hat den Toten gefunden?«
Ein zaghaftes »Ich« kam aus dem Mund der weißhaarigen Dame, die ihn von der Strenge ihres Erscheinungsbildes und ihrer Kleidung her an eine evangelische Pfarrerstochter erinnerte.
»Haben Sie ihn erkannt?«
Sie schluchzte auf, es klang seltsam erleichtert. »Der Schlossdirektor, Dr.Alexander P. von Wilden.«
Was für ein Name. Kohlschuetter räusperte sich. »Wann haben Sie ihn gefunden?«
»Als ich das Tor aufschließen wollte, um kurz vor zehn. Ich mache doch die Führungen.« Sie sah verstohlen zur Seite.
Die Frau mit dem Pagenkopf nickte ihr aufmunternd zu.
»Wissen Sie, warum er dieses Kostüm trägt?«
»Wir hatten gestern Abend unser Barockfest.«
Kohlschuetter überlegte einen Moment. Er hatte schon von dem Fest gehört. Seit 2008 fand es einmal im Jahr hier oben auf dem Schloss statt, immer im September. Seines Wissens war es stets gut besucht.
»Wie viele Gäste waren hier?«, fragte er weiter.
»Etwa dreihundert.«
»Und wann haben Sie den Schlossdirektor das letzte Mal lebend gesehen?«
Sie begann wieder laut zu schniefen. »Als wir gegangen sind. Das muss so gegen halb eins gewesen sein. Der Regen hatte gerade einmal kurz aufgehört.«
»Wie viele Menschen waren noch auf dem Schloss, als Sie gingen?«
»Vielleicht zwanzig? Ich weiß es nicht.« Zitternd griff sie nach der Hand der Pagenkopffrau und schaute Kohlschuetter aus rot geränderten Augen an. Ihr Gesicht war aschfahl. »Wann bringen Sie ihn endlich weg?«
Kohlschuetter stutzte über die Frage und antwortete ausweichend: »Bald.«
2
»Der Knabe ist da oben aus einem der Fenster gefallen.« Bernsen stemmte energisch beide Hände in die dürren Hüften und schaute, als hätte er die Neuigkeit des Jahres verkündet.
Kohlschuetter ließ seinen Blick über die Fensterreihen wandern. Nicht eines war geöffnet. »Der ›Knabe‹, wie Sie ihn nennen, soll der Schlossdirektor Dr.Alexander P. von Wilden sein. Die Damen haben ihn wohl an seiner Kostümierung erkannt. Aber nach ›gefallen‹ im Sinne von ›Zufall‹ sieht das nicht aus.«
Bernsen zuckte mit den Schultern. »Dann eben ›gestürzt‹ im Sinne von ›absichtlich‹. Ich könnte mir zwar einen schöneren Selbstmord vorstellen, also einen, bei dem man gut aussieht und nicht so zermatscht wie ein Frosch auf der Autobahn. Aber die Geschmäcker sind verschieden.«
»Wie immer perfekt auf den Punkt gebracht, Kollege. Ich wollte aber eigentlich darauf hinaus, dass sämtliche Fenster geschlossen sind und er das kaum selbst erledigt haben kann.«
Bernsen sah noch einmal prüfend nach oben. »Dann hat wohl jemand nachgeholfen. Es sei denn, er ist vom Dach gesprungen.«
»…dessen beide infrage kommenden Dachfenster auch geschlossen sind. Sehen Sie?« Kohlschuetter zeigte auf die Gaubenfenster.
»Schlauberger.«
»Gestern Abend war hier ein Barockfest. Dreihundert Gäste plus Personal.«
»Schiet.«
Das Holztor knarrte, und zwei Männerstimmen waren zu hören.
»Ich sage Ihnen, die Schenken haben ihre Herrschaft über Vargula mit dem Tode Heinrichs, also 1300, aufgegeben.«
»Wie überaus interessant.«
»Meine Nachforschungen sind in diesem Punkt eindeutig.«
»Das freut mich außerordentlich. Wieso hat denn heute noch niemand das Tor aufgeschlossen?«
Zwei Herren im gehobenen Alter betraten den Schlosshof. Der jüngere von beiden war auffallend groß und sportlich. Er trug einen dunkelblauen, akkurat sitzenden Anzug, der perfekt mit seinen grauen Schläfen, den dunklen Augen und seiner gebräunten Haut harmonierte. Der andere, etwas kleinere war eine bleiche, hagere Gestalt mit zu großer Nase und eingefallenen Wangen. Sein gesamter Habitus erinnerte an einen zerstreuten Professor.
»Was machen Sie hier? Schneidersohn, sofort das Tor schließen! Schließen Sie das Tor! Die Verrückten aus der Kutscherremise sind wieder eingefallen«, kreischte der Hagere aufgeregt. Dabei zitterte er am ganzen Körper.
Bernsen, der immer noch breitbeinig und in energischer Haltung neben dem Toten stand, drehte sich zu den beiden um. Der deutlich hörbare norddeutsche Dialekt des Hageren hatte ein Lächeln auf sein Gesicht gezaubert. »Wie meinen?«, fragte er.
»Er wird handgreiflich. Brutale Gewalt, nichts als brutale Gewalt!« Der Hagere sprang hinter seinen Begleiter und lugte verängstigt hinter dessen linker Schulter hervor.
Der andere, auffallend attraktive Mann schaute zunächst auf Bernsen und dann zu Kohlschuetter. Schließlich blieb sein Blick an dem Toten auf dem Pflaster hängen.
»Was ist passiert, und wer sind Sie?«, fragte er vollkommen ruhig und überlegt. Über das Verhalten des Hageren schien er sich nicht einmal zu wundern.
»Kripo Erfurt, Bernsen und…«
»…Kohlschuetter«, ergänzte dieser. »Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf?«
»Ich bin Professor Max Schneidersohn, Direktor der Stiftung Kultur im Schloss Heidecksburg, und das ist mein Kollege Professor Berthold Bleich-Barnitz, Direktor des Schlossarchivs, pensioniert, wohlgemerkt.« Er machte ein paar Schritte auf die Kommissare zu, um dann mit Blick auf die Leiche abrupt zu stoppen und etwas hilflos in die Runde zu schauen.
»Und das dort ist Ihr Schlossdirektor – oder besser gesagt das, was davon übrig ist«, bemerkte Bernsen ungerührt.
Beide Männer blickten mit weit aufgerissenen Augen auf den leblosen Körper ihres Kollegen.
»Oh Herr«, murmelte der Archivdirektor a.D. hinter den muskulösen Schultern seines Beschützers und bekreuzigte sich. Dann wimmerte er wie ein kleines Mädchen.
»Wir müssten Ihnen ein paar Fragen stellen«, hob Bernsen an, »bevor Sie sich vor Angst–«
»Wann haben Sie Ihren Kollegen das letzte Mal gesehen?«, fragte Kohlschuetter hastig, um Bernsen das Wort abzuschneiden.
»Gestern Abend beim Barockfest. Wir sind so gegen Mitternacht gegangen«, antwortete Schneidersohn. Er war immer noch vollkommen ruhig.
»Da hatte mir von Wilden gerade das letzte Lachshäppchen weggeschnappt«, ergänzte Bleich-Barnitz.
Beim Wort Lachshäppchen schnellte Bernsens Aufmerksamkeitskurve nach oben. Zwar war offenkundig, dass der Schlossdirektor keiner Fischvergiftung erlegen war. Aber wenn dieser verschrobene Professor damit kundtun wollte, dass die Häppchen an ihm verschwendet gewesen waren, konnte er das getrost unterschreiben. »Zusammen?«
Schneidersohn schien mit einem Kloß in seinem Hals zu kämpfen, er räusperte sich. »Ja. Wir sind eine Fahrgemeinschaft, in dem Sinne, dass ich fahre. Ihre Kollegen können das bestätigen. In der August-Bebel-Straße gab es eine Verkehrskontrolle.«
»Ich verstehe das alles nicht. Gestern war er doch noch quietschlebendig«, mischte sich Bleich-Barnitz wieder ein, wobei seine Stimme auf unangenehme Weise an eine jaulende Katze erinnerte.
Bernsen zuckte zusammen. Männer, die sich wie Weiber benahmen, konnte er nicht ausstehen, auch wenn sie aus dem hohen Norden kamen. »Das ist eben so, Jung, wenn man mit dem Kopp bremst.«
»Mord?« Schneidersohns dunkle Augen quollen fast aus den Höhlen.
»Das haben Sie gesagt!«, polterte Bernsen.
»Ich habe es immer gewusst. Die dunkle Macht des Bösen bemächtigt sich irgendwann aller Gutmenschen.« Bleich-Barnitz schlug aufgeregt die Arme zu einem Kreuz auf seiner Brust übereinander. Dann starrte er geistesabwesend auf den Toten.
Kohlschuetter und Bernsen warfen sich einen vielsagenden Blick zu, wobei Bernsen gedanklich zu einer der jüngeren Star-Wars-Episoden abdriftete, dann aber zur Erkenntnis kam, dass Bleich-Barnitz kein Jedi, sondern einfach nur seltsam war. Nach kurzem Schweigen bemerkte er lapidar: »Das kommt in den besten Familien vor.«
Schneidersohn versuchte, das Gespräch wieder in eine sachliche Bahn zu lenken. »Wir halten uns natürlich zu Ihrer Verfügung.«
»Natürlich.« Kohlschuetter nickte. »Aber bitte sagen Sie mir noch: Hatte der Schlossdirektor Feinde?«
Schneidersohn schaute ein wenig unsicher auf den durchnässten Toten keine zwei Meter vor seinen Füßen. Er schien zu überlegen, wie er seine Antwort am pietätvollsten formulieren konnte. Dann sagte er langsam und bedächtig: »Eher nicht.« Er räusperte sich unsicher. Ihm war anzusehen, dass er sich nicht wohl in seiner Haut fühlte.
»Eher nicht?«, hakte Kohlschuetter nach.
»Na ja, ein paar Feinde hat doch jeder. Das bleibt ja nicht aus…« Schneidersohn wand sich wie ein Aal.
»Dann fangen wir doch mal an.« Bernsen starrte angestrengt auf das Kieselpflaster. Offensichtlich hatte er nicht zugehört. Langsam lief er auf etwas zu, ohne den Blick zu heben. »Moment!«, schrie er sodann und bückte sich schnell wie ein Bussard, der sich aus freiem Flug auf eine Maus stürzt. »Was haben wir denn hier?«
Er hielt eine Anstecknadel zwischen Daumen und Zeigefinger und beäugte sie von allen Seiten. »Sieht aus wie ein Wappen.«
Kohlschuetter, der nun neben seinen Kollegen getreten war, schaute eine Weile auf den Fund und fragte die beiden Professoren dann: »Ein doppelköpfiger Reichsadler. Kennen Sie dieses Symbol?«
»Darf ich einmal sehen?« Schneidersohn beugte sich nach vorn, ohne einen Schritt näher an den Toten heranzutreten. »Das ist das Wappen der Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadt.«
»Und wer trägt so etwas heute noch?«, fragte Kohlschuetter irritiert.
»Ich kenne nur einen. Adalbert Grosch, der Geschäftsführer der Saalfelder Schokoladenfabrik und Vorsitzender des Unternehmervereins zum Erhalt des Schwarzburger Blutes«, antwortete Schneidersohn unbeeindruckt. »Soviel ich weiß, verlangt er von seinen sechs Vereinsmitgliedern, dass sie diese Nadel ebenfalls tragen. Doch niemand hält sich daran. Er ist wohl der Einzige.«
»Sie machen einen Scherz.« Bernsen hob ungläubig den Kopf und streckte dem Stiftungsdirektor sein Kinn entgegen. »War dieser Grosch gestern auch da?«
»Nein, leider nicht.« Schneidersohn schaute betroffen. »Also, ich meine, das ist leider kein Scherz«, beeilte er sich zu sagen. Dann fügte er hinzu: »Und er war da, zu meinem Bedauern. Seine Gattin ebenfalls. Ein Barockfest ohne die beiden gibt es im Grunde gar nicht. Er trug gestern aber eine rosafarbene Weste ohne Jacke, falls Sie mich das jetzt als Nächstes fragen wollen.«
»Wollen wir, Meister, wollen wir.« Bernsen nickte. Dabei fragte er sich, warum erwachsene Männer eigentlich immer wieder freiwillig in aller Öffentlichkeit wie Pastellbonbons herumlaufen mussten.
»Der Schlossdirektor selbst trug diese Nadel aber ganz sicher nicht?«, erkundigte sich Kohlschuetter und kramte in seiner Jackentasche nach einer kleinen Plastiktüte, um das gute Stück ordnungsgemäß der KTU übergeben zu können.
»Niemals«, fauchte Bleich-Barnitz empört. Offensichtlich hatte er sich von seinem Schock erholt und wollte sich wieder am Gespräch beteiligen. »Er ist ja gar nicht in diesem Verein.«
»Sagen Sie, heute ist doch Sonntag, was machen Sie beide eigentlich hier? Schlossbesichtigung?« Bernsen grinste frech.
Schneidersohn räusperte sich. »Ich arbeite oft sonntags. Hier ist dann einfach mehr Ruhe.«
»Ich dachte, da kommen die meisten Besucher«, zischte Bernsen Kohlschuetter zu. Laut sagte er: »Und Sie, Herr Professor? Als Pensionär haben Sie doch bestimmt Besseres zu tun?«
»Nun, solange mein Nachfolger nicht im Amt ist, war Herr Dr.von Wilden so freundlich, mir meinen alten Arbeitsplatz zu belassen«, sagte Bleich-Barnitz. »Immerhin sind meine Forschungen ein Aushängeschild für dieses Haus.« Nach einer etwas zu langen Denkpause hob er mit einer Miene, als verkündete er die Lottozahlen vom nächsten Tag, an: »PM History interessiert sich für meine Entdeckungen bezüglich der Schenken von Vargula. Ich reise morgen nach Hamburg, und das bedarf noch einiger Vorbereitungen.«
»Von was?« Bernsen verstand kein Wort.