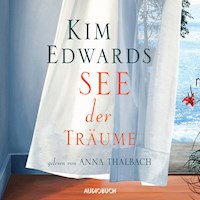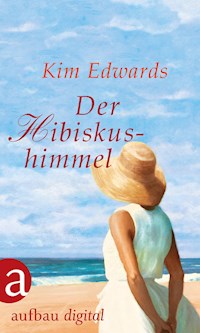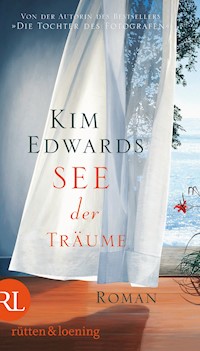
7,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
Kurz vor ihrem 30. Geburtstag ist die Weltenbummlerin Lucy Jarrett beruflich und emotional an einem Tiefpunkt angelangt. Kurzfristig beschließt sie, in ihre Heimat nach Upstate New York zu fahren. Doch zu Hause empfangen sie unerwartete und schmerzliche Konflikte. Nie hat Lucy den ungeklärten Tod ihres Vaters verwunden, und plötzlich stößt sie auf ein lange verschüttetes Familiengeheimnis, das immer mehr in die Gegenwart hineinwirkt... Nach ihrem internationalen Bestseller „Die Tochter des Fotografen“ erzählt Kim Edwards in ihrem neuen Roman über Liebe, Verrat und Verlust. „Dieses Buch strahlt.“ Bookreporter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Ähnliche
Kim Edwards
See der Träume
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gesine Schröder
Impressum
Die Originalausgabe mit dem TitelThe Lake of Dreamserschien 2011 bei Viking, New York.
ISBN E-Pub 978-3-8412-0321-2ISBN PDF 978-3-8412-2321-0ISBN Printausgabe 978-3-352-00809-2
Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Juli 2011© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, BerlinDie deutsche Erstausgabe erschien 2011 bei Rütten & Loening,einer Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG© Kim Edwards, 2011All rights reserved including the right of reproductionin whole or in part in any form.This edition published by arrangement with Viking,a member of Penguin Group (USA) Inc.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
Umschlaggestaltung Henkel / Lemmeunter Verwendung des Gemäldes »Day Lilies«von Alice Dalton Brown / Fischbach Gallery
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,KN - die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Impressum
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Epilog
DIE FAMILIE JARRETT
Danksagungen
Über die Autorin
Interview mit der Autorin
Quellenangaben
Leseprobe
Für meine Familie,
besonders für meine Eltern, John und Shirley
Alles Verborgene und alles Offenbare habe ich erkannt; denn es lehrte mich die Weisheit, die Meisterin aller Dinge.
Das Buch der Weisheit 7,21
Die Strecke hat kein Geheimnis. Das Geheimnis ist in der Sphäre.
Thomas Mann, Joseph und seine Brüder
Prolog
Mitten in der Nacht dringt ein sonderbares Licht durch den Spalt am Fenster und streift wie eine Flügelspitze ihre Hand. Ihre Eltern schlafen im Zimmer nebenan, und im ganzen Dorf ist es still, doch sie liegt seit Stunden wach; jetzt schlüpft sie aus dem Bett und tastet sich über die rauen Holzdielen voran. Der Komet. Seit Wochen reden die Leute von nichts anderem mehr als von seiner Ankunft, von den giftigen Dämpfen, in die sein Schweif die Erde hüllen wird, vom Ende der Welt. Sie ist fünfzehn, und gestern haben sie und ihr Bruder den ganzen Tag lang den Eltern geholfen, das Haus abzudichten. Alle Fenster, selbst den Schornstein haben sie mit dicken schwarzen Wolldecken verhüllt, und von überall her war das Hämmern ihrer Nachbarn zu hören, die dasselbe taten.
Ein schmales Dreieck seltsamen Lichts fällt ins Dunkel, es berührt sie mal hier, mal dort, als sie den Raum durchquert. Sie trägt ihr verschlissenes, mädchenhaftes blaues Kleid aus weicher Baumwolle. In ihrem Zimmer, einer kleinen Kammer über der Werkstatt, ist der Schutzschild aus Wolle nur nachlässig am Fenster befestigt. Als sie kräftig daran zieht, löst sich der Stoff, und der bleiche Widerschein des Kometen erfüllt den Raum. Sie schiebt das Fenster auf und atmet tief ein, dann noch einmal, noch tiefer. Nichts. Keine giftigen Gase, kein Brennen in der Lunge. Nur taufeuchter Frühling, der Geruch nach frischen Trieben und, kaum spürbar, nach Meer.
Und dann dieses seltsame Licht. Sie kennt die Sternbilder so genau wie die Furchen ihrer Hand, und so muss sie nicht erst suchen, um den Kometen zu entdecken. Hoch oben zieht er seine Bahn, reist durch die Jahrhunderte, ein funkensprühendes Juwel, erhaben und schicksalsschwer.
Fernes Hundegebell ist zu hören, das Scharren und Gurren der Hühner in ihrem Stall. Dann nähern sich Stimmen, die ihres Bruders und noch eine andere, eine, die sie kennt. Ihr Herz klopft vor Zorn und vor Verlangen. Sie zögert. Sie hat, was sie gleich tun wird, nicht geplant, diesen wichtigsten Augenblick ihres Lebens. Und doch folgt sie nicht bloß einem Impuls, als sie sich auf die Fensterbank schwingt, auf das Dach hinausklettert und ihre nackten Füße über dem Garten baumeln lässt. Sie hat ihr Kleid nicht zufällig anbehalten, die Verhüllung des Fensters mit Absicht schlecht befestigt. Den ganzen Tag schon hat sie von dem Kometen geträumt, seiner wilden Schönheit und seiner Macht, ihr Leben zu verändern.
Die Stimmen nähern sich, und sie springt.
Kapitel 1
Mein Name ist Lucy Jarrett, und bevor ich von jenem Mädchen am Fenster erfuhr, bevor ich in meinem Elternhaus auf Bruchstücke ihrer Geschichte stieß und sie zusammenzufügen begann, lebte ich in Japan in einem kleinen Ort am Meer. Es war Frühling, ein Frühling voller Erdbeben, als ich eines Nachts jäh aus einem Traum gerissen wurde. Schritte verhallten auf der gepflasterten Gasse, und in der Ferne rumpelte ein Güterzug vorüber. Ich lauschte angestrengt, bis ich auch die Brandung hören konnte, doch sonst war alles still. Yoshis Hand ruhte auf meiner Hüfte wie am Abend zuvor, als wir in der dunklen Küche tanzten, zu leiser Musik aus dem Radio, immer langsamer tanzten und schließlich innehielten, um uns im Duft des Jasmins zu küssen.
Ich schmiegte mich an ihn. Im Traum war ich an den See meiner Kindheit zurückgekehrt. Ich wollte nicht dorthin, doch ich ging. Der Himmel war wolkenverhangen, die alte grüne Holzhütte, die ich nur aus meinen Träumen kannte, von Moosen und Ästen fast verdeckt. Ihre geborstenen Fenster waren blind von Staub und Schnee. Ich ging daran vorüber auf das Seeufer zu und auf die dicke, durchsichtige Eisschicht hinaus. Ich lief weiter, bis ich sie fand: so viele Menschen, und sie lebten unter dem Eis. Als ich sie entdeckte, fiel ich auf die Knie und presste die Hände auf die glasklare Oberfläche – so dick, so undurchdringlich und kalt. Ich selbst hatte die Menschen irgendwie hierher versetzt, das wusste ich. Ich hatte sie vor langer Zeit hier zurückgelassen. Ihr Haar wogte in der Strömung, und aus ihren Augen sprach eine Sehnsucht, die der meinen glich.
Die Jalousien erzitterten. Ich hielt, noch halb im Traum gefangen, den Atem an, doch es war nur wieder ein Güterzug, der in Richtung der Berge verschwand. Seit einer Woche schon träumte ich diesen Traum jede Nacht, drangen die Erschütterungen der rastlosen Erde bis in die Tiefen meiner Vergangenheit. Der Traum erinnerte mich an eine andere Frühlingsnacht, als ich, siebzehn Jahre alt, mich von dem Rücksitz eines Motorrads gleiten ließ, das einem Jungen gehörte – Keegan Fall –, und die Apfelblüten neigten sich über uns wie blasse Sterne. Ich presste beide Hände auf Keegans Brust, bevor er losfuhr und der Motor seiner Maschine die Nachtruhe zerriss. Als ich mich zum Haus umwandte, sah ich meinen Vater im Garten stehen. Im Mondlicht schimmerten die grauen Strähnen seines Haars, die Glut seiner Zigarette hob und senkte sich. Flieder und die ersten Rosen leuchteten im Dunkel. Nett, dass du auch noch kommst, sagte mein Vater. Tut mir leid, ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst, antwortete ich. Schweigen, die Gerüche von Seewasser, gemähtem Gras und frischen Trieben in der dunklen Erde, und dann sagte er: Gehen wir angeln, Lucy? Was meinst du? Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Es klang wehmütig, und ich erinnerte mich, wie wir uns früher vor Sonnenaufgang auf den Weg zum Boot gemacht hatten, wie ich unter Mühen den Angelkoffer über den Rasen schleppte. Ich wollte mit ihm angeln gehen, seine Einladung annehmen, doch noch lieber wollte ich mich in mein Zimmer zurückziehen, um ungestört an Keegan Fall zu denken. Also wandte ich mich ab und wies ihn scharf zurecht: Also wirklich, Dad. Ich bin doch kein Kind mehr.
Das waren meine letzten Worte an ihn. Ein paar Stunden später, die Sonne stand schon hoch am Himmel, erwachte ich von dem Klang aufgeregter Stimmen, rannte die Treppe hinunter und über das taufeuchte Gras zum Ufer, wo sie eben meinen Vater aus dem Wasser gezogen hatten. Meine Mutter kniete neben ihm im flachen Uferschlamm und berührte mit den Fingerspitzen seine Wange. Seine Lippen und sein Gesicht waren blau angelaufen. In den Mundwinkeln hing ein wenig Schaum, und seine Augenlider sahen silbrig aus, schillernd fast. Wie ein Fisch, dachte ich, ein verrückter Gedanke, doch er half, andere, viel schlimmere zurückzudrängen, die mich seither nie mehr losgelassen haben: Ich hätte mitgehen sollen. Ich hätte bei ihm sein sollen. Hätte ich doch nur ja gesagt.
Neben mir auf dem Futon regte sich Yoshi und seufzte im Schlaf. Seine Hand glitt von meiner Hüfte. Das helle Rechteck des Mondlichts auf dem Boden vibrierte leicht von der fernen Brandung und dem nächtlichen Wind. Allmählich wurden die Vibrationen stärker. Es begann verhalten, wie das Grollen von Güterzügen. Dann fingen meine tibetischen Klangschalen von allein an zu summen. Die Kiesel, die ich im Regal aufgereiht hatte, fielen wie Regentropfen auf die Reisstrohmatten. Im Erdgeschoss stürzte etwas zu Boden und zerbrach. Ich hielt ganz still, als könnte ich damit auch die Welt zur Ruhe bringen, doch das Beben wurde stärker und stärker. Die Regale wankten und spien Bücher aus. Dann lief ein Zittern durch die Wände, der Boden hob und senkte sich in einer einzigen großen Wellenbewegung, als wälzte sich unter uns ein riesiges Tier, als wäre die Erde selbst lebendig und der Boden ihre rissige Haut.
Plötzlich hörte es auf. Alles war merkwürdig still. Irgendwo tropfte Wasser in eine Pfütze. Yoshi atmete gleichmäßig und tief.
Ich rüttelte ihn an der Schulter, bis er schläfrig die Augen öffnete. Solche kleineren Erdstöße bemerkte er kaum, auch wenn wir den Frühling über Hunderte davon erlebt hatten.
»Ein Erdbeben?«, murmelte er.
»Ein ziemlich heftiges. Unten ist irgendetwas zu Bruch gegangen.«
»Tatsächlich? Aber jetzt ist es ja vorbei. Komm, schlaf wieder ein.«
Er schloss die Augen und zog mich an sich. Kurz darauf atmete er wieder tief und regelmäßig. Durch das halboffene Fenster konnte ich über dem Dach des Hauses gegenüber die Sterne sehen.
»Yoshi?«, sagte ich. Als er nicht antwortete, stand ich leise auf und ging hinunter in die Küche.
Die Aloe war vom Fensterbrett gefallen, der Übertopf zerbrochen. Ich setzte Teewasser auf und begann die Erde, die Scherben und abgebrochenen Blätter aufzukehren. Wahrscheinlich taten japanische Hausfrauen im ganzen Ort gerade dasselbe, ein Gedanke, der mich erbitterte. Ich hatte eindeutig schon viel zu lange keinen ordentlichen Job. Es gefiel mir gar nicht, von Yoshi abhängig zu sein, kein eigenes Einkommen zu haben und keine sinnvolle Beschäftigung. Ich bin Hydrologin, das heißt, ich untersuche die Kreisläufe des Wassers, ob überirdisch oder unter der Oberfläche. Als ich Yoshi in Jakarta kennenlernte, arbeitete ich seit fast fünf Jahren in den Forschungsabteilungen internationaler Konzerne. Wir hatten uns ineinander verliebt, wie man es nur fern der Heimat kann. Von allen vertrauten Einflüssen abgeschnitten, hatten wir uns ein eigenes Traumland geschaffen, ganz nach unseren Wünschen. Dies ist der einzige Kontinent, der zählt, sagte Yoshi, wenn er die Formen meines Körpers erkundete. Dies ist unsere Welt. Ein Jahr, zwei Jahre lang waren wir glücklich. Dann liefen unsere Verträge aus, und bevor ich etwas Neues fand, bekam Yoshi eine verlockende Stelle als Ingenieur angeboten. Also waren wir nach Japan gezogen, ein ganz neues Land für mich und, wie sich herausstellen sollte, nicht das meiner Träume.
Ich schenkte mir eine Tasse Tee ein, ging ins Wohnzimmer, zog die Jalousien hoch und öffnete die Fenster. Kühle, frische Nachtluft wogte herein. Es war noch dunkel, doch in den Häusern ringsum begann schon der Tag; von nah und fern hörte ich Wasser rauschen und das Geklapper von Geschirr. Über die schmale Gasse gingen die leisen Gespräche von Nachbarn hin und her.
Das Haus erzitterte von der Brandung und beruhigte sich wieder. Ich setzte mich an den niedrigen Tisch, nippte an meinem Tee und dachte an den kommenden Tag, an die Bergtour, die wir uns schon so lange vorgenommen hatten. In Indonesien hatten Yoshi und ich darüber nachgedacht, zu heiraten, vielleicht sogar Kinder zu bekommen. Ich hatte in diesen vagen Phantasien immer befriedigende Arbeit gehabt oder meine Erfüllung darin gefunden, Japanisch zu lernen, Ikebanas zu arrangieren und viel spazieren zu gehen. Ich hatte nicht geahnt, wie einsam mich die Arbeitslosigkeit machen könnte und wie viel Zeit Yoshi mit seinem eigenen Job zubringen würde. Wir stritten uns häufig in letzter Zeit, aus jedem noch so nichtigen Anlass. Auch wie hartnäckig mich die Vergangenheit verfolgen würde, hatte ich unterschätzt. Nach drei Monaten der Untätigkeit in Japan hatte ich angefangen, Englisch zu unterrichten, um überhaupt einmal andere Stimmen zu hören. Wenn ich mit meinen kleinen Schülern spazieren ging, um am Ufer des Meeres mit ihnen Vokabeln am konkreten Objekt einzuüben – Stein, Wasser, Welle –, sehnte ich mich nach der Zeit, da ich dieselben Wörter jeden Tag wie selbstverständlich bei der Arbeit gebraucht hatte. Manchmal ertappte ich mich dabei, ihnen noch ganz andere Dinge beibringen zu wollen, obwohl ich wusste, dass sie sie nicht verstanden. Von diesem Wasser haben Dinosaurier getrunken, wusstet ihr das? Wasser durchläuft einen ewigen Kreislauf. Eines Tages, Kinder, werden eure Enkel Tee aus euren Tränen kochen.
Ich hatte meine Lehrtätigkeit als Provisorium angesehen, die Arbeitslosigkeit als kurzes Intermezzo, doch jetzt, einige Wochen später, begann ich mich zu fragen, ob das hier das eigentliche Leben war.
Mein Laptop blinkte auf der anderen Seite des Zimmers, und ich ging hin, um nach neuen E-Mails zu sehen. Der Bildschirm tauchte meine Hände und Arme in bläuliches Licht. Sechzehn neue Nachrichten, darunter viel Spam, aber auch zwei Mails von Freunden aus Sri Lanka und drei von ehemaligen Kollegen aus Jakarta, die mir Fotos von einer Urwaldwanderung schickten. Während ich sie überflog, dachte ich an einen Bootsausflug zurück, den Yoshi und ich mit ihnen unternommen hatten, an die üppige Vegetation an den Flussufern, die Hüte, die wir zum Schutz vor der sengenden Sonne aus Lilienblättern flochten, und ich sehnte mich schmerzlich nach dem Leben zurück, das seit unserem Umzug so weit hinter uns lag.
Drei Nachrichten kamen von zu Hause, eine davon von meiner Mutter, was mich überraschte. Wir tauschten uns regelmäßig aus, und einmal im Jahr besuchte ich sie. Doch E-Mails benutzte meine Mutter eher, wie man früher Ferngespräche gehandhabt hatte: sporadisch, kurz angebunden und nur in dringenden Angelegenheiten. Meist unterhielten wir uns am Telefon oder schickten uns dünne blaue Luftpostbriefe. Ihre folgten mir nach, wo auch immer es mich gerade hinverschlagen hatte, und meine landeten zuverlässig in dem Kasten vor dem großen Haus, in dem ich aufgewachsen war, in einem kleinen Ort mit Namen The Lake of Dreams.
Lucy, ich hatte einen Unfall, aber keinen schweren, Du musst Dir also wirklich keine Sorgen machen. Wenn Blake sich meldet, nimm seine Lageberichte nicht allzu wörtlich. Er meint es natürlich nur gut, aber seine übervorsichtige Art treibt mich noch in den Wahnsinn. Ich bin fast sicher, dass mein Handgelenk nur verstaucht ist und nicht gebrochen. Der Arzt sagt, auf den Röntgenbildern wird man es sehen. Es gibt also überhaupt keinen Grund, überstürzt nach Hause zu kommen.
Ich las die Mail noch einmal und stellte mir dabei meine Mutter vor, wie sie verletzt und einsam am Küchentisch saß. Obwohl seither mehr als zehn Jahre vergangen waren, fühlte ich mich in den Sommer nach dem Tod meines Vaters zurückversetzt. Wir hatten damals unser Leben weitergelebt wie immer, hatten versucht, eine brüchige Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir kochten Essen, das niemand aß, und blickten aneinander vorbei, ohne ein Wort zu wechseln. Meine Mutter zog in ein Gästezimmer im Erdgeschoss und begann das Obergeschoss nach und nach, Zimmer für Zimmer abzusperren. Ihre Trauer wurde zum Zentrum der drückenden Stille, und wir anderen schlichen wie auf Zehenspitzen um sie herum; hätte ich geweint oder meinen Schmerz herausgeschrien, wäre alles in sich zusammengestürzt, also hielt ich still. Selbst nach so vielen Jahren fiel ich, wenn ich nach Hause fuhr, in die alten Muster zurück und bewegte mich nur in den Grenzen, die der Verlust mir setzte.
Die nächste E-Mail war tatsächlich von Blake, und das war ein schlechtes Zeichen. Mein Bruder lebte den Sommer über auf seinem Segelboot und verdiente sein Geld als Kapitän der Ausflugsdampfer, die alle zwei Stunden von der Anlegestelle The Lake of Dreams ablegten. Im Winter tat er ungefähr dasselbe auf Saint Croix. Er benutzte gern Skype und war schon zwei Mal um die halbe Welt geflogen, um mich zu besuchen, doch E-Mails schrieb er so gut wie nie. Er schilderte mir den Unfall – jemand hatte ein Stoppschild überfahren, und das Auto meiner Mutter hatte einen Totalschaden –, klang aber nach meinem Empfinden nicht übervorsichtig, sondern eher besorgt. Meine Cousine Zoe schien im Gegensatz zu ihm völlig aus dem Häuschen zu sein, doch das war sie eigentlich immer. Sie war zur Welt gekommen, als ich schon fast vierzehn war, und der Altersunterschied zu uns anderen war so groß, dass wir manchmal das Gefühl hatten, sie sei in einer ganz anderen Familie aufgewachsen. Ihr großer Bruder Joey war in meinem Alter, hatte den Namen und das Vermögen der Familie geerbt, und wir hatten uns nie besonders gut verstanden. Zoe dagegen, die fünfzehn war und sich im Internet auskannte wie in ihrer Westentasche, fand mein Leben aufregend und exotisch und schrieb mir oft lange Mails über die dramatischen Ereignisse an ihrer Highschool, obwohl sie darauf selten eine Antwort bekam.
Es begann zu dämmern. Ich stand auf und stellte mich ans Fenster. Auf der Gasse waren jetzt die grauen Pflastersteine zu erkennen, und die Holzhäuser traten aus dem Dunkel hervor. Geschirrgeklapper und das Rauschen eines Wasserhahns auf der anderen Straßenseite rissen mich aus meinen Gedanken. Mrs. Fujimoro trat aus dem Haus gegenüber, um den Gehweg zu fegen. Ich ging auf die Veranda hinaus und nickte ihr zu. Sie fegte mit so resoluten, geübten Bewegungen, dass ich das erneute Grollen erst bemerkte, als sie innehielt. Erst schien es das Übliche zu sein, ein größerer Brecher an der Küste oder ein nahender Lastwagen – aber dann … Unsere Blicke trafen sich. Als das Beben anschwoll, griff sie nach meiner Hand.
Blätter raschelten, und in einer Pfütze kräuselte sich das Wasser. Unter dem Küchenfenster der Fujimoros bildete sich ein feiner Riss, der im Zickzack bis zum Fundament hinunterlief. Ich blieb so reglos wie möglich stehen, hielt Mrs. Fujimoros Hand und dachte an meine Mutter und ihren Unfall, an den Moment, da sie erkannt haben musste, dass sie den Zusammenprall genauso wenig abwenden konnte, wie sich der Lauf des Mondes ändern ließ.
Das Beben hörte wieder auf. Aus dem Haus drang die fragende Stimme eines Kindes zu uns. Mrs. Fujimoro atmete tief durch, trat einen Schritt zurück und verneigte sich. Sie hob ihren Besen auf, und ihr eben noch so unverstellter Gesichtsausdruck wirkte wieder verschlossen und distanziert. Ich blieb allein auf dem ausgetretenen Pflaster zurück.
»Haben Sie das Gas abgestellt?«, fragte sie mich.
»Aber ja!«, versicherte ich. »Ja, ich habe das Gas abgestellt.« Diesen Dialog führten wir häufiger, diese Worte gehörten zu den wenigen japanischen Sätzen, die ich fehlerfrei hersagen konnte.
Als ich mich umwandte, stand Yoshi in der Tür, mit zerzaustem Haar und einem alten T-Shirt über der Jogginghose. Er sah wie immer freundlich aus und verneigte sich respektvoll vor Mrs. Fujimoro, die seine Verbeugung erwiderte und auf Japanisch mit ihm zu sprechen begann. Ihr Mann war mit Yoshis Vater zur Schule gegangen, und die Fujimoros waren unsere Vermieter. Wenn Yoshis Eltern aus London zu Besuch kamen – seine Mutter ist Britin –, übernachteten sie gleich um die Ecke in einer Wohnung, die ebenfalls den Fujimoros gehörte.
»Worüber habt ihr geredet?«, fragte ich, als Yoshi sich schließlich ein zweites Mal verneigte und wieder ins Haus kam. Er war zweisprachig aufgewachsen und wechselte mühelos zwischen Englisch und Japanisch hin und her.
»Sie hat von dem großen Kanto-Erdbeben in den zwanziger Jahren erzählt. Einige ihrer Verwandten sind damals gestorben, und sie sagte, das könnte der Grund sein, warum sie sich selbst bei kleinen Erdstößen so sehr fürchtet. Sie hat schreckliche Angst, dass ein Feuer ausbrechen könnte. Und sie hofft, dass sie dich nicht erschreckt hat, weil sie deine Hand genommen hat.«
»Natürlich nicht«, sagte ich, folgte Yoshi in die Küche und nahm meine leere Teetasse mit. »Ich fürchte mich doch auch vor den Beben. Ich verstehe gar nicht, wie du so ruhig bleiben kannst.«
»Na ja, entweder hören sie wieder auf oder eben nicht. Daran kann ich schließlich nichts ändern, oder? Außerdem – sieh mal, hier«, fuhr er fort und zeigte auf die Zeitung, die ich natürlich nicht lesen konnte. »Da steht auf der ersten Seite, dass vor der Küste gerade eine Unterwasserinsel entsteht und danach alles wieder besser wird. Es ist nur eine Art Druckausgleich.«
»Wie beruhigend.« Ich sah ihm dabei zu, wie er mit präzisen, geübten Bewegungen einen neuen Tee aufgoss. »Yoshi, meine Mutter hatte einen Unfall.«
Er blickte auf.
»Was ist passiert? Geht es ihr gut?«
»Ein Autounfall. Kein schwerer, glaube ich. Oder es war doch ein schwerer Unfall, aber es geht ihr trotzdem gut. Je nachdem, wessen Version man liest.«
»Oje, die Arme. Fährst du hin?«
Ich antwortete nicht gleich. Hoffte er, dass ich ginge? Wollte er lieber allein sein?
»Eher nicht«, sagte ich schließlich. »Sie sagt, es geht ihr gut. Außerdem brauche ich endlich einen Job.«
Yoshi fixierte mich mit einem Blick, der mich einst zu ihm hingezogen hatte und den ich jetzt als einengend empfand: als würde er mich in- und auswendig kennen.
»Einen Job kannst du auch noch nächste Woche finden oder nächsten Monat.«
Ich starrte aus dem Küchenfenster auf die Hauswand gegenüber.
»Nein, Yoshi. Ich will es nicht vor mir her schieben. Das ewige Nichtstun macht mich langsam verrückt.«
»Tja«, sagte Yoshi gutgelaunt und setzte sich an den Tisch. »Da kann ich dir allerdings nicht widersprechen.«
»Ich habe alles abgegrast«, sagte ich verstimmt. »Du hast ja keine Ahnung.«
Yoshi schälte eine Mandarine auf seine eigene, sehr geschickte Art, die eine fast intakte Schale zurückließ, wie eine kleine Laterne. Er sah nicht zu mir hoch.
»Was ist denn mit der Beraterstelle bei dem chinesischen Dammbauprojekt am Mekong? Hast du dich da beworben?«
»Noch nicht. Es steht auf meiner Liste.«
»Deiner Liste, Lucy? Wie lang kann die schon sein?«
Diesmal atmete ich tief durch, bevor ich antwortete. Wir hatten uns seit Wochen auf unseren Ausflug in die Berge gefreut, und ich wollte keinen Streit.
»Ich musste erst noch recherchieren«, sagte ich und erinnerte mich selbst daran, wie wir vor wenigen Stunden noch miteinander getanzt hatten, in ebendieser Küche, im Duft des Jasmins.
Yoshi gab mir ein Stück von seiner Mandarine. Diese kleinen Früchte, Mikans genannt, wuchsen überall auf den umliegenden Hügeln und sahen, wenn sie reiften, wie leuchtender Baumschmuck aus. So hatten wir sie bei unserem ersten Besuch im vergangenen Herbst gesehen, als Yoshi gerade seine Stelle angeboten bekommen hatte und alles so neu und vielversprechend schien.
»Lucy, vielleicht solltest du dir doch lieber eine Pause gönnen und deine Mutter besuchen? Ich könnte sogar nachkommen, wenn ich in Jakarta fertig bin. Das fände ich schön. Ich würde deine Mutter gern kennenlernen.«
»Aber es ist so ein weiter Weg!«
»Nur, wenn man ihn zu Fuß gehen will.«
Ich lachte, aber Yoshi war es ernst. Er sah mich mit seinen onyxfarbenen Augen an, die dunkel waren wie der Grund eines tiefen Sees. Mir stockte der Atem, als mir wieder die letzte Nacht einfiel und der unverwandte Blick, mit dem er so sanft seine Fingerspitzen über meine Haut wandern ließ. Yoshi war oft beruflich unterwegs – er entwarf als Ingenieur Brücken für einen multinationalen Konzern –, und seine Reise nach Jakarta hatte ich mir nur als eine weitere Trennung vorgestellt. Dass sie uns stattdessen einander näherbringen sollte, erschien mir paradox.
»Willst du denn gar nicht, dass ich sie kennenlerne?«, fragte er.
»Das ist es nicht«, sagte ich. Ich griff nach der leeren Mandarinenschale und wog das fragile Gebilde in der Hand. »Jetzt ist nur einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Außerdem ist meiner Mutter nichts Ernstes passiert. Es ist nicht gerade ein Notfall.«
Yoshi zuckte mit den Schultern und nahm sich noch eine Mandarine. »Einsamkeit kann auch ein Notfall sein.«
»Was soll das heißen?«
»Ich meine nur, dass du in letzter Zeit ziemlich einsam und unglücklich wirkst, Lucy.«
Ich wandte mich ab und blinzelte, überrascht, weil mir plötzlich die Tränen kamen.
»He, Lucy.« Er berührte mit seinen klebrigen Fingern meine Hand. »Es tut mir leid, okay? Vergiss es einfach. Lass uns in die Berge fahren, wie geplant.«
Und das taten wir. An der Küste war der Himmel bedeckt, doch je höher sich der Zug in die Berge hinaufwand, desto mehr wurde ein heller, sonniger Tag daraus. Im beginnenden Frühling hatten sich die blühenden Kirsch- und Pflaumenbäume leuchtend von den Hängen abgehoben, den Boden mit ihren weißen Blütenblättern bedeckt, und meine Vokabellektionen hatten wie Gedichte geklungen: Baum, Blüte, fallen, wehen, Schnee. Jetzt grünte in der wasserreichen Ebene schon der Reis, doch hier oben hielt sich die erste Jahreszeit. Die Hortensien öffneten ihre grünen Blüten, an den Rändern violett und blau, und drängten sich üppig und dicht bis an die Schienen heran.
Wir wanderten zu einem Freiluftmuseum unter dem lichten Dach der Zedern und aßen zu Mittag in einem Bergdorf, das auf dem Rand eines schlafenden Vulkans erbaut war. Den ganzen Tag plauderten wir entspannt miteinander, wie zu unseren besten Zeiten. Bei Einbruch der Dämmerung erreichten wir das Rotenburo, eine heiße Quelle unter freiem Himmel, und verabschiedeten uns vor dem Eingang. Die Umkleide war ganz aus Kiefernholz, wohltuend schlicht und fast leer. Ich wusch mich sorgfältig von Kopf bis Fuß, übergoss mich mit warmem Wasser und ging nackt zu dem steinigen Quellbecken hinaus. Die Luft war kühl, und am indigoblauen Himmel stand schon der Mond. Zwei andere Frauen saßen mir gegenüber an die glatten Felsen gelehnt und unterhielten sich miteinander. Vor dem dunklen Gestein wirkte ihre Haut fast weiß, und ihre Körper verschwanden hüftabwärts im Wasser. Ihre Stimmen mischten sich mit dem Geplätscher der Quelle. Die Gespräche der Männer hinter der Wand schwappten zu uns herüber.
Ich ließ mich in das dampfende Wasser gleiten und stellte mir vor, wie verschlungene unterirdische Ströme diese Quellen speisten, dachte daran, wie alles mit allem verbunden war und wie sich mein Leben mit Yoshi in Japan einer einzigen Entscheidung verdankte, die ich vor über zwei Jahren, in meinen ersten Wochen in Jakarta, ganz beiläufig getroffen hatte. Ich kam gerade von einer anstrengenden einwöchigen Feldstudie an einem Kanalsystem zurück, ließ mein Gepäck auf die kühlen Marmorfliesen fallen und wünschte mir nichts weiter als eine warme Dusche, einen Teller Nasi Goreng und einen Drink. Meine Mitbewohnerin, die bei der irischen Botschaft arbeitete, war auf dem Weg zu einer Party und lud mich ein mitzukommen. Obwohl sie gutes Essen und noch bessere Musik in Aussicht stellte, sagte ich nein, doch in letzter Minute überlegte ich es mir anders.
Aus dem großen Haus, in dem die Party stattfand, drangen lachende Stimmen und Musik. Ich trug ein maßgeschneidertes dunkelblaues Seidenkleid, das meiner Figur schmeichelte und meine Augenfarbe unterstrich, mischte mich unter die Leute und plauderte mit Freunden und Bekannten. Als ich an einer Balkontür vorbeikam, zog es mich plötzlich hinaus an die frische Luft. Yoshi lehnte am Geländer und betrachtete gedankenverloren den Fluss, der unter uns vorüberzog. Ich hielt inne, denn ich wollte ihn nicht stören. Doch er drehte sich zu mir um und lächelte dieses warme, einladende Lächeln, das manchmal sein ganzes Gesicht erhellt. Er fragte, ob ich ihm Gesellschaft leisten wollte.
Ich stellte mich neben ihn ans Geländer. Zuerst wechselten wir kaum ein Wort, sondern starrten nur fasziniert in die wirbelnden braunen Fluten. Als wir dann doch ins Gespräch kamen, stellte sich heraus, dass wir einiges gemeinsam hatten. Wir waren gleich alt, und außer unserem Arbeitsgebiet und der Lust am Reisen verband uns die Tatsache, dass wir beide kein Bier vertragen. Wir unterhielten uns so angeregt, dass wir weder die anderen Gäste bemerkten, die kamen und gingen, noch unsere längst geleerten Gläser oder die heraufziehenden Wolken – bis plötzlich der Monsunregen auf uns niederprasselte und uns bis auf die Haut durchnässte. Yoshi und ich sahen einander an, mussten beide lachen, und er hob die Hände den herabstürzenden Wassermassen entgegen. Nass, wie wir waren, sahen wir keinen Sinn mehr darin, ins Haus zu gehen. Wir blieben auf dem Balkon, bis der Regen ebenso plötzlich wieder aufhörte. Yoshi begleitete mich durch die dunklen, neblig feuchten Straßen bis nach Hause. Dann strich er mir mit beiden Händen das Wasser aus dem Gesicht und gab mir einen Kuss.
Zuerst fiel es mir leicht, ihn auf Distanz zu halten. Von den unverbindlichen Fernbeziehungen, in die Berufsnomaden wie wir so leicht hineingerieten, hatte ich gründlich genug. Dann begann die Regenzeit. Sie setzte ungewöhnlich früh ein, und die Wolkenbrüche waren heftiger als sonst, füllten viel zu rasch die offenen Kanäle der Stadt und ergossen sich in die Straßen. Jakarta war zu großen Teilen eben, und das unaufhaltsame Wachstum der Stadt hatte Bäume und Brachen vernichtet und nur wenige Flächen übriggelassen, die den Regen hätten aufnehmen können. Das Wasser stieg und stieg. Eines Morgens sah ich Fische über den Rasen schwimmen, und mittags stand mir das Wasser im Wohnzimmer schon bis zu den Knöcheln. Meine Mitbewohnerin und ich sahen in den Nachrichten, wie die Flut Autos wegspülte, Häuserfassaden unterhöhlte und ein ganzes Dorf mit sich fortriss, die Heimat von 143 Menschen.
Als der Wasserspiegel allmählich wieder sank, organisierten Yoshi und zwei seiner Kollegen eine Aufräumaktion in einem Kinderheim. Er holte mich mit einem geliehenen alten Pick-up zu Hause ab und fuhr mich quer durch die zerstörte Stadt. Das ganze Grundstück des Heims war mit Schlamm und Schutt bedeckt. Es stank. Wir hatten den ganzen Tag zu tun und auch den Tag darauf, und Yoshi war überall zugleich, beim Schlammschaufeln wie bei der Einteilung der freiwilligen Helfer. Einmal beugte er sich zu einem kleinen Jungen hinunter, der in einem zerschlissenen roten Hemd weinend im Morast hockte, hob ihn hoch und trug ihn ins Haus.
Als er mich an jenem zweiten Tag nach Hause fuhr, öffnete der Himmel wieder seine Schleusen. Auf dem Weg vom Auto zur Haustür kramte ich nach dem Schlüssel, rutschte aus und griff im Fallen nach dem Ast eines Mangobaums. Blätter und Zweige regneten auf mich herab, Pollen und Blütenblätter, tote Äste. Ich hatte schon nach der Aufräumaktion furchtbar ausgesehen. Yoshi half mir hoch, und irgendwie schafften wir es durch die Tür. Komm her, sagte er, du zitterst ja. Wir drehten die Dusche auf und zogen uns aus. Schließ die Augen, sagte er und trat unter dem dampfend heißen Wasserstrahl hinter mich. Seine Hände wühlten sich in mein Haar, hüllten jede Strähne in duftenden Schaum, massierten meine Schläfen, meine Schultern. Das heiße Wasser trug die Kälte und den Schmutz mit sich fort. Ich gab seinen Berührungen nach, und als er meine Brüste behutsam, wie zwei Blüten, in die Hände nahm, wandte ich mich zu ihm um.
Und jetzt waren wir hier, so viele Meilen und Tage von damals entfernt. Yoshis Stimme wehte über die Trennwand zu mir herüber. Er lachte. Ich glitt tiefer, legte den Kopf auf einen Stein und ließ mich treiben. Dampf stieg hoch, mein Körper schimmerte unter der Oberfläche im Mondlicht, und die Frauen auf der anderen Seite waren noch immer leise ins Gespräch vertieft. Vielleicht waren sie Mutter und Tochter oder sehr verschieden alte Schwestern, denn sie hatten eine ähnliche Figur, und die Gesten der einen spiegelten die der anderen Frau. Ich dachte wieder an meine Mutter, die allein zu Hause saß.
Du wirkst in letzter Zeit ziemlich einsam und unglücklich. Yoshis Bemerkung hatte mich verletzt, doch ich konnte nicht umhin, mich zu fragen, ob er recht hatte. Nur wenige Wochen nach dem Tod meines Vaters war ich aufs College gegangen, um dem Schweigen zu entkommen, das wie ein Fluch über meinem Elternhaus lag. Keegan Fall hatte immer wieder versucht, es zu durchbrechen, doch ich hatte ihn barsch abgewiesen, zwei Mal, drei Mal, bis er nicht mehr wiederkam. Seither war ich immer in Bewegung – vom College ging ich an die Grad School, wechselte von einem Job zum nächsten, stürzte mich in eine Beziehung nach der anderen, floh vor meinem Schmerz und blickte nie zurück, bis ich jetzt, in Japan, jäh zum Stillstand kam.
Nacheinander stiegen die Frauen aus dem Becken, wühlten kleine Wellen auf und hinterließen dunkle Tropfspuren auf den Felsen. Ich musste an meinen Traum denken, an die Gesichter unter dem Eis. Mein Vater hatte mir immer Geschichten erzählt, in denen ich die Heldin war, und am Ende wurde alles gut. Auf den Schock seines plötzlichen Todes war ich nicht vorbereitet gewesen. Er war, wie sich bei der Autopsie herausstellte, gestürzt, hatte sich am Boot den Kopf angeschlagen und war ins Wasser gerutscht, ein Unfall, der sich nie vollständig hatte aufklären lassen. Seine Angel hatte man Tage später gefunden, sie hatte sich am Rand der Marschen im Schilf verfangen.
Ich stieg aus dem Wasser und zog mich an. Yoshi war noch nicht da, also wanderte ich ziellos einen mit Steinen gepflasterten Pfad entlang. Er folgte einem Bach und endete bald darauf am Ufer eines Tümpels, der kreisrund und silbern im Mondlicht vor mir lag. Am anderen Ufer, im Schatten der Bäume, regte sich etwas.
Nicht zum ersten Mal an diesem Tag hielt ich den Atem an. Ein riesiger Reiher stand dort, die Flügel eng angelegt, die Beine halb im dunklen Wasser verborgen. Der Teich beruhigte sich und glitzerte im Mondschein wie Katzengold. Dann bemerkte ich neben dem ersten einen zweiten, kleineren Reiher. Sie erinnerten mich an die zwei Frauen in der Thermalquelle, als hätte sie das Mondlicht nach dem Bad in diese stillen, wunderschönen Vögel verwandelt. Yoshi rief nach mir, und die Reiher breiteten ihre großen Flügel aus. Ruhig und anmutig hoben sie sich aus dem Wasser und flogen davon; ihre Schatten huschten über den See.
»Lucy«, rief Yoshi noch einmal. »Wenn wir uns beeilen, kriegen wir den nächsten Zug.«
Auf dem Weg in die Ebene holte uns die Hitze wieder ein. Die Hortensienblüten vor den Zugfenstern welkten mit jedem Höhenmeter, als wäre der lange, allmähliche Lauf der Jahreszeit auf eine einzige Stunde zusammengeschrumpft. Als wir unsere Haltestelle am Meer erreichten, waren gar keine Blüten mehr zu sehen, nur glänzendes Blattwerk. Wir liefen auf schmalen Kopfsteinpflasterstraßen nach Hause. Grillen sangen, und der Boden vibrierte von der nahen Brandung. Zwei Mal hielt ich an.
»Ist das das Meer?«, fragte ich.
»Wahrscheinlich.«
»Kein Erdbeben?«
Yoshi seufzte, fast ein wenig gequält. »Ich weiß es nicht. Vielleicht ein leichtes.«
Auf dem Esstisch war eine Vase umgefallen. Bücher lagen auf dem Boden verstreut. Ich wischte das Wasser auf und fegte die Blüten zusammen. Als ich mich aufrichtete, gab es einen heftigen Ruck, so stark, dass selbst Yoshi darauf reagierte und mich zu sich auf die Türschwelle zog. Minutenlang blieben wir dort stehen und spürten das Zittern des Bodens unter unseren Füßen. Ich war so müde. Mir graute vor der kommenden Nacht, vor den Erdbeben und Alpträumen. Vor dem nächsten Tag, dem nächsten grundlosen Streit und der undurchdringlichen Stille, wenn ich allein zu Hause blieb. Ich dachte an die beiden Reiher, an ihre breiten, dunklen Schwingen.
»Yoshi«, sagte ich, »vielleicht sollte ich doch meine Familie besuchen.«
Kapitel 2
Zwei Tage darauf machten wir uns vor Sonnenaufgang auf den Weg zum Bahnhof. Mein Rollkoffer holperte im Frühnebel über das Kopfsteinpflaster. Wir liefen die gewundene Gasse hoch, vorbei an den Obstständen und Getränkeautomaten für Sake und Bier, am Tempel mit dem Skulpturengärtchen und einem Laden, der hausgemachten Tofu verkaufte. Yoshi trug ein weißes Hemd zum schwarzen Anzug, sein Salaryman-Outfit, über das ich mich früher immer ein wenig lustig gemacht hatte, das in den letzten Monaten jedoch zunehmend zu einem Teil seines wahren Selbst geworden zu sein schien. Bildete ich es mir nur ein, oder entfernte sich Yoshi mehr und mehr von dem Menschen, den ich zu kennen glaubte? War dies seine eigentliche Persönlichkeit, die mir nur damals, im Land unserer Träume, verborgen geblieben war?
Die Fahrt nach Tokio dauerte eine Stunde, und allmählich füllte sich der Zug, enger und enger presste uns die Menschenmenge aneinander. Beim Aussteigen hakte sich Yoshi bei mir unter, damit wir uns im Gewimmel nicht aus den Augen verloren. Wir waren seit dem Ausflug sehr freundlich und höflich zueinander, beinahe förmlich, aber jetzt, auf dem Bahnsteig, inmitten des uferlosen Stroms von Männern in dunklen Anzügen, blieb Yoshi stehen, wandte sich zu mir um und ließ ein kleines Päckchen in meine Handtasche gleiten.
»Eine Webcam«, erklärte er, »damit wir skypen können. Und in zwei Wochen sehen wir uns wieder.« Er legte mir die Hände auf die Schultern und gab mir zwischen all den ungeduldig vorüberdrängenden Menschen einen langen, innigen Kuss. »Pass auf dich auf«, sagte er. »Ruf mich an.« Dann tauchte er in den Strom der Pendler ein und verschwand.
Ich stieg in den Flughafen-Shuttle und suchte mir einen Sitzplatz. Obwohl ich die Erinnerung an Yoshis Berührungen in mir wachzuhalten versuchte, begann sie mit dem Vorüberziehen der regengrauen Landschaft bald zu verblassen. Ich lehnte mich zurück und dachte an die bevorstehende Begegnung mit meiner Familie. Bisher hatte ich mich bemüht, mindestens ein Mal im Jahr nach Hause zu fliegen, doch der Umzug nach Japan war mir dazwischengekommen, und mein letzter Besuch lag fast zwei Jahre zurück. Mein Fernweh musste ich wohl geerbt haben, wenn man den Familienlegenden glauben durfte, die mich seit frühester Kindheit begleiteten. Mein Urgroßvater, Joseph Arthur Jarrett, erlebte mit sechzehn die Rückkehr des Halley’schen Kometen. Damals, 1910, als alle Welt der Ankunft des Himmelskörpers mit Angst und Schrecken entgegensah, bewahrte der junge Abenteurer einen kühlen Kopf, stahl sich nachts aus dem Haus und stieg den Hügel zur Kirche hinauf, um das historische Ereignis mit eigenen Augen zu sehen. Er war ein Träumer und Enthusiast, und er besaß eine Gabe, die er genauso wie seine ungewöhnlichen Augen an die nächsten Generationen weiterreichen sollte: Mit seinem feinen Gehör entlockte er jedem Türschloss sein Geheimnis. Die Riegel am Glockenturm gaben seinem tastenden Draht nach, setzten sich in Bewegung, und die Tür sprang auf. Er stieg die ausgetretenen Stufen hoch, bis er den Kometen entdeckte, der sich zwischen den vertrauten Sternen über das Firmament wölbte. Er sah zu ihm auf. Wie eine Segnung, dachte er. Wie ein Geschenk. Das Wort , Umlaufbahn, kam aus dem Lateinischen, von , Rad. Mein Urgroßvater, der wie sein Vater und dessen Vater Stellmacher werden sollte, empfand dieses neue, fremde Licht als ein Zeichen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!