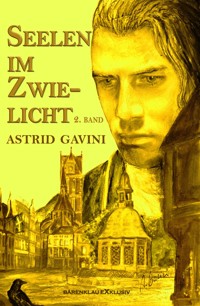3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bärenklau Exklusiv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wismar zur Zeit der Schwedenherrschaft.
Bei der verheerenden Explosion dreier Wehrtürme im Jahre 1699 stand ein Großteil der Stadt in Flammen. Elisabeth und Peter Hennings – Kinder eines angesehenen Kaufmannes – verloren bei diesem Unglück ihre Eltern und fast das gesamte Hab und Gut.
Die Geschwister sind, trotz eines Vormundes, die meiste Zeit auf sich selbst gestellt. Recht bald werden sie als junge Erwachsene mit Ereignissen konfrontiert, gegen die sogar ein gemeinsamer Kampf unmöglich erscheint.
Es sind nicht nur die Plagen des physischen Überlebens in einer schwierigen Zeit. Menschliche Abgründe und die Macht der elitären Bürgerschaft sowie des stets gegenwärtigen Aberglaubens beeinflussen ihre Wege ebenso, wie eine korrupte Gesellschaft, kirchlichen Einfluss und beängstigende, mysteriöse Vorfälle.
So ist es nur eine Frage der Zeit, bis der labile Piet in einen fatalen Sog negativer Macht gerät und seine sanftmütige Schwester mit in ein unausweichliches Elend zieht.
Als Elisabeth dem schwedischen Offizier Liam Lindkvist begegnet, ahnt sie noch nicht, dass dieser ein Geheimnis mit sich trägt, welches ihr zur Bestimmung werden soll.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Astrid Gavini
Seelen im Nebel
Band 1
Historischer Roman
Impressum
Neuausgabe: 2023
Copyright © by Authors/Bärenklau Exklusiv
Cover und Illustration: © by Astrid Gavini
Korrektorat: Bärenklau Exklusiv
Verlag: Bärenklau Exklusiv. Jörg Martin Munsonius (Verleger), Koalabärweg 2, 16727 Bärenklau. Kerstin Peschel (Verlegerin), Am Wald 67, 14656 Brieselang
Die Handlungen dieser Geschichte ist frei erfunden sowie die Namen der Protagonisten und Firmen. Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und nicht gewollt.
Alle Rechte vorbehalten
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Das Buch
Seelen im Nebel
Vorwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Das Buch
Wismar zur Zeit der Schwedenherrschaft
Bei der verheerenden Explosion dreier Wehrtürme im Jahre 1699 stand ein Großteil der Stadt in Flammen. Elisabeth und Peter Hennings – Kinder eines angesehenen Kaufmannes – verloren bei diesem Unglück ihre Eltern und fast das gesamte Hab und Gut.
Die Geschwister sind, trotz eines Vormundes, die meiste Zeit auf sich selbst gestellt. Recht bald werden sie als junge Erwachsene mit Ereignissen konfrontiert, gegen die sogar ein gemeinsamer Kampf unmöglich erscheint.
Es sind nicht nur die Plagen des physischen Überlebens in einer schwierigen Zeit. Menschliche Abgründe und die Macht der elitären Bürgerschaft sowie des stets gegenwärtigen Aberglaubens beeinflussen ihre Wege ebenso, wie eine korrupte Gesellschaft, kirchlichen Einfluss und beängstigende, mysteriöse Vorfälle.
So ist es nur eine Frage der Zeit, bis der labile Piet in einen fatalen Sog negativer Macht gerät und seine sanftmütige Schwester mit in ein unausweichliches Elend zieht.
Als Elisabeth dem schwedischen Offizier Liam Lindkvist begegnet, ahnt sie noch nicht, dass dieser ein Geheimnis mit sich trägt, welches ihr zur Bestimmung werden soll.
***
Seelen im Nebel
Vorwort
»Seelen im Nebel« ist der erste Teil einer außergewöhnlichen historischen Geschichte, die zu Anfang des 18. Jahrhunderts in der Hansestadt Wismar an der Ostsee spielt.
Die Jahre der Hanse- und Handelsmacht sind vorüber. Die Bürger kämpfen fast ausschließlich um das nackte Überleben, und die schwedische Obrigkeit scheint 1707 auch weiterhin das Sagen zu haben.
Man fragt sich vielleicht, was kann ein Roman Besonderes über eine Stadt berichten, die nach dem Leid des Dreißigjährigen Krieges und dessen erschütternden Spätfolgen nur noch darum bemüht ist, nicht an ihrem Elend zugrunde zu gehen?
Doch hinter diesen historischen Tatsachen verstecken sich viele menschliche Schicksale, wie das der Geschwister Elisabeth und Peter Hennings – deren Geschichte auf wahren Begebenheiten basiert.
Der dreiteilige Roman verdeutlicht nicht nur einen fast aussichtslosen Kampf um ein menschenwürdiges Dasein in einem, uns heute fremdartig anmutenden Zeitalter. Er erzählt auch über ein Mysterium, welches den Geschwistern auf erbarmungslose Weise ihre Bestimmung zeigt und diese sogar letztendlich in den nachfolgenden Bänden: »Seelen im Zwielicht« und »Seelen im Feuer« mit der Gegenwart verbindet
Wismar, im Mittelalter auch als »Wismaria« bekannt, wird in dieser Geschichte jenen Namen behalten und den Leser mit auf eine Zeitreise nehmen.
Aufs Allerherzlichste möchte ich mich an dieser Stelle bei dem Historiker und Leiter des Archivs der Hansestadt Wismar, Herrn Dr. Nils Jörn, für dessen unschätzbare Hilfe und Beistand auf meiner ganz speziellen Recherchereise durch die Jahre 1699 – 1716 bedanken.
archivverein-wismar(Punkt)de
Es war mir ein Anliegen, mit diesem Roman ein spannendes Stück Geschichte lebendig machen zu können.
Astrid Gavini
Kapitel 1
»Hast Du das gesehen?«, flüsterte der Soldat mit einem Ausdruck tiefster Fassungslosigkeit. Die hektisch ausgestoßene, kurze Gegenfrage seines Gefährten »Was?«, war überflüssig. Er blickte in dieselbe Richtung und wusste von daher genau, was Yorick meinte.
Alle vier hatten es gesehen, aber nur Yorick hatte sich getraut, den Mund aufzumachen und schien ganz besonders ergriffen.
Der Blick der Männer ging über die Backsteinmauer, die den Bodennebel unter der tiefblauen Nacht zu teilen schien.
Weit über dem Sockel der Kirche Sankt Georgen war dieser zu einem dichten, wabernden Nebelsee zusammengerückt und umspielte das Bauwerk mit spektralem Glimmen.
Dann war es plötzlich da: dieses Ding, das wie ein weißblauer Lichtpunkt im Innern der Kirche an den hohen Fenstern von der Westseite gen Osten huschte. Für einen Augenblick hielt es in dem gigantischen Mittelfenster über dem Tor inne und schien die Form eines menschlichen Wesens annehmen zu wollen.
Blickte da etwa eine, im Nebel stehende Person in den düsteren Garten und somit direkt zu ihnen und ihrem grausamen Tun herunter? Eine Sekunde nur, dann erlosch der Spuk, und jeder fühlte ein aufsteigendes Unbehagen, ohne ein weiteres Wort dazu sagen zu wollen.
Hatte sie ein Wesen aus dem Reich der Toten, das in der Kirche hauste, bei ihrer geheimen Tat ertappt?
»Das gefällt mir nicht«, raunzte Malte und ging zu dem Gehängten zurück. Dabei hätte er sich fast mit seinem Fuß in dem Riemen der im vernebelten Gras liegenden, mit Branntwein angefüllten Lederflasche verfangen.
Die Kameraden hatten nicht nur verstanden, sondern waren bereits vor seiner Äußerung der gleichen Meinung.
»Hängen wir den Schurken ab und beenden wir das Fest angemessen.« Roland äußerte sich nach einem kurzen, keuchenden Husten weiterhin besorgt.
»So viel haben wir doch gar nicht gesoffen. Ich meine … wir können doch nicht alle den gleichen Wahnwitz vernehmen, wenn´s nur vom Branntwein kommen sollte.«
Gustav zog sich die Mütze tiefer in die Stirn.
»Der hat uns verflucht! – Der Unhold hat in der Kirche nach Hilfe geschrien. Die Hilfe einer toten Person gewiss! Das war ein Geist!«
»Halts Maul mit dem Mist!« Dass Yorick, der Schwede, ihn derart anfuhr, ärgerte Gustav.
Auch Gustavs Freund Roland hielt dagegen und die gute Stimmung, das schadenfreudige, branntweinselige Gekicher, sowie die Verbundenheit der Genugtuung schien von der einen auf die nächste Minute irren Vermutungen und abergläubischem Gezeter Platz machen zu wollen.
Die beiden Schweden gaben nicht viel auf Spuk und Geister, verhielten sich aber dennoch angespannt und ließen den Blick nicht von der Kirchenfront.
Was aber sollte es sonst für ein vorbeiziehendes Licht gewesen sein? Der zunehmende Mond stand still, versilberte nur leicht die Kronen der Bäume und gab dem, über dem Boden schwebenden Nebel ein feines Leuchten.
»Dieser Verräter hat uns betrogen und bestohlen! Er hat das Leben unserer Freunde auf dem Gewissen … Er hat den Strang verdient. Egal, was ein Geist dazu meint!«, bemerkte Gustav nun kühn, obwohl seine Gebärden hektisch und nervös wirkten. Er stellte erneut die kleine Leiter an den breiten Lindenstamm, stieg auf und schnitt mit seinem stumpfen Messer – und von daher mit viel Anstrengung – das dicke Henkerseil vom Ast.
Der leblose Körper des Hingerichteten fiel hart auf die Erde und sackte in sich zusammen. Bevor Roland den Toten am Hemdkragen packte, nahm er noch einen kräftigen Schluck Branntwein aus der Lederflasche und ließ diese an ihrem Riemen neben dem Lindenstamm erneut zu Boden sinken. Daraufhin schleifte er keuchend den Leichnam zu dem drei Schritte weiter gegrabenen Loch, um ihn mit den Füßen – wie einen Sack Abfall – hineinzustoßen. Malte half ihm dabei.
Der Tote schlug mit dem Gesicht nach unten in dem schmalen Grab auf und verdrehte sich dabei in bizarrer Weise. Man hatte beim Ausgraben nicht auf eine angemessene Breite geachtet. Das aber war in dem Moment jedem egal. Yorick warf das Henkerseil hinterher.
Der Söldner Malte und Gustav, der Schmied, griffen sofort zu den Spaten. Hastig schaufelten sie das ausgehobene Erdreich in das Loch und stampften dieses wieder und wieder ein. Die beiden anderen Mittäter schoben mit Händen und Füßen die feuchte Erde nach.
Das abgestochene Gras wurde letztendlich sorgsam, wie eine aufgerollte Matte darübergebreitet, ebenfalls festgedrückt, mit einigen umherliegenden Steinen beschwert und mit ein paar Zweigen verdeckt.
Der Nebel legte derweil seinen dunstigen Atem über das Grab. Das Ergebnis schien perfekt, geradezu harmlos.
Für einen Moment sah es sogar so aus, als sei überhaupt nichts geschehen. Man hätte annehmen können, dass sich vier Gefährten in einer lauen, vernebelten Mainacht im großen Garten hinter Sankt Georgen treffen wollten, um einen vergrabenen Schatz zu heben und dabei schon im Voraus kräftig gefeiert hätten.
Es lief genauso, wie geplant.
Nein, es kam kein schlechtes Gewissen auf. Nur wollte sie diese seltsame Form von Unruhe nicht mehr loslassen und kurz darauf eine plötzliche Panik erschüttern. Yorick stieß Gustav an die Schulter. »Lass uns hier abhauen!«
Sofort schien jeder wortlos zu zustimmen. Yorick hatte die ganze Zeit über nicht die Augen von Sankt Georgen abgewandt, und nun sahen alle in seine Blickrichtung.
Die Basis des monumentalen Mittelfensters an der Frontseite der Kirche phosphorisierte erneut bläulich weiß. Es schien, als würden die Metallstreben, die die rautenförmige Bleiverglasung zusammenfügten, glühen. Sogleich zeigte sich jedem die transparente, leicht verschwommene Gestalt einer Frau, die starr zu den Bäumen hinter der Mauer und somit zu ihnen hinunterblickte.
Augenblicklich hetzten die vier Täter mit ihrer kleinen Leiter zur Westmauer. Noch rechtzeitig erinnerte sich Malte an die Lederflasche an der Linde, packte diese an ihrem Riemen und rannte stolpernd zur alten Mauer zurück, um diese so schnell wie möglich zu überwinden. Doch keiner der Vier schaffte es, ohne nochmals zurückzublicken.
Die Gestalt am Kirchenfenster war verschwunden. Nun aber schien ein schmaler Nebelschleier vom Garten aus hinüber zur Georgenkirche zu ziehen, um von dem gewaltigen Fenster aufgesogen zu werden. Ein mannshoher Nebelschleier, der genau aus der Richtung kam, in der das nun unsichtbare Grab lag!
In ihrer Verwirrung landeten die vier Täter recht unsanft auf der gegenüberliegenden Seite der Mauer. Man hatte in der Eile darauf verzichtet, die Leiter auch zum Absteigen zu benutzen. Doch keiner wollte in diesem Moment über seine aufgeschlagenen Knie oder Schultern jammern.
Sofort wurde mit allgemein wortlosem Einverständnis die gerettete Lederflasche durch Maltes zitternde Finger geöffnet. Es machte nochmals so lange die Runde, bis der letzte herausgeschüttelte Tropfen durch ihre Kehlen gerutscht war.
Stumm hofften sie auf die Rückkehr ihres tollkühnen Geistes, der sich allerdings nicht zeigen wollte. So wagte es keiner als Erster aufzustehen, um den Heimweg anzutreten. Bedingt durch den hohen Branntweingenuss, wäre dies auch – selbst mit bestem Willen – nach wenigen Minuten niemandem mehr möglich gewesen.
Wie verängstigte Kinder saßen die vier Mörder mit dem Rücken zur alten Mauer in der Finsternis. Leise fluchend starrten sie noch eine Weile in die flackernden Pechfackeln an den Hauswänden auf der gegenüberliegenden Straßenseite, bis sie schließlich der bleierne Schlaf einholte …
Kapitel 2
Die dunklen Novembertage hatten Einzug gehalten, aber es war immer noch sehr mild. In der immer kürzer werdenden hellen Tageszeit schien es, als ob die Sonne ihr warmes Regiment nicht so rasch an eine lauernde Kälte abgeben wollte.
Noch senkte sich der Morgennebel vor einem glasklaren, eisblauen Himmel. Wie ein zersplitterter Spiegel funkelte ihm die glatte See entgegen.
Die Rauchschwaden der frühen Kaminfeuer dünnten sich gegen das aufsteigende Sonnenlicht aus, um bereits wenige Stunden später vor einem blassen Abendrot erneut ihre grauen Schleier über die Stadt zu ziehen. Der beißende Geruch, der über Tag aus den Gerbereien zog, legte sich. An den Gestank der in den Abendstunden vom Feld in die Stadtscheunen getriebenen Schweine und anderer Nutztiere hatte man sich gewöhnt. Nun aber roch die Luft zusätzlich nach verbranntem Unrat.
In der zunehmenden Finsternis schlichen die Stimmen des Hafens als das verformte Echo eines untergründigen Nachtlebens durch die düsteren Gassen.
Die tiefen Wunden der einst blühenden Hansestadt wollten nur langsam heilen, und der Weg aus der Dämmerung ins Licht war noch weit. Doch gerade in jenen Jahren wurde Wismaria über die Grenzen hinaus bekannt und geachtet.
Den großen Krieg, mit seiner nimmersatten Feuersbrunst hatte die Stadt vor vielen Jahrzehnten überwunden und befand sich nun in schwedischer Hand. Sie wurde zum wichtigsten Stützpunkt der Schweden außerhalb ihres Landes und eine der stärksten Seefestungen Europas.
Die schwedische Garnison zählte zeitweise über 3000 Mann, die in der Stadt wohnten. Kurzerhand und ohne jegliche Zustimmung der Eigentümer quartierte man die Soldaten und Söldner der schwedischen Garnison – meist sogar mit deren Familien – in die Häuser der Bürger ein. Egal, wie eng die Behausungen bereits waren oder dadurch wurden, die Menschen mussten es hinnehmen und darauf vertrauen, dass man sie schützte. Denn es war jederzeit damit zu rechnen, dass ein weiteres Seefahrervolk in naher Zukunft die Stadt wegen ihrer strategisch günstigen Lage angreifen würde. Die großen Kriege in den Ländern des Nordens waren noch lange nicht ausgestanden.
Somit verharrte Wismaria – die einstige Hanse-und Handelsmacht schon viel zu lange wie eine bewusstlose Person in sich selbst und in der Hoffnung auf ein Wiedererwachen sowie einer baldigen Genesung durch Schutz der schwedischen Krone. Eine andere Hoffnung gab es nicht mehr, nachdem jahrzehntelange Kriege, Pest – und Hungertod als gnadenlose Allmacht ihr grausames Spiel trieben.
So trugen die neuen, durch die schwedische Regierung eingeleiteten Maßnahmen auch allmählich dazu dabei, dass sich die Stadt zu erholen begann. Neben den Soldaten kamen auch schwedische Schiffbauer, Handwerker und Kaufleute in die Hansestadt Wismaria und versuchte hier eine neue Existenz zu gründen.
Alles sollte wieder so werden wie vor dem großen Krieg, darauf gaben die Schweden ihr Wort.
Doch in der allabendlich eintreffenden Dunkelheit kam die Angst zurück, und in der aufsteigenden Nacht ließ sich jedes, noch so kleine Geräusch deutlicher vernehmen, als bei Tage.
Selbst der Herzschlag und die stillen Klagen derer, die in einem jahrzehntelangen Krieg für die Stadt ihr Leben ließen oder im Elend der Seuchen und des Hungers starben, schienen in der Finsternis durch die Gassen zu pulsieren.
Auch der schwere Atem jener, die in der darauffolgenden Zeit der Gesetzlosigkeit verfielen und dadurch ermordet oder hingerichtet wurden, glaubte man durch das Dunkel vernehmen zu können.
Nach solchen Nächten wirkte nichts erfrischender, als die ersten Schreie der Möwen in dem graugoldenen Nebel des neuen Tages. Der rasch eintretende Trubel am Hafen konnte auf den ersten Eindruck ein unbeschwertes Leben vortäuschen. Doch der Kampf um die nackte Existenz war rasch wieder allgegenwärtig.
Elisabeth wollte an einem Morgen jener späten Sonnentage zum Fischmarkt, hinaus zum Hafen. Ihr Bruder hatte sich bereits vor sechs Uhr auf den Weg zur Marien Kirche gemacht. Seinen Meister und zwei weitere Gesellen hatte man zu einer Arbeit im Turm gerufen.
Durchweg wiesen die Kirchen der Stadt sowie viele Häuser enorme Schäden an ihren Türmen und Dachstühlen auf, die noch von der vor neun Jahren stattgefundenen, verheerenden Explosion herrührten.
Die Geschwister Elisabeth und Peter Hennings hatten damals ihre Eltern und – wie viele andere Bürger auch – fast das gesamte familiäre Hab und Gut verloren.
Ein gewaltiges Gewitter schlug in jenem Sommer in die Festung ein, sodass drei mit Schießpulver gefüllte Wachtürme explodierten und einen Großteil der Stadt zerstörten.
Die Familie Hennings war über Generationen als Tuchhändler und Bierbrauer tätig gewesen und zählte zu den wohlhabenden Kaufleuten der Stadt.
Nachdem die trinkfesten Schweden Wismaria eingenommen und sich niedergelassen hatten, blieb die Brauerei auch nach dem Dreißigjährigen Krieg das lukrativste Geschäft.
Dann die Katastrophe: Als 1699 das Wohnhaus sowie die Warenspeicher und das eigene Handelsschiff von Johann Hennings den Explosionen und Flammen zum Opfer fielen, wurde alles, bis auf sein zweites Haus mit dem Tuchlager sowie einer Geldanlage bei der Stadt, vernichtet.
Die Geschwister wohnten daraufhin bei Else Stolterfoht, der Großmutter. Sie war die Witwe eines angesehenen Schneidermeisters und selbst sehr tüchtig in diesem Handwerk. So konnte sie Elisabeth das Schneidern und Nähen beibringen und lehrte diese ein tugendhaftes, christliches Leben.
An einer kleinen Seitenstraße, die von der »Frischen Grube« abbog, befand sich das schmucke Häuschen des Schneidermeisters. Es stand frontal zum Nikolaikirchturm. Nur ein paar alte Linden und die schmale Grasfläche des Sankt Nikolaikirchhofs trennten sie von der Vorderfront des monumentalen Backsteingebäudes.
Die Frische Grube, die der Straße ihren Namen gab, war ein künstlich angelegter Wasserlauf, der sie Stadt mit Trink- und Nutzwasser aus dem nahen Mühlbach versorgte und diente zudem auch für den Warentransport quer durch die Stadt.
Die Großmutter hatte nach der Wehrturmexplosion die Idee, das Geld, welches ihr Schwiegersohn bei der Verwaltung angelegt hatte, der Stadt und Kirchen zu vermachen. Nur ein Drittel davon erbat sie zurück, um dessen überlebende Bedienstete auszahlen und die Schule des Enkelsohnes finanzieren zu können.
Als Gegenleistung gewährte ihr der Stadtrat die Garantie, dass keine Einquartierungen in ihrem Haus sowie in das Henning´sche mit dem Tuchlager vorgenommen würden.
Mit all diesem Handeln fühlte sich die Großmutter auch frei von jener Schuld, die allen Bürgern der Stadt nachgesagt wurde. Denn nur diese hätte zu dem bösen Gottesgericht geführt: verschwenderischer Lebensstil und die Entheiligung des Sonntags sowie Zinswucherer und Spieler waren gewiss dafür verantwortlich zu machen, dass der Herr dieses schlimme Wetter geschickt hatte und die Türme explodieren ließ. Die Sünder hatten ihren Preis gezahlt und die Großmutter zahlte für das Seelenheil ihrer Familie den letzten Reichstaler bei Pastor und Stadt.
Das Haus mit dem Tuchlager in der Baustraße hatten bereits die Eltern der Geschwister zu Lebzeiten an einen Schneidermeister vermietet. Bei diesem fand Elisabeth auch einen Arbeitsplatz als Näherin.
1704, nach dem Tod der Großmutter, trat ein Übereinkommen in Kraft, dass den Enkeln den Einzug in das Haus des väterlichen Erbes in der Baustraße gewährte. Der Schneidermeister zog daraufhin in das Haus der Großmutter am Nikolaikirchhof neben der Frischen Grube.
Dieser Wechsel hatte einen tieferen Sinn: Die Hennings gehörten seit alters her zu dem Kirchenspiel von Sankt Georgen und ihren Kindern sollte dies nicht verwehrt werden.
Somit blieb Elisabeth auch weiterhin der Weg zu ihrem Schneidermeister vertraut. Sie versuchte mit ihrer Arbeit als Näherin den Lebensunterhalt für sich und ihren fünf Jahre jüngeren Bruder Peter – der von allen nur Piet genannt wurde – zusammen mit der Miete des Schneiders zu bestreiten.
Auf diese Weise belasteten Elisabeth und Piet auch nicht die Finanzen ihres Vormundes, dem Kaufmann Paul Streeck aus der Lubekerstrate.
Piet war inzwischen siebzehn Jahre alt und ging in eine Zimmermannslehre, was ihm allerdings keine sonderliche Freude machte.
Eigentlich wusste er selbst nicht, an welcher Tätigkeit er Spaß haben könnte. Er litt an dem gesellschaftlichen Abstieg, obwohl er das Ende der Hennings – Ära als erst siebenjähriger Junge erlebt hatte.
Nach seinem frühzeitigen Abbruch an der großen Stadtschule durfte er an keine gehobene Ausbildung mehr denken, sondern musste sich seinem Schicksal fügen und eine unliebsame Lehre durchziehen.
Was für Piet zu einer Qual werden wollte, hätten andere Jungen in seinem Alter als Privileg gesehen. Für ihn aber schien es ein reines »sich fügen müssen« zu sein, um seine Zukunft in einer schweren Zeit absichern zu können.
Mit dem Beruf seines Vaters, des Kaufmanns, hatte er sich ebenso wenig angefreundet. Das Schmiedehandwerk war ihm zu grob, und zur See mochte er schon gar nicht.
Trotz aller familiären Probleme hatten die Geschwister in der Stadt einen guten Leumund, wofür auch die Verwaltung und die Kirche Sankt Georgen nach dem ordentlichen Geldgeschenk der Großmutter gesorgt hatten. Ihre Namen standen für Opferbereitschaft, Ehrbarkeit und frommen Zusammenhalt. Von dem Kummer einer heranreifenden jungen Frau, die sich um den Lebensweg ihres noch unreifen, jüngeren Bruders mehr sorgte, als um ihren eigenen, wusste keiner etwas.
So gestand am Morgen des 19. November 1707 Piet seiner Schwester, wie unbehaglich es ihm sei, in den Marien Kirchturm hinaufsteigen zu müssen.
Er war im Juni mit seinem Meister an den Bauarbeiten im Turm von Sankt Nikolai beschäftigt gewesen und musste mit ansehen, wie ein Maurergeselle aus dieser Höhe hinabstürzte und den Tod fand. Noch kurz vor dem Unglück scherzten sie miteinander, und gleich darauf verlor der junge Mann durch eine kleine Unachtsamkeit sein Gleichgewicht. Piet umging es, Einzelheiten über das Unglück zu berichten. Es schien ihn traumatisiert zu haben.
Nun benötigte er erneut den Zuspruch seiner Schwester, um für den Gang zur Marien Kirche Antrieb finden zu können. Am gleichen Vormittag wurden auch am Horizont die ersten dunklen Schleierwolken sichtbar.
Schneidermeister Braun erlaubte Elisabeth eine Auszeit, damit sie zum Markt gehen und frischen Fisch für sich und seine Frau kaufen konnte. Sie kam auch an diesem Tag mit ihrer Arbeit gut voran und konnte dem Angebot des Meisters mit gutem Gewissen Folge leisten.
Bei ihrem Gang zum Hafen ließ Elisabeth Vorsicht walten. Es war die Zeit, in der einige Herren – und dies waren nicht nur schwedische Söldner – noch immer angetrunken aus gewissen Häusern torkelten oder an irgendwelchen Ecken herumlungerten.
Der Markt florierte für die Damen des leichten Gewerbes prächtig. Sie hatten zu allen Zeiten ihr Monopol am Hafen oder in den sogenannten Badstaven – Badestuben mitten in der Stadt, in denen man sich nicht nur der körperlichen Reinigung hingab – halten können und konnten dies in aller Freiheit ausschlachten, solange sich die Öffentlichkeit davon nicht gestört sah. Hierauf achtete die schwedische Herrschaft ernsthaft.
Nur den Kunden der Damen, die frühmorgens noch immer alkoholisiert durch die Straßen schlichen oder am späten Abend voll des edlen Bieres oder Branntweines waren, sollte man als junge Frau nicht alleine begegnen.
An jenem Freitagmorgen hatte Elisabeth Glück. Ganz alleine schritt sie durch die Gasse neben dem künstlich angelegten Wassergraben. Außer ein paar quietschenden Ratten schien in dieser Ecke der Stadt noch niemand unterwegs zu sein.
Die Fackeln und Laternen wurden bereits gelöscht, sodass sich ein düsteres Morgengrauen über und um die Gebäude legte.
Auch das erste allmorgendliche Hahnengeschrei war zu hören. Bald wieder würde das städtische Federvieh über Gassen und Plätze huschen, um sich hier und dort empört aufschreiend vor einem eilig vorüberfahrenden Pferdefuhrwerk oder Ochsenkarren in Sicherheit zu bringen.
Über den Tag kam Elisabeth die gesamte Stadt wie ein gigantischer Hühnerhof vor. Bis in den Abend gackerte es aus allen Ecken und Winkeln. Von daher war es für einige Stromer auf der Durchreise immer ein Leichtes, hier und da mal ein Huhn zu stehlen. An einer kleinen Hühnerecke fehlte es auch nicht im Garten der Großmutter. Ihre drei eigenen waren irgendwann verschwunden. Dennoch gesellten sich über die Jahre immer wieder allabendlich zwei oder drei Hühner in den kleinen Verschlag, um dort zu übernachten und ihre Eier zu hinterlassen. Niemand hatte etwas dagegen.
Kurz blickte Elisabeth zurück zu den Dächern der niedrigen Gebäude. Selbst Sankt Nikolai – die Kirche der Seefahrer – saß wie eine gigantische, aber angeschlagene Glucke auf den kleinen Häuschen am Rande der Frischen Grube. Das zerschlagene Dach ihres Langhauses gähnte wie ein unheilverkündender, tiefschwarzer Krater in den grauen Morgenhimmel.
Nur zu gut konnte sich Elisabeth an jene schreckliche Stunde erinnern, in der am 8. Dezember 1703 durch einen fürchterlichen Orkan die Kirchturmspitze abbrach und diesem herrlichen Bauwerk das Dach und die gesamte Inneneinrichtung zerschlug.
Es war das zweite Gotteszeichen, welches Wismaria seit der Explosion der Wehrtürme heimsuchte. Davon gingen viele aus. Seitdem verharrte Sankt Nikolai mit der Gewissheit, nun die größte Ruine der Stadt zu sein, in einem erbarmungswürdigen Zustand.
Erst vor einem Jahr begann der zögerliche Wiederaufbau, aber auch jener forderte in diesem Juni sein erstes Blutopfer.
Sankt Nikolai hatte sich zum Symbol der Trauer gewandelt. Kein Lichtstrahl drang aus dem mächtigen rostroten Backsteingemäuer.
Doch schon war aus dem vernebelten Innern des Kirchenschiffes ein unwirklich anmutendes, durch wildes Flügelschlagen begleitetes Schaben, Knacken und Krächzen zu vernehmen.
Die Morgenstunde war nahe, in der Schwärme von Nebelkrähen – welche in den zerschlagenen Eingeweiden der Kirche nisteten – mit irrsinnigem Stimmengewirr erwachten. Erneut würden sie – gleich einer Wolke gefiederten, schwarzen Staubes – aus diesem düsteren Krater in den neuen Tag fliegen. Viele Bürger sahen darin ein unseliges Zeichen.
Jedes Mal, wenn Elisabeth dieses Schauspiel sah, erinnerte sie sich an die letzten Stunden am Totenbett der Großmutter.
Zu hart hatte das Wetter zugeschlagen, zu sehr hatte sich Else Stolterfoht in den letzten Tagen erneut unterkühlt. Diese zweite Lungenentzündung würde sie nicht überleben, das war allen bewusst.
Elisabeth musste das Versprechen ablegen, dass sie sich um Piet kümmern und ihn nie verlassen würde, damit er nicht auf die schiefe Bahn geraten könnte.
Großmutter Else hatte schon immer Vorahnungen, die sich stets zu bewahrheiten schienen. Dann sagte sie irgendwann diesen sonderbaren Satz, den Elisabeth nie wirklich verstanden hatte.
»Das Jahr der Krähen wird kommen! Seid ehrfürchtig, denn es bringt Euch zu Eurer Bestimmung!«
Else Stolterfoht verstarb am Heiligabend 1703. Im darauffolgenden Frühjahr tauschten die Geschwister mit dem Schneidermeister die Wohnung.
Dass Sankt Nikolai zu einem riesigen Krähennest wurde, konnte Elisabeth die Jahre darauf beobachten. Doch es schien nicht das zu sein, was die Großmutter wirklich prophezeit hatte …
Elisabeth war in all diese Gedanken vertieft und sah bei ihrem Gang zum Hafen auf das grobe Kopfsteinpflaster, das durch die Feuchtigkeit des Morgennebels glänzte. Es reflektierte den müden goldgelben Schein der häuslichen Feuerstellen, die hinter den Fenstern zu erkennen waren und spiegelte sich als tänzelndes Licht in dem düsteren Gewässer der Grube.
Zum Hafen hin wurden die Gassen breiter, heller, aber auch schmutziger. Die übelriechenden Hinterlassenschaften der Tiere, die hinaus auf die Weiden vor der Stadt und zurück zum Stall gebracht wurden, lagen auf der Straße oder durchflossen als stinkendes Rinnsal die Pflastersteine. Häuslicher Abfall gesellte sich dazwischen.
Elisabeth versuchte dies nicht zu beachten. Sie richtete ihren Blick auf das Perlenspiel, das die Nebeltautropfen an die verdorrten Äste, schmiedeeisernen Gitter, bis hin in die Spinnweben an den Tauen und Planken der Fischkutter zauberten.
Sie hatte bereits das Wassertor, das die Festung zum Hafen öffnete, durchschritten. Die kontrollierenden schwedischen Wachposten waren von der Stadtseite aus großzügiger, zumal man viele Bürger mittlerweile auch kannte.
Das imposante Bauwerk, dessen Fassade zur Stadt hin ein wenig an eine enorme Kirchenorgel erinnerte, war eines der wichtigsten Treffpunkte und Durchgänge. Zu jener Stunde löschte man auch die Pechfackeln an der Stadtmauer. Nur noch vier – je zwei zu den Seiten des Tordurchgangs, direkt neben den Wächtern – flackerten für einige Zeit weiter. Sie schienen bereits am frühen Morgen die Menschen wie die Motten anzuziehen.
Der Hafentrödelmarkt war heute angesagt und Elisabeth wollte sich sputen.
Kapitel 3
»Nu isses bald ’rum mit der Sonne, Lisbeth. Habt ihr denn genug Holzvorräte für den Winter?« Die Marktfrau klatschte zwei ausgenommene Fische auf das grobe Papier. Sie sah verstohlen um sich, legte einen Dritten darauf, wickelte alles hastig zusammen und schob es unter das Tuch in Elisabeths Korb.
»Nimm – muss ja keiner wissen, ne?« Elisabeth grinste.
»Danke Mutter Mathes, aber das sollen sie nicht tun.« Mutter Mathes scheuchte mit der rechten Hand eine aufdringliche Möwe davon. Sie schwärmten erneut wie die Fliegen um den kleinen Markt und besonders um die Frauen, die am Hafen die Fische ausnahmen und verkauften.
Elisabeth zahlte und wollte den Rückweg antreten, als sie die dunklen Wolkenfetzen erblickte. Sie zogen vom Meer über den glasblauen Himmel, hatten bereits Sankt Marien erreicht und verfinsterten den ebenfalls lädierten Turm der Kirche, dessen Spitze bereits 1539 einem Blitzschlag zum Opfer fiel.
»Da liegt kein Segen drauf, wenn Sankt Marien sich verschleiert«, vernahm sie die Stimme eines älteren Mannes. Er war einer der derben, mageren Fischer, die am Ufer ausgiebig ihre Netze richteten.
»Wir werden die Kirchen schon wieder richten, um den Herrn angemessen loben zu können,« versuchte Elisabeth beruhigend zu klingen.
»Kein aufrichtiger und frommer Mensch soll je wieder gestraft werden!« Der Alte schüttelte den Kopf. Das faltige, von grauen Bartstoppeln übersäte Gesicht verfinsterte sich unter seiner zerschlissenen, schwarzen Kappe. Als er wieder auf seine Arbeit blickte, konnte man immer noch seine knochige, lange Nase erkennen. Sie ähnelte einem Krähenschnabel. Dass der Alte ungewöhnlicherweise ganz und gar in Schwarz gekleidet war, fiel Elisabeth auch auf.
»Im Juni der Tod des Jungen in Sankt Nikolai – und nun scheint es, als wollte die Finsternis auf Sankt Marien übergreifen.«
Elisabeth glaubte zu verstehen, auf was er anspielte: Die Furcht nach einer neuen Gottesstrafe, ähnlich jenem Gewitter von 1699 oder dem Orkan im Jahre 1703 war all gegenwärtig.
Damals hatten nicht nur viele Bürger ihr Leben oder ihre Häuser und sonstige Güter verloren, auch Fischern wurden die Kutter vernichtet und Bauern das Vieh getötet. Bestimmt war der Mann einer der Geschädigten. Doch Elisabeth entgegnete nichts und ging weiter.
»Sie sind wieder unterwegs, um die Seelen der Leichtgläubigen zu verführen! Hab acht, min Deern!«, hörte sie nochmals die krächzende, aber dennoch feste Stimme hinter sich. Nur kurz hielt sie an, um sich zu dem Mann umzudrehen. Das Fischernetz lag am Ufer, aber der Alte war verschwunden.
Ein geschäftiges Treiben hatte auf der rechten Hafenseite seinen Lauf genommen. Wäscherinnen waren bereits unterwegs und auch die ersten Kutschen und Pferdefuhrwerke fuhren zu den weiter draußen gelegenen größeren Schiffen.
Die ersten Schweine und Kühe wurden von den Hirten aus der Stadt zu den Wiesen getrieben. Aufmerksam durchschritten schwedische Wachposten in ihrer Respekt einflößenden blaugelben Uniform und ihrer elegant gefalteten Mütze, dem Dreispitz, das Hafengebiet. Ihren Augen schien nichts zu entgehen, was sie erkennen wollten.
Elisabeth huschte in den Schatten eines sich behäbig durch das Wassertor drängenden Ochsenkarrens, um den Blicken der Soldaten zu entgehen. Zum Glück zeigten diese andere Interessen: Ein Schiff der schwedischen Flotte machte sich unter Zurufen und großem Getöse linksseitig des Hafens zum Auslaufen bereit. Gewiss hatte es Tage zuvor Kriegsmaterial, das im neu erbauten Zeughaus gelagert wurde, gebracht.
Elisabeth sah sich um. Alles war überschaubar, nur von dem alten Mann gab es keine Spur mehr. Für einen Augenblick wollte sie zurück zur Fischmarktfrau, doch sie konnte sich nicht ernsthaft dazu entschließen. Also zuckte sie mit den Schultern und trat den Heimweg an.
Der Wachposten auf der Hafenseite des Wassertores schielte desinteressiert in Elisabeths Körbchen und ließ sie ohne Umstände zurück in die Stadt.
Ein Schwarm Nebelkrähen zog quarrend zu den Gärten und Bäumen der Innenstadt, während die Möwen dort mit ihren schrillen Rufen über die alten Dächer schwirrten.
Auf der Straße, die zur Grube und dem Haus, in dem sie nun seit vier Jahren mit Meister Braun und dessen Frau die Kleider für bessergestellte Bürger nähte, zog Elisabeth ihr Schultertuch über den Kopf. Es fröstelte sie – zum ersten Mal in diesem Jahr …
An jenem Mittag schickte der Schneidermeister sie früher nach Hause, als sonst. Die Sonnenstrahlen hatten sich tatsächlich gegen Nachmittag verzogen und man wollte nicht, dass sie in ein schlimmes Wetter geraten könnte.
Auch dürfte sie am nächsten Tag gerne später kommen, hätte sie Plagen mit einem Unwetter gehabt, meinte der Meister. Schließlich war es ein Leichtes, die wichtigen Arbeiten auch zu Hause zu erledigen. Für solche Ausnahmen hatte sich Elisabeth eine Schneiderecke eingerichtet.
So packte sie einige ihre Näharbeiten in ihren Korb und ging mit eiligem Schritt zu ihrem kleinen Bürgerhaus in der Baustraße.
Dieses war, mit einem beeindruckenden Schaugiebel versehen, eines der vielen schmucken Häuser, die direkt gegenüber der Sankt Georgen Basilika standen.
Von ihrem Küchenfenster aus konnte sie zur Südwestseite des herrlichen Gebäudes blicken, fast im gleichen Winkel, wie damals bei Großmutter auf die majestätische Nikolaikirche.
Von Sankt Georgen trennte sie auch hier nur eine Straße sowie eine Reihe Linden auf ihrer und eine üppig wuchernde Baumvielfalt auf der anderen Seite.
Elisabeth spürte, dass es wichtig war, den Kamin zeitiger anzuzünden als sonst. Die vier Reichstaler, die sie an jenem Tag für Miete und Arbeit von Meister Braun bekommen hatte, legte sie sofort in ihre Geldtruhe.
Endlich eine Sorge weniger, dachte sie.