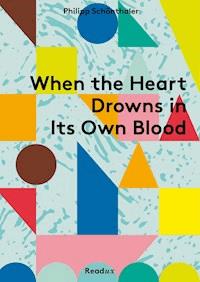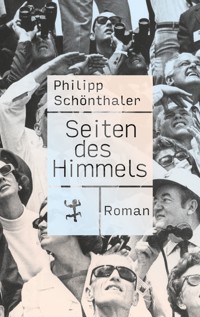
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach einem verschollenen Spiegel-Artikel erhält der Erzähler in Philipp Schönthalers neuem Roman unerwartet eine Einladung zu einer Tagung am Forstell-Institut in Nevada. Dort, in einem atombombensicheren Archiv, lagern nicht nur die Fachpublikationen von Natur- und Ingenieurwissenschaftlern wie Wernher von Braun, Robert Oppenheimer und Norbert Wiener. Auch ihre von technischen Meistererzählungen überschatteten Dichtungen werden dort sicher verwahrt, als schlummerten in ihnen untergründige Allianzen zwischen Technik und Literatur, Mathematik und Fantasie, als bräuchte es Romane, um auf dem Mond zu landen. In diesem Geflecht aus historischen Ereignissen und individuellen Biografien, technischen Innovationen und literarischen Schreibprojekten dringt der Protagonist allmählich immer weiter vor, bis dorthin, wo sich Fiktion in Realität und die Realität in immer neue Fiktionen verwandelt und all das lesbar wird auf den Seiten des Himmels.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Seiten des Himmels
Inhalt
I Die Rakete als Science-Fiction
1. Den Himmel regieren
2. Auf dem Mond
3. Zwischen Wüste und Weltraum
II Kybernetik, Kommunikation & Künstliche Intelligenz
4. Ein Wirbel im Fluss
5. Der Anti-Proust
6. Ein perfekter Agent
III Die Bombe, eine Biografie
7. Die Überschreitung
8. Seele Nr. 59
9. Chicago brennt
IV Computer & Satelliten
10. Die Garage
11. Die Wahrheit simulieren
12. Der Blick ins All
Literatur
Ich mixe mir ein paar Martinis, lege die Brandenburgischen
Konzerte auf und schreibe und schreibe.
– Wernher von Braun
Entweder müssen die Ingenieure Dichter werden oder
die Dichter Ingenieure. Im Wesentlichen hat das schon
Platon so gesagt, denn es bedeutet, dass die Menschheit als
Ganze nur von Personen regiert werden kann, die das
Menschliche in seiner vollen Tiefe erfassen.
– Norbert Wiener
Du reimst die Atome, willst schmeicheln und amüsieren,
Statt zu entwaffnen, sollte dein Rat inspirieren.
– Edward Teller
Die Geschichte, wie das alles herausgefunden wurde,
ist lang und faszinierend, und ich werde wohl eines Tages
eine Erzählung daraus machen, habe jetzt aber keine Zeit,
dir davon zu berichten. Zweifellos werde ich danach
ein anderer sein, nur weiß ich noch nicht genau, wer.
– Alan Turing
IDie Rakete als Science-Fiction
1. Den Himmel regieren
Zum fünfzigsten Todestag Wernher von Brauns war ein Artikel auf Spiegel Online erschienen, der mit überraschendem Sarkasmus über das literarische Werk des Raketeningenieurs herfiel. Möglicherweise war die Häme von den negativen Schlagzeilen motiviert worden, die die Space-Industrie nach dem Revival, das sie zu Beginn des neuen Jahrtausends verzeichnet hatte, neuerdings wieder produzierte. Süffisant rekapitulierte der Spiegel-Journalist die Karriere des Raketenpioniers – wie der Dreiunddreißigjährige am Ausgang des Zweiten Weltkriegs in den Allgäuer Alpen Zuflucht gesucht und sich gemeinsam mit seinem eingeschworenen Mitarbeiterstab bei winterlichem Aprilwetter und üppigen Mahlzeiten die Zeit in der salutogenen Höhenluft des Sporthotels Ingeburg in Oberjoch vertrieben hatte, wo auch Konrad Zuse, der in den letzten Kriegsmonaten in Berlin geheiratet hatte, untergekommen war und die Z 4, das Nachfolgemodell der Z 3, heimlich in einem Bauernstall versteckt gehabt hatte.
Der Artikel schilderte, wie Deutschlands technische Intelligenzija den Anmarsch der Alliierten in »Deutschlands höchstgelegenem Ski- und Bergdorf« (so die örtliche Tourismusbehörde) gelassen abgewartet hatte, wie Wernher irgendwann – die Informationslage schlecht, sämtliche Kommunikationsmittel wie Telefon oder Funk dysfunktional – seinen jüngeren Bruder Magnus Hans Alexander auf einem Rad ins Tal geschickt hatte, um (darauf bedacht, ja keinen umherstreunenden Franzosen oder Russen in die Arme zu laufen) Kontakt mit den Amerikanern aufzunehmen, bevor sich Wernher den Hitlerpass bei Oberjoch überquerend ins österreichische Reutte hatte chauffieren lassen, wo die amerikanischen Offiziere die sagenumwobenen Männer der deutschen Wunderwaffe in einem eleganten Herrenhaus im rustikalen Alpinstil in Empfang genommen hatten. Die Ingenieure waren am frühen Abend in der Lechtaler Ortschaft eingetroffen, nur die Stromversorgung hatte zu wünschen übrig gelassen. Aber der Krieg hatte sie hinreichend geschult, sich in jeder noch so erdabgewandten Finsternis zu orientieren. In ihren schweren Mänteln hatten sie die Stufen erklommen, sich auf ihre Zimmer getastet. Das Licht hatte sich mit einem elektrischen Fauchen zurückgemeldet. Wurde aber auch Zeit! Sie hatten sich frisch gemacht, sich anschließend Rühreier, Toast, eine Extraportion Butter und – in jenen Tagen eine Delikatesse – echten Bohnenkaffee servieren lassen.
Illustriert war der Artikel mit den ikonisch gewordenen Fotos, die am nächsten Morgen nach einem reichhaltigen Frühstück entstanden waren und von Braun mit zerschmetterter Schulter und zweifach gebrochenem Arm zeigten:
Von Braun war mit seinem übermüdeten Chauffeur von der Fahrbahn abgekommen, irgendwo zwischen Weißenfels und Leipzig waren sie mit hundert Stundenkilometer über einen hohen Abhang hinausgeschossen, die plötzliche Stille, als der Wagen die Haftung unter den Reifen verloren hatte und vierzig Meter durch die Luft gesegelt war, hatte den Doktor der Raumfahrt – seine schmale, im Frühjahr 1934 an der Friedrich-Wilhelm-, heute Humboldt-Universität zu Berlin eingereichte Doktorarbeit war über weite Strecken plagiiert gewesen – noch vor dem Aufprall erwachen lassen. Der linke, wie zu einem chronischen Hitlergruß eingegipste Arm des SS-Sturmbannführers, dem der Reichskanzler zuletzt noch großzügig den Professorentitel spendiert hatte, hatte dann zu einem eher grotesken Auftritt bei seiner Gefangennahme geführt, zumal von Braun einem Militärreporter der Beachhead News an jenem mild verschneiten Vormittag des 3. Mai versichert hatte, dass der Krieg, wenn es gelungen wäre, die massenindustrielle Raketenproduktion im Mittelwerk zu verzehnfachen, aller Wahrscheinlichkeit nach anders verlaufen wäre.
In groben Zügen erinnerte der Spiegel-Journalist an die wechselnden Stationen der Gefangenschaft der gut hundert Naziingenieure, darunter Versailles, bevor sie vom letzten Ort ihres Gewahrsams, dem hessischen Witzenhausen, ins texanische Fort Bliss verschifft worden waren, wo amerikanische Raketenpioniere des kalifornischen Jet Propulsation Lab wenige Monate zuvor Holzbaracken aufgestellt und ein Testgelände eröffnet hatten, während nahezu zeitgleich in direkter Nachbarschaft die geheime, später in White Sands umbenannte Alamogordo Bombing and Gunnery Range entstanden war, wo sich am 16. Juli 1945 eine Schar Männer um vier Uhr morgens nachlässig die Gesichter mit Sonnenmilch eingerieben und anschließend die Augen hinter dunklen Schweißerbrillen verborgen hatte. Die Luft war noch schwer von einem überraschenden Monsun gewesen, der die ganze Nacht hindurch getobt und die jungen Ausnahmewissenschaftler in eine wachsende Unruhe versetzt hatte, als der erhabene Wolkenpilz der Trinity schließlich über dem Jornada-del-Muerto-Becken – dem Tal von der Reise des toten Manns – mit seinen knöchernen Yuccas, spröden Lavaströmen und weißen, sich weit in den Süden hinunter flüchtenden Gipsdünen zwölf Kilometer in den Himmel aufgelodert war. Die überwältigende Detonation, die den Boden hatte erzittern und die Fensterscheiben in den nächstliegenden Ortschaften wie von Geisterhand hatte rasseln lassen, hatte die ausgewählten Zeugen – einige kannten sich noch aus dem wilden Göttingen der Zwanzigerjahre – in eine jungenhafte Hysterie versetzt.
Während seine Mitarbeiter auf ihre Schiffspassage gewartet hatten, war von Braun in die neue Wahlheimat geflogen und direkt nach seiner Ankunft in El Paso ins örtliche Krankenhaus eingeliefert worden. Drei Monate, von Oktober bis Dezember, hatte der Deutsche, der sich als Schweizer Stahlmagnat ausgab, dann zwischen amerikanischen Kriegsversehrten gelegen, seine verschleppte Hepatitis-A-Infektion auskuriert. Von seinem Bett aus waren die kahlrasierten Franklin Mountains zu sehen gewesen, in der Ferne die rötlichen Gipfel der Sangre de Cristo Mountains – die Berge des Bluts Christi –, die für die kommenden fünf Jahre die Kulisse seiner reduzierten Existenz darstellen sollten.
Denn selbst nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus war der deutsche Exilant, über dessen Anwesenheit im Land peinlich geschwiegen wurde (offiziell hatte man der geheimen Umsiedlung der Naziwissenschaftler den kryptischen Namen Operation Paperclip verliehen), zu bleierner Untätigkeit verdammt geblieben. Die landesweiten Ausgaben für die Raketenforschung waren gekürzt worden, die schlanken Leiber der V2s, die ihre Reise von den unterirdischen Stollen im Harz in die tiefgläubigen Südstaaten noch vor ihren Schöpfern angetreten hatten, erodierten in der menschenfeindlichen Wüstensonne New Mexicos, während der ehemalige Peenemünder Helmut Gröttrup, der für das Bordsystem der V2 zuständig gewesen war und sich auf die Seite der Sowjets geschlagen hatte, schon bald die erste Rakete reichsdeutscher Bauart in den Moskauer Himmel aufsteigen ließ.
Heimgesucht vom Schatten seiner Karriere als ranghoher Nationalsozialist, war der manische, von schlesischem Adelsgeschlecht abstammende von Braun, der in den folgenden Jahren mehrfach Gefahr lief, in depressive Episoden abzudriften, zum evangelikalen Christentum konvertiert, hatte seine knapp achtzehnjährige Cousine Maria Luise von Quistorp geheiratet, ein Kind mit ihr gezeugt und das Cellospiel wieder aufgenommen. In selbstgesuchter Einsamkeit war er mit dem Jeep durch die leergefegte Wüste mit ihren verzweigten Kreosotbüschen und wilden Salbeisträuchern gebrettert, abends in dem Holzschuppen versackt, den die Expats mit DIY-Mobiliar in einen behelfsmäßigen Club verwandelt hatten, wo sie dem Viersternestrandhotel Schwabe nachtrauerten, in dem die Ingenieure nur wenige Jahre zuvor von livrierten Dienern umschwirrt und bis zuletzt – die Wehrmacht hatte irgendwo tief in Russland gesteckt, die Bombardierung der Raketenfabrik hatte noch ausgestanden – mit ausgesuchten Weinen und mondänen Cocktails versorgt worden waren, als er sich plötzlich daran erinnert hatte, wie er als Teenager Hermann Noordungs Das Problem der Befahrung des Weltraums gelesen, kurz darauf Fritz Langs Die Frau im Mond gesehen und daraufhin, wie in Trance, seine erste Science-Fiction-Story »Lunetta« geschrieben hatte, die im Jahr seiner Abiturprüfung in der Schülerzeitung abgedruckt worden war.
Jetzt hatte der junge Familienvater die Erzählung also wieder hervorgekramt. In den Nachtstunden – im Hintergrund die Brandenburgischen Konzerte, ab und an das markerschütternde Geschrei der Tochter durch die lächerliche Bretterwand – hatte er sich an seinen Schreibtisch gesetzt: und hatte geschrieben. Im Sommer 1948 war sein erster Roman vollendet gewesen.
Im Vorwort von Das Marsprojekt, das davon erzählt, wie Menschen erstmals zum roten Planeten fliegen, beruft sich von Braun auf Dante Alighieri: Der italienische Dichter habe seine Darstellung der Höllenkreise, trotz der präzise geschilderten Schrecken, mit vollkommen ruhiger Hand verfasst, und so berichtet Das Marsprojekt wie die Göttliche Komödie von einer Reise ohne Wiederkehr, und wie die Höllenwanderer des berühmten italienischen Dichters müssen von Brauns Marsreisende alle Hoffnung an den Pforten fahrenlassen – diesmal jedoch nicht an den Toren zur Hölle, sondern zum Weltraum. Die Handlung des Marsprojekts selbst datiert auf das Jahr 1980. Nach einem Dritten Weltkrieg ist die Welt endlich pazifiziert, deren Ordnung nun auf einer Einsicht beruht, die am Anfang der Luftfahrt steht: Wer die Erde beherrschen will, muss den Himmel regieren. Die Quelle des neuen Weltfriedens ist die ringförmige Raumstation Lunetta. Nachdem die mit atomaren Sprengköpfen aufgerüstete Raumstation den Ausgang des Kriegs entschieden hat, kreist sie für Raketen unerreichbar im All. Gleichzeitig bleibt ihr als kosmischer Weltpolizei kein irdischer Ort verborgen. Aber auch kein außerirdischer. Und als dann Kanäle auf dem Mars entdeckt werden, wird eine Mission dorthin entsandt. Erfreulicherweise entpuppen sich die Marsianer, die mit ihren überdimensionierten Köpfen unterirdisch in vollklimatisierten Kapseln leben und von einem Herrscher namens Elon regiert werden, als gottesgläubig und friedliebend. Ihr Mobilitätskonzept besteht aus Hyperloopzügen und selbstfahrenden Elektroautos, die geshart werden. Von ihrer Hochtechnologie zu einem hohen Grad zivilisatorisch ermüdet, kommunizieren die Marsianer über Hologramm-Telefone, shoppen oder schauen TV.
Das Typoskript hatte von Brauns ehemalige Sekretärin, die englische Übersetzung ein mit der Familie bekannter Leutnant besorgt. Walter Dornberger, der das deutsche Raketenprogramm in Peenemünde als Generalmajor geleitet und zuletzt als Beirat der Mittelwerk GmbH die industrielle Raketenproduktion in Nordhausen samt angegliederter Arbeitslager übersehen hatte, hatte das 480 Seiten starke Manuskript als Erster gegengelesen und leichtfertig einen Bestseller vorausgesagt – ein Erfolg, der dann allerdings nur seinen eigenen, zeitgleich verfassten Peenemünder-Memorien V2 – Der Schuss ins Weltall. Geschichte einer großen Erfindung vorbehalten bleiben sollte, die bis ins neue Jahrtausend in zahllosen Neuauflagen und mehreren Übersetzungen erschienen.
Von Braun hatte in den nächsten Monaten hingegen von insgesamt achtzehn US-amerikanischen Verlagen ausschließlich Absagen erhalten. Ein Lektor hatte angemerkt, dass er sich sicher sei, dass von Brauns Roman den Kern einer Story enthalte, allerdings habe er ihn nicht finden können. Und der Lektor der Macmillan Publishers hatte sich nicht den Kommentar verkneifen können, dass man aktuell von einer Veröffentlichung absehe, sich aber erlauben würde, das Manuskript erneut anzufragen, falls der Verlag wider Erwarten in die Raketenproduktion einsteigen würde. Tatsächlich hatte sich von Braun, der als Gymnasiast nur mäßige Mathenoten nach Hause gebracht hatte, mit seinen seitenlangen Kalkulationen gebrüstet, die er in einsamen Wüstennächten, mit nichts als einem einfachen Rechenschieber bewaffnet, unter großen Mühen angefertigt hatte.
Eine Zusage hatte von Braun schließlich von Otto Bechtle erhalten, einem ehemaligen Offizier der deutschen Luftwaffe, der kurz zuvor den Verlag seines Vaters im schwäbischen Esslingen am Neckar übernommen hatte. Doch während der ausschließlich aus Tafeln und Rechnungen bestehende technische Appendix des Marsprojekts als Vorabdruck im Sonderheft der Zeitschrift Weltraumfahrt erschien, die von der 1948 in Stuttgart gegründeten Gesellschaft für Weltraumforschung (Gf W) herausgegeben wurde, sollte der Roman selbst dann allerdings gar nicht mehr auf Deutsch gedruckt werden, da von Braun sich mit dem Ghostwriter von Dornbergers Memoiren Franz Ludwig Neher überwarf, einem schwäbischen Autor, der neben den in der von Hermann Göring herausgegebenen Heftreihe Unsere Jagdflieger veröffentlichten Propagandabiografien von Piloten auch mehrere Romane und Sachbücher unter dem Pseudonym Peter Hilten verfasst und den Bechtle mit der Überarbeitung seines Manuskripts beauftragt hatte. Schon Nehers Entwurf für das erste Kapitel hatte allerdings kaum noch etwas vom Original von Brauns erahnen lassen, was Letzteren, als Nehers eigener, auf von Brauns Manuskript basierender Science-Fiction-Roman Menschen zwischen den Planeten schließlich in Stalins Todesjahr in die Läden kam, offensichtlich doch nicht weiter kümmerte, war ja einerseits die englische Übersetzung seines Marsprojekts bei der University of Illinois Press angekündigt, und andererseits hatte der Koreakrieg erneut die ballistischen Bodenzu-Boden-Raketen auf den Wunschzettel der US-amerikanischen Streitkräfte gesetzt, sodass die deutschen Ingenieure bereits drei Wochen, nachdem die Truppen der Nordkoreanischen Volksarmee am 25. Juni 1950 die Grenze in den Süden des geteilten Lands überschritten hatten, aus ihrem Schlafmodus geweckt und nach Alabama ins Redstone Raketen-Arsenal versetzt wurden und der angehende Autor sich plötzlich wieder in seiner alten Position als technischer Manager eines veritablen Raketenbauprogramms wiederfand.
Von Brauns zweiter Roman, Erste Fahrt zum Mond, war dann schließlich 1960, im selben Jahr, in dem die deutsche Übersetzung von Norbert Wieners Romandebüt Die Versuchung. Geschichte einer großen Erfindung erschien, herausgekommen. Anders als sein Erstling hatte von Brauns zweiter, schon ein Jahr später auch auf Deutsch erschienener Roman jedoch kaum Beachtung gefunden, was der Spiegel-Journalist in seiner Besprechung zum Anlass nahm, sich darauf zu konzentrieren:
Erste Fahrt zum Mond schildert eine komplett unaufgeregte Reise zum Mond. Dem Anschein nach besinnt sich von Braun darin auf jenen persönlichen Traum, der ihn schon als Teenager umgetrieben hat und der folglich in keinem der meist seichten, von mäßigen Regisseuren im Auftrag öffentlicher und privater Fernsehsender produzierten Biopics über das angebliche Genie und dessen meteoritenhaften Aufstieg zu einem popkulturellen Star in den farbenfrohen Kulissen Walt Disneys fehlt: Die Mutter bringt ihren Sohn zu Bett, verpasst ihm einen Gutenachtkuss und rückt die Decke zurecht. Kaum hat sie das Zimmer auf leisen Sohlen verlassen, schlägt das Kind die Augen auf, schlüpft aus dem Bett und schleicht zum Fenster. Mal sind die Vorhänge offen, mal muss der kleine Wernher sie zur Seite ziehen, damit der psychedelisch funkelnde Vollmond zum Vorschein kommt, von dem er sich nun wie ein junger Werwolf mit gen Himmel gerecktem Hals in den Bann schlagen lässt.
Eigentümlich ist von Brauns Roman, weil das Begehren nach dem einzigen natürlichen Satelliten der Erde, das wiederholt als mythischer Knackpunkt seiner Biografie dient, sich in dem Moment erschöpft, als die Astronauten auf dem erdnahen Himmelskörper eintreffen. In ermüdenden Details beschwört Erste Fahrt zum Mond zunächst die technischen Herausforderungen der bemannten Raumfahrt. Als die Astronauten dann endlich landen, scheinen die Romancharaktere einschließlich des Erzählers jedoch restlos ausgelaugt. Sollten sie jemals neugierig gewesen sein, den Mond mit eigenen Augen zu sehen, so ist davon nichts mehr zu spüren. Zwar ist der Hinweis des Erzählers, dass ein Raumschiffkapitän darauf gedrillt sei, »seine Gefühle zu unterdrücken«, zutreffend und dürfte nicht ohne Grund an dieser Stelle im Roman platziert worden sein. Dennoch ist fragwürdig, ob er die Erwartungen der Leserinnen und Leser an diesem heiklen Punkt im Plot, da die Schleusen des gelandeten Mondmoduls sich mit einem »zischenden Geräusch« öffnen und die beiden Astronauten John Mason und Larry Carter durch die getönten Schilder ihrer Bubble-Helme mit den Worten »Es war ein grandioser und trostloser Anblick« starren, um kurz darauf die massigen Sohlen ihrer Boots erstmals auf den wie krustiger Schnee knirschenden Untergrund zu setzen, hinreichend abpuffert.
Zunächst schwärmen die beiden Astronauten aus. Während sie mit der durch ihre gelbstichigen Visiere eingeschränkten Sicht kämpfen, sprechen sie ihre Beobachtungen in die in ihrem Helm integrierten Mikrofone. Die Tonbandaufnahmen sollen später »von Gelehrten vieler Fachgebiete intensiv nach Fragen und Antworten durchforscht werden«. Was man sich wohl als freien Bewusstseinsstrom vorstellen kann, den Mason und Carter gewissenhaft vor sich hinplappern, spart der Erzähler aus. Beschrieben wird lediglich, dass Mason seinen Bericht, nachdem er auf circa drei Romanseiten orientierungslos umhergeirrt ist, unvermittelt mit dem Satz schließt: »Das lunare Terrain zeigt an dieser Stelle keine Abweichungen.«
In den kommenden fünf Tagen stürzen sich die beiden dankbar in die auf der Erde trainierten Routinen, stoßen stillschweigend Sensoren in den Untergrund oder entnehmen Gesteinsproben. Die automatisierten Handgriffe und technischen Geräte ersparen ihnen nun die zähe Arbeit, den Erdtrabanten mit ihren Sinnesapparaten zu erschließen und ihre Eindrücke versprachlichen zu müssen, wissen sie doch ohnehin nicht, was sie »noch auf das Band hätten sprechen sollen«. Erst als die Fähre auf dem Mond landet und die sichtlich erleichterten Astronauten wieder fortträgt, ergreift ein erster und einziger Heiterkeitsanfall von ihren schwerelosen Körpern Besitz und schüttelt sie für wenige Sekunden durch.
Der Spiegel-Journalist gab zu bedenken, dass das blasse, im Grunde inexistente Bild einer generischen Wüste, das der Roman von der Mondoberfläche zeichne, möglicherweise ein authentisches Abbild jener Leere um Fort Bliss darstelle, die von Braun mit ihrer unerbittlichen Hitze so sehr zugesetzt habe, dass selbst die Ausfahrten mit dem Jeep zu einer wachsenden Qual geworden seien. Mit jedem Tritt aus dem Bungalow habe sich die angebliche Weite in eine unerträgliche Enge verkehrt und den erfolgsverwöhnten Ingenieur mit dem Stillstand seiner Karriere konfrontiert, was den Journalisten jedoch zu der Frage veranlasste, ob nicht gerade die Überblendung der mondsüchtigen Kindheitsfantasie mit der zermürbenden Realität des texanischen Wüstenalltags den Anstoß hätte geben müssen, dass sich von Braun in seinen fiktiven Szenarien in andere Landschaften hineinversetzen und spekulative Höhenflüge dazu hätte nutzen wollen, neue Möglichkeitsräume zu eröffnen oder eine ekstatische Verwandlung anzustreben. Allerdings habe, wie es in dem Artikel hieß, bereits von Brauns Debüt demonstriert, dass der Autor, sobald er den Nahbereich der Raketen verlasse, erschreckend fantasielos bleibe oder zu der seit seinem Studium bewährten Technik des Pastiches greife und wie ein generisches Sprachmodell lediglich Bausteine bestehender Texte ohne eigenen Gestaltungswillen collagiere. »Was also wollen die Astronauten auf dem Mond? Was ist von Brauns Vision?« Offenbar sei von Braun in hohem Maß unfähig gewesen, so das wenig schmeichelhafte Fazit des Spiegel-Artikels, mit der Raumfahrt eine Utopie zu verbinden, die jenseits der technischen Leistung seiner mit komplexen Treibstoffgemischen betriebenen Flugkörper gelegen habe.
Als ich vor mehreren Wochen auf den Spiegel-Artikel gestoßen war, hatte ich mich schon seit Längerem mit der Geschichte der Technik und Raumfahrt beschäftigt. Meine Aufmerksamkeit hatte der Artikel aber vor allem aufgrund der zum Teil heftigen Kommentare erregt, die er hervorgerufen hatte – was vermutlich ein Grund dafür gewesen war, dass ich den Artikel selbst gar nicht richtig zur Kenntnis genommen und seinen Inhalt sofort wieder vergessen hatte. Erst als ich in einer Buchhandlung zufällig auf eine hypertroph gestaltete Neuauflage von Das Marsprojekt stieß, erinnerte ich mich wieder daran. Die Empfehlungen auf dem Cover der Neuausgabe warben mit »Erstmals auf Deutsch« und »Ursprüngliche Originalfassung«, zudem wurde ein aktuelles Nachwort angepriesen. Auf der Umschlagrückseite gaben sich Celebrities aus unterschiedlichen Sparten die Hand, darunter ein früherer Präsident der Vereinigten Staaten, der in die Hymnen auf den »one and only Rocketman« (Bill Kaulitz) einstimmte, dessen visionärer Roman unseren »Sinn des Möglichen« sprenge (Gwyneth Paltrow), die »Grenzen zwischen Fantasie und Wirklichkeit, Fiktion und Wissenschaft« ein für alle Mal verschiebe (Nancy Kress) und uns den rettenden Glauben wiederschenke, »das Unmögliche zu denken« (Jeff Bezos). Das Nachwort stammte von jenem Journalisten und selbst ernannten Trendforscher, der, wie ich meinte, von Braun in dem Spiegel-Artikel zu dessen fünfzigstem Todestag lächerlich gemacht hatte. Jetzt feierte er ihn mit der Frage »Was, wenn von Braun, statt Protagonist in einem Pynchon-Roman, ein zweiter Pynchon geworden wäre?« als wiederzuentdeckendes Talent mit einer bemerkenswerten Doppelbegabung. Spontan kaufte ich das Buch und begann es zu lesen. Als ich dann wenig später den Spiegel-Artikel zum fünfzigsten Todestag erneut aufrufen wollte, war dieser aus dem Netz verschwunden – und blieb auch auf Nachfrage bei der Online-Redaktion und Archivstelle sowie bei befreundeten Kolleginnen und Kollegen, die ich kontaktierte, nicht auffindbar. Stattdessen stieß ich über die Recherche der an der deutschen Erstauflage des Debüts beteiligten Akteure auf das Forstell-Institut.
In teils kryptischen, teils testosteronschwangeren Sätzen wird die Entstehung des in Nevada gegründeten Instituts auf dessen Homepage unter dem Menüpunkt »Unsere Geschichte« geschildert. Das Hub, das wahlweise als Thinktank, Unbibliothek, Future Archiv, Labor, Non-College oder Bureau of Technoartistic Research apostrophiert wird, verschreibt sich, wie es an einer Stelle heißt, dem »anderen, noch ungedachten Denken unserer größten Wissenschaftler:innen, Ingenieur:innen, Entrepreneur:innen und Visionär:innen« der technokapitalistischen Supermoderne. Anonyme Geldgeberinnen und Geldgeber haben nicht nur den Erwerb sämtlicher Nachlässe namhafter Männer und markant weniger Frauen (die großteils im 20. Jahrhundert geboren worden sind), sondern auch sämtliche Abdruck- und Verwertungsrechte ihrer bereits veröffentlichten akademischen und außerakademischen Fachpublikationen sowie belletristischer Schriften ermöglicht. Die großzügigen Spenden haben »den lange vorbereiteten und in souveräner Verzweiflung herbeigesehnten Traum« des Gründerteams wahr werden lassen, unterirdisch ein atombombensicheres Archiv zu errichten, das die Nachlässe und Schriften in sowohl papierener als auch digitaler Form professionell verwahrt, wo sie im Rahmen von in der Regel einwöchigen bis zu zweimonatigen Stipendien zu Recherchezwecken (einschließlich der Unterbringung in freundlichen Ein- oder Zweizimmerapartments auf dem Campus) verfügbar gemacht werden.
Während ich auf der Homepage, später in verstreuten Berichten Informationen über das Institut zusammenpuzzelte, verfestigte sich meine spontane Vermutung, dass der Spiegel-Artikel, wenn überhaupt, dort zu finden wäre. Doch meine Neugier weckte das Forstell-Institut auch aus einem weiteren Grund: Es reizte mich im Rahmen einer Artikelserie, die ich damals lanciert hatte. Die Serie ging dem Schicksal von 404-Fehlermeldungen nach, gelöschten Webpages, Onlineartikeln, Chatverläufen oder Posts, die, in welchem Rahmen auch immer, signifikante Spuren in der Öffentlichkeit hinterlassen hatten, als Primärquelle selbst aber verschwunden waren. Zwar gab es etliche Initiativen, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, das Web so vollumfänglich wie möglich zu speichern, dennoch war die Menge der verlorenen Daten schwindelerregend. Mich aber interessierte vielmehr die Frage, was oder wer hinter den digitalen Brandlöchern steckte, die die 404-Error-not-found-Seiten, modifizierte oder vom Netz genommene Einträge, in das Gewebe öffentlicher Erregungen, textbasierter Grabenkämpfe oder wissenschaftlicher Publikationen rissen, denen der Boden unter den Sohlen ihrer Fußnoten abhandenkam. Handelte es sich um eine natürliche Entropie der Kommunikation, oder gab es ein persönliches, finanzielles, technisches, juristisches oder sonstiges Schicksal, das für das Verschwinden einzelner Daten und Quellen verantwortlich war und das es lohnte, zu erzählen?
In einem der Videoclips auf der Homepage des Instituts erklärte einer der Co-Founder, dass das Denken der Natur- und Ingenieurwissenschaftler, deren Nachlässe das Forstell-Institut beheimatete, von technischen Meistererzählungen überschattet worden sei, obwohl das Genie dieser Individuen seinen vollen Ausdruck erst darin gefunden habe, dass ihr Denken sich auch in vollendeten und unvollendeten Gedichten, Erzählungen und Romanen oder, wenn auch deutlich seltener, in Zeichnungen, Malereien, Kompositionen oder Games manifestiert habe. Mal hätten diese »smartesten Köpfe, die das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat«, ihre intuitivkünstlerische Anlage selbst verdrängt, mal sei es die Praxis gewesen, nicht selten militärische oder geheimdienstliche Aufträge, die Entwicklung von Raketen, Computern, Atombomben oder Satelliten, die sie davon abgehalten habe, andere – eben ästhetische – Pfade der Erkenntnis hinlänglich zu beschreiten. Nichtsdestotrotz seien die Nachlässe ein eindrucksvoller Beweis, dass die technische Elite des 20. Jahrhunderts mit bemerkenswerter Kraft von literarischen und künstlerischen Ausdrucksweisen angezogen worden sei, erklärte der erstaunlich jung wirkende Gründer: Offenbar seien sie sich sehr wohl darüber im Klaren gewesen, »dass die Technologien von morgen aus dem Stoff der Fiktionen von heute gemacht sind«.
Das sei aber nur eine Seite. Selbstverständlich sehe man die Verdrängung auch in der Rezeption, die bisher blind für diese »vielfältigen Ökologien der technischen Imagination« geblieben sei. Er wolle an dieser Stelle lediglich Wernher von Braun als sogenannten Vater der Mondrakete, Robert Oppenheimer als sogenannten Vater der Atombombe, Edward Teller als sogenannten Vater der Wasserstoffbombe, Norbert Wiener als sogenannten Vater der Kybernetik oder Alan Turing als sogenannten Vater des Universalcomputers erwähnen, die zweifellos zu den Koryphäen »der im Bunker des Instituts verwahrten Autoritäten« zählten. Darüber hinaus seien aber auch die Nachlässe all derer zu entdecken, die bislang im Schatten gestanden hätten, so beispielsweise die sogenannten ENIAC-Girls: Kay McNulty, Betty Jennings, Betty Snyder, Marlyn Wescoff, Fran Bilas und Ruth Lichterman, die mit dem Electronic Numerical Integrator and Computer Amerikas ersten Universalrechner zur Berechnung ballistischer Tabellen bedient hätten. Nicht ohne Stolz berichtete der Gründer außerdem, dass dem Institut kürzlich der Ankauf der bisher in Privatbesitz befindlichen, unvollendeten Autobiografie Ein Grashüpfer im hohen Gras von Klara von Neumann, der Mathematikerin und Frau John von Neumanns, gelungen sei.
Die technische Produktion des 20. Jahrhunderts, so der Co-Founder nach einer bedeutungsheischenden Pause, habe sich in großen Teilen als irregeleitet, zerstörerisch oder schlicht monströs erwiesen: höchste Zeit also, danach zu fragen, wie die radikalen Hirne, die die absolute Produktion unserer technischen Welt aus der Taufe gehoben hätten, damit umgegangen seien. »Über welche Alternativen haben sie nachgedacht?« Hierfür sei das Institut auch ausdrücklich für Forschungsprojekte offen, die sich in den Bereich des Spekulativen vorwagten: »Was also, wenn das Feuer dieser Gehirne nicht von dem militärisch-technokapitalistischen Komplex, deren Kinder sie waren, verzehrt worden wäre und ihr Denken seinen Ausdruck stattdessen in der Literatur hätte entfalten können?«
Ich subtrahierte den rhetorischen Überschuss und entschied, dass das Institut genug zu bieten hatte, was meine Neugier triggerte, wobei mich vor allem die Vermutung, dass der online nicht mehr auffindbare Spiegel-Artikel in dem bombensicheren Archiv lagern könnte, in den folgenden Tagen und Wochen nicht mehr losließ. Dennoch wäre mein Interesse am Institut wohl bald wieder versiegt, wenn ich nicht eine E-Mail erhalten hätte, die mich – in scheinbar personalisierter Ansprache – zu einer Tagung auf dem Campus einlud. Der Titel der Konferenz lautete: »Als unsere Wissenschaftler:innen noch Künstler:innen waren«. Und so kam es, dass ich auf Kosten der Medienanstalt, für die ich tätig bin, mit dem Auftrag, anlässlich der Tagung ein Feature über das Archiv zu schreiben, wenig später in einem nur mäßig ausgelasteten Jumbo nach Los Angeles saß.
Die kurzfristige Planung der Reise hatte mir nur wenig Zeit gelassen, mich auf die Tagung vorzubereiten. Gemerkt hatte ich mir lediglich, dass für den Eröffnungsvortrag der Spiegel-Journalist und Trendforscher als ausgewiesener Wernher-von-Braun-Spezialist angekündigt war. Erst im Flugzeug kam ich dann dazu, die weiteren Vorträge und Vitas der Speaker zu studieren. »Buzz Aldrins langer Weg zum Science-Fiction-Autor. Musste Aldrin erst auf den Mond, um Autor zu werden?«, hieß der Talk einer promovierten Biochemikerin, die eine Forschungsgruppe über Wissenschaftsgeschichte und narrative change koordinierte und momentan als Kuratorin für zeitgenössische Performancekünste in Los Angeles, Jarkata und Laos tätig war. Mit »Warum haben wir Claude Shannons Kurzgeschichten noch immer nicht zu lesen bekommen?« war der Input einer Lüneburger Medienwissenschaftlerin überschrieben. Ein Doktorand von der Universität Peking und Minnesota sollte über den Autodidakten, Logiker und Kybernetiker Walter Harry Pitts sprechen: »Pitts Anti-Proust. Einige triftige Spekulationen über das Schicksal eines verschollenen Romans«. Andere Vorträge sollten sich mit den Autobiografien von Jean Jennings Bartik und Klara von Neumann oder mit den »Frauen, die die Männer auf den Mond geschossen haben« beschäftigen, während eine ghanaische Professorin über »Das Archiv als Trümmer, Trost, Task, Traum, Technik, Tempel, Tod, Transgression, Trug und Täuschung« sprechen sollte. Als wir zum Landeanflug ansetzten, war meine Stimmung gehoben.
Möglicherweise rührte die euphorisierte Affektlage, mit der ich den LAX-Terminal betrat, aber lediglich aus den Flashbacks, die sich gleich Push-Benachrichtigungen über meine Sinne schoben, katapultierte mich doch die jetzige Ankunft in eine Blase der Erinnerung daran, wie ich vor bald einem Vierteljahrhundert dort zum ersten Mal als Austauschstudent eingetroffen war. Ich war damals für ein Jahr nach Santa Barbara gegangen. Jetzt riefen die Innenarchitektur des Airports mit seinen konventionslosen Proportionen, die wuchtigen Pissoirs und grauen Exit-Türen, die man mithilfe eines martialischen Gürtelbands und des geballten Gewichts des eigenen Körpers aufstoßen musste, dazu die überraschend softe Viskosität der Teppiche das entfernte Echo einer nur schwer zu greifenden Vertrautheit hervor.
Ein Shuttle brachte mich schließlich zum Autoverleih. Mit dem Wagen wollte ich zum Forstell-Institut nach Crystal fahren, eine kleine Wüstensiedlung in Nevada, hundertzwanzig Kilometer von Las Vegas und bloß einen Steinwurf vom Death Valley entfernt, nördlich, keine dreißig Kilometer entfernt, lag Mercury, jene zeitweise mit Las Vegas um die Einwohnerzahlen konkurrierende Wüstenstadt, die anlässlich des Nevada-Testgeländes gegründet worden war, auf dem ab den Fünfzigern über einhundert atmosphärische Atombombenexplosionen die Erdkruste vernarbt hatten. Die Fahrt steigerte meine Erregung, die wenig später in eine manifeste Übelkeit kippte, sodass ich vorsichtshalber eine Plastiktüte auf dem Beifahrersitz des teilautonomen Mietautos platzierte, das mich auf den Spuren der historischen Route 66 aus Los Angeles hinausnavigierte. Vielleicht ist mir auch nur die Bordnahrung nicht bekommen, überlegte ich während eines unangekündigten Schweißausbruchs, als ich in Gedanken unvermittelt bei Shane landete, von dem ich in jedem erdenklichen Sinn, aller Wahrscheinlichkeit nach auch sexuell, angezogen gewesen war, was ich damals allerdings nicht oder allenfalls nur sehr verspätet realisiert hatte. Den Großteil meines Studienaufenthalts hatte ich mit ihm verbracht, selbst meinen Seminarplan hatte ich weitgehend an dem seinen ausgerichtet, aus gutem Grund hätte man uns also für ein Paar halten können; was einige – dieser Gedanke kam mir, wie ich meinte, erst jetzt – mit Sicherheit auch getan hatten. Dabei hatte ich sehr wohl gewusst, zumindest stellte es sich mir in der Erinnerung so dar, dass sein Coming-out zu diesem Zeitpunkt erst drei oder vier Jahre zurückgelegen hatte.
Der Kontakt zu Shane war schon bald nach meiner Rückkehr nach Deutschland abgebrochen. Nur mit Chester, die ich in den letzten Monaten meines Studienaufenthalts in Santa Barbara kennengelernt hatte, tauschte ich noch ab und an Kurznachrichten oder E-Mails aus. Umso überraschter war ich nun also, dass mich die Autofahrt auf geheimnisvollen Bahnen in einen mentalen Stream gleiten ließ, in dem ich darüber nachsann, dass ich damals eine Beziehung mit Shane eingehen und in den USA hätte bleiben können. Im Nachhinein kam mir das gleichzeitig naheliegend und zu hundert Prozent ausgeschlossen vor. Ich war unfähig, mir ein Erwachsenenleben eines Mitt- bis Endzwanzigers auf dem amerikanischen Kontinent vorzustellen, in dem ich die Rolle des Hauptprotagonisten hätte übernehmen müssen. Im Rückspiegel beobachtete ich das intensive Licht der sinkenden Sonne, während die trockene Finsternis der Nacht im Südosten kaum merklich, aber stetig die stilisierten, gegen den Himmel stark konturierten Hügelketten erklomm.
Wenige Kilometer vor Barstow switchte das orange Symbol einer Kaffeetasse auf dem Display auf Rot, kurz darauf leuchteten multiple Warnmeldungen auf, die asynchron blinkten. Der Widerstand, meine Müdigkeit länger zu batteln, löste sich in einem bunten Pixelgestöber auf, nach dem dritten oder vierten Motel auf der endlosen Einfallstraße Barstows stoppte ich an einem Best Western. Bis nach Crystal waren es keine dreihundert Kilometer mehr, weshalb ich am Tag darauf in aller Ruhe Pancakes mit geschäumtem Butterersatz und Zuckerrübensirup verzehrte, das Mojave River Valley Museum im Ortskern von Barstow besuchte und im paar Straßenblöcke entfernten Route 66 Mother Road Museum 5-Dollar-Souvenirs besorgte. Drei Stunden später erreichte ich Crystal auf den Punkt rechtzeitig, um einzuchecken, meinen Trolley im Apartment zu parken und an einer Führung über den Campus teilzunehmen, auf der ich bereits einen ersten Einblick in den So-much-more-than-Books-Store, die Katakomben des Archivs, die digitalen und analogen Katalogsysteme, den Lese- und Zeitschriftensaal, ein Depot mit antiquiert wirkenden Computern und elektronischen Speichergeräten sowie das interne Rechenzentrum inklusive seinem batterie- und dieselbetriebenen Notstromaggregat erhielt, bevor ich geduscht und mit erfrischend feuchtem Haar, das ich mir glatt in den Nacken strich, zur austernförmigen Conference Hall spazierte, in der die Tagung stattfinden sollte.
Natürlich hatte ich mehrfach gerätselt, warum man mich überhaupt eingeladen, ob mein Besuch der Webseite möglicherweise dazu geführt hatte, dass das Forstell-Institut meine Daten über einen Datenmakler erworben und mir anschließend eine automatisch generierte E-Mail zugesandt hatte. Oder gab es tiefer liegende Gründe? Nach und nach hatte ich den Entschluss gefasst, die Frage offensiv anzugehen, hatte mir vorgestellt und es mehrmals im Geist durchgespielt, wie einer der Gründer, manchmal war es der Spiegel-Journalist, an mich herantreten und sich erkundigen würde, was mich auf den Campus gebracht habe. Ich lachte dann möglichst vieldeutig auf, erklärte, dass ich genau aus diesem Grund gekommen sei: Ich wolle herausfinden, warum man mich eingeladen habe. Manchmal entspann sich daraufhin ein hochsuggestiver, ins Mysteriöse neigender Wortwechsel, in der Regel endete das proleptische Skript aber mit einem ambivalenten Kopfschütteln, beziehungsweise malte ich mir allenfalls noch einen mehrfach gelayerten Ausdruck auf dem Gesicht des Gründers oder Trendforschers aus, den ich dann (stets erfolglos) zu dechiffrieren versuchte.
Als ich mich den circa dreißig Personen näherte, die sich für einen Sektempfang vor der Conference Hall gesammelt hatten, spielte sich das fiktive Encounter automatisch von Neuem in meinem Cortex ab. In der Wiederholungsschleife erschien es mir mit einem Mal peinlich und rief jetzt eher die Assoziation eines von Selbstzweifeln zugespammten Konfirmanden auf, der mit seinem nur schlecht memorierten Glaubensbekenntnis bewaffnet vor zum Alter pirschte.
Den Spiegel-Journalisten identifizierte ich auf Anhieb. Er trug ein beiges Leinenhemd in extra long, seine Beine steckten in Paisley-Hosen mit leichtem Schlag, an seinen Füßen grobgenoppte Wandersandalen. Ich sah absichtsvoll davon ab, ihn sofort anzusprechen, und schloss mich der Gruppe von der Campustour an. Man unterhielt sich über das Gründerteam des Instituts, zwei Männer und eine Frau, die sich noch nicht gezeigt hatten, aber jeden Moment erwartet wurden. Einer der Gäste behauptete in einem anbiedernd verschwörerischen Tonfall, dass nur einer der beiden Jungs volljährig sei, »und wir sprechen hier von vierundzwanzig, fünfundzwanzig Jahren, Maximum«.
»Von Braun ist mit fünfundzwanzig technischer Leiter der Heeresversuchsanstalt in Peenemünde geworden«, warf eine Frau mit aufwendiger Fönfrisur ein, gekleidet war sie in eine florale Westernbluse, an den Füßen trug sie pinke Cowboystiefel. Als die Gesichter der anderen sie skeptisch musterten, herrschte für fünfzehn Sekunden Stille.
Der Talk des Spiegel-Journalisten, der als von-Braun-Spezialist, Trendforscher und ehemaliger Mitarbeiter des deutschen Nachrichtenmagazins vorgestellt wurde, war mit dem Titel »Was uns der Science-Fiction-Autor Wernher von Braun wirklich sagen wollte« angekündigt, und er enthielt nur wenig, was über sein Vorwort zur posthumen Erstveröffentlichung von Das Marsprojekt im deutschen Original hinausging. Interessant war die Keynote aber insofern, als er von Braun als Science-Fiction-Autor frei von aller Ironie ernst nahm. »War der Science-Fiction-Roman für Wernher von Braun nur ein Mittel zum Zweck?« Mit dieser Frage eröffnete der ehemalige Spiegel-Journalist seinen Vortrag. Im Vorwort zum Marsprojekt schreibe von Braun, dass der Roman eine »Vision von morgen« stiften, darin aber bereits »die Kraft des Handelns« von heute entfesseln solle. Zudem habe von Braun belegen wollen, dass der Aufbruch ins All technisch möglich sei. Allerdings sei ihm der Mond als Destination zu nah erschienen, weshalb er den Mars gewählt habe. »Aber was heißt das?« Der Redner setzte eine Kunstpause. »Erschöpft sich der Roman im Nachweis der technischen Machbarkeit? Oder beinhaltet die Zukunftserzählung etwas, das darüber hinausgeht?« Akut werde die Frage mit dem zweiten Roman, erklärte er daraufhin, wobei er das Hardcover wedelnd in die Höhe hielt. Mit Erste Fahrt zum Mond lasse sich nämlich ganz konkret fragen, ob der Roman seine Bestimmung neun Jahre nach seinem Erscheinungstermin mit der Apollo-11-Mission erfüllt habe.
»Aber greifen wir nicht vor«, pfiff er sich selbst zurück. Denn man könne lange darüber streiten, was der Roman antizipiere. »Handelte es sich um eine PR-Maßnahme für die Raumfahrt? Stand der Nachweis der technischen Machbarkeit im Zentrum? Oder ging es um die Bedeutung einer kosmischen Existenz? Erinnern wir uns: Wir standen damals an der Schwelle zum Space Age.«
An dieser Stelle war die eigentliche These des Vortrags versteckt: Erste Fahrt zum Mond artikuliere die Einsicht, dass der Outer Space nur posthuman oder gar nicht zu erschließen sei. »Im All kann der Mensch nur als Element innerhalb einer technischen Infrastruktur existieren, die total ist. Der individuelle Ausdruck des Individuums, wie wir es kennen, verliert seine Bedeutung.« Folge man dieser Perspektive, dann lasse sich Erste Fahrt als Sequel zum Debüt lesen. »Denn schon im Marsprojekt macht sich von Braun über eine Science-Fiction lustig, die nur die Einzelleistung von Helden kennt oder auf nichts Besseres verfällt, als die Raumfahrt wie eine proustsche Madelaine in rührselige Liebesgeschichten zu tunken.« Die Realität sehe hingegen anders aus. Man entwickele Raketen nicht wie einen Computer, den man in Einzelarbeit in seiner Garage montieren könne – »siehe Goddard, der für die amerikanische Raumfahrt folgenlos geblieben ist«. Vielmehr werde das Tor in den Weltraum nur als gesamtgesellschaftliche Anstrengung oder gar nicht aufgestoßen. Und so sei es kein Zufall, dass der Auftakt der Raumfahrt mit den für den Weltkrieg aufgesetzten Research & Defense-Technologien korrespondiere, mit diesen gewaltigen Rüstungs- und Verteidigungsprogrammen, mit denen die Staaten zum Träger des technisch-wissenschaftlichen Fortschritts zu werden versucht hätten. Insofern Hitlerdeutschland, was die Raumfahrt anbelangt habe, führend gewesen sei, dann allein deshalb, weil es im großen Stil in den Raketenbau investiert habe, wohingegen die Verantwortlichen in den USA die Rakete noch als bloße Science-Fiction behandelt hätten. Dass die Deutschen an die Rakete geglaubt hätten, habe wiederum an deren Verwendungszweck gelegen, von dem von Braun und Dornberger den Führer beim berüchtigten Treffen in der Wolfsschanze im Juli 1943 mit der Rakete als ultimativer Waffe endgültig hätten überzeugen können. Die letzte Hürde für die industrielle Produktion sei damit genommen worden, wobei mittlerweile hinreichend bekannt sei, dass die Rakete für die Zwangsarbeiter und KZ-Insassen, die sie gefertigt hätten, weitaus tödlicher als für die Alliierten gewesen sei. »Es hat also einen guten Grund, dass von Braun seine Hauptprotagonisten Mason und Carter nicht als Helden auftreten lässt. Sie sind nur die Zahnräder in einer planetaren Maschinerie.« Die Stimme des Trendforschers hatte im Verlauf des Vortrags einen leicht raunenden Ton angenommen: »Aber von Braun geht weiter. Auch die menschliche Sprache verwandelt sich unter den Bedingungen der Raumfahrt zu einem technischen Datenträger.« Deshalb würden die Monologe Masons und Carters wie die Proben, die sie der Atmosphäre und dem Gestein entnähmen, nach apparativen Kriterien aufgezeichnet und ausgewertet: »Menschen, Steine, Staub: Im Outer Space sprechen sie eine Sprache, und es ist eine durch und durch technische.«
Der gelernte Journalist nahm einen großen Schluck aus einem Glas mit einer seltsam honigfarbenen Flüssigkeit, ließ seinen Handrücken nachdenklich über die Lippen gleiten. »Ich will den Punkt noch mal anders anpacken: Im Weltraum gibt es keine erste oder zweite Natur, die für den Menschen irgendwie gegeben oder natürlich wäre – ein Gedanke übrigens, den der deutsche Kybernetiker Gotthard Günther, der sich schon früh um die Herausgabe US-amerikanischer Science-Fiction-Romane bemüht hat, etwas poetischer artikulierte: Da im All die irdische Idee des Menschen nichts taugt, muss der Mensch Günther zufolge sein terrestrisches in ein stellares Seelenleben umkrempeln. Genau davon handelt von Brauns Roman, wenn er zeigt, dass sich die interplanetare nur als technische Existenz denken lässt. In diesem Sinn sind Mason und Carter also von Brauns ›First Men‹ – die ersten Menschen einer technokosmischen Existenz.«
An dieser Stelle, so der Vortragende, sei übrigens der Hinweis angebracht, dass der im Fischer-Verlag in der deutschen Übersetzung vertriebene Titel den Sinn des Romans grandios verfehle. »Das englische Original heißt First Men to the Moon, nicht Erste Fahrt zum Mond – nicht also der Transport, sondern die Transformation des Menschen ist das eigentliche Thema. Die Raumfahrt leitet eine Geburt des Menschen aus dem Geist der Technik ein. Wenn Sie mich fragen, ist das die Vision des Romans«, führte der ehemalige Spiegel-Journalist aus, bevor er seinen Vortrag mit einer offenen Frage schloss: »Was heißt das nun aber für den Science-Fiction-Autor Wernher von Braun? Warum greift der Ingenieur zur literarischen Fiktion? Wie immer man diese Fragen beantwortet: Anders als die historische Apollo-11-Mission lässt uns der Roman mit einem Rätsel zurück. Die Absicht der Mondmission ist klar, sie hat sich mit der Landung auf dem Mond als historische Leistung erfüllt. Für den Roman trifft das so nicht zu.«
Noch während des in seiner Überschwänglichkeit allzu selbstgefälligen Applauses verschwand der Trendforscher, zumal keine Fragen bei diesem feierlichen Auftaktvortrag vorgesehen waren, durch eine Hintertür und tauchte auch für den Rest des Abends nicht wieder auf. Ähnlich verhielt es sich auch am Folgetag. Ich sah ihn nur einmal, wie er mitten in einem Vortrag die Conference Hall betrat und im Eingangsbereich stehend lauschte; als ich mich fünf Minuten später nach ihm umsah, war er fort.
In den folgenden drei Tagen besuchte ich eine Großzahl der Vorträge, verbrachte Zeit im Archiv, interviewte das Bibliothekspersonal, zwei der Founder und die Institutsgärtnerei. Im Buchladen erwarb ich eine dreisprachige Sonderausgabe von »Lunetta«, von Brauns Schülerarbeit, sowie eine broschierte Auflage von Stafford Beers Gedichtband Transit; laut Buchrücken hatte der Gedichtband des britischen Kybernetikers bislang nur als Privatdruck in einer Stückzahl von zweihundert Exemplaren existiert. Außerdem kaufte ich Klara von Neumanns Autobiografie, die neuaufgelegten Gedichte von Erwin Schrödinger in einer zweisprachigen Schmuckausgabe, Carl Friedrich von Weizsäckers Verse aus jungen Jahren (1931–1946) sowie Warren McCullochs Gedichtband Natürliche Passung.
Nach dem Spiegel-Artikel recherchierte ich anfangs heimlich, bat dann aber schließlich das Bibliothekspersonal um Hilfe. Nichtsdestotrotz blieb der Artikel verschollen. Als ich mich beiläufig nach dem ehemaligen Spiegel-Journalisten und jetzigen von-Braun-Spezialisten erkundigte, erfuhr ich, dass er im vierzig Kilometer entfernten Pahrump wohnte, weshalb ich mich am Vortag meiner Abreise ernsthaft zu sorgen begann, dass ich ihn verpassen könnte. Aber da stand er dann plötzlich vor mir, als hätte er, so rätselte ich einen Moment lang, im Eingangsbereich des Archivs auf mich gewartet. Allerdings war er dann so kurz angebunden, dass ich den Verdacht sofort wieder fallen ließ, und als ich entschied, dass ich nichts zu verlieren hätte, und ihn direkt fragte, ob es wahr sei, dass er seine Tätigkeit für den Spiegel eingestellt habe, und dass ich mich dafür interessierte, was mit dem Spiegel-Artikel zu von Brauns fünfzigstem Todestag geschehen sei, erklärte er nach einem auffallend langen Intervall, ohne auf meine Fragen einzugehen: »Kommen Sie mit. Ich will Ihnen etwas zeigen.«
Ich folgte ihm zu seinem Auto. »Ich fahre zum Devils Hole, das Projekt wird Sie interessieren.« Seine Laune hatte sich spürbar verbessert. »Sie haben doch einen Moment Zeit?«, fügte er noch hinzu, wobei er seinen Sportwagen schon mit überhöhter Geschwindigkeit vom Campus steuerte.
»Wissen Sie, was mich an dieses Land gebunden hat?« Im Wagen war der ehemalige Journalist plötzlich wie ausgewechselt, redete unbekümmert drauflos. Vielleicht hatte seine anfängliche Verstocktheit nur daher gerührt, dass wir uns eines Mischmaschs aus Englisch und Deutsch bedient hatten. Jetzt war er auf Deutsch umgeschwenkt und fand offenbar Gefallen daran. Er nannte seinen Namen, Sam, bot mir das Du an. Je länger er sprach, desto flüssiger wurde seine Aussprache, nur das Thema unserer anfänglichen Unterhaltung schien vergessen. »Es ist das Licht«, beantwortete er seine eigene Frage, während er das Verdeck herunterließ. »Bei Bedarf sind übrigens eine Kappe und Brille im Handschuhfach.« Er selbst streifte eine hautenge Lederkappe über den Kopf, kämpfte mit dem Riemen, den er mit einem Druckknopf einhändig unter dem Hals zu schließen versuchte. »Ich habe lange gebraucht, bevor ich dem Geheimnis des Lichts an der Westküste auf die Spur gekommen bin. Also, ich meine, bis ich es benennen konnte.« Wir hatten die letzten Häuser Crystals hinter uns gelassen und waren nun von allen Seiten von der Mojave-Wüste umgeben, die sich aus nichts als Felsen und Sand zusammenzusetzen schien. Nur alle paar Kilometer änderte sich das Muster der minimalistischen Vegetation geringfügig, tonangebend blieb in all dem aber der Himmel: Mit seinem stupenden Blau setzte er die Landschaft ins Bild, ließ sie mit maximal reduziertem Puls atmen. »Dabei liegt sein Geheimnis offen zutage«, fuhr er fort: »Es ist die Transparenz. Die Dinge werden nicht beleuchtet. Das pazifische Licht erschafft sie jeden Tag neu. Das ist das ganze Geheimnis. Morgens reißt du die Tür deines Bungalows auf und trittst in eine Welt, die über Nacht erschaffen worden ist. Wie in einem Reagenzglas. Alles ist wie am ersten Tag. Daher rührt der inflationäre Optimismus in diesem Land, der Wille, die Dinge einfach anzupacken … Natürlich spricht das auch für einen anderen Umgang mit der Angst.« Ohne einen Blick in den Rückspiegel zu werfen, setzte er zu einem Überholmanöver an, für wenige Sekunden wurden seine Worte vom Splitt umspült, der gegen das Bodenblech sprühte. »Die heftige Intensität dieses Lichts spürt jeder, der zum ersten Mal hier ist, sofort. Das geht unter die Haut. Das ist nichts Metaphysisches, hat nichts mit dem aufklärerischen Licht Europas zu tun. Du lebst in der gesättigten Illumination einer Immersion, die für alle, die ihr verfallen sind, absolut ist.«
Sam hatte die Anlage aufgedreht, sein Kopf wippte im Beat der Musik, ich meinte einen Song von Moon Safari zu identifizieren, Airs erstem Album aus den späten Neunzigern. »Aber warum findet das Leben dann in verdunkelten Innenräumen statt?«, warf ich ein. »Man sieht doch überall nur Jalousien. Oder nimm die Cafés und Restaurants – wattierte Innenräume. Dazu diese supersoften Teppiche, die alles tonlos schalten. Unterwegs sucht man dann Schutz im Panzer seines Automobils.« Ich wusste nicht, ob er mich hören konnte, der Wind riss die Worte, sobald ich sie ausgesprochen hatte, von meinen Lippen. Dennoch hatte ich keine Lust zu schreien und fuhr deshalb mit unverändertem Lautstärkelevel fort: »Vermutlich könnte man den Menschen hier weismachen, dass sie unterirdisch leben sollten. Wie von Brauns Marsianer. Die Sonne auf der Haut spüren nur die Obdachlosen und Outcasts. Die anderen bekommen das Licht in einem abgedunkelten Saal auf einen Screen projiziert. Das ist doch nichts als Pop, pure Nostalgie.«
»Wir sind gleich da!«, rief Sam. Wir waren mittlerweile auf eine Schotterpiste abgebogen, an einem Schild mit der Aufschrift »Ash Meadows National Wildlife Refuge« vorbeigesprengt und erreichten kurz darauf einen Parkplatz. Die Landschaft war vielfältiger geworden, Sam erklärte, dass es in der Umgebung sogar inselförmige Marsh Lands mit Antennengräsern und fluoreszierenden Gewässern gebe. Über den salinen, von spröden Rissen durchzogenen Untergrund führte ein Holzsteg zur »U.S. Fish and Wildlife Service’s Ash Meadows Fish Conservation Facility«, worin eine Replika des Devils Hole untergebracht war, eine mit fossilem Wasser gefüllte künstliche Felsenformation, die in real life nur drei Kilometer von der Facility entfernt, aber zum Schutz abgezäunt war.
Das Devils Hole bildete die Heimat eines endemischen Fischs, des Teufelsloch-Wüstenkärpflings, den es nur hier gab. Niemand wusste, wie der Fisch vor zehn- oder zwanzigtausend Jahren in das winzige Becken in der Wüste, fernab von allem, gelangt war. Aufgrund einer heißen Quelle herrschten konstante 34 Grad Celsius, die dem Tier einmalige Lebensbedingungen bescherten. »Schon Ende der Sechziger hat sich der Bestand der Fische auf fünfunddreißig Exemplare dezimiert«, erläuterte der ehemalige Spiegel-Journalist, »nachdem landwirtschaftliche Bewässerungsprojekte dazu geführt haben, dass der Wasserpegel im Hole 1969 auf einen alarmierenden Tiefstand gesunken ist. Fieberhaft hat man versucht, den Fisch an anderen Orten anzusiedeln, aber alle bisherigen Versuche sind gescheitert. Der Teufelsloch-Wüstenkärpfling ist übrigens der erste Fisch, der in den Sechzigern offiziell zu einer bedrohten Art erklärt worden ist.« In den Nullerjahren habe man sich dann schließlich in einem millionenschweren Pilotprojekt darangemacht, das Teufelsloch in aufwendigen 3-D-Verfahren künstlich nachzubilden. Die Aufzucht und Replikation des Ökosystems habe sich allerdings als schwieriger als gedacht erwiesen. Dennoch habe die Population der zwei Zentimeter großen Tiere, deren winziger Leib von einem irisierenden Königsblau erleuchtet werde, langsam wieder zugenommen.
Sam war Inhaber einer Fischpatenschaft und mit dem Personal vor Ort bestens vertraut. Das keimfreie, der Öffentlichkeit nicht zugängliche Labor mussten wir durch eine Desinfektionskammer und Luftschleuse betreten. Mit seinem Beton, seinen Rohren, Kabeln und Metallgittern, die das Becken in der Mitte der Halle rahmten, wähnte man sich eher in einer konventionellen Fabrik als in einem Biohabitat. Sam ging auf die Knie, steckte seinen Kopf durch das Geländer, das den rechteckigen, zweieinhalb auf sechs Meter großen Pool säumte. Das Wasser war von einem schlierigen Algenfilm bedeckt, der teils schmuddelig, teils synthetisch grün schimmerte. »Unter der Wasseroberfläche ist alles identisch mit dem originalen Teufelsloch«, erläuterte er, »nur die Tiefe variiert. Es ist noch immer nicht bekannt, wie tief das echte Devils Hole eigentlich ist. Ab den Sechzigern wurden dort Apnoe-Tauchrekorde aufgestellt. Einige Taucher sind ertrunken; in der komplexen Geografie des Tunnelsystems mit seinen erstaunlich geräumigen Kammern wurden ihre Leichen nie gefunden. Tiefer als hundertachtzig Meter hat es aber bislang niemand geschafft. Anfang der Zehnerjahre zeichneten dann Überwachungskameras auf, wie ein Erdbeben im über dreitausend Kilometer entfernten Oaxaca in Mexiko eine winzige Tsunamiwelle im Teufelsloch auslöste. Seitdem rätselt man, ob es unterirdische Kanäle gibt, die den Pool der Wüstenkärpflinge mit dem Pazifik verbinden.« Ich kniete mich neben Sam, starrte in den Tank. »Da!«, schrie er auf, als plötzlich blaue Lichtpunkte auftauchten, die in irregulären Bahnen durch das Becken glitchten, illuminierte Linien unter die Oberfläche des brackigen Wassers kritzelten, abtauchten und kurz darauf wie auf einem matten Screen in neuer Anordnung aufflackerten, den Tank elektrisierten. Er rappelte sich auf, wechselte die Poolseite. Diesmal legte er sich flach auf den Bauch, schob seinen Oberkörper über die Kante des Schachts, bis er die Wasseroberfläche mit dem Finger hätte berühren können.
Ich weiß nicht, wie lange wir an dem Beckenrand kauerten, auf die statische Oberfläche starrten, darauf warteten, dass die Fische den Pool erneut erleuchteten. Anfangs setzten wir unsere Unterhaltung noch fort. »Ich frage mich immer, ob ich hier in die Vergangenheit oder in eine Zukunft blicke«, murmelte Sam: »Und dann ist da der Punkt, an dem die Zeit stirbt und die pure Gegenwart herrscht. Vielleicht bin ich deshalb so oft hier.«
Meine Knie begannen zu schmerzen, sodass ich mich ebenfalls bäuchlings auf den Spritzbeton legte.
»In der Biologie werden Tiere wie die Wüstenkärpflinge als naturschutzabhängige Arten bezeichnet«, erläuterte Sam; er ließ nicht erkennen, ob er mich adressierte oder einfach nur vor sich hin brabbelte. »Ohne Schutzmaßnahmen wie diese würden sie aussterben. Eine amerikanische Journalistin hat dagegen vorgeschlagen, in einer Abwandlung des Stockholm-Syndroms, also des psychologischen Phänomens, dass Geiseln eine emotional positive Bindung zu ihren Entführern aufbauen, lieber von Stockholm-Arten zu sprechen, weil diese Tiere ihren Verfolgern – also uns – auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Manchmal frage ich mich, ob die Kärpflinge merken, dass sie hier und nicht im Devils Hole sind. Wissen sie um das Loch, das dort draußen klafft, obwohl sie niemals, auch nicht annähernd, in die Abgründe und verschachtelten Tunnelsysteme des eigentlichen Teufelslochs vordringen werden? Und wenn ja, was macht ein solches Wissen mit ihnen?« Allmählich wurden die Pausen zwischen seinen Sätzen länger. Als ich meinte, dass er endgültig verstummt war, fuhr er fort: »Also die animalische Erkenntnis einer unergründlichen Tiefe. Wie könnte sich ein solcher Sinn äußern? Die Ahnung von einem fernen Leben, das anderswo stattfindet? Und tragen die im Devils Hole geborenen Kärpflinge diesen Sinn ebenfalls in sich? Oder sind sie frei davon?«
Irgendwann setzte sich das Schweigen dann durch. Nur die Lüftung und technischen Apparaturen waren zu hören, Sauerstoff, der unter einer synkopischen Blasenbildung ins Wasser strömte, Zähler, die chronisch über den Verlauf von Zeiten und Werten wachten. Erst die Facility-Managerin hob die Stille wieder auf, teilte uns mit, dass das Lab nun schließen werde.
Als wir mit schweren Schritten – die Beine waren vom langen Liegen lahm geworden – zum Auto zurückstaksten, legte ich mir Sätze zurecht, mit denen ich dem ehemaligen Spiegel