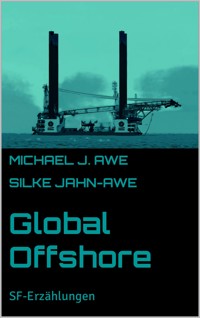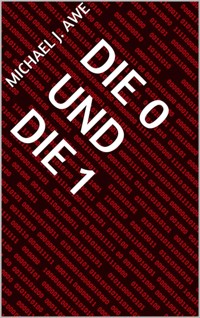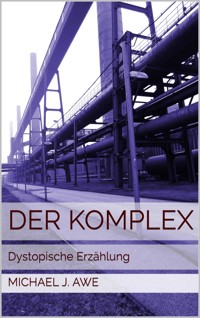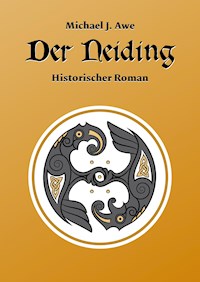6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2068 beginnt das ambitionierteste Projekt der Menschheit: Die Besiedlung des Mondes. Doch kurz nachdem die ersten elf Mitglieder der ersten Mondstation eingetroffen sind, bricht der Kontakt zur Erde ab. Auf sich allein gestellt müssen die Besatzungsmitglieder inmitten der lebensfeindlichen Umgebung überleben. Ihre Isolation wird nach fünfzehn Jahren durch das Auftauchen eines jungen Mannes unterbrochen, der ohne Schutzanzug draußen im Vakuum steht. Die Biologin Dava ist sich sicher, in diesem Fremden ihr während der Schwangerschaft verlorenes Kind zu erkennen. Durch das Auftauchen des Fremden, der sich an nichts erinnern kann und von manchen als feindliches Alien betrachtet wird, treten die latenten Spannungen innerhalb der Besatzung zum Vorschein. Als die Situation zu eskalieren droht, befindet sich plötzlich ein Raumschiff von der Erde im Landeanflug.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Michael J. Awe
Shackletons Kinder
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Impressum neobooks
1
Regolith stieg vom Boden auf und bedeckte Jenns Stiefel. Der graue Staub, den sie mit jedem Schritt aufwirbelte, legte sich träge wie eine zweite Haut auf ihren BioSuit. Das Mädchen trat aus dem Schatten des Gebäudes und sah vor sich die 68 Sonnenkollektoren, die sich in geordneten Reihen am Rande des Kraters entlangzogen. Das Panoramavisier des Helmes dunkelte sich in den Strahlen der tief stehenden Sonne automatisch ab. Auf den ersten Blick waren neue Einschläge im Mondstaub zu erkennen, die meisten kleiner als der Abdruck ihres Zeigefingers. Sie musterte die zerklüftete, graue Wüstenlandschaft. Ein geometrisches Muster aus Licht und Schatten, in der ihr jede Änderung auffiel. In der Ferne erhob sich das Bergmassiv des Malaperts in die Höhe, dessen Gipfel ewig leuchteten.
»Siehst du schon was?«, erklang Goozers Stimme aus dem Helmlautsprecher.
»Bin gleich da«, antwortete sie.
Sie stieß sich vom Boden ab und beförderte ihre hoch aufgeschossene, dünne Gestalt einige Meter weiter. Kurz vor der ersten Reihe der Kollektoren blieb sie stehen. Ihre glänzenden Oberflächen der Sonne zugewandt, zeigten sie ein tiefes Blau, eine einzigartige Farbe in einer Welt, die aus Weiß, Grau und Schwarz bestand.
Ein Sonnenkollektor in der Nähe vom Kraterrand war von einem kleinen Meteoriteneinschlag zerstört worden. Sie beugte sich vor und fluchte leise. Jenn löste das Multitool aus der Halterung ihres Anzugs und begann damit, das Panel abzumontieren. Vorsichtig legte sie es in das weiche Regolith.
»Ein Treffer!«, funkte sie.
»Das komplette Panel?«
»Glatter Durchschlag.«
»Bring es rein«, antwortete Goozer. »Ich sehe es mir mal an.«
Nachdem Jenn den Rest der Sonnenkollektoren kontrolliert hatte, hüpfte sie am Rand des Kraters zurück. Das große Rund des Shackletons klaffte neben ihr, eine gigantische Öffnung von 21 km Durchmesser, in dessen Tiefe nie ein Sonnenstrahl drang. Das Mädchen warf einen Blick in das riesenhafte, schwarze Loch. Vermutlich war auch so einiges da unten eingeschlagen und hatte seinem pockennarbigen Grund noch die eine oder andere Delle mehr verpasst.
Als sie das abmontierte Solarpanel erreichte, hob sie es behutsam auf und machte sich langsam auf den Rückweg. Die Erde hing tief über dem Horizont. Bläulich, mit weißen Wolkenschlieren, stachen die Umrisse der Kontinente beige und grünlich hervor. Ein unbekannter Ort mit fremden Farben für sie. Jenn achtete nicht weiter darauf. Ihr Blick war fest auf die Station gerichtet. Vierundzwanzig in einem Kreis angeordnete Gebäude mit einem größeren Habitat in der Mitte, zu dem die Gänge wie die Speichen eines Rades liefen. Die mit Regolith beschichteten Kuppeln verschmolzen mit der grauen Wüstenlandschaft. Nur der Mondgarten mit seiner transparenten Außenhülle bildete eine Ausnahme. Er benötigte die dicke Schicht aus Mondstaub nicht, um Bewohner vor der Strahlung zu schützen, und gestattete sowohl einen Ausblick auf den Shackletonkrater, als auch auf die Erde.
Jenn begab sich zur Luftschleuse, die direkt an Goozers Werkstatt angeschlossen war. Sie legte das Solarpanel ab und drehte das dreispeichige Rad in der Mitte der dicken, weißen Tür, bis sich das Außenschott öffnen ließ. In dem kleinen Raum dahinter war gerade so viel Platz, dass vier Personen hereinpassten. Jenn bugsierte das Panel durch die schmale Tür und zog das Schott hinter sich zu. Als die Lampe auf grün schaltete, löste sich der Verriegelungsmechanismus des Innenschotts und sie konnte die Station betreten. In der Reinigungskammer begann sie damit, die dünne Staubschicht zu entfernen. Mit geübten Bewegungen schrubbte sie die Oberseite des BioSuits ab und betätigte die Wasserdüsen an der Decke. Geduldig sah sie zu, wie die trübe Flüssigkeit zu ihren Füßen ablief. Im Umkleideraum schlüpfte aus dem engen BioSuit und verstaute Helm und Anzug in der dafür vorgesehenen Aufbewahrungseinrichtung, wo die Sachen trocknen konnten. Wie eine Reihe von Vogelscheuchen pflegte ihr Vater bei dem Anblick der aufgereihten Anzüge zu sagen. Sie zog einen blauen Overall an und lief in die Werkstatt. Goozer saß über den Tisch gebeugt und inspizierte durch eine Leuchtlupe eine Platine. Das Licht der Lampe spiegelte sich in seinen runden Brillengläsern.
»Wie sieht es aus?«, fragte er.
»Sonst war alles intakt. Aber das defekte Panel ist zur Hälfte zerschmettert worden.«
»Ist auch in unserer Schlafphase einiges heruntergekommen«, meinte Köhler. »Man konnte die Einschläge spüren.« Der sehnige Mann saß am runden Tisch im hinteren Teil der Werkstatt, vor sich einen Becher und eine Flasche, beide aus dem dunkelgrauen Material, das der 3-D-Drucker ausgab, und trank etwas von dem selbstgebrannten Alkohol.
»Es waren auch einige größere Brocken dabei.« Jenn zeigte die Größe mit den Händen an. »Einer hat die äußere Reihe der Kollektoren knapp verfehlt.«
»Der hätte auch uns aufs Dach fallen können«, brummte Goozer.
Köhler trank einen Schluck. »Ich glaube, das meiste ist im Krater gelandet.«
»Ein richtiger kleiner Schwarm.« Goozer legte die Platine beiseite und wuchtete seinen massigen Körper vom Stuhl. Der Techniker ging zum runden Tisch und setzte sich Köhler gegenüber. Mit einer seiner großen Hände zog er einen Becher zu sich heran. »Du auch?«, fragte er Jenn mit einem Schulterblick.
»Was findet ihr nur an dem Mist?«, sagte Jenn.
»Gewohnheit, meine Liebe«, antwortete Goozer. Er trank den Becher mit einem Zug leer und verzog das Gesicht.
Jenn nahm zwischen den beiden Männern Platz.
»Wir könnten mal die Rezeptur ändern!«, meinte Köhler.
»Viel Auswahl haben wir nicht und ich muss jetzt schon Ruth darum anbetteln, dass ich etwas von dem Weizen bekomme. Purer Luxus nennt sie das. Dabei hält das Zeug die halbe Station zusammen.«
Jenn griff nach dem Wasserbehälter und goss sich ebenfalls ein. Sie nahm einen kleinen Schluck und ließ das Wasser eine Weile im Mund, bevor sie es herunterschluckte.
Goozer hob den Becher. »Auf die Sonnenenergie.«
»Auf den Fortschritt«, bekräftige Köhler.
Der Techniker klopfte auf die Tischplatte. »Aber andersherum, was hat uns der ganze Fortschritt genutzt? Jetzt sitzen wir hier fest und kommen weder vor noch zurück.«
»Gut, wenn man es so sieht …« Köhler trank und strich sich mit dem Ärmel über den Mund. »Aber ohne den Fortschritt wären wir niemals ins All aufgebrochen.«
»Ich weiß nicht, ich weiß nicht …«, murmelte Goozer. »Es wurde doch immer gemacht, was getan werden konnte. Gab es auch nur einen Cent zu gewinnen, ging man über Leichen. Und wenn man jemanden suchte, der die Verantwortung dafür übernahm, gab es niemanden. So ging es also die ganze Zeit. Kurzlebige Menschen trafen mit ihren großen Firmen Entscheidungen, die ihnen kurzfristig Gewinn brachten und unwiderruflich den Ast absägten, auf dem wir alle saßen. So ist der Mensch! Beklage ich mich darüber?« Goozer schüttelte seinen massigen Schädel. »Aber vielleicht wäre ich nicht hier, wenn die menschliche Natur eine andere wäre.«
»Ich dachte, du wolltest wieder zurück?«, fragte Jenn. Goozers Frau und sein Sohn waren auf der Erde zurückgeblieben. Was eine Trennung von einem halben Jahr werden sollte, hatte sich auf unbestimmte Zeit ausgedehnt. Und vermutlich lebte dort ohnehin niemand mehr. Aber Jenn hatte gelernt, diese Gedanken für sich zu behalten.
Goozer sah durch seine runden Brillengläser zu der Stelle, wo sich hinter der dicken Wand der blaue Punkt der Erde befinden musste. »Je länger ich von der Erde fort bin, um so mehr vermisse ich sie. Ich wünschte, ich hätte sie nie verlassen.«
Vermutlich wärst du dann tot, dachte Jenn und nippte an dem Wasserbecher.
»Du kennst die Erde nicht«, sagte Goozer zu ihr. »Du weißt nicht, wie es dort ist.«
Goozer und Köhler stießen gemeinsam an und schwiegen. Schließlich lachte Köhler leise. »Warum sollten wir zurückkehren? Wir haben hier die Chance, eine neue Gesellschaft aufzubauen. Eine bessere!«
Wie immer war seine Stimme ruhig. Noch nie hatte Jenn gesehen, dass er nervös oder hektisch wurde, obwohl er von ihnen allen die meisten Außeneinsätze durchführte.
Goozer verzog das runde Gesicht, tastete mit der Zunge nach seinem Backenzahn und ließ den Alkohol in seinem Mund etwas wirken. »Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll, aber immer dann, wenn in der Vergangenheit eine bessere Gesellschaft geschaffen werden sollte, endete das mit Tod und Diktatur. Immer war die Freiheit das erste, was geopfert wurde. Und immer mussten Menschen für das Versprechen einer besseren Gesellschaft sterben. Es beginnt immer damit, dass der Einzelne nichts mehr wert ist.«
»Und was schlägst du vor?«
»Ich? Ich bin kein Politiker. Frag schlauere Menschen als mich. Ich sage nur, dass wir beim Einzelnen anfangen sollten. Ist der Einzelne frei und hat seinen Wert, ergibt sich alles andere von selbst.«
Köhler beugte sich über den Tisch. »Die sogenannte Freiheit des Einzelnen bedeutet bloß, dass einige wenige Menschen unwahrscheinlich reich und die meisten anderen unwahrscheinlich arm sind. Die Mehrheit darf schuften, zahlen und konsumieren. Es macht doch keinen Unterschied, ob ein autoritärer Staat oder einige skrupellose Konzerne herrschen. Bei dem einen verlieren wir die Freiheit, bei dem anderen glauben wir nur, frei zu sein.«
Goozer griff nach der einfarbigen, undurchsichtigen Flasche und schüttelte sie kurz, ob noch genügend Alkohol drin war. »Was folgt denn daraus? Man kann doch nicht alles relativieren!«
»Das ist eine historische Chance«, sagte Köhler. »Wir sind der Anfang von einer neuen Generation von Menschen. Wir sind nicht mehr Deutsche oder Polen, Russen oder Amerikaner. Wir lassen die Vergangenheit hinter uns. Jetzt sind wir nur noch Menschen.«
»Das ist doch alles schön und gut«, erwiderte Goozer. Langsam schenkte er ihnen nach. »Aber doch auch total falsch. Wir tragen unsere Vergangenheit immer mit uns herum. Selbst im hintersten Winkel des Universums wäre ich noch ein alter Pole und du ein Deutscher.«
Köhler zuckte mit den Schultern. »Aber was ist mit der nächsten Generation? Und mit den Kindern von dieser? Sie werden die Erde nie gesehen haben. Sie werden nicht wissen, was ein Pole oder ein Deutscher ist.« Er blickte zu Jenn, seine grauen Augen ruhten einen Moment auf ihr.
Die nächste Generation, dachte Jenn. Es gibt keine neue Generation, es gibt nur mich.
»Vielleicht«, murmelte Goozer, »vielleicht auch nicht. Ich habe schon Feindschaften erlebt, die von Generation zu Generation weitergeben wurden. Von den Eltern zu den Kindern, und alle traten sie in die alten Fußstapfen. Nicht ein neuer Gedanke kam dazu. Man wurde nicht um einen Deut schlauer, sondern konservierte nur seine Vorurteile.«
»Das ist eine sehr pessimistische Sicht der Dinge.«
Goozer hob den Becher an die Lippen und behielt den Hochprozentigen wieder eine Weile im Mund, bevor er ihn hinunterschluckte »So sind wir Menschen nun mal. Wir sind soziale Wesen, wir orientieren uns an der Vergangenheit und fühlen uns wohl mit dem, was alle anderen machen. Daran ist ja auch gar nichts auszusetzen. Aber ich weiß einfach nicht, wie der Mensch einen Neuanfang schaffen soll. Noch nicht einmal Penicillin haben wir. Fünfzehn Jahre sind wir schon hier oben, und doch hängen die Herzen immer noch an der Erde. Jeden Tag denken wir an das, was wir zurückgelassen haben. Was würde ich darum geben, noch einmal zu Hause zu sein. Die Natur zu sehen, die wunderbare Natur …«
»Aber was ist mit dem ganzen anderen? Die Menschheit ist im Eimer. Wir haben es verbockt. Hier haben wir die Chance, es besser zu machen.«
»Die Natur«, sagte Goozer, als hätte er die letzten Worte nicht gehört, »ist das Beste, was es gibt. Man steht am Morgen auf, nimmt seine Angel und geht in den Wald. Die Luft ist sauber und riecht nach Holz und Moos. Es weht ein lauer Wind. Die Sonne geht gerade auf. Dann setzt man sich ans Ufer des Flusses, wirft die Angel aus, öffnet seine Thermoskanne und wartet darauf, dass etwas anbeißt.«
Jenn erhob sich und nickte ihnen zu. Sie hatte keinen Anteil an der Vergangenheit, die in solchen Gesprächen beschworen wurde, und fühlte sich immer wie ein Fremdkörper. Außerdem langweilten sie diese endlosen Debatten.
Goozer seufzte leise, griff sich die Flasche und stand ebenfalls auf. »Wird Zeit, dass sich deine Mutter um den Zahn kümmert.«
Langsam trat Jenn auf den Außenring hinaus, verabschiedete sich von dem großen Techniker, der mit der Flasche in der Hand in die andere Richtung lief, und ging zurück zu ihrem Quartier. Der Ring, der die vierundzwanzig kreisförmig angelegten Habitate miteinander verband, war so schmal, dass Jenn mit ausgestreckten Armen knapp die Wände berühren konnte. Wenn sie ihn lange genug entlanglief, konnte sie beinahe vergessen, dass sie sich auf einer Station befand.
Jenn öffnete die Luke zu ihrem Wohnhabitat und rief während des Eintretens:
»LUNA«
Eine wohlklingende Frauenstimme drang aus den Lautsprechern in der Decke. »Hallo, Jenn! Über was wollen wir heute sprechen?«
»Was ist Penicillin?«
Jenn unterhielt sich, ohne einen bestimmten Punkt im Raum zu fixieren. Sie war es gewohnt, mit einer KI zu reden, die überall und nirgends war. Im Laufe der Zeit hatte sie sich angewöhnt, LUNA als Teil des Habitats zu betrachten, als sei die Kuppel ein Lebewesen. Sie mochte den Gedanken, von einem lebendigen Wesen umgeben zu sein.
»Die Penicilline«, begann die Frauenstimme, »sind eine Gruppe von antibiotisch wirksamen Substanzen, die sich strukturell von der 6-Aminopenicillansäure ableiten. Neben …«
»Stopp, LUNA. Reduziere die Komplexität. Erkläre es einfacher.«
»Wie du wünscht, Jenn. Penicillin ist ein Arzneimittel, das aus Kulturen des Pinselschimmelpilzes Penicillium chrysogenum gewonnen wird. Es gehört zu den Antibiotika. Darunter versteht man Wirkstoffe, die vor allem gegen Bakterien wirken und deshalb gegen bakterielle Infektionen eingesetzt werden. Möchtest du noch mehr hören?«
»Danke, das reicht!«
Das hatte Goozer also gemeint. Sie hatte ihre Mutter häufiger darüber reden hören, wie dringend sie Antibiotika bräuchten. Aber es war nichts da. Nicht eine Tablette.
Jenn ging langsam im Raum umher, und betrachtete die Wände des Habitats, die noch auf der Erde gefertigt worden waren, bevor sie mit einem Lunar Lander auf die Mondoberfläche abgesetzt wurden. Ein zylindrischer Körper, der die Eingangsschleuse bildete, aus dem sich eine selbstaufblasbare Hülle entfaltete, die dann von autonomen Roboterfahrzeugen mit mehreren Schichten aus Mondstaub gesintert wurden, bis eine meterdicke feste Außenwand entstanden war. Sie kannte jedes Detail seit ihrer Kindheit, man hatte es ihr immer wieder erklärt. Vielleicht war sie selbst wie dieses Habitat, eine Mischung aus Teilen von der Erde und Teilen von Mond. Eine fremdartige, noch nie dagewesene Mischung.
»Wollen wir mit dem Unterricht von gestern fortfahren?«, fragte LUNA.
Jenn ließ sich in den Schneidersitz sinken. »Die binomischen Formeln.«
»Kannst du noch die zweite binomische Formel aufsagen?«
Nach dem Unterricht verließ Jenn das Quartier. Im Mondgarten schien niemand zu sein. Die Außenblenden stellten sich gerade auf und ließen Sonnenlicht ein, beendeten die nächtliche Dunkelphase für die Pflanzen. Dava war vermutlich schon in den Treibhäusern. Wie die meisten hier auf der Station, mit Ausnahme von Miebach und Sagan, tat sie jeden Tag dasselbe zu einer bestimmten Zeit. Dava ging jeden Morgen zuerst in den Mondgarten und sah anschließen in den Treibhäusern nach dem Rechten. Mila begab sich täglich nach dem gemeinsamen Frühstück in ihre Praxis, egal, ob da etwas zu tun war oder nicht. Goozer nahm seine Morgenmahlzeit immer im Ufo ein, bevor er sich in seine Werkstatt zurückzog, in der ihm Köhler kurz vor Mittag Gesellschaft leistete. Wenn Köhler nicht auf Außenmission war, saß er in seinem Quartier und bastelte an seinen Gebäuden aus Regolith, den er mit Klebstoff vermischte. Lasse, ihr Vater, verbrachte die meiste Zeit im Ufo. Dort kochte er, bewirtete die anderen, redete mit allen, die vorbeikamen und suchte nach immer neuen Rezepten für die ewig gleichen Grundzutaten. Kaum etwas machte ihn glücklicher, als ein neues Gericht kreieren zu können, das dann Einzug in sein persönliches Rezeptbuch fand. Clarance war jahrelang jeden Tag im Bunker gewesen und hatte einen immer größeren Bereich schräg unterhalb der Station ausgeschachtet. Eimer für Eimer hatten alle, die ihm geholfen haben, das abgebaute Gestein hinausgeschafft. Jetzt, wo die Arbeit beendet war, plante er den Durchbruch zu einem Lavatunnel in der Nähe. Seine Frau Ruth kümmerte sich um die Tiere, melkte jeden Morgen die Kühe, versorgte die Schweine und Hühner, mistete aus und war die erste Hälfte des Tages damit beschäftigt, aus der rohen Milch Käse und Butter herzustellen. Und Tamar …
Als Jenn Köhlers Quartier passierte, sah sie Tamar, die mit ausgestreckten Armen unterhalb einer Dachluke hing. Langsam zog sich die Frau mit den kurzen, schwarzen Haaren hoch, bis ihr Kopf die Höhe der Aussparung der Luke erreicht hatte und ließ sich wieder herunter. Ihre nackten Arme glänzten im Licht der LED-Beleuchtung.
»Hallo Tamar!«, rief Jenn. Sie blieb im Gang stehen und sah zu der Frau hinauf.
»Hi, Kleines«, antwortete Tamar, bevor sie sich ein weiteres Mal nach oben zog.
»Wie häufig hast du es heute schon geschafft?«
»104«, sagte Tamar.
»Nicht schlecht!«
»Auf der Erde wäre es nicht schlecht.« Tamar ließ sich nach unten sinken, bis sie komplett ausgestreckt über dem Boden hing. »Hier ist es nur der halbe Spaß.«
»Du meinst einsechstel Spaß!«
Die Sehnen an den Armen traten hervor, als Tamar sich langsam hochzog. »Gleich werden wir die ersten Tomaten ernten. Dein Vater hat sich sehr gefreut, als er sie bekam.«
»Er grübelt schon seit Wochen über die Optimierung seiner Tomatensuppe.«
»Das Highlight des Quartals!« Tamar schnaufte leise, als sie erneut unten ankam. Eine Weile blieb sie mit ausgestreckten Armen hängen. Ihre Achselhöhlen glänzten. Die Tätowierungen auf ihrer Haut sahen aus wie frisch gemalt. Jenn fiel auf, dass sie noch nie zusammen draußen gewesen waren, und fragte sich, wie es wäre, mit ihr einen Krater hinunterzuklettern. Vermutlich dürfte sie neben Köhler die geschickteste Kletterin sein.
Tamar ließ sich zum Boden hinab und schüttelte die Arme aus. »Habe ich dir schon erzählt, dass ich drei Geschwister habe?«
Jenn schüttelte den Kopf.
»Mein Bruder lebt in einem Kibbuz und kümmert sich dort um die Landwirtschaft. Meine ältere Schwester ist Kinderärztin geworden. Und unser Nesthäkchen ist an einer Tanzschule und studiert Ballett und modernen Tanz. Zumindest tat sie es noch, als ich aufbrach.«
Jenn hatte sich von LUNA Aufnahmen von Tänzern auf der Erde zeigen lassen. Auf der Station tanzte niemand.
»Und ich bin sogar einer der ersten Menschen geworden, die außerhalb der Erde siedelten«, fuhr Tamar fort. »Dafür, dass wir alle von einer Mutter und einem Vater abstammen, sind wir ziemlich unterschiedlich geworden.«
»Aber ich bin die einzige Jugendliche hier, und irgendwann werde ich ganz alleine sein.« Jenn hielt den Blick fest auf die Krümmung des Ganges gerichtet. »Ihr werdet alle nach und nach sterben und mich allein lassen. Dann gibt es nur noch mich.«
»Bis dahin kann noch viel passieren, Kleines.«
»Das ist die Zukunft, die ich für mich sehe. Meine Mutter redet immer davon, dass wir eines Tages wieder auf die Erde zurückkehren werden. Ich verstehe nicht, wie sie immer noch daran denken kann.«
»Hoffnung«, sagte Tamar. »Wir brauchen sie so dringend wie die Luft zum Atmen.«
»Du übertreibst!«
»Der Mangel an beidem ist tödlich. Das eine geht ziemlich schnell, das andere dauert länger. Aber wenn wir uns aufgeben, werden wir hier nicht überleben können.«
»Du meinst, so wie Miebach?«
»Es ist nicht leicht für uns, weißt du. Du bist aus einem anderen Holz geschnitzt, bist hier geboren. Aber wir anderen haben alle Dinge zurückgelassen, die wir vermissen.«
Eine Weile gingen sie schweigend nebeneinander her.
»Gibt es einen Gott, Tamar?«
Tamar lachte leise. »Wie kommst du denn da drauf?«
»Weil du immer in diesem Buch liest.«
»Ah!« Tamar musterte sie von der Seite. »Du hast mich noch nie danach gefragt.«
»Du machst das oft, also muss es dir wichtig sein.«
»Und jetzt möchtest du wissen, was es damit auf sich hat.«
»Mutter hat gesagt, ich soll dich nicht darauf ansprechen.«
»Das kann ich mir vorstellen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen: Darauf antwortete ich mit einem klaren Ja. Solltest du aber deine Mutter fragen, würde sie Nein sagen.« Tamar lächelte. »Wie du siehst, kommst du so nicht weiter.«
»Und wie dann?«
»Der Weg führt immer nach innen, Kleines. Wenn es einen Gott gibt, und daran glaube ich, ist er in uns. Sein Wort ist in unserem Herzen. Du musst ihn nicht dort draußen suchen.«
»Auch hier auf dem Mond?«
»Er ist da, wo wir sind.«
»Das hört sich ziemlich praktisch an.«
Tamar schmunzelte und schüttelte ihre Arme aus. Manchmal wünschte sich Jenn, dass Tamar ihre Mutter wäre. Warum konnte sie mit Mila nicht so reden wie mit ihr? Seit Jahren klammerte sich ihre Mutter so an ihre Lebenslüge, dass sie die Realität gar nicht mehr sehen konnte. Als wäre der Plan der Rückkehr in Stein gemeißelt und nur eine Frage der Zeit.
Aber die Wahrheit war, dass sie alle nichts wussten.
2
Dava betrachtete den weißen Kittel, den sie von der Erde mitgebracht hatte. An vielen Stellen hatte sie ihn im Laufe der fünfzehn Jahre geflickt. In geschwungenen Buchstaben stand ihr Name auf der linken Brusthöhe: Dr. Neumann. Ihr akademischer Grad kam ihr mittlerweile fremd vor. Er stammte aus einer anderen Zeit, als der Aufenthalt hier Teil eines klar umrissenen Experiments gewesen war, mit eindeutigen Aufgaben und einer konkreten Zeitdauer. Das alles war nun Vergangenheit. Sie hatte sich damit abgefunden, dass sie vermutlich den Rest ihres Lebens auf diesem Erdtrabanten verbringen würde. Niemand würde je ihre umfangreichen Aufzeichnungen lesen.
Sie hatte im Rahmen ihrer Möglichkeiten das Beste getan, den Anbau von Salat, Algen und einfachem Gemüse hier draußen zu perfektionieren. Ihrer aller Leben hing von den Ergebnissen ihrer Arbeit ab.
»Arbeitsbiene«, murmelte sie. »Stoische Ameise … Aber Wissenschaftlerin …?«
Sie griff nach dem Kittel und zog ihn an. Die Biologin trat an die transparente Außenhülle und sah über die zerklüftete Landschaft hinweg. Der Mondgarten, wie Dava ihn getauft hat, war nah am Rand des Shackletonkraters gebaut worden. Durch seine beschichteten Fensterflächen drang Sonnenlicht, ein künstliches Magnetfeld schütze vor der schädlichen Strahlung, die ansonsten jede Pflanze innerhalb kürzester Zeit verbrannt hätte. Im Laufe der Jahre war der Mondgarten immer weiter ausgebaut worden und glich mittlerweile einem richtigen Park, in dem sogar kleine Bäume wuchsen. Er war eine Ausnahme in der durch und durch auf praktischen Nutzen ausgelegten Habitate der Station. Hier ging es nicht um die Gewinnung von Nahrungsmitteln, wie in den unterirdischen Gewächshäusern, sondern um Balsam für die Seele. Und vielleicht, dachte Dava, wäre die Hälfte von uns ohne ihn schon durchgedreht. Jede freie Minute, die sie sich nicht um die Ernährung der Siedler kümmerte, verbrachte sie hier. Goozer und Tamar hatten sogar in wochenlanger Arbeit im Vakuum Metallrollos montiert, die die Außenseite vor kleineren Einschlägen schützen sollten.
Dava rieb sich den schmerzenden Nacken. Sie musste sich irgendeinen Wirbel verrenkt haben. Oder die Bandscheibe war hinüber. Die Sache zog bis hinunter in ihre Fingerspitzen. Dava bewegte ihren Kopf nach links und rechts und hörte ein leises Knacken. Heute beim Frühstück hatten sie wieder über Zahnprobleme gesprochen. Von all den Themen war das Zahnthema an Tagen wie diesen etwas, was ihr den Rest geben konnte. Dinge wurden nicht weniger deprimierend, wenn man darüber sprach. Aber was hatten sie schon zu bereden? Es gab nichts, was nicht bereits hunderte Male besprochen worden wäre. Dava hatte sich angewöhnt, auf der linken Seite zu kauen, damit der kaputte Zahn rechts oben länger hielt. Nicht nur ihre Knochen bauten allmählich in der geringen Gravitation ab, auch die Zähne gaben allmählich den Geist auf. Mila, die Stationsärztin, tat ihr Bestes, um die Sache in den Griff zu bekommen, doch da sie keine Ausrüstung besaßen, blieb ihr nichts anderes übrig, als die kaputten Zähne zu ziehen. Ohne Betäubung.
Die Biologin schloss die Augen. Dava fühlte die beständige Gegenwart der Stationsbewohner wie ein Tonnengewicht auf ihrer Brust. Sie kam sich vor wie ein Kiesel im Fluss, den die Strömung glatt geschliffen hatte. Was half, um nicht gänzlich den Verstand zu verlieren, war die eiserne Routine, an der sie seit Jahren festhielt. In einer Umgebung, die noch nicht mal einen Tagnachtrhythmus besaß, brauchte sie jegliche Leitplanke, die den endlosen Strom der Zeit in kleine, überschaubare Einheiten aufteilte.
Dava warf einen letzten Blick hinaus und verließ den Mondgarten. In der geringen Schwerkraft besaß ihr Gang etwas Unnatürliches. Sie stieß sich nur leicht mit den Füßen ab und hielt mit den Armen das Gleichgewicht. Die sie umgebenden Wände ließen sie manchmal vergessen, wo sie war, aber die Schwerkraft tat es nie.
Die fünf Pflanzenhabitate waren unter der Oberfläche angelegt worden, und so tauschte sie das sonnenlichtdurchflutete Gartenhabitat gegen das fürs Pflanzenwachstum optimierte Kunstlicht. Es war ihre Maulwurfexistenz, wie sie sie halb im Scherz bezeichnete. Die Stufen hinunter ging sie in Gedanken, die Hände in die Taschen ihres Kittels geschoben. Als sie in den sogenannten Bunker trat, schalteten sich die wenigen LEDs an der groben Decke ein. Wie lange hatten die Männer sich unter der Anleitung von Clarance durch das Gestein geschlagen? Es kam ihr vor, als wäre das eine Ewigkeit her.
Im Pflanzenhabitat 1 waren schon die Hummeln und Bienen bei der Arbeit. Wenn es um das Bestäuben ging, waren sie eine unersetzliche Hilfe. Sie hatten sich gut an die geringere Schwerkraft angepasst und versahen ihren Dienst mit der gleichen Emsigkeit, die sie auch auf der Erde an den Tag legten. Eine pelzige Hummel brummte dicht an ihr vorbei und setzte sich auf ihren Unterarm. Die Pollenpäckchen an ihren Hinterbeinen verrieten, dass sie schon etliche Pflanzen angeflogen hatte. Selbst ihr Kopf war mit gelblichen Pollen bedeckt. Der Hautflügler ließ sich einige Schritte von Dava tragen und flog dann wieder davon. Dava warf einen prüfenden Blick nach links und rechts, wo sich bis zur Decke reichende Regale unter Kunstlicht erstreckten. Sie hatten hier kein üppiges Angebot an Nahrungsmitteln, aber sie bekamen eine Grundlage an frischem Gemüse zu essen. Etwas, was für ihre Moral wichtiger war als saubere Wäsche oder wöchentliches Duschen. Ihr Speiseplan bestand aus Algen, Salat, verschiedene Kohlsorten, Tomaten, Gurken, Radieschen, Kohlrabi, genetisch modifizierte Sojabohnen und Zucchini. Im Habitat 1 wuchsen die Pflanzen in Erde, während sie in den anderen Pflanzenhabitaten von einer Nährstofflösung versorgt wurden. Es hatte sie viel Zeit und Anstrengung gekostet, den Humus herzustellen, und sie war noch immer stolz darauf, wenn sie das Erdreich musterte.
Dava ging den langen Korridor hinunter, um das zweite Habitat zu besichtigen, und massierte sich unbewusst ihren Nacken. Mit einer Sache hatten sie Glück im Unglück gehabt: Die Anlagen waren für die Versorgung von über 100 Leuten konstruiert worden. Dass sie nun nur 11 waren, stellte in dieser Hinsicht einen erheblichen Vorteil dar. Außerdem wuchsen die Pflanzen in der Mikrogravitation schneller und brachten rund das Doppelte des irdischen Ertrags. So konnte dreimal jährlich geerntet werden. Ein Teil der Ernte diente dabei als Saatgut für die nächste Generation. Das war der Kreislauf, der sie am Leben hielt.
Vor den Reihen von Pilzen blieb sie stehen. Sie musste so ungefähr sechs oder sieben Jahre alt gewesen sein, als ihr Opa auf einem Waldspaziergang mit seinem Stock auf einige Fliegenpilze gezeigt und gesagt hatte: »Das hier sind die heimlichen Herrscher der Welt!« Sie war verblüfft gewesen und hatte erst gedacht, dass ihr Opa sie reinlegen wollte, aber er hatte nur erwidert: »Wenn die Pilze irgendwann beschließen, dass wir Menschen nicht gut für sie sind, werden wir innerhalb von kurzer Zeit von diesem Planeten verschwinden!« Damals hatte sie angefangen, sich mit Pilzen zu beschäftigen. Ihre Doktorarbeit hatte sie über die Mykorrhizierung verfasst, um das Problem des Pflanzenanbaus auf dem Mond zu lösen. Dabei bildeten die nährstoffarmen Böden und die geringe Schwerkraft die Eckpfeiler des Problems. Mithilfe einer Pilz-Pflanzen-Symbiose wurde das Pflanzenwachstum gefördert, indem Pilzfäden die Pflanzenwurzeln mit zusätzlichem Wasser, Stickstoff, Phosphaten und Spurenelementen versorgten, während die Pilze Zugang zu Zucker und Fetten erhielten, welche die meisten Pflanzen rund um den Wurzelbereich in den Boden ausschieden. Schon auf der Erde hatte sich gezeigt, dass die Mikrogravität die Mykorrhizierung behinderte und das Pflanzenhormon Strigolacton diese wesentlich verbesserte.
»Ah, da bist du ja!«
Tamar kam den schmalen Gang hinunter. Mit ihren kurzen Haaren und dem blauen Overall wirkte sie wie ein Mann. Sie hatte von der Erde eine elektrische Haarschneidemaschine mitgebracht, die immer noch funktionierte und die sie regelmäßig nutzte. Ansonsten gab es Scheren aus dem 3-D-Drucker, mit denen sich die anderen behelfen mussten. Für die Männer bedeutete das, dass sie sich den Bart erst ab einer gewissen Länge stutzen konnten, denn Rasierklingen gab es nicht.
»Schmeckst du auch schon Lasses Tomatensuppe auf der Zunge«, rief Tamar. »Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann eine so gute Suppe machen kann.«
Dava lächelte. »Lasse ist sehr vielfältig.«
Sie gingen zu den Tomatensträuchern hinüber, die voller roter Früchte hingen. Tamar steckte sich eine kleine Tomate in den Mund. »Für diese Dinger könnte ich töten.«
»Das wird eine gute Ernte«, sagte Dava und pflückte einige Früchte. Sie besah sie sich eine Weile und legte sie in eine graue Box. »Ich hatte schon befürchtet, sie würden zu wenig Wasser bekommen.«
»Tomaten sind kleine Diven«, sagte Tamar und zupfte eine weitere vom Strauch. »Richtige Schluckspechte vor dem Herren.«
»Die Mikrodüsen funktionieren prächtig.«
Tamar hatte neue Düsen für das Bewässerungssystem gebaut, womit sie ihren Wasserverbrauch für die Tomaten um 20 Prozent verringern konnten. Ihre Eltern und Großeltern waren alte Kibuzveteranen, die in der israelischen Wüste die Technik der Tröpfchenbewässerung zur Perfektion gebracht hatten.
»Wenn du Gott um einen Gefallen bitten willst, werde selbst aktiv«, sagte Tamar. »Ich bin sicher, dass hier noch einiges geht. Gibt mir noch etwas Zeit, und ich werde die ganze Mondoberfläche urbar machen.«
Dava warf der kurzhaarigen Frau einen prüfenden Blick zu, doch Tamar verzog keine Miene. Manchmal wusste sie nicht, ob Tamar einen Scherz machte oder nicht.
»Meine Mutter hat immer Wert darauf gelegt, dass ich eine gute Köchin werde!«, meinte Tamar, ohne mit dem Pflücken innezuhalten. »Es hat nichts gebracht. Heute Nacht habe ich von ihr geträumt, und sie hat mir ein Tablett mit frischen Käse-Knisches hingehalten. Sie kamen gerade frisch aus dem Ofen und dufteten köstlich. Einige hatten eine Käsefüllung, andere enthielten Kartoffeln, Hühnerfleisch oder Kascha. Ich habe nicht gewusst, was ich damit tun soll. Wollte sie, dass ich es aß, oder sollte ich lernen, sie zu kochen?«
»Vielleicht hattest du einfach nur Hunger auf etwas anderes?«, meinte Dava. »Ab und zu träume ich auch von Nahrungsmitteln, die ich lange nicht mehr gegessen habe. Manchmal würde ich einfach nur gerne eine Tasse Kaffee trinken. Es gibt Tage, da zerbreche ich mir den Kopf darüber, wie ich etwas züchten kann, was einer Kaffeebohne auch nur nahekommt. Eine Art von Zichorienkaffee, was auch immer. Wenn wir noch Kontakt zur Erde hätten, würde ich sofort nach Kaffeesträuchern fragen.«
Tamar lachte. »Wir würden einen Weg finden, sie hier zum Wachsen zu bringen. Und wenn es nur für eine Tasse im Jahr reichen sollte. An deinem Geburtstag würde ich dann mit einer frisch aufgebrühten Tasse zu dir kommen, und es wäre der großartigste Kaffee, den du je getrunken hast!«
Jetzt musste auch Dava lachen und für einen Moment vergaß sie ihre Anspannung. Es tat einfach gut, mit Tamar zu sprechen. Und sei es nur über Kaffee und Knisches.
»Letzte Woche habe ich von Tscholent geträumt«, fuhr Tamar fort. »Das Rindfleisch war so weich, dass es schon zerfiel.«
Dava beugte sich lächelnd vor und pflückte eine weitere Tomate. Früher hätte sie nie geglaubt, dass sie einmal von Essen träumen würde, aber mittlerweile erging es ihnen allen so. Das Reden darüber war zu einer eigenen Gesprächskategorie geworden. Tatsächlich waren die Unterhaltungen über die Gerichte der Erde weniger masochistisch, als es schien. Man verpackte seine Sehnsucht in ein harmloses Gespräch und fühlte sich seltsam getröstet davon, dass es den anderen auch so ging. Vielleicht, dachte Dava, war das Reden über Essen der soziale Kitt schlechthin, ohne den sie sich schon alle an die Gurgel gegangen wären.
Als sie die Tomaten gepflückt hatten, gingen sie gemeinsam nach oben. Auf den oberen Treppenstufen legte Tamar den Kopf schief.
»Hörst du das?«, fragte sie.
Dava lauschte, konnte aber nichts Ungewöhnliches wahrnehmen.
»Dieses dumpfe Geräusch, als würde regelmäßig etwas Umfallen«, meinte Tamar.
»Jetzt höre ich es auch!«
Sie traten in den schmalen Gang der Station. Ein dürrer Mann hockte auf dem Boden, den Rücken gegen die Wand gelehnt. Sein rechter Fuß war bloß. Die beiden Frauen sahen sich kurz an. Der Mann warf seinen Schuh ein weiteres Mal an die gegenüberliegende Wand. Mit einem dumpfen Aufprall schlug der Schuh gegen die glatte, weiße Fläche und fiel dann zu Boden. Ruhig und gleichmäßig zog der Mann den Schuh an dem langen Schnürsenkel wieder zurück.
Dava trat langsam näher. »Hallo, Miebach!«
Sein frettchenhaftes Gesicht mit den dunklen Augen blieb ausdruckslos. Er hob den Schuh in die Höhe und warf ihn erneut. Das Ende des Schnürsenkels behielt er dabei in der Hand, als würde er einen Angelhaken auswerfen.
Dava ging neben Miebach in die Hocke. »Die Tomaten sind erntereif«, sagte sie. »Lasse wird uns heute daraus etwas Prächtiges zubereiten.«
Miebach zog seinen Schuh wieder zurück und hob ihn auf. Der Informatiker und Funker der Station wirkte dabei äußerst konzentriert. Rational, ging es Dava durch den Kopf. Der Weg, den der Schuh in dem schmalen Gang zurücklegte, war nicht weit. Miebach warf den Schuh ein weiteres Mal.
»Jetzt sag bloß nicht, du magst keine Tomaten«, bemerkte Tamar. »Für jemanden, der sich früher ausschließlich von Pizza ernährt hat, muss das doch die heißeste Neuigkeit des Jahres sein.«
Miebach zog langsam und gleichmäßig den Schuh an dem Schnürsenkel zurück und betrachtete ihn aufmerksam. »Weißt du, was witzig ist?«, fragte Miebach, ohne den Schuh aus den Augen zu lassen. »In Russland gab es eine Verhörmethode, bei der man sich vor dem Gefangenen den Schuh auszog und ihm mit der Sohle einen Schlag ins Gesicht gab.« Miebach holte aus und warf erneut. »Danach zog man sich den Schuh wieder an. Es war eine Methode, die Psyche des Gefangenen zu treffen. Schau, du bist es nicht einmal wert, dass man dich mit der Faust schlägt.«
»Auch das haben wir hinter uns gelassen!«, sagte Dava. Sobald sie den Satz ausgesprochen hatte, bemerkte sie, wie hohl er war. Und doch musste sie etwas sagen, um sich diesem Ganzen entgegenzustemmen. »Ich begleite dich in dein Quartier, Miebach!«
Der dürre Mann erhob sich. Er reichte Dava nur bis zur Schulter. Ohne weiteres Aufheben trat er durch die Luke in seinen Raum. Das Quartier war spartanisch eingerichtet, als hätte er es gerade erst bezogen. Es gab keinen persönlichen Gegenstand, kein Foto an der Wand oder ein individuelles, aus dem 3-D-Drucker gefertigtes Möbelstück. Nur ein Computerterminal auf dem Tisch, vor dem er die meiste Zeit verbrachte. Miebach ging leicht hinkend geradewegs zum Bett und ließ sich hineinfallen.
»Brauchst du noch was?«, fragte Dava.
Miebach rührte sich nicht.
»Ich erwarte dich zum Essen«, sagte Tamar. »Glaub nicht, dass wir dir was übrig lassen, falls du nicht kommen solltest.«
Tamar verließ den Raum. Dava schüttelte traurig den Kopf und wandte sich ab.
»Es ist wie bei uns, Dava!«, hörte sie Miebach hinter sich sagen. »Man gönnt uns nur die Sohle, nicht die Faust.«
3
Jenn betrachtete den Teller, der das typische dunkle Grau der Gegenstände aus dem 3-D-Drucker besaß. Farblich zog sich eine Trennung durch die ganze Station. Alles, was sie von der Erde mitgebracht hatten, war Weiß oder Silber: die Türen, Wände, Decken und Böden. Alles Graue stammte von ihrer Zeit nach der Ankunft. Möbel, Werkzeuge, Besteck. Sie konnten vieles herstellen, aber nur mit dieser einen Farbe. Die Farbe der Mondoberfläche. Des Regoliths. Die Farbe unserer Beschränktheit hatte es Sagan genannt. Sie konnte ihn nicht ausstehen.
Die einzigen anderen Farbtöne entsprangen Davas Arbeit, das Grün der Pflanzen, das Braun der Stängel oder des Erdreichs, das Rot der Tomaten. Sie stammten von der Erde, gehörten nicht hier her, waren als Samen mit dem Schiff gekommen, aber hier gewachsen. Sie bildeten die Ausnahmen, waren die andauernden Versuche, den Mond urbar zu machen, ihm das Essen abzutrotzen, was sie für ihre Existenz brauchten. Es war wie mit dem Sauerstoff. Auch er wurde künstlich erzeugt, um ihr Leben zu ermöglichen.
Jenn fuhr mit dem Finger über den Rand des grauen Bechers. Das Einzige, was der Mond ihnen mehr oder minder freiwillig gab, war Wasser. Der Abbau des Eises, das sich auf dem Grund der Krater befand, sicherte ihr Überleben. Die ersten Jahre nach ihrer Ankunft hatte Köhler, sie war noch ein Kind gewesen, die Wassereisvorkommen in allen Kratern der Umgebung kartiert. Das Wassereis würde ihnen nicht ausgehen, nicht zu ihren Lebzeiten. Wenn der Mond sie umbrachte, wären es andere Dinge. Aber die winzigen Gestalten, die auf seiner Oberfläche lebten, schienen ihn nicht zu interessieren.
»Das Geheimnis von Tomatensuppe ist Geduld!«, sagte Lasse. »Und natürlich gute Tomaten!«
Sie sah auf und blickte zu ihrem Vater hinüber, der konzentriert in dem großen Topf rührte. Er stand an der Küchenzeile ihres Quartiers, umgeben von all den Zutaten und Küchenutensilien, die er für die Zubereitung brauchte. Lasse erzählte Jenn häufig von Gerichten, die er auf der Erde zubereitet hatte. Auch hier war er täglich in der Küche und bereitete das Essen für sie zu, meistens kochte er aber im Gemeinschaftsraum für die ganze Station. Er schien ein untrügliches Gespür dafür zu haben, was gut zusammenpasste, und hatte im Laufe der Jahre gelernt, mit dem, was sie hatten, auszukommen.
»Und dazu natürlich ein guter Rotwein«, meinte Lasse. »Vollmundig und nicht zu süß. Den haben wir momentan aber leider nicht da. Deswegen werden wir uns behelfen müssen, um ein wunderbares Abendessen zu kreieren.«
Jenn hatte noch nie in ihrem Leben Wein getrunken. Noch nie eine Weintraube gegessen. Sie wusste, dass ihr Vater aus einer Gegend der Erde stammte, wo die Rebstöcke an den Hängen eines Flusses wuchsen, die die Hitze des Tages einfingen. Es gab helle und dunkle Trauben, die zu Wein wurden. Lasse erzählte gerne davon und sie hörte ihm zu, weil es ihm Freude bereitete. Sein freundliches Gesicht mit der Halbglatze strahlte dann immer vor Seligkeit.
Die ruhigen, gleichmäßigen Handlungen der Küchenarbeit lullten sie sanft ein, und selbst wenn sie längere Zeit kein Wort miteinander sprachen, war die Stille niemals unangenehm. So konnte sie ihren Gedanken nachhängen oder ihm einfach nur schläfrig dabei zugucken, wie er eines seiner Gerichtete zubereitete. Er schien dieser Beschäftigung nie müde zu werden.
»Du hättest dortbleiben sollen«, murmelte Jenn.
»Auf der Erde?« Lasse schöpfte mit einem Löffel etwas von der Suppe ab und blies darauf. »Ich bin nur deiner Mutter zuliebe auf die große Reise gegangen.«
Jenn hob den Kopf. »Das wusste ich noch gar nicht.«
Lasse probierte vorsichtig seine Suppe, wobei sich seine hohe Stirn in Falten legte. »Ich habe mir das auch alles ganz anders vorgestellt. Eine richtige Kolonie sollte hier entstehen. Später wären unsere Familien nachgekommen, anschließend sollten Freiwillige folgen. Es gab sogar schon Werbung dafür: Pioniere gesucht. Bauen Sie sich eine Zukunft auf dem Mond auf. Der Transport sollte kostenlos erfolgen. In den ersten Jahren hätte man 28 Siedler pro Jahr ins All geschossen, später sogar 140. Was wurde nicht groß gedacht … Ein dauerhafter Außenposten der Menschheit. Der Aufbruch ins All. Das Problem der Überbevölkerung sollte durch die Mondbesiedlung gelöst werden. Die Firmen wollten die Rohstoffe, die Wissenschaftler neue Erkenntnisse und Möglichkeiten, die Menschen eine Zukunft. Aber für viele von uns war es nur ein vorübergehender Job. Spannend genug und mit einmaligen Möglichkeiten. Gut bezahlt und mit viel Prestige behaftet. Wir alle wussten, dass dies nicht ungefährlich werden würde. Aber niemand von uns hat damit gerechnet, dass man uns einfach hier im Stich lassen würde. Als hätte man den Plan der Kolonisation von einem Moment auf den anderen einfach abgeblasen.«
»Mochte Mama die Erde nicht mehr?«
»Oh doch! Aber sie reizte die berufliche Herausforderung. Sie hatte genug davon, in einem Krankenhaus zu arbeiten, und wollte auch nicht in einer Praxis in einer Kleinstadt versauern. Also hat sie sich für die Mondmission beworben, um nach zwei, drei Jahren wieder zurückzukehren. Das hätte sich gut in ihrem Lebenslauf gemacht und die gesammelte Erfahrung wäre unschätzbar gewesen. Weißt du, sie ist der pragmatischste Mensch, den ich kenne, und hatte alles genau geplant ...« Lasse goss etwas flüssige Sahne in die Suppe. »Aber das Ganze hat auch eine positive Seite.«
Jenn zog die Stirn in Falten.
»Wir sind Eltern einer fantastischen Tochter geworden.«
Jenn musterte ihren Vater, konnte aber keine Anzeichen dafür entdecken, dass er sie gerade auf den Arm nahm. »Auf der Erde hättet ihr auch ein Kind haben können.«
»Aber das wäre nicht unser wunderbares Mondmädchen gewesen.«
Wie könnt ihr mich lieben, dachte Jenn, und den Mond hassen? Das eine gehörte untrennbar mit dem anderen zusammen. Wenn man sie vom Mond wegschaffte, war sie nicht mehr Jenn, sondern würde eine andere Person werden. Wie konnte ihr Vater also so etwas sagen? Aus einem Mondmädchen konnte nie ein Erdmädchen werden.
Jenn schluckte ihren Ärger herunter und dachte über die Worte Lasses nach. Sie kannte die Erzählung der Besiedlung schon in den unterschiedlichsten Versionen, jeder hatte seine eigene Variante. Und alle stellten sich dieselben Fragen. Auch ihr Vater schien sich beständig mit der Frage nach dem Warum zu beschäftigen. Als ob das irgendetwas ändern würde. Und jetzt erfuhr sie, dass er nur wegen ihrer Mutter hier hergekommen war. Konnte man da nicht auch von ihr verlangen, dass sie aus Liebe zu ihren Eltern zur Erde zurückkehrte, wenn sich die Möglichkeit bot?
Jemand klopfte ans Außenschott und schob die angelehnte Tür auf.
»Bist du bereit?«
Ruth steckte ihr rundes Gesicht durchs Schott und sah sie erwartungsvoll an.
Jenn warf ihrem Vater einen Blick zu.
»Geh ruhig«, sagte er mit einem Lächeln. »Ich komme hier allein klar.«
Auf einem Bauernhof aufgewachsen war Ruth es gewohnt, sich um die Tiere zu kümmern. Die kräftige Frau trug bereits das Behältnis für die Eier und einen Milchkanister. Ihr dickes, hellblondes Haar steckte wie immer unter einem Tuch. Heute war es das ausgewaschene Grüne.
»Die Hühner legen momentan gut«, sagte Ruth und drückte ihr den Eierkorb in die Hand.
»Wie viele Eier hattest du gestern?«, fragte Jenn.
»Elf. Nessie hatte ihres mal wieder besonders gut versteckt.«
»Hinter dem Verschlag?«
»Ja. Sie scheint es schon aus Trotz nicht wie die anderen machen zu wollen.«
»Hast du das mit Miebach gehört?«, fragte Jenn.
»Mit dem Schuh?«
»Ja. Ich mache mir langsam Sorgen.«
»Ach was!«, sagte Ruth. »Das wird schon wieder. Der ist robuster, als er aussieht.«
»Ich weiß nicht. Miebach sieht schlecht aus.«
»Wir alle kriegen mal den Koller hier drin. Mach dir da keine zu großen Gedanken drum.«
Und wenn er was Dummes anstellt?, dachte Jenn. Sie teilte Ruths Sorglosigkeit nicht, spürte aber auch, dass die Frau an ihrer Seite nicht gerne darüber sprechen wollte. Es war eines von solchen Themen, die man auf der Station am liebsten mied.
»Er schläft wohl noch«, meinte Ruth, als sie an Miebachs Quartier vorbeikamen, dessen Schott geschlossen war.
Direkt neben Miebachs Unterkunft befanden sich die drei Lagerräume, dahinter lag das Habitat für die Hühner, gefolgt von dem Raum für die Schweine und dem für die Kühe. Das Schweinedreieck, pflegte ihr Vater zu sagen.
Jenn ging zu den Hühnern, während Ruth sich zu den Kühen begab. Da niemand auf der Station so gut melken konnte wie sie, musste man sich keine Gedanken über die Aufgabenverteilung machen.
Jenn öffnete das Schott zum Hühnerstall und trat ein. Von der Größe und der Form her entsprach er den üblichen Habitaten, nur war der Raum bis auf ein Hühnerhaus leer und der Boden mit Sand bedeckt. Die Hühner liebten es, darin zu scharren und in den Kuhlen ein Sandbad zu nehmen. Der Sand stammte tatsächlich noch von der Erde, was nicht einer gewissen Ironie entbehrte, wenn man bedachte, dass der ganze Mond voller Regolith war. Aber Regolith machte nicht nur die Menschen krank, sondern auch die Tiere.
Als die Hennen Jenn sahen, liefen sie gackernd auf sie zu. Die Hähne hingegen stolzierten in sicherer Entfernung und beäugten sie. Das Mädchen legte die Schale für die Eier ab, schnappte sich eine kleine Schaufel und entnahm mit ihr Futter aus einem Bottich. Jenn streute großflächig die Körner aus, während um sie Hektik ausbrach, als die Hähne angerannt kamen. Die Tiere hatten noch nie die Erde gesehen und sich gut an die Bedingungen hier oben angepasst. Solange sie ihr Futter bekamen und man sie in Ruhe ließ, schienen sie zufrieden zu sein.
Jenn kletterte in den niedrigen Verschlag. Geduldig sammelte sie die Eier ein und legte sie in die Schale. »Vierzehn!«, sagte sie. Das war nicht schlecht.
Auf dem Rückweg sah sie noch bei Ruth rein, die mit dem Melken beschäftigt war. Auf einem kleinen Kistchen gehockt saß sie neben einer Kuh und ließ mit rhythmischen Bewegungen ihrer Finger Milch in den Eimer fließen.
»Bist du schon fertig?«, fragte Ruth.
Jenn hob die Schale. »Vierzehn Eier!«
»Hab ich dir doch gesagt. Die Ladys sind fleißig.«
Behutsam trug Jenn die wertvolle Fracht zu ihrem Vater.
4
Dava schlug die Augen auf. Sie folgte mit ihrem Blick dem Lauf der kuppelförmigen Decke über ihrem Kopf. Durch die drei Luken fiel etwas Licht, sodass sie die Umrisse erkennen konnte. Sie hatte geträumt, konnte sich aber an nichts erinnern. Auf der Bettkante blieb sie sitzen und starrte auf den Boden vor ihren bloßen Zehen. Dava lauschte eine Weile in die Stille. Nicht das geringste Geräusch war zu hören, als wäre das Vakuum durch die Wände gesickert.
Es war noch nicht lange her, da war sie nicht alleine gewesen. Alles hatte einen Sinn gehabt, die natürlich Ordnung der Dinge. Man fand einen anderen Menschen, verliebte sich, bekam ein Kind, wurde langsam älter, während man gemeinsam etwas aufbaute.
Andrej, dachte sie. Ein Lächeln, ein Blick. Die Wärme seiner Arme. Sein brillanter Verstand und seine Kreativität. Im einen Moment konnte er ernst sein, und im nächsten von kindlicher Albernheit. Wie gut hatte ihr das getan. Nachdem sie ihn kennengelernt hatte, hatte sie nie wieder zurückgeschaut. Sie hatte nichts vermisst.
Hustend stand Dava auf und griff nach dem blauen Overall, der über der Stuhllehne hing. Sie schlüpfte hinein und zog die beiden Reißverschlüsse zu. Der Rechte ging nur noch mit Mühe zu, würde es wohl nicht mehr lange machen. Eine Weile blieb sie mit gesenktem Kopf stehen und überlegte, von wem sie einen Ersatzreißverschluss bekommen könnte. Als ihr niemand einfiel, bückte sie sich seufzend nach ihren Schuhen und zog sie über die bloßen Füße. Sie suchte einen halbwegs intakten Stoffstreifen, um sich die Haare zu einem losen Zopf zu binden. Sie waren fettig und konnten mal wieder eine Wäsche gebrauchen.
»Morgen«, murmelte sie.
Dava öffnete das Schott und stieg nach draußen. Als sie durch die Luke trat, fuhr ein Stich durch ihren Nacken. Auf den Weg den Außenring hinunter massierte sie die schmerzende Stelle. Es war immer samstags gewesen, wenn ihre Mutter in den Garten gegangen war, um sich um ihre Pflanzen zu kümmern. Dava hatte noch den Geruch von Gartenerde in der Nase, den Duft nach Torf, der stundenlang an ihren Händen hielt. Diese unscheinbare Erde hatte für sie das größte Geheimnis dargestellt, ein Mikrokosmos vor ihren Augen, der die Heimat von unzähligen Lebewesen bildete. Beim Anlegen des Mondgartens wollte Dava Pflanzen haben, die in der Erde wuchsen. Keine Hydrokultur, bei der die Wurzeln in einer Nährstoffflüssigkeit hingen. Das war zwar praktischer, hätte die menschliche Psyche aber nicht zufriedengestellt. Alles wäre eine Täuschung, eine Attrappe gewesen. Grünzeug, sagte Clarance immer, aber auch er verbrachte seine Zeit gerne inmitten der Pflanzen. Der Mensch war einfach nicht für das höhlenmäßige Leben in den Habitaten geschaffen, selbst ein Bergmann wie Clarance nicht. Der Mondgarten bot ihnen die Chance, ihre merkwürdige Existenz für eine Weile zu vergessen.
Als Dava das Gartenhabitat betrat, griff sie wie üblich zum Kittel und schlüpfte hinein. Langsam, die Hände in den Taschen, schlenderte sie den gewundenen Weg entlang. Die Rollos ließen Sonnenlicht in langen Bahnen durch die durchsichtige Außenhülle des Mondgartens fallen. Routinemäßig prüfte sie die Pflanzen, sog den Geruch der Feuchtigkeit ein, der in der Luft lag. Außer ihr war niemand hier. Die Illusion der Abgeschiedenheit, dachte Dava. Da sind wir schon so wenige Menschen auf diesem Gesteinsbrocken und doch verlangt es uns nach Alleinsein genauso sehr wie nach Gesellschaft.
Auf dem Land aufgewachsen, hatte sie erst das Studium in die Großstadt geführt. Wo sie sonst allerhöchsten von einem Nachtkäuzchen oder den Hähnen im Morgengrauen geweckt worden war, wurde sie in ihrem Zimmer im Studentenwohnheim von zurückkehrenden Nachbarn aus dem Schlaf gerissen, die alkoholisiert und übermütig von ihren nächtlichen Runden durch die Clubs nach Hause kamen. Sie hingegen hatte schon um 8 Uhr in der Bibliothek gesessen. Nicht, weil sie so strebsam gewesen wäre, sondern weil es ihr dabei half, mit dem neuen Leben in der Stadt zurechtzukommen. Indem sie sich in die Bücher versenkte, schaffte sie es, all die verwirrenden Möglichkeiten um sich herum auszublenden. Deswegen gehörte sie bald zu den besten Studierenden. Dabei war sie weder besonders fleißig noch zielstrebig gewesen, sie traute sich nur nicht, sich manchen Dingen zu stellen. Das Leben war leichter für sie, wenn sie sich mit wenigen Sachen beschäftigte und der Routine die Zügel überließ. War das der Grund, warum sie sich für die Mission zum Mond gemeldet hatte? Der ultimative Rückzug vor den scheinbar unendlichen Möglichkeiten des Lebens, ein überschaubares Dasein ganz im Dienste der Wissenschaft? Ihr Doktorvater hatte sie für die Mission empfohlen und sie war dem Weg gefolgt, ohne viel darüber nachzudenken. Es war ihr immer leichter gefallen, den Erwartungen anderer Menschen zu entsprechen, als sich mit ihren eigenen Wünschen auseinanderzusetzen. Aber wenn sie nicht zum Mond geflogen wäre, hätte sie nie Andrej kennengelernt, der als Kraftwerksingenieur das erste Team begleitet hatte. Sie waren im Mondgarten von Tamar getraut worden, dabei war Tamar weder eine Geistliche gewesen, noch hatten sie sich für eine bestimmte Konfession entschieden. So war es dazu gekommen, dass eine jüdische Frau einen russisch-orthodoxen Mann mit einer protestantischen Frau verheiratete. Nach elf Ehejahren war Andrej an Krebs gestorben und hatte sie allein mit ihrer Trauer und in der zehnten Schwangerschaftswoche zurückgelassen.
Dava beugte sich zu einem Farn hinunter, dessen Blattspitzen braun geworden waren. »Was ist los mit dir?«, murmelte sie. Die Farne waren immer noch ihr Sorgenkind, auch wenn sie mittlerweile ganz anständig gediehen. Im letzten Jahr hatte sie zwei von ihnen verloren.
Dava blickte nachdenklich auf die gezackten Blätter. Ob die Luftfeuchtigkeit zu gering war? Sie erhob sich und streckte den Rücken. Ihren Nacken massierend ging sie zu der gläsernen Außenhülle und blickte auf die graue Kraterlandschaft hinaus. Sie hatte schon Tausendemale hier gestanden und die Ruhe genossen, allein mit ihren Gedanken und Erinnerungen. Die schräg stehende Sonne warf ein scharfes Licht über die Mondoberfläche, das lange, harte Schatten erzeugte. Vierzehn Tage Helligkeit, vierzehn Tage Dunkelheit, der ewige Rhythmus des Südpols. Aber manche Bereiche blieben immer im Licht. Sie blickte zu den Sonnenkollektoren, die sich Reihe für Reihe der Sonne zuwandten. Für die Mission war der Bau eines Atomreaktors geplant gewesen, der sie mit Energie versorgen sollte, wenn die Siedlung gewachsen war. Andrej hätte den Bau übernehmen sollen, doch dazu war es nie gekommen.