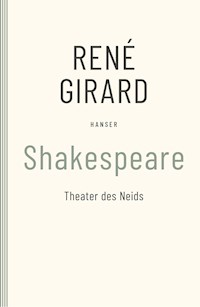
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine epochale Studie über William Shakespeare: Alle menschliche Kultur entwickle sich aus dem Bedürfnis der Nachahmung, besagt René Girards mimetische Theorie. Philosophie, Literaturwissenschaft und Religionswissenschaft haben die Theorie aufgegriffen, und Girard selbst wendet sie nun auf ein zentrales Werk der Weltliteratur an. Er zeigt, wie Shakespeares Helden dem elementaren Bedürfnis der Nachahmung folgen und damit bis heute faszinieren. Sein Buch beleuchtet daher nicht nur Shakespeare und sein Theater, sondern auch die Literatur und ihre Rolle in unserem Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 774
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
René Girard
Shakespeare
Theater des Neides
Aus dem Englischen übersetzt von Wiebke Meier
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Einleitung
Kapitel 1
Des Lobs freut sich die Liebe
Valentine und Proteus in Die beiden Veroneser
Kapitel 2
Der Neid auf solch ein köstlich Gut
Collatine und Tarquinius in Die Schändung der Lukretia
Kapitel 3
Der Lauf wahrer Liebe
Die vier Liebenden in Ein Mittsommernachtstraum
Kapitel 4
O lehrt mich, wie Ihr blickt
Helena und Hermia in Ein Mittsommernachtstraum
Kapitel 5
Ihrer aller Geist umgestaltet
Die Genese des Mythos in Ein Mittsommernachtstraum
Kapitel 6
Mehr als Bilder der Phantasie
Die Handwerker in Ein Mittsommernachtstraum
Kapitel 7
Ein Ganzes voll Bestand
Theseus und Hippolyta in Ein Mittsommernachtstraum
Kapitel 8
Liebe mit fremden Augen
Mimetische Wortspiele in Ein Mittsommernachtstraum
Kapitel 9
Liebe durch Hörensagen
Mimetische Strategien in Viel Lärm um nichts
Kapitel 10
Liebe du ihn, weil ich es tue
Die Pastorale in Wie es euch gefällt
Kapitel 11
Der Spiegel nicht, Ihr seid es, der ihr schmeichelt
Selbstliebe in Wie es euch gefällt
Kapitel 12
O welch ein Maß von Hohn sieht schön aus
Selbstliebe in Die zwölfte Nacht
Kapitel 13
Es ist mir nun so süß nicht wie vorher
Orsino und Olivia in Die zwölfte Nacht
Kapitel 14
Ein trauernd Mädchen bei den lust’gen Griechen
Die Liebesaffäre in Troilus und Cressida
Kapitel 15
Lüsternheit und Krieg
Die Subversion des mittelalterlichen Dramas Troilus und Cressida
Kapitel 16
Die Blicke jener Männer
Machtspiele in Troilus und Cressida
Kapitel 17
O Pandarus!
Troilus und Cressida und der universale Mittelsmann
Kapitel 18
Bleiches und blutloses Nacheifern
Die Stufungskrise in Troilus und Cressida
Kapitel 19
Der Vater sollte wie ein Gott Euch sein
Die Stufungskrise in Ein Mittsommernachtstraum
Kapitel 20
Verderbliches Gegenteil
Die Stufungskrise in Timon von Athen und anderen Dramen
Kapitel 21
O Verschwörung!
Mimetische Verführung in Julius Caesar
Kapitel 22
Innre Wut und wilder Bürgerzwist
Polarisierende Gewalt in Julius Caesar
Kapitel 23
Das große Rom soll saugen belebend Blut
Der Gründungsmord in Julius Caesar
Kapitel 24
Laßt Opferer uns sein, nicht Schlächter, Caius
Das Opfer in Julius Caesar
Kapitel 25
Zerlegen laßt uns ihn, ein Mahl für Götter
Opferzyklen in Julius Caesar
Kapitel 26
Ein allgemeiner Wolf und eine allgemeine Beute
Der Gründungsmord in Troilus und Cressida
Kapitel 27
Süßer Puck!
Der Entschluß zum Opfer in Ein Mittsommernachtstraum
Kapitel 28
Um die Weisesten zu fangen
Die Ambivalenz des Opfers in Der Kaufmann von Venedig und Richard III.
Kapitel 29
Glaubst du an deine eigene Theorie?
»Französische Dreiecke« in James Joyce’ Shakespeare
Kapitel 30
Hamlets langweilige Rache
Vergeltung in Hamlet
Kapitel 31
Soll man die heil’gen Tempel niederreißen?
Begehren und Tod in Othello und anderen Dramen
Kapitel 32
Du liebst sie, weil du weißt, daß sie mich liebt
Rhetorische Figuren in den Sonetten
Kapitel 33
Ein Werkzeug, Euch anzuketten
Das Wintermärchen (Akt I, Szene 2)
Kapitel 34
Du koaktive Kunst!
Eifersucht in Das Wintermärchen
Kapitel 35
Weder Bosheit noch Veranlassung
Die Erbsünde in Das Wintermärchen
Kapitel 36
Und Eurem Schatten will ich liebend huldigen
Das Wintermärchen (Akt V, Szenen 1 und 2)
Kapitel 37
Wirft nicht der Stein mir vor, ich sei mehr Stein als er?
Das Wintermärchen (Akt V, Szene 3)
Kapitel 38
Sie nehmen Eingebung an, wie die Katze Milch schleckt
Selbstsatire in Der Sturm
Register
Einleitung
Angesichts Tausender von Büchern über Shakespeare in den Regalen unserer Bibliotheken sollte jeder, der sich daran macht, ein neues zu schreiben, mit einer umfangreichen Rechtfertigung beginnen. Meine Entschuldigung ist die ganz gewöhnliche: eine unbezähmbare Liebe zum Gegenstand. Allerdings wäre es unaufrichtig, wenn ich behauptete, daß diese Liebe so grund- und körperlos ist, wie Immanuel Kant in seinen Schriften zur Ästhetik empfiehlt.
Meine Arbeit über Shakespeare ist mit allem, was ich geschrieben habe, angefangen bei einem Aufsatz über fünf europäische Romanciers, aufs engste verknüpft. In diese fünf war ich so gleichmäßig und unparteiisch vernarrt, daß ich in seliger Unkenntnis der literarischen Mode, die von den Literaturkritikern herrisch verlangt, bei den von ihnen ausgewählten Autoren nach dem zu suchen, was sie absolut »singulär«, »einzigartig«, »unerreichbar« und »unvergleichlich« macht – mit anderen Worten: was sie von allen anderen Autoren unterscheidet –, auf die Möglichkeit spekulierte, meine fünf Romanautoren könnten etwas gemeinsam haben. Sicher ein schockierender Gedanke, doch der Einsatz zahlte sich – zumindest in meinen Augen – aus; ich entdeckte etwas und bezeichnete es als »mimetisches Begehren«.
Wenn wir an Phänomene denken, in denen Nachahmung eine Rolle spielen könnte, nennen wir Dinge wie Kleidung, Gewohnheiten, Gesichtsausdruck, Sprache, Theaterspielen, künstlerische Schöpfungen usw., doch an das Begehren denken wir meistens nicht. Folglich sehen wir die Nachahmung im gesellschaftlichen Leben als eine Kraft an, die unser Zusammenleben bestimmt und eine milde Konformität herstellt, indem einige wenige gesellschaftliche Vorbilder massenhaft reproduziert werden.
Wenn Nachahmung auch im Begehren eine Rolle spielt, wenn sie auch unseren Erwerbs- und Besitztrieb vergiftet, dann verfehlt die konventionelle Auffassung, selbst wenn sie nicht ganz falsch ist, den wichtigsten Punkt. Nachahmung führt die Menschen nicht bloß zusammen, sondern treibt sie ebenso voneinander fort. Paradoxerweise kann sie beides gleichzeitig bewirken. Individuen, die dasselbe begehren, werden durch etwas so Mächtiges geeint, daß sie die besten Freunde sind, solange sie dieses Begehren teilen können; sobald ihnen das nicht mehr möglich ist, werden sie zu den erbittertsten Feinden.
Für Shakespeare ist die ungebrochene Kontinuität zwischen Einigkeit und Uneinigkeit genauso entscheidend wie für die tragischen Dichter Griechenlands, und auch für ihn war sie eine reiche Quelle poetischer Paradoxe. Diese wichtige Quelle menschlicher Konflikte – die mimetische Rivalität – müssen Dramatiker wie Romanciers entdecken, wenn ihr Werk die Flüchtigkeit des Modischen überdauern soll, und sie müssen sie ganz auf sich gestellt entdecken, ohne die Hilfe von Philosophen, Moraltheoretikern, Historikern oder Psychologen, die sich zu dem Gegenstand beharrlich ausschweigen.
Shakespeare entdeckte diese Wahrheit so früh, daß sich seine erste Annäherung ausgesprochen unreif, ja fast wie eine Karikatur ausnimmt. In seinem noch sehr jugendlichen Gedicht Die Schändung der Lukretia beschließt der potentielle Vergewaltiger Tarquinius, eine Frau zu vergewaltigen, der er – anders als sein Vorbild bei dem römischen Historiker Livius – nie wirklich begegnet ist; er fühlt sich allein deswegen zu ihr hingezogen, weil der Ehemann ihre Schönheit über alle Maßen rühmt. Vermutlich schrieb Shakespeare die Szene, unmittelbar nachdem er das mimetische Begehren entdeckt hatte. Er war so gepackt davon, so begierig, das dadurch konstituierte Paradox herauszustellen, daß er eine zwar nicht völlig unglaubwürdige, aber doch ziemlich beunruhigende Ungeheuerlichkeit schuf, eine völlig »blinde Vergewaltigung«, in dem Sinn, wie wir von einer »blinden Verabredung« sprechen.
Moderne Kritiker haben eine heftige Abneigung gegen das Gedicht. Was Shakespeare betrifft, so erkannte er sehr schnell (was ich selbst wohl nie gelernt habe), daß es kein sicherer Weg zum Erfolg ist, wenn man vor der Öffentlichkeit mit der roten Flagge des mimetischen Begehrens winkt. Sehr rasch wurde Shakespeares Umgang mit dem Begehren raffiniert, listig und komplex, doch er blieb konsequent, ja obsessiv mimetisch.
Shakespeare kann im Hinblick auf das mimetische Begehren so explizit sein wie unsereiner und verfügt über ein eigenes, dem unseren hinreichend nah verwandtes Vokabular, so daß man sofort weiß, was gemeint ist. Er spricht von »suggeriertem Begehren«, »Suggestion«, »eifersüchtigem Begehren«, »nacheiferndem Begehren« usw. Aber das wesentliche Wort ist »Neid«, für sich genommen oder in Verbindungen wie »neidisches Begehren« oder »neidisches Nacheifern«.
Wie das mimetische Begehren ordnet der Neid das begehrte Etwas einem Jemand unter, der sich einer privilegierten Beziehung dazu erfreut. Der Neid trachtet nach dem höheren Sein, das weder der Jemand noch das Etwas allein, sondern nur die Verbindung beider zu besitzen scheint. Unfreiwillig bezeugt der Neid einen Mangel an Sein, der den Neidischen beschämt, besonders seitdem der Stolz in der Renaissance metaphysisch überhöht wurde. Darum ist Neid die schwerste Sünde, zu der man sich bekennen kann.
Wir brüsten uns häufig damit, daß uns kein Wort mehr schockieren könne, wie aber steht es mit »Neid«? Unsere angeblich unersättliche Lust auf Verbotenes macht kurz vor dem Neid halt. Primitive Kulturen fürchten und unterdrücken den Neid so sehr, daß sie nicht einmal ein Wort dafür haben; wir haben ein Wort und verwenden es kaum, und dieser Umstand muß etwas zu bedeuten haben. Viele Handlungen, die Neid erzeugen, verhindern wir nicht mehr, doch alles, was an seine Gegenwart mitten unter uns erinnern könnte, wird stillschweigend geächtet. Es heißt, die Bedeutung psychischer Phänomene stehe im direkten Verhältnis zum Widerstand, den sie gegenüber ihrer Aufdeckung an den Tag legen. Wenn wir diesen Maßstab sowohl auf den Neid wie auf das Verdrängte der Psychoanalyse anwenden, wer von beiden gibt denn dann den plausibleren Kandidaten für die Rolle des am besten gehüteten Geheimnisses ab?
Wer weiß, ob die geringe Akzeptanz, die das mimetische Begehren in akademischen Zirkeln errungen hat, nicht teilweise seiner Fähigkeit zuzuschreiben ist, eher als Maske und als Substitut für das, was Shakespeare als Neid bezeichnet, zu fungieren und nicht als seine explizite Offenlegung? Um alle Mißverständnisse zu vermeiden, habe ich für den Titel meiner Untersuchung das traditionelle Wort gewählt, das provokante Wort, das strenge und unpopuläre Wort, das von Shakespeare selbst verwendete Wort – Neid.
Heißt das, es gebe keine legitime Verwendung mehr für den Begriff des mimetischen Begehrens? Das ist nicht ganz richtig. Jeder Neid ist mimetisch, aber nicht jedes mimetische Begehren ist neidisch. Neid weist auf ein einzelnes statisches Phänomen hin, nicht auf die gewaltige Matrix von Formen, zu der das Nachahmen von Konflikten in Shakespeares Händen wird.
Diejenigen, die gegenüber dem mimetischen Begehren einwenden, auf Grund seines »Reduktionismus« verarme die Literatur, verwechseln es mit einer Sammlung einschränkender Begriffe, die angeblich einen begrenzten Inhalt erzeugen. Shakespeare beantwortet den Einwand selbst, indem er für eine Figur, die das mimetische Begehren in Die beiden Veroneser buchstäblich verkörpert, den Namen des griechischen Gottes der Verwandlung, Proteus, wählt. In diesem frühen Drama gelingt es ihm noch nicht, alle Implikationen des Namens zu entfalten, aber in den komischen Meisterwerken, angefangen bei dem wunderbar leichtfüßigen Mittsommernachtstraum, tritt die »proteische« Qualität des mimetischen Begehrens offen zutage.
Das Ziel meiner Untersuchung ist, zu zeigen, daß ein Literaturkritiker Shakespeare um so gerechter wird, je »mimetischer« er im Kern ist. Sicher wird den meisten eine solche Versöhnung von praktischer und theoretischer Kritik unmöglich erscheinen. Dieses Buch will demonstrieren, daß sie sich irren. In bezug auf Shakespeare sind nicht alle Theorien gleich: Seine Schöpfung gehorcht denselben mimetischen Prinzipien, die ich auf sein Werk anwende, und sie gehorcht ihnen explizit.
Shakespeare definiert das mimetische Begehren in seinen Komödien an vielen Stellen; er bezeichnet es als »Liebe, die auf der Wahl von Freunden beruht«, »Liebe mit fremden Augen«, »Liebe durch Hörensagen«. Er hat einen eigenen, unnachahmlichen Stil, Mimesis theoretisch darzustellen: diskret, gelegentlich auch versteckt – nie vergißt er, daß die mimetische Wahrheit unpopulär ist –, aber sobald man den Schlüssel besitzt, der alle Schlösser in diesem Reich öffnet, tritt sie uns übermütig und komisch vor Augen. Der Schlüssel ist nicht das alte Gerede vom »mimetischen Realismus«, von einer angeblich separaten künstlerischen Mimesis, welcher der Stachel des Konflikts gezogen wurde. Für Shakespeare gehört auch die Kunst zur giftigen Vielfalt der Nachahmungen.
Für das, was ich tue,ist der Begriff Interpretation, so wie er gegenwärtig verwendet wird, nicht angemessen. Meine Aufgabe ist viel elementarer. Zum erstenmal lese ich einen Text so wortgetreu, wie er bisher hinsichtlich vieler Gegenstände, die für die dramatische Literatur wesentlich sind, noch nie gelesen wurde: dazu gehören Begehren, Konflikt, Gewalt und Opfer.
Die Freude am Schreiben der Untersuchung speiste sich aus den immer wieder neuen Entdeckungen im Text, die der neomimetische Ansatz erlaubt. Shakespeare ist komischer, als wir uns das klarmachen, auf eine bitter satirische, ja zynische Weise, und steht heutigen Einstellungen viel näher, als wir je vermuteten. Es ist ein Irrtum, zu glauben, daß seine Intentionen unrettbar verloren seien. Seit den Zeiten der alten Neuen Kritik haben die Interpreten die Intentionen der Dichter als unzugänglich, ja belanglos abgetan. Soweit es das Theater betrifft, ist das verheerend. Ein Lustspieldichter hat komische Effekte im Sinn, und wenn man die nicht versteht, kann man sein Werk nicht erfolgreich aufführen.
Mit Hilfe des mimetischen Ansatzes lassen sich die »Probleme« vieler sogenannter problematischer Stücke lösen. Er ermöglicht neue Interpretationen von Ein Mittsommernachtstraum, Viel Lärm um nichts, Julius Caesar, Der Kaufmann von Venedig, Die zwölfte Nacht, Troilus und Cressida, Hamlet, König Lear, Das Wintermärchen und Der Sturm. Er deckt die dramatische Einheit und thematische Kontinuität von Shakespeares Bühnenwerk auf. Er entdeckt große Veränderungen in seiner persönlichen Perspektive, eine Geschichte seines Œuvre, die Hinweise auf seine persönliche Geschichte liefert. Vor allem aber offenbart der mimetische Ansatz einen originellen Denker, der seiner Zeit um Jahrhunderte voraus war, der moderner war als irgendeiner unserer heutigen sogenannten Meisterdenker.
Shakespeare identifiziert die Kraft, die das differenzierte kulturelle System in bestimmten zeitlichen Abständen zerstört und wieder in einen Entstehungsprozeß zurückführt, als mimetische Krise, die er als eine Krise der Stufung bezeichnet. Er sieht ihre Lösung in einer kollektiven Gewalt, die jemanden zum Sündenbock macht (zum Beispiel Julius Caesar). Das Omega des einen kulturellen Zyklus ist das Alpha eines anderen. Es ist die einmütige Opferhandlung, die die sprengende Kraft der mimetischen Rivalität in die aufbauende Kraft einer opferbereiten Mimesis umwandelt, die in bestimmten zeitlichen Abständen der ursprünglichen Gewalt erneut zur Geltung verhilft, um eine Wiederholung der Krise zu verhindern.
Als strategisch denkender Dramatiker greift Shakespeare bewußt auf die Kraft des Sündenbockmechanismus zurück. Während eines Großteils seiner Karriere vereinigte er zwei Stücke in einem, indem er die unterschiedlichen Segmente seines Publikums bewußt zu zwei verschiedenen Interpretationen ein und desselben Stückes hinführte: die Leute im Parterre zu einer Erklärung auf der Grundlage des Opfers, die sich in den meisten modernen Interpretationen fortsetzt, und die Leute auf den Rängen zu einer nicht auf das Opfer bezogenen, mimetischen Erklärung.
Trotz meiner Bemühungen um kompositorische Einheit war es nicht immer möglich, die chronologische Untersuchung der Stücke mit der logischen Entfaltung des mimetischen Prozesses, der auch ein zeitlicher ist, in Einklang zu bringen. Die Verbindung beider gelang für die Komödien leidlich, aber nach der Erläuterung von Troilus und Cressida zwang mich die Notwendigkeit einer logischen Darstellung, gelegentlich zwischen Stücken verschiedener Perioden hin und her zu springen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn ich darauf hätte verzichten können.
Die Unzulänglichkeit hinsichtlich der chronologischen Ordnung ist nicht die schlimmste meiner Sünden. Nach etwa drei Viertel meiner Kapitel habe ich ein Kapitel zu James Joyce’ Ulysses eingefügt, genauer zu Stephen Dedalus’ Ausführungen über Shakespeare. Dieser Text wird meistens als irrelevant für ein Verständnis Shakespeares abgetan, doch er stellt die erste mimetische Interpretation von Shakespeares Werken dar, eine verblüffende Verdichtung vieler Ideen, die ich im vorliegenden Buch entfalte.
Joyce’ Text hat eine sehr ungewöhnliche Eigenart: Geschickt lädt er zu einer philisterhaften Fehldeutung seiner selbst ein, die in literarischen Zirkeln immer noch vorherrscht. Dieses Täuschungsmanöver fädelt Joyce geradezu diabolisch mit Hilfe einer dramatischen Ambivalenz ein, die Shakespeares Muster zu folgen scheint. Alle künftigen Leser, die Joyce seiner Schriften nicht für wert hält, werden geschickt irregeleitet und auf den Weg von Stephens feindlichen Zuhörern geschickt; am Ende »opfern« sie den Vortragenden und seinen Vortrag.
Joyce, der meine unkonventionellen Thesen stützt, ist ein so mächtiger Verbündeter, daß ich der Versuchung nicht widerstehen konnte, ihm ein eigenes Kapitel zu widmen. Doch wo sollte das plaziert werden? Um die rechte Wirkung zu erzielen, bedurften Stephens mißverstandene Donnerkeile der klärenden Tugend meiner eigenen sorgfältigen Auslegungen. Joyce mußte, eben wegen seiner Überlegenheit, auf meine eigenen Erörterungen folgen. Ich wollte ihn aber nicht als eine Art Konklusion ganz ans Ende stellen, um nicht den Eindruck zu erwecken, daß ich mit allem, was er zu Shakespeare sagt, übereinstimme. Seine schrille Frechheit ist genau das, was nötig ist, um Shakespeare aus dem Berg von humanistischen Frömmeleien und ästhetischem Brei zu retten, unter dem der »edle Barde« jahrhundertelang begraben war; doch Joyce übersieht meiner Meinung nach im Hinblick auf die letzten Stücke etwas äußerst Wichtiges. Diese führen etwas radikal Neues ein, nämlich eine humanere, ja religiöse Note, der gegenüber der sonst so scharfsinnige Joyce vollkommen blind ist.
Schließlich entschied ich mich dafür, Joyce zwischen die Diskussionen der vielen Stücke, in bezug auf die er und ich übereinstimmen, und der sehr wenigen, bei denen wir nicht übereinstimmen, einzufügen. Doch eigentlich ist eine Lösung, die meine Analyse der Stücke unterbricht, nicht zufriedenstellend.
Ein weiteres Problem war die Auswahl der Stücke und spezifischen Szenen, die meine Diskussion am besten veranschaulichen würden. Ich hatte die Qual der Wahl. Ich wählte nicht unbedingt die reichhaltigsten Texte aus, sondern diejenigen, die für meinen Zweck die eindeutigsten waren. In der Regel stellen sie die erste Dramatisierung der mimetischen Struktur dar, die sie veranschaulichen. Die Auswahlmethode erklärt, warum die Stücke, über die ich wenig oder gar nichts sage, häufig am Ende der Periode plaziert sind, in der der Autor das besondere Genre, dem sie angehören, kultivierte – zum Beispiel Maß für Maß und Ende gut, alles gut bei den Komödien, Macbeth und Antonius und Kleopatra bei den Tragödien. Das umgekehrte trifft für die Romanzen zu – es findet sich nichts zu Perikles, sehr wenig zu Cymbeline, dagegen ziemlich viel zu Das Wintermärchen und etwas zu Der Sturm.
Die Historiendramen fehlen fast vollständig. Mir ist bewußt, daß darin sehr viel mimetisches Material zu finden ist, besonders in Heinrich IV., Teil II, doch mit Rücksicht auf mein hauptsächliches Interesse sind diese Werke eher unergiebig und schneiden im Vergleich zu den meisten Komödien und Tragödien nicht sehr gut ab.
Meiner Untersuchung fehlt es zugegebenermaßen an einer gewissen Ausgewogenheit. Es werden so viele Stücke diskutiert, daß am Ende nur wenige fehlen, und deren Fehlen erscheint nicht gerechtfertigt. Diese Stücke habe ich nicht absichtlich, aus theoretischen oder ästhetischen Gründen, ausgeschlossen. Das »romantische« Romeo und Julia ist reich an mimetischer Satire, aber für ein bereits sehr angeschwollenes Buch war mein Essay zu dem Schauspiel zu lang geworden, daher entschied ich mich, ihn ganz wegzulassen.
Alle Mängel des vorliegenden Buches habe ich selbst zu verantworten. Ich hoffe, daß meine Leser in der Lage sein werden, die Spreu vom Weizen zu trennen und am Ende zumindest ein vages Bild dessen hervorzuzaubern, was eine vollkommenere Durchführung desselben Projekts hätte leisten können.
Kapitel 1
Des Lobs freut sich die Liebe
Valentine und Proteus in Die beiden Veroneser
Seit frühester Kindheit sind Valentine und Proteus aus Verona Freunde, und zur weiteren Erziehung wollen ihre Väter sie gemeinsam nach Mailand schicken. Aus Liebe zu einem Mädchen namens Julia weigert Proteus sich, Verona zu verlassen; Valentine begibt sich alleine nach Mailand.
Doch trotz Julia vermißt Proteus Valentine sehr und begibt sich nach einer gewissen Zeit ebenfalls nach Mailand. Dort treffen sich die beiden Freunde im Herzogspalast wieder, in Anwesenheit der Tochter des Herzogs, Silvia; Valentine stellt Proteus kurz vor. Nachdem sie gegangen ist, verkündet Valentine, daß er sie liebe, und seine maßlose Leidenschaft verärgert Proteus. Sobald Proteus jedoch allein ist, hat er ebenfalls etwas zu verkünden: Er liebt Julia nicht mehr und hat sich ebenfalls in Silvia verliebt:
Wie eine Glut die andre Glut vernichtet,
So wie ein Keil den anderen vertreibt,
Ganz so ist das Gedächtnis vor’ger Liebe
Vor einem neuen Bild durchaus vergessen.
(II/4, 192–195; Bd. I, S. 119)1
Das muß, wenn es sie je gab, »Liebe auf den ersten Blick« sein, denkt man, aber Proteus ist da nicht so sicher: In drei wichtigen Zeilen deutet er eine andere Erklärung an:
Ist es mein Aug, ist’s meines Freundes Lob,
Ihr echter Wert, mein falscher Unbestand,
Was Unvernunft so zum Vernünfteln treibt?
(II/4, 196–198; Bd. I, S. 119)
Die ganze Komödie bekräftigt eindrucksvoll, wie entscheidend Valentines Rolle bei der Entstehung von Proteus’ plötzlicher Leidenschaft für Silvia ist. Unserer romantischen und individualistischen Ideologie gemäß kann ein geborgtes Gefühl wie dieses nicht wirklich intensiv sein, weil es nicht echt genug ist. Bei Shakespeare trifft das nicht zu; Proteus’ Begehren ist so heftig, daß er Silvia in der Tat vergewaltigen würde, wenn Valentine sie nicht in äußerster Not rettete.
Hierbei handelt es sich um ein mimetisches oder vermitteltes Begehren. Valentine ist das Vorbild oder der Vermittler, Proteus das vermittelte Subjekt und Silvia ihr gemeinsames Objekt. Mimetisches Begehren kann mit der Schnelligkeit eines Blitzes einschlagen, es hängt nicht wirklich, sondern nur scheinbar von dem Eindruck ab, den das Objekt macht. Proteus begehrt Silvia nicht, weil ihre kurze Begegnung bei ihm einen entscheidenden Eindruck hinterlassen hat, sondern weil ihm schon im voraus alles gefällt, was Valentine begehrt, egal was es ist.
Das mimetische Begehren ist eine Idee Shakespeares. Wir können das erneut an Proteus’ Monolog erkennen, der die Rolle der Wahrnehmung bei der Entstehung seines Begehrens nach Silvia ständig verkleinert:
Schön ist sie; so auch Julia, die ich liebe –
Nein liebte …
(II/4, 199; Bd. I, S. 119)
Wenn Silvia objektiv nicht begehrenswerter als Julia ist, dann besteht ihr einziger Vorzug darin, daß Valentine sie bereits begehrt. Shakespeare vermindert damit in der Redewendung Liebe auf den ersten Blick das starke Gewicht des Blicks. Auch von den beiden Mädchen im Mittsommernachtstraum heißt es, sie seien gleichermaßen schön, und auch das stärkt die Beweise für ein mimetisches Begehren.
Den dramatischen Kontext für dieses erste und für viele weitere mimetische Begehren bei Shakespeare bildet die enge, alte Freundschaft zwischen den beiden Protagonisten. Kurz bevor Proteus in Mailand eintrifft, schildert Valentine diese Freundschaft gegenüber Silvia und ihrem Vater:
Ich kenn ihn wie mich selbst; denn seit der Kindheit
Vereint als Freunde lebten wir zusammen.
(II/4, 62–63; Bd. I, S. 115)
Wenn zwei junge Männer zusammen aufwachsen, lernen sie dieselben Lektionen, lesen dieselben Bücher, spielen dieselben Spiele und sind in bezug auf fast alles derselben Meinung. Sie neigen auch dazu, dieselben Objekte zu begehren. Die fortgesetzte Konvergenz ist nicht nebensächlich, sondern gehört zum Wesen ihrer Freundschaft; sie tritt dermaßen regelmäßig und unausweichlich auf, daß sie durch ein übernatürliches Geschick vorherbestimmt zu sein scheint; in Wirklichkeit hängt sie von einer wechselseitigen Nachahmung ab, die so spontan wie beständig ist, daß sie unbewußt bleibt.
Den Eros kann man nicht in derselben Weise teilen wie man ein Buch, eine Flasche Wein, ein Musikstück und eine schöne Landschaft teilt. Proteus verhält sich einfach weiter so, wie er es immer getan hat – er ahmt seinen Freund nach, doch dieses Mal sind die Konsequenzen radikal anders. Plötzlich, ohne vorherige Warnung, reißt dieselbe Haltung die Freundschaft auseinander, welche diese bisher immer genährt hat. Nachahmung ist also ein zweischneidiges Schwert. Einmal erzeugt sie so viel Harmonie, daß sie als sanftester und langweiligster aller menschlichen Triebe erscheint, ein anderes Mal so viel Streit, daß wir uns weigern, das als Nachahmung anzuerkennen.
Shakespeare ist von der Ambivalenz der Nachahmung fasziniert und zeigt ausführlich den verstörenden Zusammenhang zwischen einer Haltung, die die Freundschaft fördert, und einer Haltung, die sie zerstört. Als Valentine noch in Verona war, unternahm Proteus einen Versuch, ihn in seine Beziehung zu Julia einzubinden. Er wollte seinen Freund am Fortgehen hindern, und sein erster Gedanke fiel auf Julia. Da er sie anziehend fand, hatte er ganz natürlich das Gefühl, daß auch Valentine angezogen sein müßte; er rühmte ihre Schönheit genau so, wie Valentine jetzt in Mailand Silvia rühmt.
Immer wenn sie nicht übereinstimmen, haben unsere beiden Freunde das Gefühl, daß etwas nicht stimmt; jeder versucht dann, den anderen davon zu überzeugen, er solle sein Begehren so ausrichten, daß es wieder mit dem des Freundes zusammenfalle. Die fortgesetzte Koinzidenz von zwei Begehren ist Freundschaft. Doch genau dasselbe gilt auch für Neid und Eifersucht. Die Mimesis des Begehrens ist beides, tiefste Freundschaft und schlimmster Haß. Dieses durchsichtige Paradox spielt in Shakespeares gesamtem Bühnenwerk eine enorme Rolle.
Als Proteus Verona schließlich verließ, tat er das, so behauptete er, aus Gehorsam gegenüber seinem Vater, doch er hatte schon vorher seinem Vater nicht immer gehorcht. Das Beispiel eines Freundes ist überzeugender als alle Wünsche eines Vaters. Proteus, dessen Stolz verletzt ist, braucht eine Entschuldigung, die ihm sein Vater liefert. Hier wird zum erstenmal etwas veranschaulicht, was uns im Verlauf der Untersuchung immer wieder begegnen wird. Entgegen der landläufigen Meinung zählen die Väter bei Shakespeare als Väter nur sehr wenig. Sie sind nicht, wie bei Freud, an sich selbst wichtig, sondern dienen lediglich als Masken des mimetischen Begehrens.
Als Proteus in Mailand ankommt, wird er unweigerlich an Valentines Indifferenz gegenüber Julia erinnert:
Liebesgespräche waren dir zur Last;
Ich weiß, du hörst nicht gern von Liebessachen.
(II/4, 126–127; Bd. I, S. 117)
Proteus ist leicht verstimmt und doch voll widerwilliger Bewunderung für den unabhängigen Geist seines Freundes. Das ist der wahre Grund, warum er Verona schließlich verläßt. Sein Begehren nach Julia ist durch Valentines Indifferenz bereits abgeschwächt worden.
Proteus’ Reise nach Mailand ist eine verzögerte Nachahmung Valentines, seine plötzliche Leidenschaft für Silvia ist genau dasselbe. Einem Freund in erotischen Dingen die Wahl zu überlassen, ist zwar spektakulärer als ein Wechsel des Wohnorts, doch das Nachahmungsmuster ist dasselbe. Wenn wir das Gespräch, in dem Proteus’ Begehren erzeugt wird, unmittelbar nach der kurzen Begegnung mit Silvia, genauer untersuchen, erkennen wir bei beiden Phänomenen die gleichen Konturen: Nachdem Proteus eine Zeitlang versucht hat, auf eigenen Füßen zu stehen, hält er der Anstrengung nicht länger stand und erliegt ganz plötzlich Valentines Einfluß:
Proteus:
War dies der Abgott, dem du huldigest?
Valentine:
Ja; ist sie nicht ein himmlisch Heil’genbild?
Proteus:
Nein; doch sie ist ein irdisch Musterbild.
Valentine:
Nenn göttlich sie.
Proteus:
Nicht schmeicheln will ich ihr.
Valentine:
Oh, schmeichle mir; des Lobs freut sich die Liebe.
(II/4, 144–148; Bd. I, S. 118)
In einem christlichen Kontext kann es eine Beleidigung sein, jemanden als »Abgott« zu bezeichnen. Man verbindet damit eine unaufrichtige Huldigung; ein himmlisches Heiligenbild dagegen wird zu Recht und nicht zu Unrecht angebetet.
Zweimal hat Proteus Silvia schon auf die Erde herabgeholt, aber Valentine will sie immer noch im Himmel sehen:
Valentine:
Laß sie doch eine Hoheit sein, erhaben
Vor allen Kreaturen auf der Erde.
Proteus:
Nur Julia nehm ich aus.
(II/4, 152–154; Bd. I, S. 118)
Freimütig geben die letzten Worte den wahren Grund für Proteus’ Mißvergnügen an: Zuviel Lob für Silvia bedeutet eine implizite Ablehnung Julias. Proteus will einen Waffenstillstand, doch Valentine verlangt die bedingungslose Kapitulation:
Valentine:
Nimm keine aus;
Du nimmst zuviel dir gegen sie heraus.
Proteus:
Hab ich nicht Grund, die meine vorzuziehn?
Valentine:
Und ich will ihr zum höchsten Vorzug helfen:
Sie soll gewürdigt sein der hohen Ehre –
Zu tragen Silvias Schleppe; daß dem Kleid
Die harte Erde keinen Kuß entwende
Und, durch so große Gunst von Stolz gebläht,
Zu tragen weigert sommersüße Blumen
Und rauhen Winter ewig dauernd halte.
(II/4, 154–163; Bd. I, S. 118)
Während er diese Zeilen anhört, kann Proteus nicht umhin, sich die düstere Zukunft auszumalen, die ihn in Gesellschaft seiner jämmerlichen Julia erwartet. Permanent wird er im Schatten des strahlenden Paares stehen, dem demütige Verehrung gezollt werden muß. Zudem ist Silvia zufällig die Tochter des herrschenden Fürsten. Man sollte diese Tatsache zwar nicht überbewerten, doch ist sie der Erwähnung wert.
Für Silvias Lob greift Valentine vor allem auf religiöse Metaphern zurück. Die traditionelle Kritik verurteilt seine Sprache als künstlich. Sie lasse sich unterschiedslos auf alle Frauen anwenden, sagt man, und beschreibe keine im besonderen. Heutzutage ist Rhetorik wieder in Mode, aber merkwürdigerweise aus ebendem Grund, aus dem sie unseren Vorgängern mißfiel: Ihre offenkundige Verachtung für die Wahrheit schmeichelt der heutigen Selbstgefälligkeit; wir wünschen uns eine totale Trennung von Sprache und Realität und sind so davon überzeugt, sie in der Rhetorik zu finden, daß unser Nihilismus sich erneut bestätigt fühlt.
Die Trennung ist weniger total, als es den Anschein hat. Ich stimme gerne zu, daß die Bezeichnung einer Frau als »göttlich« sie nicht so beschreibt, »wie sie wirklich ist«. Religiöse Metaphern schildern die Schönheit einer Frau nicht wahrheitsgetreu, doch ist das auch nicht ihr eigentlicher Zweck. Das physische Erscheinungsbild wird, wie wir bereits gesehen haben, in einem mimetischen Kontext ohnehin bedeutungslos.
Die Debatte ist ein Wettstreit, und die Metaphern sind dem Zweck vollkommen angemessen. Sie sind aufsteigend angeordnet und deuten höhere und niedrigere Grade des Verführerischen an. In Wirklichkeit ist Julia kein »strahlender Stern« und Silvia keine »himmlische Sonne«; die rhetorische Aufgeblasenheit ist extrem, aber deswegen sind diese Bilder nicht weniger ein Bezugsmaßstab als ein Thermometer, auf dem man die Zahlen mit hundert oder mit hunderttausend multipliziert hat. Silvia könnte also, selbst wenn sie nicht »erhaben vor allen Kreaturen auf der Erde« wäre, durchaus eine begehrenswertere Partie sein als Julia. Und Valentine könnte, selbst wenn er nach der Hochzeit mit ihr nicht wirklich zu einem olympischen Gott würde, den unglücklichen Proteus und seine mediokre Geliebte immer noch weit überragen.
Valentine setzt die Sprache so geschickt ein, daß Proteus immer niedergedrückter klingt. Während der erstere immer längere Sätze bildet, äußert sich der letztere weiterhin in kurzen und düsteren Ausbrüchen. Früher, in Verona, hatte Proteus sich genauso herrlich gefühlt wie nun Valentine; die Liebe zu Julia hatte ihn reich gemacht, alle anderen arm. Jetzt ist nur Valentine reich, so reich, daß sein unerhörter Reichtum seinen Freund vergleichsweise arm macht.
Ehe er der magnetischen Anziehungskraft von Valentines Begehren erliegt, unternimmt Proteus eine letzte Anstrengung, sein eigenes unabhängiges Begehren zu retten. Aber Valentine ist unerbittlich:
Valentine:
Verzeih! mit ihr verglichen ist das nichts,
So einzig ist sie.
Proteus:
Bleib sie einzig denn.
Valentine:
Nicht um die Welt! Ja, Freund, sie ist schon mein,
Und ich so reich in des Juwels Besitz
Wie zwanzig Meere, all ihr Sand von Perlen,
Nektar die Flut, gediegnes Gold die Felsen.
(II/4, 165–171; Bd. I, S. 118)
Wenn unser Schmerz über die Verstoßung zu groß ist, gewinnt die unerreichbare Welt unserer Verfolger eine transzendentale Qualität, die an eine spezifisch religiöse Erfahrung erinnert, archaisch und modern zugleich, in der die Götter eher übelwollend als wohlwollend sind.
Dieses Mal bekommt Proteus unmißverständlich zu hören, daß er in den Augen seines Freundes jede Bedeutung verloren hat:
Verzeih! auch kein Gedanke mehr an dich,
Denn jeder ist Begeistrung für die Liebste.
(II/4, 172–173; a.a.O.)
Die Liebe macht der Freundschaft den Vorrang streitig. Ein vernichteter Proteus fühlt sich nun nicht nur seiner Geliebten, Julia, und seines besten Freundes, Valentine, sondern am Ende auch seines eigenen Selbst beraubt. Die unbewußte Grausamkeit Valentines hat Proteus in so etwas wie einen mittelalterlichen Aussätzigen, einen absoluten Paria verwandelt.
Unter seinen Füßen öffnet sich ein bodenloser Abgrund, und weit über ihm steht die schöne Silvia in Gesellschaft eines hingerissenen Valentine. Sie könnte Proteus ans Ufer der Lebenden zurückbringen, wäre sie bereit, ihm ihre helfende Hand zu reichen. Valentine hat seinen Freund ausgelöscht, doch er hat ihm auch den Weg zur Auferstehung gezeigt. Unaufhaltsam wird Proteus dazu gebracht, sein eigenes Begehren an einer höheren Gottheit neu auszurichten.
Die Sprache von Himmel und Hölle ist die einzige, die dem, was Proteus geschieht, angemessen ist. Zuerst greift Valentine etwas mechanisch darauf zurück, aber im Verlauf des Gesprächs gewinnt sie beträchtlich an Bedeutung. Die Diskussion erlischt, sobald Proteus von Valentines Sprache der Idolatrie vollkommen überzeugt ist. Er ist zum Kult der Silvia bekehrt worden.
Anders als Proteus scheint Valentine gegen mimetisches Begehren immun zu sein. In Verona widersteht er dem Begehren seines Freundes; dann, in Mailand, verliebt er sich, soweit wir das beurteilen können, ohne äußeres Zutun. Für sein Begehren nach Silvia gibt es kein sichtbares Vorbild und keinen Mittelsmann. Aber diese Autonomie des Begehrens ist eine trügerische Erscheinung, ist paradoxerweise eine weitere mimetische Illusion. Valentine ist komplexer, als es den Anschein hat; eben erst sahen wir, wie er Silvia äußerst überzeugend »zum Nutzen« von Proteus lobte, während er kurz zuvor Proteus selbst nicht weniger überzeugend zum Nutzen Silvias und ihres Vaters lobte. Wenn er auf sie dieselbe Wirkung ausgeübt hätte wie auf seinen Freund, hätten die beiden einander am Ende in den Armen gelegen. Das endgültige Ergebnis wäre also ein weit größeres Unglück gewesen als das, was Valentine dann in der Tat herbeiführt – ein Unglück, wie es sich in einigen späteren Stücken, besonders in Troilus und Cressida, tatsächlich ereignet. Valentine ist ein unfreiwilliger Kuppler, eine Präfiguration des bewußten Kupplers der späten Komödien. Er arbeitet so fieberhaft gegen sein eigenes Interesse, daß man sich fragt, worauf sein Begehren eigentlich gerichtet ist.
Findet Valentine insgeheim Gefallen an der Aussicht auf eine amouröse Verbindung zwischen seiner Geliebten und seinem besten Freund? Eine solche Spekulation ist legitim, ja unverzichtbar, sie darf uns aber nicht dazu verleiten, Shakespeares Text durch eine psychoanalytische Theorie zu ersetzen. Das uns zur Verfügung stehende Handwerkszeug kann uns von der falschen Dichotomie zwischen normalem und anormalem Begehren befreien.
Man darf nie vergessen, daß Valentine und Proteus einen ganz normalen Grund für ihren Versuch haben, einander zugunsten ihrer jeweiligen Geliebten zu beeinflussen: ihre Jugendfreundschaft. Die Wahl einer Frau ist so wichtig, daß eine negative oder auch nur eine halbherzige Antwort seitens eines engen Freundes uns an der Klugheit unserer Wahl zweifeln läßt. Mit einer oberflächlichen Antwort geben wir uns nicht zufrieden, wir verlangen, daß man uns enthusiastisch unterstützt.
Erst schwächte Valentines Indifferenz gegenüber Julia Proteus’ Begehren, und dann zerstörte sie es. Verständlicherweise versucht Valentine, eine parallele Erfahrung zu vermeiden, und bemüht sich darum, Proteus davon zu überzeugen, daß Silvia Julia überlegen sei. Wäre Proteus’ Reaktion in Mailand dieselbe wie die Valentines früher in Verona, dann würde Valentines Vertrauen in Silvia genauso geschwächt wie vorher Proteus’ Vertrauen in Julia geschwächt worden war. Valentines übertriebenes Lob für Silvia ist ein Versuch, diese Gefahr zu bannen.
Valentine legt mehr Zuversicht an den Tag, als er wirklich besitzt, weil er Proteus die höchstmögliche Wertschätzung für Silvia abringen will. Das heißt nicht, daß er diesem hübschen Mädchen gegenüber indifferent ist, doch zwischen seinem Angezogensein und dem fanatischen Kult, den er öffentlich vollzieht, besteht ein Abstand, den er paradoxerweise ohne Hilfe von Proteus nicht überbrücken könnte. Obwohl Valentines Entscheidung für Silvia nicht in dem Sinn mimetisch determiniert ist wie die von Proteus, hat sein Begehren eine mimetische Dimension, die sein übertriebenes Lob sichtbar werden läßt. Valentine macht sein Begehren wirklicher, als es ist, um Proteus anzustecken und um seinen Freund zu einem mimetischen Vorbild a posteriori zu machen.
Die Rolle, die Valentine spielt, um Proteus davon zu überzeugen, daß Silvia göttlich sei, können wir deutlich erkennen; Proteus’ Rolle, um Valentine von derselben Vorstellung zu überzeugen, ist etwas weniger sichtbar, aber genauso unbezweifelbar. Im selben Maß wie Proteus’ Begehren nach Silvia zunimmt, nimmt auch Valentines Begehren zu und wird seine Rhetorik lebhafter.
Valentines Strategie ist keineswegs außergewöhnlich; wir können alle in unserer Umgebung andere Menschen beobachten, die sie ebenfalls anwenden, und wenn wir vor einer Selbsterforschung nicht zurückscheuen, können wir auch uns selbst dabei ertappen. Unsere Begehren sind nicht wirklich überzeugend, solange sie sich nicht in den Begehren anderer widerspiegeln. Nur knapp unterhalb unseres klaren Bewußtseins nehmen wir die Reaktionen unserer Freunde vorweg und versuchen, sie in Richtung unserer eigenen, noch unsicheren Wahl zu lenken, in die Richtung, die unser Begehren standhaft einhalten soll, um keinesfalls als mimetisch zu erscheinen. Eine derartige Standhaftigkeit ist indes nicht so vorherbestimmt, wie jedermann vermutet. Mit Hilfe seines mimetisch konditionierten Vorbilds kräftigt Valentine sein noch schwankendes Begehren und macht so die Halbwahrheit seiner Liebe zu Silvia zu einer »vollständigen« Wahrheit.
Valentines Verlangen nach dem mimetischen Begehren von Proteus ist selbst mimetisch. Die asymmetrische Stellung der beiden Freunde zerstört die fundamentale Symmetrie ihrer mimetischen Partnerschaft nicht, sondern schafft sie allererst.
Ein an Psychopathologie interessierter Beobachter wird bei Valentine und Proteus allerlei »Symptome« diagnostizieren, die bisher nur schwach sichtbar sind. In vielen späteren Theaterstücken Shakespeares, einschließlich Viel Lärm um nichts, Die zwölfte Nacht, Troilus und Cressida, Othello, Cymbeline und Das Wintermärchen tauchen sie mit schärferen Konturen wieder auf.
Valentine kann, wenn er Proteus’ Neid erregt, in unseren Augen etwas »Sadistisches« an sich haben, und etwas »Masochistisches«, wenn er unter der Rückwirkung des Neides zu leiden hat. Man kann ihn einen »Exhibitionisten« nennen, wenn er Silvia vor Proteus anpreist, man kann auch Freuds »latente Homosexualität« bei ihm diagnostizieren. Nichts davon ist unwichtig, doch unsere Einsicht in das Stück wird eher beschädigt als befördert, wenn wir uns durch das psychiatrische Vokabular von Shakespeares Quelle der Intelligibilität, dem mimetischen Begehren, ablenken lassen.
Ein Mann kann keinen größeren Beweis dafür liefern, daß eine Frau begehrenswert ist, als indem er sie tatsächlich begehrt. Doch wäre es übertrieben zu sagen, daß Proteus in Verona oder Valentine in Mailand wirklich wollen, daß der Freund sich in die Frau verliebt, die jeder bereits selbst liebt. Dennoch ist die Grenze zwischen einer bloßen Ermutigung des Freundes und dem Versuch, ihn und die Frau einander in die Arme zu treiben, nur schmal.
Wenn diese Grenze deutlich überschritten wird, haben wir das Gefühl, uns hinter einer bestimmten »perversen« oder pathologischen Schwelle zu befinden, doch im Grunde hat sich die Situation nicht verändert, und die genauere Bestimmung hängt vom Betrachter ab. Vorläufig will ich vor allem zeigen, daß man die mehr oder weniger »perverse« Struktur stets auf einen ganz normalen Antrieb der beiden Jugendfreunde zurückführen kann, die ihre Begehren wechselseitig nachahmen, weil sie das schon immer getan haben und weil diese Nachahmung ihre jeweiligen Begehren und ihre gemeinsame Freundschaft bisher ausnahmslos gestärkt hat.
Dasselbe Individuum, das alles in seiner Macht stehende tut, um dem Freund sein eigenes Begehren mitzuteilen, wird beim leisesten Anzeichen von Erfolg wahnsinnig vor Eifersucht. Das gilt später selbst für den durch und durch berechnenden, perversen Kuppler Pandarus. Bereits jetzt können wir verstehen, warum das der Fall ist: Sobald das eigene Begehren durch das auf den Freund übertragene Begehren neu belebt worden ist, fürchtet dieses neu belebte Begehren genau die Konkurrenz, nach der es sich gesehnt hat, solange ihr die jetzt durch die Rivalität gelieferte Lebenskraft fehlte.
Entgegen allgemeiner Überzeugung ist das Vorhandensein gut leserlicher Symptome keine Garantie dafür, daß sich eine pathologische Interpretation von selbst versteht. In allen Stadien der diachronen Entwicklung ergibt die mimetische Perspektive mehr Sinn. Alle Symptome können ausnahmslos auf die traumatische Erfahrung der mimetischen Doppelbindung zurückgeführt werden, auf die von Valentine und Proteus gleichzeitig gemachte Entdeckung, daß dem normalen Imperativ der Freundschaft – ahme mich nach – auf rätselhafte Weise ein weiterer Imperativ an die Seite getreten ist: ahme mich nicht nach. Alle »pathologischen Symptome« sind Reaktionen auf die Unfähigkeit der Freunde, sich aus dieser Doppelbindung zu befreien oder sie auch nur erst einmal deutlich wahrzunehmen.
Die wichtigsten Wahrheiten sind die unschuldige Freundschaft und das mimetische Paradox, das sie zerstört; Pandarus ist, wie wir sehen werden, nur eine mimetische Karikatur dieser fundamentalen Wahrheit. Psychopathologische Überlegungen sind legitim, solange sie nicht überhandnehmen. Bei Shakespeare hat die Perversion des Begehrens ihren Ursprung nie in sich selbst, sondern wird mimetisch von der ursprünglichen Doppelbindung hergeleitet; zu keiner Zeit liegt die wahre Quelle der Intelligibilität irgendwo in unseren Körpern oder in unseren instinktgesteuerten Trieben. Wenn wir Freud, der doch so ungemein kenntnisreich ist, mit modernen Begriffen interpretieren, trifft das auch auf ihn zu, aber Freud ist sich dessen nicht bewußt, Shakespeare dagegen sehr wohl.
Der einzige Weg, der mimetischen Doppelbindung zu entkommen, die einzige radikale Lösung bestünde darin, daß die beiden Freunde allem besitzergreifenden Begehren ein für allemal entsagten. Die eigentliche Wahl besteht zwischen dem tragischen Konflikt und der völligen Entsagung, dem Königreich Gottes, den Goldenen Regeln der Evangelien. Diese Alternative ist so erschreckend, daß Shakespeares Helden und Heldinnen versuchen, ihr auszuweichen, und deshalb zu den Entstellungen und Perversionen immer wieder neuer mimetischer Verdopplungen verurteilt sind. Die Suche nach einem Kompromiß produziert eine unzuträgliche Verbindung von Dingen, die nicht verbunden werden sollten; Entsagung wird zu einer Parodie ihrer selbst, mit der leicht schlüpfrigen Färbung sexueller Perversion. Werte und Bedeutungen, die voneinander getrennt bleiben sollten, vergiften einander: Freundschaft und Eros, Besitzstreben und Freigebigkeit, Frieden und Krieg, Liebe und Haß.
Eine bemerkenswerte Zeile Valentines gegen Ende des Stücks veranschaulicht diese fundamentale Ambiguität. Sie findet sich unmittelbar nach Proteus’ Versuchen, Silvia zu vergewaltigen. Nach ihrer Rettung erfolgt eine allgemeine Versöhnung, während deren der siegreiche Valentine, mit seiner Geliebten gerade wieder vereinigt, sie ihrem Beinahe-Vergewaltiger buchstäblich anbietet:
Geb ich dir alles, was in Silvien mein.
(V/4, 83; Bd. I, S. 155)
Valentines Großmut mißachtet nicht nur Silvias Gefühle, sondern belohnt auch verbrecherisches Verhalten. Die traditionelle Kritik, immer zu der Auffassung neigend, daß Schurken streng zu bestrafen sind, ist über Valentines maßlose Großzügigkeit empört. In ihrer Unnachsichtigkeit begreift sie nicht, daß Valentine einen Teil der Schuld an der Treulosigkeit seines Freundes übernehmen muß. Zuerst begriff Valentine nicht, was sein mimetischer Spott für Proteus bedeutete, doch jetzt begreift er das und ist daher nicht in der passenden Stimmung für eine selbstgerechte Empörung. Die einzige friedliche Lösung besteht darin, dem Rivalen das umstrittene Objekt, Silvia, zu überlassen. Wie Abraham erklärt Valentine sich bereit, seine Liebe auf dem Altar der Freundschaft zu opfern.
Ein reuiger Valentine versucht, seine Sünde wiedergutzumachen. Im Kontext einer selbstlosen Freundschaft soll keine Doppeldeutigkeit bestehen bleiben. Doch unser Unbehagen dauert an; gerne möchten wir Valentines »maßlose Großzügigkeit« als reine Freundschaft interpretieren, doch unweigerlich erinnert sie uns daran, wie effizient er seine Aufgabe erledigte, als er Silvias Schönheit anpries.
Beide Interpretationen widersprechen einander, doch eine Entscheidung zwischen ihnen ist nicht möglich, und eine Entscheidung sollte auch nicht getroffen werden. Dieser Gordische Knoten ist seine eigene Erklärung in dem Sinn, daß jede Bemühung, die mimetische Doppelbindung ohne völlige Entsagung zu umgehen, eine Art »Monster« produzieren muß, eine unaufrichtige Versöhnung von Einheiten, die unversöhnt bleiben sollten. Diese Ambivalenz ist für Shakespeares Werk essentiell und wird in ihm mit der Zeit immer prononcierter. Die Doppelbindung mimetische Liebe/mimetischer Haß ist bei Shakespeare das Trauma par excellence und pervertiert die menschlichen Beziehungen, die sie nicht gewaltsam zerstört.
Die Shakespearesche Ambivalenz könnte man als eine Kontaminierung der Tragödie durch die Goldene Regel und der Goldenen Regel durch die Tragödie bestimmen, als eine unheilige Vermischung beider. Wenn wir auf eine Pseudowissenschaft von sexuellen Trieben und Instinkten vertrauen, dann geht uns nicht nur die tragische Dimension aller Shakespeareschen Stücke verloren, sondern dann wird auch der sexuelle Aspekt undurchsichtig und unverständlich.
Die Doppelbindung des mimetischen Begehrens ist nicht nur für Die beiden Veroneser essentiell, sondern für Shakespeares gesamtes Werk. Nach meinem Urteil beeinträchtigt die Blindheit der Kritiker gegenüber diesem Punkt ihre Interpretation insgesamt entscheidend. Sie stellt das intellektuelle Äquivalent zum perversen Begehren bei Shakespeare dar, das nie offen erörtert wird. Selbst jene Interpreten, die kluge Fragen zur Beziehung zwischen Valentine und Proteus stellen, lösen das Paradox am Ende auf, anstatt sich explizit damit auseinanderzusetzen.
Das gilt meiner Meinung nach auch für Anne Barton2, die ich für ungewöhnlich scharfsinnig halte, die aber den Konflikt zwischen den beiden Freunden als Konflikt zwischen »Freundschaft« und »Liebe« bestimmt. Eben das ist er nicht. Man kann das Problem nicht auf die Entgegensetzung zweier Begriffe reduzieren.
Nehmen wir einmal an, daß sowohl Valentine als auch Proteus die Liebe um ihrer Freundschaft willen aufgäben. Das bedeutete in Wirklichkeit, daß sie frei wären, sich wieder gegenseitig nachzuahmen, und früher oder später würden sie wieder dieselbe Frau oder einen anderen Gegenstand begehren, den sie nicht teilen könnten. Wiederum würde die Freundschaft zerstört. Freunde können Valentine und Proteus nur sein, indem sie dasselbe begehren, und wenn sie das tun, werden sie zu Feinden. Keiner von ihnen kann die Freundschaft der Liebe opfern oder die Liebe der Freundschaft, ohne das zu opfern, was er behalten, und zu behalten, was er opfern will.
Der Konflikt zwischen Freundschaft und Liebe ist ein verbaler Schwindel, der die unauflösliche mimetische Verstrickung der beiden künstlich auftrennt. Er erinnert mich an die klassischen französischen Kritiker, große Experten im Verbergen der nackten mimetischen Rivalität hinter den edlen Draperien vorgetäuschter ethischer Debatten: Ehre gegen Liebe, Leidenschaft gegen Pflicht usw. Doch die Franzosen sind nicht die einzigen Übeltäter; alle anderen machen dasselbe, und solange die fundamentale Rolle der mimetischen Rivalität nicht anerkannt ist, muß jede Interpretation des Tragischen wieder in irgendeine Form begrifflicher Täuschung zurückfallen. Am Ende verbergen alle Kritiker das Tragische hinter unwichtigen »Werten«.
Die Tragödie läßt sich nicht auf eine begriffliche Differenzierung zurückführen, und niemand zeigt das kraftvoller als Shakespeare. Die mimetische Doppelbindung wird bei ihm so augenfällig, daß er es seinen Lesern schwer macht, dem auszuweichen, und bei Kritikern, die einem Verstehen seiner Vorgehensweise zu nahe kommen, glühenden Zorn erregt. Wenn Thomas Rymer beklagte, daß es in Othello um nichts oder fast nichts gehe, sagte er die Wahrheit.3 Shakespeares Werk eignet sich weniger als die meisten anderen Werke dafür, das menschliche Dilemma hinter den Konventionen humanistischen Geredes zu verbergen.
Tragische Antagonisten kämpfen nicht um »Werte«; sie begehren dieselben Objekte und denken dieselben Gedanken. Sie wählen ihre Objekte nicht zufällig aus; es geht nicht um Abwechslung, um eine Laune oder einen unlogischen Grund, es ist kein Fehler in einem ökonomischen System, in dem zu viele Menschen um zu wenige Objekte wetteifern. Die Helden denken gleich und begehren das gleiche, weil sie enge Freunde und Brüder in jedem Sinn des Wortes »Bruder« sind.
Wenn Aristoteles das Tragische als Konflikt zwischen nahen Verwandten bestimmt, dürfen wir die Aussage nicht von einem engen familienbezogenen Standpunkt her interpretieren. Tief in der menschlichen Psyche reicht die mimetische Rivalität an die identische Substanz von Einigkeit und Uneinigkeit in allen menschlichen Dingen heran.
Die tragische Inspiration, die sich nicht auf das Schreiben von Tragödien beschränkt, beginnt bei der Anerkennung der nackten Wirklichkeit. Das haben wir in Die beiden Veroneser vorliegen. Die folgenden Zeilen finden sich in dem kostbaren Monolog Proteus’, aus dem ich bereits mehrfach zitiert habe:
Mich dünkt mein Eifer kalt für Valentine,
Und daß ich ihn nicht liebe so wie sonst;
Ach! Doch sein Fräulein lieb ich allzusehr:
Dies ist der Grund, ihn weniger zu lieben.
(II/4, 203–206; Bd. I, S. 119)
Die Stelle ist nicht besonders schön oder auffallend; unserem Verlangen nach Subtilität und Opakheit erscheint die Botschaft zu einfach und offenkundig. Doch sie skizziert eine Genesis menschlicher Konflikte, die sicher im »wirklichen Leben« präsent ist und die ebenfalls die Substanz nicht nur von Shakespeares Theater, sondern von jedem großen Theater ausmacht.
Die mimetische Rivalität zwischen Valentine und Proteus liefert der Komödie ihr Thema und ist auch der Rohstoff aller dramatischen und narrativen Literatur. Die einzigen, die ihr Gerechtigkeit widerfahren lassen, sind die großen Autoren, die tragischen Dichter Griechenlands, Shakespeare und Cervantes, Molière und Racine, Dostoevskij und Proust und einige wenige andere. Nur die großen Meisterwerke des Theaters und der Literatur des Abendlandes bekennen sich zum Vorrang der mimetischen Rivalität.
Es ist äußerst merkwürdig, daß Literaturkritiker diesem Umstand nie die geringste Aufmerksamkeit schenken, sie halten ihn für eine Selbstverständlichkeit. Ihre theoretischen Abhandlungen sind weniger durch literarische Texte beeinflußt als durch Philosophen, und die Sozialwissenschaftler verbergen systematisch, was Shakespeare wirklich interessiert und was in ihren Augen ein Gemeinplatz zu sein scheint. In den begrifflichen Systemen von Philosophen, Psychologen, Soziologen, Psychoanalytikern oder Konfliktforschern, den Spezialisten für Auseinandersetzungen, kommt die mimetische Rivalität nicht vor. Und allen Theoretikern der Nachahmung, von Platon und Aristoteles bis zu Gabriel Tarde, sowie allen modernen experimentellen Forschern, die nachahmendes Verhalten untersuchen, ist das durchsichtige, aber wesentliche Paradox einer von Konflikten bestimmten Mimesis entgangen.
Konfliktforscher erfinden eine Vielzahl an Theorien über die Natur und den Ursprung der Uneinigkeit zwischen den Menschen, ohne die mimetische Rivalität je zu berücksichtigen. Wenn der Mensch nicht der Schuldige ist, dann muß es eine Idee oder vielleicht eine chemische Substanz sein – etwas, was dem Wesen der Freundschaft und des Freundes an sich fundamental fremd ist. Sie suchen nach einem Prinzip der menschlichen Aggression, das tief in unseren Genen begraben ist, sie befragen unsere Hormone, sie beschwören Mars, Ödipus und das Unbewußte, sie verfluchen die Repressionen durch die Familie und andere soziale Institutionen, die mimetische Rivalität aber erwähnen sie nie. Sie ist der eigentliche Skandal der menschlichen Beziehungen, dem die meisten von uns ausweichen, weil er unsere optimistische Sicht auf diese Beziehungen beleidigt. Wir setzen als selbstverständlich voraus, daß der Konflikt zwischen den Menschen die Ausnahme und die Harmonie die Regel ist, besonders zwischen so vortrefflichen Freunden wie Proteus und Valentine.
Tragische Schriftsteller sehen die Dinge anders. Statt dem auszuweichen, was auch die meisten anderen eifrig meiden, konzentrieren sie sich obsessiv darauf: Selbst diese frühe Komödie enthält bereits viele Zeilen, die das tragische Paradox indirekt bestimmen. Als Valentine Proteus dabei erwischt, wie er Silvia vergewaltigen will, ruft er aus:
O schlimme Zeit!
Daß ich den Freund als schlimmsten Feind gefunden.
(V/4; Bd. I, S. 155)
Das ist keine rhetorische Hyperbel, sondern eine kaum verhüllte Formulierung dessen, worum es in dem Stück eigentlich geht, die unheimliche Nähe, ja Identität von mimetischer Freundschaft und mimetischem Haß. Während seiner ganzen Karriere porträtiert Shakespeare Freunde und Brüder, die aus für den nichtmimetischen Beobachter unsichtbaren Gründen zu Feinden werden. Doch auch das Umgekehrte trifft zu: Ohne ersichtlichen Grund können tödliche Feinde zu vertrauten Freunden werden.
Wenn sich herausstellt, daß der schlimmste Feind unter allen Feinden ein Freund sein muß, sollte daraus folgen, daß unter allen Freunden ein Feind der beste Freund sein muß. Wem dieses letzte Paradox wie eine Übertreibung klingt, der sollte seine Aufmerksamkeit auf die Geschehnisse im Coriolan, der letzten großen Tragödie Shakespeares richten. Anstelle von zwei engen Freunden, die zu Feinden und dann noch einmal zu Freunden werden, haben wir in Coriolan und Aufidius zwei erbitterte Krieger und tödliche Rivalen vor uns, die vorübergehend zu engen Freunden werden. Als die aufgebrachten Mitbürger schließlich den unbesiegbaren, aber hochfahrenden Coriolan verbannen, wendet sich der Held mit der Bitte um Hilfe an Aufidius, den militärischen Führer der Volsker, mit dem er jahrelang erbitterte Kämpfe ausgefochten hat. In einem Monolog rechtfertigt er sein kühnes Ersuchen an den Erzfeind damit, daß extreme Liebe und extremer Haß unbeständige Gefühle seien, die zu jeder Zeit ineinander übergehen könnten:
O Welt! Du rollend Rad! Geschworne Freunde,
Die in zwei Busen nur ein Herz getragen,
Die Zeit und Bett und Mahl und Arbeit teilten,
Vereinigt stets, als wie ein Zwillingspaar,
In ungetrennter Liebe, brechen aus
Urplötzlich durch den Hader um ein Nichts
In bittern Haß. – So auch erboste Feinde,
Die Haß und Grimm nicht schlafen ließ vor Plänen,
Einander zu vertilgen, durch ’nen Zufall,
Ein Ding, kein Ei wert, werden Herzensfreunde
Und Doppelgatten ihre Kinder.
(IV/4, 12–22; Bd. III, S. 175)
Der weitere Verlauf bestätigt Coriolans Spekulation; die beiden Feinde fallen einander in die Arme, als sie erkennen, daß sie einander sehr ähnlich sind und Gefallen an nahezu denselben Dingen finden. Aufidius vertraut Coriolan den Befehl eines militärischen Feldzugs gegen Rom an. Und ganz rasch erwacht selbstverständlich wieder der rivalisierende Ehrgeiz, und am Ende ermordet Aufidius seinen mimetischen Rivalen, den er mit gleicher Intensität liebt und haßt.
Die Struktur des Konflikts ist in Komödien und Tragödien dieselbe. Der einzige Unterschied besteht in der Art der Lösung, die aus dramaturgischen Erwägungen gewaltsam oder nicht gewaltsam sein kann.
Alle Konflikttheorien und auch unsere Sprache spiegeln die allgemein übliche Auffassung wider, daß die Trennung um so tiefer sei, je stärker der Konflikt zwischen den Antagonisten ist. Der tragische Geist operiert mit dem entgegengesetzten Prinzip: Je stärker der Konflikt, desto weniger Raum gibt es in ihm für einen Unterschied. Shakespeare formuliert diese zentrale mimetische Wahrheit ganz unterschiedlich; sobald wir sie in einem mimetischen Licht lesen, wird ihre Rationalität offenkundig. Was auf Valentine und Proteus oder auf Coriolan und Aufidius zutrifft, gilt in Antonius und Kleopatra auch für Caesar und Mark Anton:
… das Band, das ihre Freundschaft zu verknüpfen scheint, erwürgt ihre Verbrüderung.
(II/6, 120–122; Bd. III, S. 934)
Unsere Interpretation der Beiden Veroneser bedarf nur einer geringfügigen Korrektur, um vollkommen zufriedenstellend zu sein. Aus Gründen der Veranschaulichung habe ich die mimetische Symmetrie der beiden Protagonisten etwas übertrieben, sie ist nicht immer perfekt, ganz im Gegenteil; hier müßte eine ausgeglichenere Sichtweise vorherrschen.
Die Symmetrie ist keine eingebildete, doch hat sie sich in diesem frühen Stück noch nicht in demselben Maß durchgesetzt wie beim späten Shakespeare. Sie manifestiert sich kraftvoll, aber in einer unbehaglichen Kombination mit ihrem Gegenstück, einem asymmetrischen Entwurf der beiden Helden. Der Autor scheint zwischen zwei einander diametral entgegengesetzten Konzepten seiner Komödie zu schwanken.
In bestimmten Augenblicken haben wir das Gefühl, die beiden Protagonisten seien vom mimetischen Begehren in gleicher Weise betroffen und ihre Reziprozität oder Symmetrie sei perfekt. In anderen Augenblicken scheint das »schlechte« mimetische Begehren allein Proteus anzugehören, und seine Schlechtigkeit gibt den dunklen Hintergrund ab, vor dem das wenig begründete Gutsein Valentines an Sein zu gewinnen scheint. Ist das der Fall, dann wird Proteus zu einem konventionellen Schurken und Valentine zu einem konventionellen Helden.
Ein gereifter Shakespeare würde die konventionelle Asymmetrie von Valentine und Proteus entschlossener abschwächen; er würde die Held-Schurke-Dichotomie gründlicher dekonstruieren, als er es in Die beiden Veroneser tut. Das frühe Werk schwankt noch zwischen einer traditionellen Komödie einerseits, in der Neid, Eifersucht und andere schlechte (mimetische) Gefühle ausschließlich Proteus zugeordnet sind, und einem radikaleren Shakespeare-Stück andererseits, in dem Valentines mimetischer Spott auf Proteus das exakte Äquivalent zu Proteus’ Verrat darstellt.
Das behandelte Stück hat von beiden etwas, von dem alten komischen Muster, das die mimetische Reziprozität hinter Sündenböcken verbirgt, und von der radikal mimetischen Konzeption, die sich im Mittsommernachtstraum durchsetzen wird. In Die beiden Veroneser habe ich das hervorgehoben, was auf den zukünftigen Shakespeare hinweist, und weniger das, was darin zu einer Theatertradition gehört, die ein erfahrener Shakespeare später entschlossen und vollständig über Bord werfen wird.
Kapitel 2
Der Neid auf solch ein köstlich Gut
Collatine und Tarquinius in Die Schändung der Lukretia
Mimetisches Begehren ist keine vorübergehende Marotte des jungen Shakespeare; es strukturiert die menschlichen Beziehungen nicht nur in seinen Theaterstücken, sondern auch in dem Gedicht Die Schändung der Lukretia, das 1594 veröffentlicht wurde, in demselben Jahr also, das häufig für die Entstehung der Beiden Veroneser angenommen wird.
Sie erinnern sich: Am Ende der Komödie versucht Proteus, Silvia zu vergewaltigen, doch er gelangt nicht zum Ziel, da Valentine noch gerade rechtzeitig erscheint. Im Gedicht wird die Vergewaltigung dagegen brutal ausgeführt: Tatsächlich handelt es sich um dieselbe Art von Vergewaltigung, dieselbe mimetische Vergewaltigung. So wie Valentine Silvia vor Proteus gerühmt hat, rühmt Lukretias Gatte, Collatine, seine schöne und tugendhafte Frau unklugerweise vor Tarquinius, mit demselben Ergebnis.
Die Schändung der Lukretia ist eine tragische Version der Komödie – die Komödie eine komische Version des Gedichts. Man weiß nicht, was zuerst entstanden ist. Vielfach nimmt man an, es sei die Komödie, und ein Vergleich beider Werke macht das glaubhaft. Ich gehe von dieser als der chronologisch korrekten Abfolge aus, doch meine Interpretation ist weder von der einen noch von der anderen Sequenz abhängig; sollte sich die anerkannte Abfolge als falsch herausstellen, wären lediglich geringfügigere Veränderungen vonnöten.
Wie die Komödie definiert auch das Gedicht das mimetische Begehren, dieses Mal aber so sorgfältig und genau, daß kein Zweifel mehr möglich ist:
Sein Rühmen von Lukretias Überlegenheit
Regte die wilde Leidenschaft des Königssohnes an;
Denn oft betört das Herz ein Wort, ein Ton.
Der Neid auf solch ein köstlich Gut erwachte,
Und der Gedanke stachelt’ ihn wie Hohn,
Daß ihm, dem Fürsten, das Geschick versage,
Womit ein Untertan zu prahlen wage.
(36–42; Bd. IV, S. 305)
Was mir hier entscheidend erscheint, ist die Verknüpfung zweier wesentlicher Wörter: Das eine ist selbstverständlich »Neid«, das wichtigste Wort bei Shakespeare für das mimetische Begehren, und das andere ist »anregen/suggerieren«. Wenn man den Ausdruck mimetisches Begehren irgendwie unpassend, vielleicht nicht Shakespearisch genug findet, kann man Shakespeares eigenen Begriff dafür einsetzen: suggeriertes Begehren. Im vorliegenden Kontext sind beide Begriffe gleichwertig.
Es handelt sich jedoch nicht um Synonyme. Suggeriertes Begehren ist unzweideutig, aber als Forscher muß ich in eigener Sache einige Vorbehalte formulieren. Der Begriff impliziert zu viel Passivität; niemand kann ein von jemand anderem bereits vorgefertigtes Begehren übernehmen, selbst das aufnahmefähigste Subjekt muß mit dem Vermittler aktiv zusammenarbeiten. Kein Individuum kann mimetisches Begehren ohne Hilfe bei einem anderen Individuum erzeugen; auch bei Shakespeare wird das Begehren ohne Ermutigung oder gar Kenntnis seitens der Vorbilder ständig zu einem mimetischen. Es gibt meiner Meinung nach gute Gründe, um mimetisches oder nachahmendes statt suggeriertes Begehren zu sagen.
Mir ist jedoch verständlich, warum Shakespeare den genannten Ausdruck verwendete, denn er ist für die spezifischen Formen der Mimesis, die in seinem Werk vorherrschen, besonders gut geeignet; wie Valentine tut Collatine alles in seinen Kräften Stehende, um seinen Rivalen mit seinem Begehren anzustecken, auch er ist ein erfolgreicher Agent provocateur:
Die Nacht zuvor, im Zelte des Tarquin,
Eröffnete er diesem seinen Schatz, sein Glück;
Der Himmel hab ein Kleinod ihm verliehn
In einer Gattin, welcher keine gleich sei;
Dies höchste Los sei zweimal nicht zu ziehn;
Ein König könne größern Ruhm gewinnen,
Doch eine Frau wie diese niemals minnen.
(15–21; Bd. IV, S. 303)
Die Worte sind diskret, sie evozieren jedoch eine lebhafte Darstellung weiblicher Schönheit, eine anstößige Zurschaustellung, die die tatsächliche Vergewaltigung vorwegnimmt. »Eröffnete er diesem seinen Schatz« klingt, als entkleidete Collatine Lukretia inmitten seiner Soldatenkameraden. Es werden Bilder heraufbeschworen, die Tarquinius nicht mehr aus dem Kopf bekommt.
Collatines Antrieb erscheint irrational und ist doch von einer unheimlichen Rationalität, einer irren, aber folgerichtigen Logik durchzogen, analog dem kalten Wahnsinn eines Spekulanten, der überzeugt ist, er müsse alles aufs Spiel setzen, um den größten Gewinn zu erzielen. Die stolzesten Männer wollen die begehrenswertesten Objekte besitzen; solange aber ihre Wahl nur mit leeren Schmeicheleien bejubelt wird, können sie nicht sicher sein, daß das wirklich der Fall ist; sie brauchen einen handfesteren Beweis, das Begehren anderer, so vieler und so angesehener Männer wie möglich. Deren Begehren müssen sie ihre reichsten Schätze rücksichtslos preisgeben.
Selbst die größten und seltensten Besitztümer – Frau, Geliebte, Vermögen, Königreich, überlegenes Wissen –, sie alle verlieren ihre Anziehungskraft, wenn man sich ihres Besitzes zu sicher ist. Wie ein Spieler versucht ein ängstliches Begehren verzweifelt, sich immer wieder zu regenerieren. Die spätere Beschreibung Collatines als eines »geizigen Verschwenders« (79) bezieht sich nicht nur auf seine Sprache, sondern auf sein ganzes Vorhaben, auf die ebenso rücksichtslose wie habgierige Torheit, die das Lob seiner Frau darstellt:
Die Schönheit ist des Anwalts überhoben,
Sie spricht für sich zum Auge laut genug.
Was einzig ist, mit Worten noch zu loben,
Bleibt bestenfalls ein müßiger Versuch.
O Collatine, du handeltest nicht klug;
Denn weiß man einen Edelstein sein eigen,
Soll man von ihm vor Diebesohren schweigen.
(29–35; Bd. IV, S. 305)
Der glückliche Besitzer einer vollkommenen Frau sollte nicht weniger diskret, ja verschwiegen sein als der Priester eines heiligen Mysteriums. Collatine der Verkünder erntet, was er gesät hat. Shakespeare schiebt die Schuld an der Vergewaltigung nicht einfach vom einen Mann zum anderen, er macht beide Männer gemeinsam als Urheber eines Verbrechens verantwortlich, für das sie sich bald gegenseitig bestrafen werden.
Collatine weiß die Schönheit seiner Frau nur im grellen Schein des Neides wirklich zu würdigen. Der Neid ist für ihn ein Aphrodisiakum par excellence, der einzig wahre Liebestrank. Tarquinius’ Begehren ist vom Neid bestimmt, aber auch bei Collatine ist das der Fall. Sein Neid auf Tarquinius’ Neid macht ihn zum Nachahmer seines Rivalen, macht beide gleich. Der Unterschied zwischen Held und Schurke schwindet.
Shakespeares Faszination ist erneut zu erkennen, als Lukretia Tarquinius davon abzubringen versucht, sie zu vergewaltigen. Eines ihrer Argumente lautet, daß Tarquinius’ mimetische Leidenschaft angesichts seiner herausgehobenen Stellung eine enorme Anzahl an Nachahmungen hervorbringen muß:
Bedenke, daß dem Volk des Fürsten Bild
Als Muster, Schule, Buch und Spiegel gilt.
Sprich, willst du sitzen auf dem Lehrerstuhle
Der Wollust? Willst du für das Handbuch gelten
Der edlen Kunst, wie man erfolgreich buhle?
Soll dich die Welt den Unzuchtspiegel schelten,
Das Musterbild der Schmach, des Lasters Schule?
(615–621; Bd. IV, S. 346–347)
Der Anfang des Gedichts ist ein umfangreiches Beiseitesprechen des Autors über das häufigste mimetische Muster bei Shakespeare; hier wird ein möglicher Grund für Shakespeares Entscheidung angedeutet, ein narratives Gedicht und kein Theaterstück zu schreiben. Wenn narrative Lyrik für theoretische Überlegungen zum mimetischen Begehren das falsche Medium zu sein scheint, dann ist es das Theater noch mehr. Ein Dramatiker kann sein Drama nur durch eine Figur im Drama kommentieren, die er dann mit einer übergroßen Fähigkeit zur Selbstbefragung ausstatten muß. Und wer hätte jemals einen jungen Mann gehört, der anerkennt, daß seine »Liebe auf den ersten Blick« nicht spontan ist, wie Proteus das praktisch tut? Im Gedicht nehmen die Hauptkommentare mutatis mutandis denselben Ort ein wie Proteus’ Monolog unmittelbar nach Erwachen seines mimetischen Begehrens, sie sind eine längere und inhaltsreichere Version des früheren Monologs. In einem Schauspiel müßte Tarquinius die Kommentare sprechen, was zumindest ungeschickt wäre. Das mag der Grund oder ein Grund sein, warum Shakespeare sich bei dieser Gelegenheit dafür entschied, ein narratives Gedicht und kein Theaterstück zu schreiben.
Wir erkennen immer deutlicher, daß das mimetische Begehren im Werk Shakespeares kein Fremdkörper ist, es ist kein »Werkzeug der Kritik«, das ich als Kritiker an dieses Werk von außen herantrage. Die Kommentare des Autors sind eine Fortsetzung und Erweiterung dessen, was er in Die beiden Veroneser begonnen hatte, sie sind eine Reflexion über das, was er in seinem Werk selbst am bemerkenswertesten findet.





























