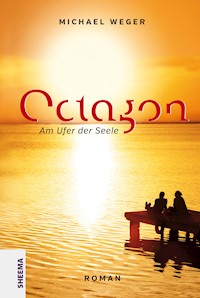Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sheema-Medien
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einige Jahre in der Zukunft. Die junge Pariser Journalistin Claire recherchiert in Rom. Sie begegnet einem Mann, der sie in den Bann zieht. Er erzählt ihr von seiner Heimat, einem neuen Utopia auf einer unbekannten Insel im Atlantik. Claire folgt ihm dorthin und findet eine Gemeinschaft hoch entwickelter Menschen vor, mit außerordentlichen Fähigkeiten und Lehren. Sie berichtet darüber in der Weltpresse. Ihr Artikel schlägt ungeahnte Wellen und droht die beseelte Gemeinschaft zu vernichten. Nur eine höhere Macht kann sie noch retten. Doch das Schicksal hat andere Pläne… Es geht um die großen Fragen menschlichen Daseins: Was ist die wahre Natur der Seele? Was das Wesen der Liebe? Michael Weger bietet erleuchtende und überraschende Antworten darauf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Weger
SHARE
Die Teile der Liebe
Roman
Michael Weger
Die Teile der Liebe
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliothek; detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
1. Auflage 2016 | OriginalausgabeCopyright © 2016 Sheema Medien Verlag,Inh.: Cornelia Linder, Hirnsbergerstr. 52, D - 83093 AntwortTel.: +49 (0)8053 – 7992952, Fax: +49 (0)8053 – 7992953
www.sheema-verlag.de
Copyright © 2016 Michael Weger | www.michaelweger.com
Ebook ISBN 978-3-931560-82-9
EPDF ISBN 978-3-931560-83-6
ISBN Buch-Ausgabe 978-3-931560-63-8
Coverabbildung: © shutterstock | repbone
Autorenfoto: © Isabella Weitz | www.isabellaweitz.com
Umschlaggestaltung: Sheema Medien Verlag, Schmucker-digital | schmucker-digital.de, Patrick Connor Klopf | bluepepper.at
Gesamtkonzeption: Sheema Medien Verlag, Cornelia Linder
eBook-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim | www.brocom.de
Alle Rechte vorbehalten. Das gesamte Werk ist im Rahmen des Urheberrechts geschützt. Jegliche von Autor und Verlag nicht genehmigte Verwertung ist unzulässig. Dies gilt auch für die Verbreitung durch Film, Funk, Fernsehen, fotomechanische und digitalisierte Wiedergabe, Tonträger jeder Art, elektronische Medien, Internet, sowie auszugsweisen Nachdruck und Übersetzungen. Anfragen für Genehmigungen im obigen Sinn sind zu richten an den Sheema Verlag unter Angabe des gewünschten Materials, des vorgeschlagenen Mediums, gegebenenfalls der Anzahl der Kopien und des Zweckes, für den das Material gewünscht wird.
Haftungsausschluss: Dieses Buch dient keinem rechtlichen, medizinischen oder sonstigen berufsorientierten Zweck, sondern ausschließlich Unterhaltungs- und Bildungszwecken. Die hier gegebenen Informationen ersetzen keine fachspezifische Beratung oder Behandlung. Wer rechtlichen, medizinischen oder sonstigen speziellen Rat oder Hilfe sucht, sollte sich an einen geeigneten Spezialisten wenden. Autor und Verlag übernehmen keine Haftung für vermeintliche oder tatsächliche Schäden irgendeiner Art, die in Verbindung mit dem Gebrauch oder dem Vertrauen auf irgendwelche in diesem Buch enthaltenen Informationen auftreten könnten.
Für Isa, Luc und die Rebellen
Mag sein, die Strudel reißen uns hinab.
Mag sein, wir landen an den glücklichen Inseln.
Wird uns auch manches genommen,
so erwächst uns doch viel.
Und haben wir oft nicht mehr die Kraft,
die einst den Himmel und die Erde hat bewegt –
wir sind doch, was wir sind:
die immer gleiche Glut heroischer Herzen,
durchdrungen von Zeit und Schicksal,
stark im Willen, unverzagt zu kämpfen,
zu suchen und zu finden, irgendwann.
(Homer, Odyssee, um 790 v. Chr.)
Spalte ein Stück Holz und ich bin da.
Heb` einen Stein auf und du wirst mich finden.
(Thomasevangelium, Logion 77, um 150 n. Chr.)
Im siebten Himmel befinden sich Gerechtigkeit und Recht,
Reichtum und Heil, die Schätze des Lebens,
die Schätze des Friedens und die Schätze des Segens,
die Seelen der Gerechten, die Geister,
die Seelen derer, die einst geboren werden,
und der Tau, der einst die Toten beleben wird.
Gefunden sind fernerhin: die Ophanim, die Seraphim,
die heiligen Tiere, die Dienstengel
und der Thron der Herrlichkeit.
(Talmud, Hagiga II,1; 12b, 0 bis 800 n. Chr.)
I
Die Schatten der Krieger
1
Der junge Mann war in Rom angekommen.
Er stand vor dem Kolosseum und starrte in den Himmel. Das helle Blau hing wie ein unwirklicher Baldachin über dem baufälligen Wahrzeichen.
Richtung Süden zog ein Großer Brachvogel vorbei.
Im Westen türmten sich Gewitterwolken.
Es würde Regen geben.
Vorsichtig betrat er einen der Bogengänge, die in das Innere des Amphitheaters führten. Das Gewölbe erweckte den Eindruck, als könnte es jeden Augenblick Brocken der Mauern auf ihn herabstürzen lassen. Er zog den Kopf ein und beeilte sich, die gefährlichen letzten Meter schnell hinter sich zu bringen.
Am Eingang der Arena hielt er inne und sah sich um. Traurigkeit stieg in ihm hoch und mit ihr Erinnerungen an die vielen trostlosen Erlebnisse und ähnlichen Anblicke im Laufe seiner langen Reisen.
So viel Verwahrlosung und Elend hatte er in der ewigen Stadt nicht erwartet, im Gegenteil: Er war guter Hoffnung gewesen, endlich sein Ziel zu erreichen.
Was ihm jedoch begegnete, schien das erlebte Grauen noch zu übertreffen.
Oder täuschten ihn seine Sinne? War er einfach zu hungrig, zu erschöpft und leer, um all der Not ein weiteres Mal gewappnet entgegenzutreten?
Wellblechdächer armseliger Quartiere, vor Jahren als Notlösung errichtet, hatten sich über morschen Holzbalken abgesenkt und waren zusammengefallen. Davor reihten sich, unter verschlissenen Planen, Lager aus Pappkartonagen, voll von vermodernden Konservendosen, Stofffetzen, Unrat – würdelose Behausungen, die jeder zivilisierten Kultur spotteten.
Männer und Frauen, allen Alters und aller Hautfarben, saßen teils dicht gedrängt in Gruppen beieinander, mit gesenkten Köpfen über angezogenen Knien, die sie umschlungenen hielten, als wollten sie mit letzter Kraft einen Funken Geborgenheit heraufbeschwören.
Mütter reichten ihre Säuglinge an jene weiter, die noch stärker und genährt genug schienen, um die schreienden Bündel mit wenigen Tropfen Milch aus ihren Brüsten am Leben zu erhalten.
Etwas abseits spielten die älteren Brüder und Schwestern, stellten, mit Holzstöcken in dünnen Händen, alte und neue Kriegsszenarien nach. Sie hatten sich einige Jahre länger ins Dasein gerettet, hieben aber, als wollten sie es trotzig beenden, wild aufeinander ein. Traf sie ein Hieb, flohen sie, versteckten sich, preschten hervor, stürzten erneut ins Getümmel, fielen wieder, rappelten sich hoch und kämpften weiter. Hätten sie echte Waffen in Händen gehalten, ihr Spiel hätte nicht anders ausgesehen. Denn obwohl es weithin, als einzige Szene dieses Dramas, etwas von Leben versprühte, handelte es nur vom Tod. Und der Zorn der Kleinen, gespeist aus der Not, befeuert vom Elend des täglichen Überlebenskampfes, stand jenem ihrer Väter und Brüder, die lange zuvor, irgendwo in der Welt, gefallen waren, um nichts nach. Das hatten sie erlebt – und nur davon konnten ihre Spiele zeugen.
Der junge Mann stand noch immer am Eingang der Arena – erschöpft, sprachlos, den Tränen nahe.
Vergeblich hielt er nach Hilfskräften Ausschau, nach Sozialarbeitern, Dolmetschern, Sanitätern oder Ärzten, denen er auf seinen Reisen, an Orten wie diesen, stets begegnet war. Er hatte den Glauben nie aufgegeben, vielleicht ja gerade an den traurigsten Plätzen der Welt, jene beherzten Menschen anzutreffen, jene Rebellen der Hoffnung, nach denen er auf der Suche war.
Erst als sein Blick an der gegenüberliegenden Seite der Arena auf eine Menschenschlange fiel, wurde er fündig. Einige Frauen und Männer verteilten Suppe aus großen Plastikeimern, andere winkten Kranke und Verletzte zu sich.
Was er aus der Entfernung jedoch beobachten konnte, gab ihm wenig Zuversicht: Auch ihre Gesichter waren fahl, ihre Augen leer, die Bewegungen mechanisch, teilnahmslos. Das Mehr an Lebensenergie, das es brauchte, um neben routinierten Handlungen etwas an Wärme, Obhut und Nähe zu spenden, war ihnen scheinbar schon lange verloren gegangen.
Trotz allem entschied der junge Mann, nicht aufzugeben, schritt die gut neunzig Meter über den Platz und reihte sich in die Schlange ein.
Stunden später, es dämmerte bereits, saß er neben den anderen Fremden an einer der offenen Feuerstellen auf dem Boden und schöpfte mit trockenen Brotstücken Suppe aus einem Metallteller. Das gab ihm ein wenig Kraft zurück.
Die Kapuze seines bodenlangen Mantels hatte er tief über die Stirn gezogen. Der widerstandsfähige Stoff bot Schutz vor Hitze und Kälte und würde auch den Regenströmen des aufziehenden Gewitters standhalten, das nun bedrohlich schnell näher kam.
Es war still in der Arena.
Die Kinder hatten ihre Spiele um Leben und Tod für diesen Tag beendet. Nur hie und da war ein Murmeln zu hören oder das Bellen eines Streuners, der um eine der Gruppen herumstrich, in der Hoffnung, etwas von dem kärglichen Mahl abzubekommen.
Die Feuer warfen ihr flackerndes Licht auf die ansteigenden Ränge des Amphitheaters und für Momente schien es, als würden die Jahrhunderte über die Menschenschar hereinstürzen, als wolle der Geist eines Gladiators sein Schwert erheben, um den endgültigen Hieb zu setzen.
Mit den ersten Tropfen machten sich vereinzelt kleine Gruppen auf den Weg in die Wandelgänge unter der Arena, um eine trockene Kammer zu finden.
Der junge Mann blieb ruhig sitzen. Er vertiefte sich gerade in eine der Übungen, die er von Kindheit an erlernt hatte. Und es gelang ihm, einmal mehr, sich der Trauer zu entledigen und jene Gelassenheit heraufzubeschwören, die es ihm erlaubte, dem Schicksal und den Wirren des Lebens mit milden, liebevollen Augen zu begegnen.
Er beobachtete weiterhin die wenigen freiwilligen Helfer, die den Armen und Siechen zur Seite standen, bemühte sich, in deren Gesten und Blicken etwas Seele, Funken aus dem Feld der Seele, zu entdecken, doch mangelte es ihm in diesen Stunden an der nötigen Energie, um ihnen oder seiner Aufgabe gerecht zu werden.
Er würde die Nacht im Freien verbringen und es morgen erneut versuchen. Sein Mantel würde ihn schützen und wenn der Regen später über seine Wangen liefe, würde er es genießen. Sonne und Wind hatten seine Haut über Tage hin ausgetrocknet. Er zog den Kragen enger und legte sich eingerollt auf die Erde.
Wo vor seinen Augen nun Tropfen auf den sandigen Boden fielen, stiegen kleine, rötliche Staubwolken auf. Der Südwind hatte seit Wochen in Wellen von Wolkenbänken Saharasand mit sich gebracht und ihn über der Stadt verteilt. Schon in den Randbezirken war ihm der rote Staubfilm aufgefallen, der sämtliche Gebäude und Denkmäler in einen alles begleichenden Ton getaucht hatte.
Auf seiner Kapuze hörte er das Trommeln schwerer Tropfen. Das Geräusch nahm an Regelmäßigkeit zu, wurde zu einem Tosen, einem aufgewühlten Meer, in das er versank.
Langsam übermannte ihn die Müdigkeit, die er nach den Strapazen der langen Schiffsreise – westlich der Atlantikküste Afrikas entlang nach Norden, durch die Straße von Gibraltar und das Mittelmeer bis Rom –, schon viel früher erwartet hatte.
Morgen würde seine Suche erneut beginnen.
Hier, in der ewigen Stadt, glaubte er trotz allem fündig zu werden und auf ein paar jener seltenen Menschen zu stoßen, die der Kolonie des Glücks neue Hoffnung bringen mochten.
2
Die ersten Sonnenstrahlen malten eine Sichel aus Licht auf die hohen Arkadenbögen des Amphitheaters. Der junge Mann blinzelte sich den Schlaf aus den Augen und ließ seinen Blick eine kurze Weile auf diesem Gemälde ruhen, das am oberen Rand in tiefem Blau von einem intakten Himmel erzählte.
Seine Glieder fühlten sich schwer an, doch konnte er mit einzelnen geübten Bewegungen die Muskeln dehnen, den Blutstrom stärken und schließlich zumindest im Ansatz zu jener Kraft zurückfinden, die ihn sonst so verlässlich trug. Er erhob sich, schüttelte den Sand von seinem Mantel und steuerte den Ausgang der Arena an.
Er sah sich noch einmal nach den Hilfskräften um, doch entschied endgültig, dass es die Mühe nicht lohnte, ihr Wesen weiter zu erforschen oder sie gar zu befragen.
Er schlug den Weg Richtung Norden ein.
Dort sollte sich den Berichten nach unter einem der sieben Hügel eine andere, intakte, wieder genesene Völkergemeinschaft befinden. Zwar, hieß es, seien Rassen- und Glaubenskonflikte nach wie vor Teil des Alltags, doch wäre es einigen der neuen Anführer geglückt, Ordnung und Gerechtigkeit herzustellen. Diese Anführer, Männer und Frauen aus aller Welt, waren nach ihren ersten Hilfseinsätzen vor Ort geblieben oder zurückgekehrt, um nach dem Niedergang der sozialen Strukturen, den Wiederaufbau zu unterstützen. Der monatelange Bürgerkrieg, der auf das Eintreffen Hunderttausender Flüchtlinge innerhalb weniger Jahre gefolgt war, hatte in vielen betroffenen europäischen Städten und Ländern nur Chaos und verbrannte Erde hinterlassen. Ohne das aufopfernde Engagement solcher beherzten Seelen hätte es keine Zukunft gegeben, wären alte Seuchen ausgebrochen, neue Hungersnöte, neue Kriege und der Tod hätten weiter regiert, mit all der Härte und Brutalität, die der Mensch ihm seit Jahrtausenden beigebracht hatte.
Jenen, die ihn, den Tod, schließlich besiegten – wenn auch nur an wenigen Orten Europas –, wollte der junge Mann begegnen. Sie sollte er beobachten, ihre Seelen erkunden, um dann vielleicht Einzelne den Prüfungen zu unterziehen. Je nachdem, wozu ihn Zufall und Weisungen anleiten mochten.
Auf seinem Weg durch verwinkelte Gassen, Straßen und über Plätze der römischen Innenstadt kam er ins Staunen, wie viele unterschiedliche Eindrücke ihm innerhalb weniger Kilometer begegneten. Mit den Jahren hatten sich viele neue Bezirke gebildet, die wie durch unsichtbare Grenzen voneinander getrennt schienen. Er hielt sich jedoch nicht lange auf, folgte seiner Route mit schnellen Schritten und die Eindrücke zogen wie im Flug an ihm vorbei.
In einer Nebengasse reihten sich pittoreske Geschäfte aneinander, die von einzelnen Passanten besucht wurden. Deren Bekleidungen nach musste es sich um die wenigen Übriggebliebenen einer betuchten Gesellschaft handeln, die, wider besseren Wissens und zu sehr verwurzelt, ihre alte Heimat nicht aufgegeben hatten.
Gleich darauf folgten ausgestorbene Häuserreihen und Straßenzüge, verwahrloste Ecken, in denen jeder Schritt von den Wänden widerhallte, als rhythmisches Echo, das sich im Nirgendwo verlor.
Wenig später tauchte unversehens ein bürgerkriegsähnliches Szenario auf, mit Rauchwolken aus Gullys, aufgerissenen Pflastersteinen und Erkern voll Einschusslöchern.
Keine Hundert Meter weiter mündete sein Weg in ein beschaulich anmutendes Viertel, mit blühenden Orangenbäumen in eingefassten Blumenbeeten und alten Leuten, die gebückt des Weges trotteten oder auf Holzbänken beieinandersaßen.
Dann wieder stieß er auf Häuserfronten, deren Fassaden oft Stockwerke hoch, über und über mit Graffitischriftzügen oder Nachahmungen berühmter Fresken bemalt waren. Eines der obersten Geschosse war eingefallen – und so reckte Adam die Hand vergeblich seinem Gott entgegen.
Hier schienen selbst die Trittgeräusche von der Stille verschluckt zu werden und er fühlte, wie sich die Traurigkeit erneut seiner bemächtigen wollte.
Diesmal nahm er – mit einem kurzen Blick auf sein inneres Feld, indem er seinen Atem regulierte und eines seiner schönsten Erlebnisse erinnerte – dem aufkommenden Schmerz schon im Keim die Energie.
Schließlich gelangte er auf einen der Hügel. Um welchen es sich handelte, wusste er nicht zu sagen. Von hier aus konnte er einen Marktplatz überschauen, der etwas unter ihm in lebhaftem Treiben pulsierte. In der Mitte des Rondeaus ragte ein ägyptischer Obelisk in die Höhe und schien mit seiner Pyramide an der Spitze auf den einzigen Ausweg hinzuweisen: Vergiss nicht, dort wartet ein Himmel.
Immer der Himmel, der einen die Hoffnung gemahnt.
Der junge Mann hatte seinen Mantel abgestreift, ihn auf dem Boden ausgebreitet und saß in Trägershirt und Jeans auf dem doppelt gewebten Stoff. Durch sein Fernsichtgerät, ein Monookular der letzten Generation, beobachtete er das weitläufige Areal.
Und tatsächlich schien das Leben hier in neuen und anders geordneten Bahnen zu verlaufen: Menschen unterschiedlichster Hautfarben lachten und feilschten an Marktständen; Kinder jagten verspielt Hunden und geflickten, ledernen Bällen hinterher; Junge und Alte saßen tratschend beieinander, hielten sich an Händen, spielten Karten, tranken Kaffee und Likör oder rauchten schwarzen Tabak.
Der junge Mann verstaute das Okular im Innenfutteral des Mantels, stützte die Arme auf, lehnte sich zurück und genoss für eine Weile die heiße Luft und das Licht der Sonne, die im Zenit stand.
Die Nacht in der Arena und der zügige Marsch durch die Stadtviertel hatten ihm einiges abverlangt; und noch immer steckte ihm die lange Schiffsreise in den Gliedern.
Er legte sich hin und schloss für einen Moment die Augen, um an seine Heimatinsel, an seinen Lieblingsplatz über den Klippen, zu denken, wo er seit frühester Kindheit Stunden um Stunden verbracht hatte. Jahrelang war er immer wieder dorthin zurückgekehrt.
Er saß auf der äußersten Kante des Felsbruchs, ließ die Beine über dem Abgrund baumeln und betrachtete das Meer darunter, das sich an den Felswänden brach und an manchen Tagen die Gischt bis zu ihm hochspülte.
Beinahe konnte er das Salz auf den Lippen schmecken.
„Du bist nicht von hier“, ertönte die helle Stimme eines Jungen hinter ihm, „die von hier haben nicht so was“, er formte mit den Fingern das Okular nach, „wie heißt das denn? Und auch so einen Mantel haben die nicht. Wo bist’n du her? Was is das denn? Da drin?“ Er wies auf das Futteral. Offensichtlich hatte der Junge ihn schon eine ganze Weile beobachtet und setzte sich nun, ohne Scheu, direkt an seine Seite.
Der Mann sah ihn an und freute sich über das offene Wesen des Kleinen, der ihn jetzt aus großen, braunen Augen anblickte. Aus Gewohnheit streifte er mit seinem inneren Blick kurz über dessen Feld und was er empfing, löste einen Funken Glück in ihm aus. Er musste lächeln.
„Komm. Ich zeig dir was“, trällerte der Junge, war schon wieder auf den Beinen, hatte die Hand des Fremden genommen und versuchte, ihn hochzuziehen.
Er folgte ihm, stand auf, griff nach dem Mantel und lief, an der Hand des Kleinen, den Hügel und einige Treppen hinab, mitten hinein in das Treiben des Platzes.
„Komm! Komm!“ Der Junge ließ nicht nach, ihn durch die Menschenmassen irgendwohin zu zerren.
„Amid!“ Eine großgewachsene Frau mit rötlich gelockter Mähne war hinter einem der Marktstände hervorgetreten. „Was stellst du denn wieder an?“, tadelte sie ihn liebevoll auf Farsi und strich ihm über die Haare. „Entschuldigen Sie“, sprach sie den Mann an. „Ich hoffe, er hat Sie nicht belästigt. Wie dumm von mir: Sprechen Sie überhaupt diese Sprache?“ Den letzten Satz hatte sie auf Italienisch formuliert.
Der junge Mann nickte, doch bevor er etwas erwidern konnte, wandte sich die Frau wieder an den Jungen.
„Ich hab dich überall suchen müssen. Das geht so nicht, Amid. Die anderen Viertel sind gefährlich und ich mache mir Sorgen.“ Schuldbewusst blickte der Junge sie mit großen Augen an. „Und nicht diesen Blick. Du weißt genau, das zieht nicht bei mir.“ Sie sah wieder zu dem Mann. „Es tut mir leid, aber wir müssen weiter. Amid hat heute schon seine monatliche Untersuchung verpasst und ich habe nur mit Mühe einen späteren Termin bekommen. Entschuldigen Sie uns, ja?“
Damit machten sie sich auf den Weg. Amid winkte ihm noch zu, und dann waren die zwei auch schon in dem bunten Treiben verschwunden.
Während die Frau mit dem Jungen gesprochen hatte, konnte der Mann auch in ihrem Feld entdecken, wonach er suchte. Sollte das Schicksal sich fügen, würde er gewiss bald wieder auf die beiden treffen.
Zufrieden, so schnell schon mögliche Kandidaten gefunden zu haben, wandte er sich nun den Menschen zu, die um ihn herum fröhlich ihren Alltag verlebten. So viel Unbekümmertheit hatte er lange nicht mehr gesehen.
Mit wenigen Handgriffen formte er einen Rucksack aus seinem Mantel, schulterte ihn lässig und ließ sich hineinziehen in das Treiben der Menge. Er folgte dem Menschenstrom, der ihn, wie als natürliches Element eines inneren Kreislaufs, mal an den Rand, dann wieder ins Zentrum des pulsierenden Organismus trug. Stundenlang trieb er in Mäandern durch dieses Flussbett aus Menschen und Nutztieren, vorbei an Marktständen, Brunnen und Skulpturen. Der Platz kam ihm so, während er kreuz und quer herumwanderte, noch um vieles weitläufiger vor.
Erst gegen Abend ließ er sich erschöpft auf dem Holzsessel eines rustikalen Straßenlokals nieder. Die auf dem Tisch ausgelegte Speisekarte erinnerte ihn daran, wie hungrig er eigentlich war und dass er den ganzen Tag über noch nichts gegessen hatte. In einem der Straßenläden hatte er gerade mal ein paar Flaschen Wasser erstanden, die er in regelmäßigen Abständen mit kleinen Schlucken geleert hatte.
Die Kellnerin, eine zierliche Frau mit dunklem Teint, warf, während sie Bestellungen an den anderen Tischen aufnahm, wiederholt verstohlene Blicke auf seinen muskulösen Oberkörper. In dem Trägershirt sah er aus wie einer der Männer aus dem Arbeiterviertel, die sich an den späten Nachmittagen gerne hier sehen ließen. Trotzdem unterschied er sich von ihnen. Ob es an seinen klaren, dunklen Augen lag oder an der Haltung, mit der er am Tisch saß und die Menschen beobachtete, hätte sie nicht zu sagen vermocht. Als sie schließlich vor ihm stand, konnte sie ihre Augen nicht von ihm lassen.
Er strich sich eine Strähne seiner schwarzen Haare aus dem Gesicht und blickte zu ihr hoch. Das Interesse in ihren Augen war nicht zu übersehen und er erwiderte es mit einem freundlichen Lächeln. Als ihr bewusst wurde, dass sie ihn anstarrte, sah sie verlegen zur Seite, nahm dann aber, ohne weiteren Versuch einer Annäherung, seine Bestellung entgegen.
Er bestellte ein Steak mit Salat und ein großes Glas Limonenwasser.
Nach kurzer Zeit, in der er müde dasaß und das Treiben auf dem Platz nur noch an sich vorüberziehen ließ, kam die Kellnerin mit dem Essen zurück.
Mit Bedacht kaute er lange an jedem Bissen des zu heiß gebratenen Fleisches, um seinen Magen nicht zu überfordern Zusehends kam er wieder zu Kräften.
Das Abendlicht warf in immer größeren Schatten die Vorboten der Nacht über den Markt. Langsam leerten sich die Stände. Planen wurden aufgezogen, Rollläden heruntergelassen und die Menschen verschwanden in den Nebengassen, als würden sie, nach dem großen Spiel des Tages, eine ganz andersartige Arena verlassen, eine, die nie für den Kampf um Leben und Tod errichtet war, sondern zur puren Lebensfreude und zum fairen Wettstreit, bei dem es nur Gewinner gab.
Der junge Mann blieb noch länger sitzen und ließ den Tag Revue passieren.
Nur wenige weitere Kandidaten waren ihm begegnet. Immer wieder hatte er, wenn eine Äußerung, eine Geste oder ein besonderes Funkeln im Antlitz Einzelner seine Aufmerksamkeit erregt hatten, einen Blick auf ihr Seelenfeld geworfen. Doch die in Frage kommende Energie war wie üblich rar.
Sein Essen bezahlte er mit einer der flachen Goldmünzen in Größe eines Zehncentstückes, die er in einem versteckten Schutzbeutel bei sich trug. Die Kellnerin freute sich über das seltene Geldmittel, war jedoch wenig überrascht. In diesen Tagen wurde mit allem gehandelt, was sich anderenorts wieder eintauschen ließ. Und Gold und Silber waren, wie zu allen Zeiten, die beliebtesten Währungen.
Langsam musste er sich um einen Schlafplatz kümmern.
Mit gewohnten Handgriffen langte er in den Rucksack, entfaltete ihn wieder zum Mantel, streifte ihn über, erhob sich und entschwand, nach wenigen Schritten, aus dem trüben Licht, das noch aus den Fenstern des Lokals strömte, ins Dunkel der Nacht.
3
Er wählte, den Weisungen des Zufalls folgend, eine Nebengasse aus, deren hellerer Schein ihn anzog.
Ganz still war es nun in dem Viertel. Nur das stotternde Brummen einzelner Stromaggregate unterbrach den Widerhall der Nacht. Die Bewohner der Häuser hatten ihre Fenster allesamt verschlossen. Sie schützten sich, so gut es ging, vor dem Sand und der Hitze, die schon seit Jahren im beständigen Wandel der Klimazonen auch die Nächte beherrschten.
Durch einzelne Glasscheiben fiel Licht auf die Pflastersteine. Helle Rauten breiteten sich als schräges Muster vor ihm aus. Er folgte den Lichtstellen, trat mit seinen Schritten hinein, empfand immer mehr Freude dabei und hüpfte bald, verspielt wie ein Kind, über das Schachbrett der abendlichen Stunde.
Es erinnerte ihn an seine Eltern, an gemeinsame Abende in der Jugendzeit, als sie am offenen Kamin über einem Brettspiel um die Wette geeifert, miteinander gelacht und sich unterhalten hatten.
Dann fiel ihm seine Geliebte ein, eine junge dunkelhaarige Frau, mit der er so gern seine Nächte verbrachte, die ihm nun jedoch seltsam fern und wie entfremdet schien.
An die Freunde dachte er, den nächsten, vertrauten Kreis seiner Weggefährten. Je länger seine Reise angedauert hatte, desto schwerer war es ihm gefallen, ihre Ströme und inneren Bewegungen im großen, kosmischen Feld nachzuvollziehen. Umso mehr freute er sich auf das Wiedersehen mit den geliebten Menschen. Vor allem, da ihn jetzt nur noch wenige Tage von seiner Inselfamilie trennen sollten. Allerdings hatten die Erinnerungen die kurze ausgelassene Stimmung gedämpft. Er empfand einen Anflug von Einsamkeit. Gedankenverloren schritt er weiter durch eine der Gassen, die nun in einen nächsten, um vieles kleineren Platz mündete.
Sein Blick fiel auf einen vierschrötigen Mann, der eben erst seinen Marktstand mit Holzplanken sicherte. Es handelte sich wohl um einen der Bauern aus den umliegenden Landstrichen, von denen ihm auch am großen Platz einige begegnet waren. Dieser hier hatte scheinbar besonders lange ausgeharrt, um seine exotischen Früchte und Getreidewaren anzubringen.
Der junge Mann wollte seinen Weg eben im Schatten der angrenzenden Häuserfronten fortsetzen, als plötzlich ein seltenes Leuchten hinter dem Laden aufflackerte.
Er sah genauer hin und erkannte im dämmrigen Licht einer Gaslaterne ein Mädchen, das hinter der Rückwand zum Vorschein gekommen war. Ihre Energie strahlte aus sich heraus quer über den Platz. So ein Feld war ihm lange nicht begegnet. Er hielt inne und beobachte die Kleine.
Ihr verschlissenes Kleidchen flatterte im Wind. Sie mied das Licht, hielt sich versteckt und spähte mit großen Augen verstohlen um sich.
Eine ganze Weile beobachtete sie gespannt den Bauern, wie er noch einige Steigen seiner Waren in das Heck eines verbeulten Kombis verlud. Dann, als sie glaubte, seine Abläufe einschätzen zu können, trat sie auf Zehenspitzen hervor, griff mit beiden Händen in den noch offenen Laden, entnahm ihm so viele Paradiesäpfel, wie sie in Armen und Händen tragen konnte, und wollte ebenso schnell wieder verschwinden. Plötzlich erschien der Mann auf der anderen Seite des Holzverschlags. Er baute sich direkt vor ihr auf. Sie hatte sich getäuscht, er hatte sie schon lange bemerkt. Ausdruckslos blickte er sie an, holte mit seiner Pranke aus und schlug ihr ins Gesicht.
Das Mädchen flog ein paar Meter nach hinten, mit ihr die roten Äpfel, die auf ihrer Flugbahn einen Streifen des Laternenlichts querten und seltsam in der Luft tanzten, als hätte jemand mit ihnen jongliert. Der Kopf des Mädchens schlug hart auf dem Steinsockel eines Brunnens auf. Ein scharfes Knacken schoss über den Platz. Ihr Schädel war gebrochen. Sie blieb regungslos liegen. Die Äpfel kullerten noch hinterher und sammelten sich, als würden sie zu ihr wollen, nahe an dem verkrümmten Körper.
Dann war es still.
Der Bauer starrte auf die Kleine. Sekunden vergingen. Wie in Zeitlupe stapfte er schließlich auf sie zu, beugte sich hinunter, wollte sie berühren, hielt jedoch, als ihm bewusst wurde, was er angerichtet hatte, in der Bewegung inne. Er sank lautlos auf die Knie, stürzte seinen Kopf in die Hände und ein heftiges Schluchzen, einem Aufschrei gleich, schüttelte den groben Körper. Im nächsten Moment riss er seinen Kopf hoch, jagte mit den Blicken über den Platz, taumelte rückwärts, raffte hastig noch übrige Waren zusammen, sprang in den Wagen und raste mit jähem Aufheulen des Motors davon. Die roten Bremslichter warfen einen letzten Schein auf den Platz, als er um die Ecke der nächsten Gasse bog und verschwand. Das Brummen des Motors verklang immer leiser hallend in den Häuserschluchten.
Im spärlichen Laternenlicht lag der Platz nun wieder friedlich da. Das Kleid des Mädchens flatterte immer noch im Wind.
Langsam löste sich der junge Mann aus dem Schock, der ihn seit dem Sturz der Kleinen hatte erstarren lassen. Er lief, wozu er minutenlang nicht in der Lage war, zu ihr.
An ihrer Seite angelangt, kniete er sich hin, tastete mit den Fingern am zarten Hals nach dem Puls. Ganz schwach nahm er die feine, unregelmäßige Wölbung ihrer Haut unter seinen Fingerkuppen wahr. Sie lebte noch.
Er setzte sich neben sie, nahm ihren Körper hoch. Sie wog nicht mehr als ein Vogel. Behutsam zog er sie ganz dicht an sich, umhüllte sie mit seinen Armen und barg sie für diesen letzten Moment ihres Lebens in seiner Wärme. Mit der ganzen Kraft des Herzens griff er in seinem Inneren nach der großen Liebe, zu der er fähig war wie kaum jemand sonst. Und er schenkte sie ihr. Ließ sie einströmen in sie und wiegte sie, sacht, wie ein blühender Baum ein Kind wiegt, wenn es hoch in seiner Krone sitzt im Sommerwind.
Ein letztes Mal schlug sie ihre schon trüben Augen auf und blickte ihn an. Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie flüsterte etwas. Er neigte sein Ohr an ihre Lippen.
„Für meine Mutter. Äpfel aus Paradies. Sie krank. Braucht. Bringst du? Mutter. Bitte. Bitte.“ Im letzten Ausatmen verklang ihr Flüstern. Ihre Augen schlossen sich und ihr Herz verstummte.
Der junge Mann, der das Unsterbliche schon oft mit eigenen Augen gesehen hatte, blickte nun der sich lösenden Seele nach, die langsam dem Körper entwich. Staunend sah sie zu ihm herab und er erzählte ihr, mit einem einzigen Gedanken, von der Ewigkeit und den liebevollen Geistern ihrer Vorfahren, die sie erwarten würden. Schon erschien der helle Schimmer des Tores hinter ihr, das sich immer öffnet, wenn ein Mensch geht, und der sie nun umstrahlte und wie Flügel um ihre Schultern leuchtete.
Dorthin wurde sie nun gehoben, ganz sacht, wie ein Blatt im Wind vom Baum bricht und nach oben getragen wird, wenn das Leben entschieden hat, ihm, bevor es fällt, noch einmal die Weite und Schönheit der Welt zu zeigen.
Der junge Mann löste seine Umarmung und legte den leblosen Körper auf die Pflastersteine. Während das Blut aus ihrem Schädel sich mit dem Rot der Äpfel vermischte, ging er langsam seines Weges. Er blickte nicht zurück.
Ihren letzten Wunsch würde er nicht erfüllen können. Die Genesung ihrer Mutter musste er dem Schicksal überlassen. Für die Kleine war das aber auch nicht von Belang. Jetzt nicht mehr.
Nachdem er den Platz verlassen hatte, schälte sich langsam ein Schatten aus dem Dunkel einer Häuserfront. Eine junge Frau wurde sichtbar. Sie hatte die letzen Augenblicke mitverfolgt, nachdem sie bei einem nächtlichen Spaziergang wie zufällig auf den Platz gestoßen war. Sie wischte sich Tränen aus dem Gesicht, fuhr sich zitternd durch die blonden Haare und ging einige Schritte auf den kleinen, toten Körper zu. Entsetzt wandte sie sich ab.
Dann sah sie dem jungen Mann hinterher, der wie ein schwarzer Engel in der Nacht verschwunden war.
4
Es muss doch irgendwo … Claire wühlte in den Schubladen ihrer Kommode. Nachdem sie alle durchsucht hatte, gab sie es auf. Sie stand nackt vor dem Spiegel, der über der Kommode hing, sah hinein, zog die Augenbrauen hoch, drehte ihren Kopf nach rechts und nach links, blickte auf ihren neuen struppigen Kurzhaarschnitt, der sich nur schwer würde bändigen lassen, und schüttelte den Kopf.
Sie war knapp dran. In zwanzig Minuten sollte sie in der Redaktion sein.
Wo könnte noch einer …? Die kleine Reisetasche fiel ihr ein, die sie für die Nächte bei Jerome immer griffbereit im Vorzimmer stehen hatte. Letztens hatte sie zwei, drei Slips mit einem Griff hineingestopft. Sie hastete in den Flur, nahm die Tasche vom Boden vor der Garderobe hoch und wühlte darin weiter. Ha! Grinsend hielt sie einen weißen, spitzenbesetzten Slip in die Höhe wie eine Trophäe. Sie zog ihn an und dachte kurz nach. Auf einen BH musste sie notgedrungen wohl auch an diesem Morgen verzichten. Irgendwann, sehr bald, war dringend ein Waschtag angesagt.
Im kleinen Schlafzimmer ihrer Zweizimmerwohnung in Rive Gauche, dem fünften Pariser Arrondissement, zwängte sie sich in den engen beigefarbenen Rock, den sie am Vorabend in weiser Voraussicht nicht in eine Ecke geworfen hatte. Dazu passend nahm sie ihre letzte gebügelte weiße Bluse aus dem Schrank.
Jerome mochte diese Kombination, vor allem wenn sie in seinem Chefbüro, mit den zum Redaktionsgroßraum offenen Glasscheiben, eine Besprechung hatten. Rock und Bluse, meinte er, wirkten zwar ausreichend sexy, aber auch seriös genug, um den kursierenden Gerüchten über ihre heimliche Liaison nicht noch mehr Zündstoff zu geben.
Doch eigentlich war es ihr heute egal. Im Gegenteil. Sollte er nur einen mittleren Kollaps erleiden, nachdem er ihren Artikel wieder gekürzt und auf Seite zwölf verbannt hatte. Bouvier, der widerliche Redakteur, dem die Endkorrektur der Texte oblag, hatte dann zu allem Überfluss auch noch den fehlenden Buchstaben in ihrem Namen übersehen und so hieß die Urheberin ihres Artikels in der heutigen Ausgabe von „Le Monde“ Cladel statt Claudel. Es war der Mädchenname ihrer Mutter, den sie, schon von Beginn ihrer Journalistenlaufbahn an, als Pseudonym benutzte. So blieb sie, in gewissem Sinn, mit ihr verbunden und schaffte zugleich Distanz zu ihrem Vater.
Seufzend blickte sie kurz zur Seine, die sie, durch einen Spalt zwischen zwei Häusern der ersten Uferreihe, sehen konnte. Tiefe Wolken hingen über dem Fluss und zogen mit ihm durch die Stadt. Am liebsten würde sie den Rest des Vormittags blau machen, sich in eines der Künstlercafés im Viertel setzen, mit der Hand ihren nächsten Artikel schreiben und von den Touristen angestarrt werden, als wäre sie eine der jungen linken Schriftstellerinnen, die sich in Flugblättern und alternativen Zeitschriften immer radikaler zu Wort meldeten.
Sie zog den Rock wieder aus, knöpfte die Bluse auf und sah sich nach etwas anderem Brauchbaren um. Große Auswahl blieb ihr nicht.
Vor allem, weil sie mit Jerome nicht nur über den heutigen Artikel streiten musste, sondern ihn gleichzeitig dazu bewegen wollte, ihr die geplante Recherchereise nach Rom zu genehmigen. Also musste sie taktisch vorgehen. Am besten, ihm zuerst wegen der Kürzungen und Seite zwölf ein schlechtes Gewissen machen, dabei zugleich verführerisch und abweisend genug sein, dass er Angst bekommt, auch die folgende Nacht ohne mich verbringen zu müssen, und ihm dann im richtigen Moment die Zusage für die Romreise entlocken.
Also doch der Rock und die Bluse. Sie zog beides wieder an. Ihr Café au Lait am Küchentisch war mittlerweile kalt. Das hasste sie. Sogar an einem perfekten Morgen hätte schaler Kaffee ihr die Laune verdorben. Sie ließ ihn einfach stehen, packte ihr Neopad in die lachsfarbene David-Jones-Tasche und stand ungeschminkt mit zerzausten Haaren vor der Eingangstür. Das geht so nicht. Doch. Tut es. Anders schaue ich am Morgen, wenn ich neben ihm aufwache, auch nicht aus. Gerade verrucht genug, um ihn auf die richtigen Gedanken zu bringen.
Sie stieg in die eleganten Stöckelschuhe und lief die drei Stockwerke nach unten. Vor der Haustür schlugen ihr der Wind und die feuchtwarme Luft entgegen. Es würde Regen geben. Keinen Schirm dabei. Wird schon aushalten. Eigentlich wollte sie nur die wenigen Meter zum nächsten Taxistandplatz laufen. Doch es war einer jener neuen, autofreien Tage in Paris. Mittlerweile durften Fahrzeuge, egal, ob mit Benzin- oder Elektromotoren, nur noch an jedem zweiten Tag unterwegs sein. Das hatte sie vergessen. Also musste sie wohl oder übel den zehnminütigen Fußweg zur nächsten U-Bahnstation auf sich nehmen. Sie würde sich um einiges verspäten, streifte darum die Stöckelschuhe wieder ab, stopfte sie in die Tasche und rannte barfuß los. So konnte sie wenigstens ein paar Minuten aufholen und die schmutzigen Fußsohlen würde ohnehin niemand bemerken. Aber ihr würde es Spaß machen, dass zumindest etwas ihrem wahren Wesen und so gar nicht den neuerlich erstarkten Rollenklischees der besseren Pariser Gesellschaft entsprach.
5
„Mon amour!“ Jerome sprang vom Ledersofa auf und kam mit ausgebreiteten Armen auf sie zu. „Toll!
Diese neue Frisur! Was ist das für eine Farbe?“
„Blond, Jerome. Es ist einfach nur blond. Wie du mich gern hast.“ Ihr schnippischer Tonfall war nicht zu überhören.
„Aber es hat einen silbrigen Stich, nein?“, flötete er weiter, während er ihr durchs Haar fuhr und sie an sich zog.
„Ja, hat es. Meine Friseurin …“ Er küsste sie auf den Mund.
Gott, fühlt sich das gut an. Warum ist der nur so charmant? Und gut aussehend? Und warum lasse ich mich auf ein Gespräch über meine Haare ein? Und warum küsst er mich vor den offenen Glasscheiben und hört gar nicht mehr auf? Das geht in die völlig falsche Richtung.
„Jerome“, sie schob ihn etwas von sich, „was ist denn los mit dir? Das stört dich doch sonst immer, wenn die ganze Belegschaft uns beobachtet.“
„Es wird Zeit, dass wir das ändern. Diese Heimlichtuerei geht mir auf die Nerven.“
Das geht entschieden in die falsche Richtung.
„Ach ja? Tut sie das?“
„Das hast du dir doch immer gewünscht, meine Kleine, nein? Also machen wir es offiziell. Nächste Woche, was meinst du? Am Abend der Charity-Gala für die Libyer. Vor der ganzen Pariser Gesellschaft.“ Er strahlte sie an.
Meine Kleine. Wie sie diese Anrede hasste. Sie rang sich ein Lächeln ab.
„Aber lass uns das in Ruhe besprechen“, er war auf dem Weg zum Sofa. „Heute Abend. Bei mir. Um neun. Oui, mon chérie?“ Er nahm sein Pad zur Hand, tippte darauf und aus der gegenüberliegenden Wand wurde ein einziger, die Fläche deckender Screen. Offensichtlich hatte er nicht vor, das Gespräch fortzusetzen.
„Sonst noch was auf dem Herzen?“, fragte er, ohne sie anzusehen.
Er will es öffentlich machen. Ja, das hatte sie sich gewünscht. Aber schon lange aufgegeben zu glauben, dass es wahr werden könnte. Warum gerade jetzt? Geht sein schlechtes Gewissen so weit? Oder spürte er irgendwo, unter den Schalen seiner Perfektion, dass sie sich mit leisen Schritten mehr und mehr von ihm distanzierte?
„Jerome“, plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie an einem Wendepunkt in ihrem Leben stand. Irgendwie fühlte sie das jetzt ganz deutlich. „Die nächsten Wochen wollte ich in Rom sein und recherchieren. Hast du das vergessen?“
„Aber das lässt sich doch verschieben, nicht wahr? Die laufen dir doch nicht weg, deine Rebellen.“ Er bezog sich auf ihre Kolumne. Eine weitere kleine Spitze, die einmal mehr zum Ausdruck brachte, was er in Wahrheit von ihrer Arbeit hielt.
„Aber es ist mir wichtig. Das weißt du.“
„Und ich bin dir nicht wichtig?“
„Doch, natürlich.“ Etwas drängte jetzt in ihr. „Aber dabei geht es nicht um dich. Ich muss das für mich tun. Und für die Welt. Le Monde. Worum geht es denn hier?“
„Das frag ich mich auch langsam.“
„Du weißt, was ich meine.“ Sie blickte ihn an. „Wenn eine Institution wie Le Monde dem humanitären Auftrag nicht mehr nachkommt, dann bleibt nichts über, gar nichts, an dem sich eine geschundene Gesellschaft wieder aufrichten kann.“ Sie wandte sich ab. „Ich verstehe nicht, warum wir immer wieder darüber diskutieren müssen. Wie kannst du den Vorgaben der Eigner so widerspruchslos folgen?“ Aufs Neue hatte sie, im Gespräch mit ihm, eine Traurigkeit eingeholt, die sie in den letzten Monaten immer öfter gespürt hatte. Prompt kam ihr das Konfliktthema Nummer eins in den Sinn. Kein allzu gutes Argument, aber es passt. „Zum Glück willst du keine Kinder. Mir fällt es auch mit jedem Tag schwerer, mir vorzustellen, noch welche in die Welt zu setzen.“ Es wurde sehr still in dem ausladenden Büro. „Wir müssen etwas beitragen, Jerome, und an der Zukunft bauen. Hör wenigstens auf die Leser. Die lieben meine Kolumne.“
„Nur weil du diesen“, er fühlte sich in die Ecke gedrängt, „diesen Preis“, beinahe wollte er ‚lächerlichen’ sagen, „von ihnen bekommen hast? Was glaubst du, warum wir den überhaupt ausschreiben? Das ist Leserbindung. Nichts sonst. Außerdem“, er wurde lauter, „hättest du diesen Preis nicht gewonnen, dann hätte ich mich bei den Eignern nicht so für dich eingesetzt und es gäbe deine kleine verträumte Kolumne schon längst nicht mehr.“ Er übersah, wie sie sich mehr und mehr versteifte. „Die Rebellen der Menschlichkeit. Was für ein rührseliger Kinderkram!“ Er war zu weit gegangen.
„Du willst unsere Beziehung öffentlich machen?“
„Wechsle jetzt nicht das Thema.“
„Wir reden doch über nichts anderes. Zuerst wolltest du mit mir ins Bett, das hat nicht geklappt. Dann hast du mir diese Kolumne gegeben und ich habe mich, naiv, wie ich war, erweichen lassen und tatsächlich geglaubt, dass du an mir, an meiner Person interessiert wärst – und nicht nur an meinem Aussehen und an Sex.“ Sie ließ ihre Worte kurz stehen. „Und vor allem: dass du an mich als Journalistin glaubst.“
„Aber das tue ich doch, mon amour.“ Er kam wieder auf sie zu, versuchte sie zu beschwichtigen.
„Dann beweis es.“ Sie blickte ihm direkt in die Augen. „Lass mich nach Rom gehen. Lass mich dort recherchieren und dann gibst du mir eine Seite. Eine ganze Seite und verdammt noch mal nicht Seite zwölf!“ Sie war so klar und bestimmt, wie es ihr ihm gegenüber selten gelungen war. „Und wenn ich zurück bin, dann reden wir über alles. Über uns und wie es weitergehen soll.“
Mit der Genehmigung für die Reise saß Claire wenig später an der nordseitigen, drei Stockwerke hohen Glasfront der Großraumredaktion. Postmoderne Schalensessel waren in einer Reihe an der Wand befestigt und verstärkten den Eindruck einer Abflughalle, an die das neue Headquarter von Le Monde erinnerte.
Vor zehn Monaten, als die laufenden Kosten der erst vor wenigen Jahren errichteten Firmenzentrale im ersten Arrondissement alle Schätzungen sprengten, wurde das Prestigeobjekt schnell wieder abgestoßen und die Zeitung war in eine ehemalige Remise vor den Toren von Paris gezogen. Mittlerweile überstiegen die Renovierungskosten erneut den Plan und so geriet die Eignergruppe mehr und mehr unter Druck. Die Abteilungen für Soziales, Kultur und Bildung wurden gekürzt, die Aufmachung abermals geändert, das Marketing mit allerlei Lesereinbindung forciert und alles, was die Sensationsgier der Leute befriedigte, wurde schreiend groß auf die ersten Seiten platziert.
Claires Artikelreihe über die Rebellen der Menschlichkeit, in der sie von außerordentlichen Leistungen einzelner Ärzte, Dolmetscher, Sanitäter und Lehrer in Krisengebieten berichtete, hatte einen dementsprechend schweren Stand. Und Jerome setzte sich tatsächlich für sie ein. Wenn auch aus anderen Motiven, als ihr lieb war.
In machen Stunden hatte sie ihr perfekter Chefredakteur – der hohes Ansehen genoss und in einem Loft über der Pariser Innenstadt wohnte – auch in sein Herz blicken lassen. Die Seiten, die sie in diesen Momenten an ihm kennengelernt hatte, waren gut, tief und vor allem freundlich. Sonst hätte sie es auch, um alles in der Welt, nicht schon zwei Jahre als seine heimliche Geliebte ausgehalten.
Vor allem aber glaubte Claire an ihre Arbeit. Und das ließ sie so manchen Kompromiss eingehen und über vieles hinwegsehen. Sie wusste, dass ihr Artikel über die sozialen Fortschritte in einem der afghanischen Transitlager die Leser berührt, ihnen Hoffnung und Trost gespendet hatte. Darum war er auch zum Bericht des Jahres gewählt worden. Sie erlebte es immer wieder: Die tiefe Sehnsucht der Menschen nach Einigung, Lösung und Frieden war ungebrochen erhalten.
Trotzdem fühlte sie sich jetzt gerade ernüchtert und leer.
Sie hatte in dem Gespräch – oder sollte sie sagen: in dem Streit – mit Jerome ein falsches Spiel gespielt. Sie hatte ihn emotional erpresst und war sich gleichzeitig, ganz nebenbei, durch all sein kränkendes Verhalten klar geworden, dass sie es nicht mehr lang an seiner Seite aushalten würde. Es fühlte sich schmutzig an.
Zwischen den Glasflächen, auf die TV-Berichte, Börsenkurse und allerlei Datenkolonnen projiziert wurden, gaben vereinzelte matte Stellen den Blick auf den Himmel frei.
Es hatte wieder zu regnen begonnen und der Smog zog in grauen Nebelfetzen über die Stadt, wie schon seit Monaten.
Auch der Blick in das Innere des Hallenbüros machte wenig Mut. Redakteure jagten gestresst über Bodenlaufbänder, tippten nervös auf ihre Pads und diktierten in gedämpftem Tonfall Berichte über immer neue ökologische Katastrophen, den weltweiten Kampf gegen den Terror oder menschliche Dramen, die sich irgendwo an meterhohen Grenzzäunen zwischen Sicherheitstrupps und flüchtenden Massen ereignet hatten.
Es war nicht zu leugnen: Die Welt stand sozial und ökologisch am Abgrund. Mit ihr Le Monde und die Freiheit. Doch nicht nur die der Presse, sondern die jedes einzelnen Menschen.
Claire öffnete eine App und verband sich mit der Onlinereservierung des Reiseunternehmens, das zur Firmengruppe gehörte. Auf der Plattform fand sich wie üblich alles, was sie brauchte. Sie gab die Rahmenzeiten für eine sichere Flugverbindung ein, markierte die Parameter zur gewünschten Unterkunft und nach wenigen Minuten waren die Buchungen erledigt.
Schon am nächsten Abend sollte sie zumindest der Pariser Tristesse entflohen sein. Was auch immer in der Ewigen Stadt auf sie warten mochte, konnte nicht schlimmer sein als das Elend, das ihr hier auf den Straßen täglich begegnete.
Sie wollte den Berichten aus Rom nachgehen. In einem nordöstlich gelegenen Viertel der Stadt, nahe der Piazza del Popolo, sollte eine neue, intakte Völkergemeinschaft entstanden sein. Dorthin führte sie ihr Weg, um jene Menschen zu interviewen, die für den Wiederaufbau verantwortlich waren.
Vor ihrer Abreise hatte sie noch einiges zu erledigen. Der Berg von Wäsche auf ihrem Badezimmerboden war dabei das geringste Problem. Vor allem musste sie sich bei ihrem Vater verabschieden, den sie aus guten Gründen schon zwei Wochen vermieden hatte zu kontaktieren. In den letzten Tagen waren seine Nachrichten aber immer fordernder geworden und so sorgte sie sich, trotz allem, um seine Gesundheit und seinen Gemütszustand.
Sie zog das Headset aus ihrem Neopad und aktivierte einen Videocall.
Wie üblich blieb die visuelle Übertragung einseitig, da ihr Vater das Bild blockierte. Seine Stimme klang erschöpfter als sonst und obwohl er sich über ihren Anruf zu freuen schien, spürte sie, dass seine Gedanken bei anderen Themen blieben. Claire hakte nicht nach, sprach ruhig in ihr Pad und vereinbarte einen Besuch am Abend in der Villa, in der sie bei ihm aufgewachsen war.
Nach dem Telefonat öffnete sie ihren Newsground-Account. Das neue Social-Media-Netzwerk verzeichnete geradezu explodierende Userzahlen. Die Menschen zogen sich mehr und mehr in virtuelle Welten zurück. Viele Reiche hatten die Städte verlassen, um in abgeschotteten Arealen, umgeben von hohen Zäunen, zu leben. Städter setzten oft tagelang keinen Fuß vor ihre Wohnungen. Es lag auf der Hand, dass diese Netzwerke dadurch zu den wichtigsten Kontaktforen für Familien oder andere soziale Verbände zählten und die wichtigste Einkaufsquelle darstellten. Newsground war die neue Nummer eins. Vor allem, weil es sich in Sachen Datenschutz und Ethik höchsten Maßstäben verpflichtet zeigte und dieses Versprechen an seine User bislang auch hatte halten können.
Sie loggte sich auf ihrer Journalseite ein, überflog die neuesten Letters und stellte ihre News ins Netz. Sie erzählte in wenigen Worten von der bevorstehenden Reise, von ihrer Hoffnung, auch aus Rom über herausragende Leistungen der Menschlichkeit berichten zu können, und verabschiedete sich für die nächsten Wochen von ihren treuen Lesern wie üblich mit den Worten: Le Monde c’est à ceux, qu’espèrent – die Welt gehört denen, die hoffen.
Danach machte sie sich auf den Weg. Sie sah noch einmal über die Halle und für einen Moment war ihr, als würde sie zum letzten Mal den Blick über die lose befreundeten Redakteure, Journalisten und endlosen Reihen von Schreibtischen schweifen lassen. Sie schüttelte den Gedanken ab, trat aus dem ziegelroten Backsteingebäude und stand im Regen.
6
Der Kiesweg führte von den Parklauben bis hinauf zum Portal, der in französischem Neubarock erbauten Villa. Claire nahm, da sich der Regen gerade wieder beruhigt hatte, den alten Weg, den sie in den Jahren ihrer Schulzeit täglich hochgelaufen war. Sie kam an der verwitterten Steinbank vorbei, die immer noch am selben Platz stand und sie an ihre Mutter erinnerte. Es waren die frühesten Bilder aus ihrem Erinnerungsschatz und diese trug sie mit sich, behütet wie ein besonderes Kleinod.
Mit einem Taschentuch wischte sie die Steinplatte trocken, setzte sich kurz, legte die Hände in den Schoß und neigte ihren Kopf zur Seite. Wie gern hätte sie sich jetzt an die Schulter ihrer Mutter gelehnt, die hier oft auf sie gewartet hatte. Sie war der sichere Hafen gewesen, in den das damals kleine Mädchen einlaufen konnte, nachdem es, aus dem fremden Land der beginnenden Schulzeit, mit so vielen neuen Eindrücken nach Hause gekommen war.
Doch schon in Claires zweitem Schuljahr war die Mutter gestorben.
Still und ohne Aufhebens war sie durch Gift dem Leben entflohen – und hatte damit ein klaffendes Loch in Claires Seelenleben hinterlassen, das keine noch so große Bemühung des Vaters hatte füllen können.
Zudem gab Claire ihrem Vater im Stillen nach wie vor die Schuld am Selbstmord der Mutter. So schrecklich dieses Gefühl war, das sie erst viele Jahre später, in den Wirren der Pubertät, überkam, sie konnte bis heute nicht davon ablassen – seine Affären, seine Kälte und Lieblosigkeit mussten die Mutter aus dem Leben getrieben haben.
Das lag wie ein schwarzer Schatten über ihrer Beziehung. Und da sie es, ihm gegenüber, nie ausgesprochen hatte, nahm der Vater ihre distanzierte Art mit den Jahren als persönliche Kränkung und schließlich als pure Abneigung wahr. Was ja auch stimmte. Nur aus anderen Gründen, als er vermutete.
Entsprechend angespannt war ihre Beziehung über die Zeit geblieben. Mittlerweile jedoch ließ die Wahrheit sich immer schwerer verbergen und schrie und ächzte wie ein verbitterter Geist, der zeitlebens in einem dunklen Kerker eingeschlossen war und zeternd versuchte, ans Tageslicht zu kommen.