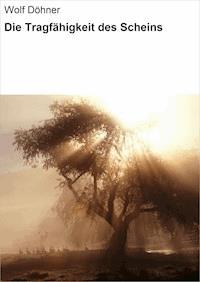4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zur Zeit des Endes des zweiten Irak-Kriegs trifft der Schrifsteller Bernd auf Katharina, die ihm ihre Geschichte in dem Land erzählt. Sie ist eine begnadete Erzählerin. Und Bernd fühlt sich alsbald wie in den Geschichten der Sheherazade aus deren Erzählungen in "Tausend und eine Nacht". Gekonnt spinnt sie den Faden vom Vergangenen ins Gegenwärtige und wieder zurück, bis Bernd schließlich meint, selbst Teil ihrer Geschichte zu sein. Doch dann ist seine Erzählerin plötzlich verschwunden und Bernd beginnt zu glauben, dass alles nur seiner Fantasie entsprungen ist nach einem flüchtigen Treffen mit einer geheimnisvollen Frau im Zug von Berlin nach München.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Wolf Döhner
Sheherazade - Mon Amour
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Scheherazade – Mon Amour
Wie alles anfing
Im Suq
Am Haken
Auf nach Tikrit
Unverhoffte Wende
Impressum neobooks
Scheherazade – Mon Amour
Erzählung
von Wolf Döhner
Wie alles anfing
Woran liegt es, dass mich Berlin immer wieder fasziniert? Ich bin doch stets nur Zaungast in dieser Stadt – anders als mein Cousin Uwe.
Er lebt förmlich auf, seit er wieder in Berlin ist. Die Trennung von Carola, seiner langjährigen Freundin in München hat ihn zunächst in Depressionen gestürzt, erzählte er mir. Aber jetzt fühlt er sich befreit. Ein ungeheurer Druck ist von ihm gefallen. Er hat spontan alle Brücken zu München abgebrochen und ist mit fliegenden Fahnen zurück nach Berlin gezogen – ohne zu wissen, was ihn erwartet. Aber er hat vom ersten Augenblick, in dem er wieder in der Stadt war, um nach einer Wohnung zu suchen, gespürt, dass er hierher gehört.
Biografien sind unerbittlich, auch und gerade, wenn die Beteiligten selber sie lange oder sogar nie verstehen. Für Uwe ist Berlin tatsächlich so etwas wie eine Heimatstadt. Hier hatte er die wichtigsten Zeiten seiner Jugend verbracht. Hier hatte er später studiert, die Studentenunruhen 69 miterlebt und im SDS agitiert.
Erst kürzlich standen wir aus Anlass der Beerdigung meines Vaters auf dem Dahlemer Dorffriedhof und hatten dann später noch einen Besuch bei Gollwitzer und Dutschke gemacht, die auch dort ruhen.
Am Bahnhof hatte ich mir ein Buch von Cees Noteboom gekauft: Allerseelen. Der Feiertag lag zwar schon mehr als einen Monat zurück. Und in Berlin kennt man nicht einmal den Begriff, geschweige denn den folgenden Feiertag Allerheiligen. Aber der Klappentext sprach mich an. Nicht zuletzt weil die Handlung in Berlin spielt.
Uwe hatte mich vom Bahnhof Zoo abgeholt. Ich war von Osten gekommen. Der ICE von München nach Hamburg über Berlin, durch die ehemaligen Zonenrandgebiete dann bei Ludwigstadt durch das Schiefergebirge und über die Thüringische Grenze nach Probstzella. Es war erst 14 Jahre her, dass diese Gegend aus einem langen Dornröschenschlaf der neueren deutschen Geschichte erweckt wurde. Und wenn man bei der Fahrt durch das enge Tal bis hin nach Hockeroda an der Saale und dann weiter nach Saalfeld fährt, könnte man fast vergessen, im ICE 1518 nach Berlin zu sitzen. Geradezu gemächlich und irgendwie unwirklich schlängelt sich der Zug durch die Landschaft. Die Zeit scheint still zu stehen. Und manchmal huschen die baufälligen Schemen der Vergangenheit am Fenster vorbei und man ahnt, dass es kein Dornröschenschlaf, sondern eher ein Albtraum war, aus dem damals ein Teil Deutschlands erwachte.
Am frühen Abend erreichten wir dann das Weichbild Berlins. Ganz selbstverständlich fuhren wir in diese Metropole ein. Ich dachte an die Zeit, in der eine Zugreise nach Berlin fast ein Abenteuer war. Wir passierten Schönefeld und später den berüchtigten Bahnhof Friedrichstraße, bevor wir am Hauptbahnhof ankamen
„Na, altes Haus, wie geht´s und wie war die Fahrt?“ begrüßte Uwe mich.
„Ich verbitte mir Anzüglichkeiten und Fragen zu meinem Befinden, bevor ich nicht ordentlich gegessen habe.“ Ich umarmte ihn und fügte hinzu. „Im Übrigen bin ich lediglich zwei Jahre älter als du, altes Haus.“
Wir verstanden uns wie immer sofort. Uwe hatte natürlich Plätze in einem Lokal nahe seiner Wohnung reserviert, wo wir dann ausgiebig speisten und uns austauschten.
Nach dem Essen zündete Uwe sich eine Zigarette an. Wir aßen gemeinsam fast ausschließlich in Lokalen, wo das Rauchen erlaubt war. Denn längere Zeit ohne Zigarette war für ihn ein Ding der Unmöglichkeit. Und so war eine seiner sich ständig wiederholenden Tätigkeiten das Drehen von Zigaretten, um seinen Vorrat aufzustocken. Uwe hielt mir sein voll gefülltes Zigarettenetui entgegen.
„Ich habe für dich bereits mit gebröselt,“ meinte er.
„Hast du die Nachrichten heute schon gehört? Saddam Hussein soll sich in der Nähe seines Heimatortes versteckt halten.“
„Nein, aber egal wo er sich gerade aufhält, es wird Zeit, dass man den Despoten fängt.“
„Stimmt, er ist ein Verbrecher. Allerdings war er das lange mit ausdrücklicher Duldung des Westens.“
„Moral ist in der Politik eine Hure. Das war schon immer so, ob in der großen Politik oder in der kleinen wie zum Beispiel in Berlin.“
Und nun wurden die neueren oder älteren politischen Skandale oder Skandälchen Berlins genussvoll durchgenommen und mit mehr oder weniger geistreichen Kommentaren versehen.
Das war das Prozedere, wenn wir uns trafen.
Nun saß ich wieder im Zug südwärts. Was fasziniert mich an Berlin? Ich wollte nicht ständig in der Stadt leben. Nach einer überschaubaren Zeit zieht es mich zurück in die Beschaulichkeit meiner schwäbischen Kleinstadt, wohl wissend, dass ich von dort immer wieder eine Auszeit benötige, sei es in Berlin oder in einer anderen Großstadt.
Es sind natürlich nur am Rande die kleinen oder großen Geschichten der Stadt, die einen an Berlin faszinieren. Es ist weit mehr. Arthur, der Protagonist des Buches von Noteboom wandert bei Schnee durch die neu vereinte Stadt. Er kennt sie schon seit vielen Jahren. Auf beiden Seiten war er als holländischer Kameramann tätig. Ihn begeistert vielleicht am ehesten das Unvollständige dieser Stadt, dieses Kommen und Gehen, die Prozesse. In unzähligen, scheinbar belanglosen, kurzen oder längeren Filmszenen sammelt er Eindrücke, die die Vergänglichkeit und das Werden dokumentieren.
Der Zug passierte die pottebene Mark und ihre nicht endenden Birkenwälder. Birken sind Pionierpflanzen. Sie bereiten Künftiges vor, indem sie dem Boden Halt geben, Halt um nicht davon geweht zu werden vom Wetter oder dem Wind der Zeit, Halt, um kommenden Generationen von Pflanzen ein Zuhause zu geben. Denn erst Vergangenes kann den Humus bilden, auf dem Neues wächst.
Was hat Berlin mit den Birken zu tun, dachte ich und beantwortete mir im gleichen Atemzug selber die Frage: Die Stadt strotzt geradezu vor Vergangenheit. Aber dazwischen wächst unermüdlich Neues. Manches kann man schon sehen, wie den Potsdamer Platz, der nach seiner Befreiung von den Wundmalen der Trennung zwar neue Wunden zu verkraften hat und nicht wiederzuerkennen ist. Man muss ihn jetzt nicht mögen. Aber er ist Ausdruck von Lebenswillen und Neubeginn. Und vieles Andere erstrahlt in neuem Glanz. Berlin ist ein urbaner Wald von unglaublicher Vielfalt und Schönheit.
Aus meinen Gedanken wurde ich jäh in die Wirklichkeit um mich zurückgerissen. Im Speisewagen wurde es laut. Ein Gast hatte keinen Fahrschein und auch keinen gültigen Ausweis. Der Schaffner kündigte ihm gegen seinen lautstarken Widerstand an, dass er in Naumburg den Zug zu verlassen hätte. „Ich habe hier Hausrecht", meinte er. „Notfalls muss ich die Polizei benachrichtigen."
Es war der gleiche Gast, vor dem mich vorhin der Kellner gewarnt hatte, als ich mich an einen leeren Tisch setzen wollte.
"Setzen Sie sich an einen anderen Tisch", sagte er, ohne dass ich ihn sogleich verstand. " Hier sitzt noch ein Gast, der gleich wiederkommt."
Er machte eine unmissverständliche Kopfbewegung, die pure Verachtung ausdrückte und zeigte auf ein halbleeres Bierglas, das noch auf dem Tisch stand.
Etwas verwirrt begab ich mich zu einem anderen Tisch, an dem schon eine junge Frau saß und las.
Der Gast kam dann tatsächlich kurze Zeit später zurück. Ein großer, braun gebrannter Kerl im Trainingsanzug. Die schwarzen Stummelhaare standen ihm wie eine Bürste vom Kopf. Seine tief liegenden Augen stachen unter starken Augenbrauen hervor, sodass er auf den ersten Eindruck eher furchteinflößend erschien,
Aber als er dann zu meinem Tisch kam und die junge Frau ansprach, war seine Sprache leise und fast schüchtern. Sie verstand ihn zunächst genauso wenig wie ich. Dann wurde klar, dass er ihr etwas zu Essen bestellen wollte.
Sie bedankte sich aber und bat gleichzeitig um Entschuldigung, dass sie hier säße und lese.
"Sei mir nicht böse, aber ich will jetzt gerade lesen."
Sie waren also vertraut – wie vertraut war nicht zu erfahren.
Später ging ich zu meinem Platz im Abteil, um etwas zum Schreiben zu holen. Als ich wiederkam, war der Platz mir gegenüber leer. Der Bürstenkopf saß alleine weiter vor mir, als dann kurz vor der nächsten Station die Szene mit dem Schaffner einsetzte.
Wo mochte die junge Frau sein? Welches Schicksal mochte beide miteinander verbinden?
Während ich noch darüber nachdachte, fuhr der Zug wieder an. Draußen lief der Trainingsanzug auf dem Bahnsteig dem Zug mit nach vorne gebeugtem Oberkörper hinterher. Seine Gestalt erhielt dadurch fast etwas Groteskes, so als fiele dieser große Körper beim nächsten Schritt unweigerlich vornüber zur Erde. Aber er fiel nicht. Er wirkte zornig und ratlos. Dann entschwand er meinem Gesichtsfeld.
So enden Geschichten, dachte ich. Oder sie fangen so an.
Ich erhob mich, um wieder zu meinem Abteil zu gehen. Im Aufstehen bemerkte ich auf dem Sitz mir gegenüber eine kleine, runde Dose aus Messing, deren Deckel eine emaillierte, sich kreuzende Doppel-Helix zierte. Auf diesem Platz hatte vor kurzem noch die Frau mit dem Buch gesessen.
Ich nahm das Kleinod auf und öffnete es, obwohl ich mir zunächst nicht sicher war, ob es nicht besser wäre, es liegen zu lassen oder dem Schaffner ungeöffnet als Fundstück zu übergeben. Obwohl....
Ja, ich war neugierig oder soll ich besser sagen interessiert? Vermutlich hätte sogar fast jeder so gehandelt wie ich. Ein Fundstück muss man zunächst untersuchen und sei es nur um Hinweise auf den Eigentümer zu bekommen. In dem Döschen lag ein winziges Bild des Mannes, den ich eben erst so verzweifelt auf dem Bahnsteig hatte hin und herlaufen sehen. Ich erkannte ihn sofort an seiner vorne übergebeugten Haltung und seinen buschigen Augenbrauen auch wenn er auf dem Bild in einem modischen Anzug gekleidet war, volles, schwarzes Kopfhaar trug und in fast lässiger Haltung auf der Promenade irgendeines touristischen Ortes zu sehen war. Er wirkte auf dem Bild keineswegs mehr so befremdlich, wie ich ihn hier im Zug erlebt hatte. Das Lächeln in seinem Gesicht nahm zudem den Augen den furchterregenden Ausdruck. Kurzum, mir lächelte eine gänzlich andere, durchaus sympathische Person zu. Seinen rechten Arm hatte er zur Seite ausgestreckt so, als habe er jemanden an der Hand. Doch dort fehlte dem Bild die weitere Information, denn offensichtlich war hier etwas abgeschnitten worden, so dass es aussah, als wäre die Hand amputiert worden.
Anscheinend gehörte das Fundstück der Unbekannten oder vielleicht sogar dem Unbekannten. Unter dem Bild lag zusammengefaltet ein Zettel: „Ein Stern ist uns in unseren Schoß gefallen. In Liebe K“, stand da mit großen, markanten Buchstaben geschrieben. Ich vermutete, dass sie von dem Mann stammten, dessen Äußeres so wenig zu seiner Sprache und zu der Schrift zu passen schien.
Das Zitat erkannte ich sofort als eines von Lasker Schüler. Viel wichtiger war jedoch, dass jetzt mein Jagdinstinkt geweckt war. Die Frau mit dem Buch musste noch in dem Zug sein, denn anders konnte ich das Verhalten des Mannes auf dem Bahnsteig in Naumburg nicht deuten. Also galt es nur, sie zu finden. Allerdings war mir klar, dass das Finden erst ein Anfang sein würde – von was wusste ich nicht. Aber ich war neugierig und ich merkte, wie meine Fantasie wieder auf Touren kam. Eine Fantasie, die mich in den letzten Jahren fast vollständig verlassen zu haben schien. Mein letztes Buch, das ich veröffentlichen konnte, lag schon fünf Jahre zurück. In der Zwischenzeit hatte ich mich notdürftig von dessen Erträgen und Gelegenheitsarbeiten über Wasser halten können.
Es war in der Tat nicht schwer, die Frau zu finden. Ich schlenderte suchend zweimal durch den gesamten Zug und dann sah ich sie. Sie saß in einem leeren Abteil und war in ihr Buch vertieft.
Ein fragendes Lächeln des Erkennens begegnete mir, als ich in das Abteil trat, bevor sie sich wieder ihrer Lektüre zuwendete.
Wie sollte ich mich an sie wenden? Sie war vollständig in das Buch vertieft. Es schien mir einfach ungehörig, sie dabei zu stören. Ich betrachtete sie eingehend. Sie mochte Mitte oder Ende dreißig sein, also gut zwanzig Jahre jünger als ich. Ihr dunkler Teint war vermutlich der Rest einer Urlaubsbräune. Er passte jedenfalls gut zu dem schwarzen Pferdeschwanz, der mit einem weißen Seidentuch zusammengebunden leicht hin und herwippte, wenn sie die Seiten blätterte. Ihre randlose Brille gab ihr etwas Lehrerhaftes. Aber das, was ich von den Augen erkennen konnte, zeugte von Interesse und Spaß am Lesen. Immer wieder huschte ein leichtes Lächeln über ihr Gesicht, das in seltsamem Gegensatz erschien zu dem strengen, fast melancholischen Zug um ihren Mund.
Nach einer Weile hob sie den Kopf.
„Warum fixieren Sie mich so eingehen? Ist etwas nicht in Ordnung mit mir?“
Sie schaute mich mit braunen Augen neugierig an und ich merkte wie ich rot wurde.
„Verzeihen Sie, dass Sie sich durch mich offensichtlich gestört fühlen. Eigentlich wollte ich das gerade vermeiden. Auf der anderen Seite muss ich Sie wohl stören, weil ich vermute, dass Sie das hier im Speisewagen liegen gelassen haben.“
Und damit hielt ich ihr das Döschen entgegen.
Eine steile Falte bildete sich zwischen ihren Augenbrauen, als sie es fast zögernd entgegennahm. Ohne es zu öffnen legte sie es neben sich, murmelte einen kurzen Dank und griff wieder zu ihrem Buch. Doch dann legte sie es wieder hin und sah mich mit einem fast spöttischen Lächeln an.
„Sie haben natürlich das Döschen geöffnet und kennen ihren Inhalt. Sie haben den Mann auf dem Bild erkannt und nun sind sie neugierig, wie das Bild und das Zitat zu der Wirklichkeit passen.“
Ich starrte sie mit offenem Mund an. Eine solche Direktheit hatte ich nicht erwartet. Sie aber stieß ein kleines, kurzes Lachen aus.
„Sie brauchen sich weder entschuldigen noch verlegen zu sein. Ich hätte sicher genauso gehandelt wie Sie. Aber ich denke, es ist an der Zeit, dass Sie sich vorstellen.“
Vielleicht wurde ich noch röter, als ich schon war, als ich ihr meinen Namen nannte. Doch dann hatte ich mich gefangen. Mir gefiel ihre gerade Art und die Sprache, die sie sprach.
„Natürlich haben Sie recht mit Ihren Vermutungen. Ich gebe unumwunden zu, dass ich neugierig bin. Das gehört eben zu dem Beruf eines Schriftstellers.“
Sie hatte die Brille abgenommen, löste das Seidentuch aus dem Pferdeschwanz, schüttelte kurz den Kopf, so dass ihre Haare sich auf ihren Schultern ausbreiten konnten.
„Beim Lesen stören mich die Haare, Herr Köhler, oder darf ich Bernd sagen“, meinte sie ohne einen Anflug von Koketterie. Dann fuhr sie fort. „Ich darf Sie doch bei Ihrem Vornamen nennen. Ich heiße übrigens Katharina, Katharina Ulrich. Erzählen Sie mir ein wenig von sich.“
Ich hatte mich bereits an ihre direkte Art gewöhnt und so berichtete ich in aller gebotenen Kürze über meine Verhältnisse und dass ich nun schon seit einigen Jahren in einer schöpferischen Flaute steckte.
Aufmerksam hörte sie zu und musterte mich dabei interessiert. „Wir sind fast Kollegen, denn ich bin freie Journalistin und kenne durchaus auch Zeiten, in denen nichts zu laufen scheint. Vielleicht kann ich Ihnen ja mit der Geschichte, die Sie mit Recht hinter dem Mann auf dem Bild vermuten, eine kleine Anregung geben“,