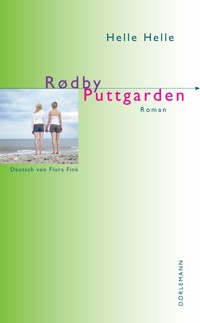19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
SIE – Mutter und Tochter, das sind SIE. Der Roman erzählt von Krankheit und Liebe und davon, wie es ist, in den frühen 80er-Jahren aufs Gymnasium zu gehen. Und von Sprache, die nicht ausreicht … oder dann doch?BOB – Bob weiß nicht recht, was er will. Seine Freundin, die Tochter aus SIE, geht ganz auf in ihrem neuen Studium. Er arbeitet ein wenig im Seemannshotel, richtet ihre Einzimmerwohnung ein und verliert sich in Kopenhagener Straßennamen. Vor allem wünscht er sich wohl eine Zukunft mit ihr. Sie ist die Ich-Erzählerin des Romans, erzählt aber nur von Bob und seinem Leben – insbesondere von dem, woran sie nicht teilhat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Helle Helle
SIE und BOB
Zwei Romane
Aus dem Dänischen von Flora Fink
DÖRLEMANN
Die dänische Originalausgabe »de« erschien 2018 bei Rosinante, Kopenhagen. Die dänische Originalausgabe »BOB« erschien 2021 bei Gutkind Forlag, Kopenhagen. Die Übersetzerin und der Verlag danken der Danish Arts Foundation für die großzügige Unterstützung der Übersetzung. eBook Ausgabe 2022 Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten © Copyright 2020 BOB, Helle Helle and Gutkind forlag A/S, København © Copyright 2018 de, Helle Helle and Rosinante & Co, København Published by agreement with Winje Agency A/S, Norway © 2022 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf unter Verwendung einer Grafik von Mikkel Carl Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-915-7www.doerlemann.com
Inhalt
SIE
1
Später läuft sie mit einem Blumenkohl über die Felder. Ade, Chinaschuhe. Alle Wege führen zu Wegen. Sie geht weiter durch die Vestergade, vorbei an den vorgartenlosen Häusern. Ein Mann winkt von seinem Frühstückstisch. Doch wo man herkommt, sind Häuser nicht vorgartenlos.
Der Asphalt glitzert, sie geht über den Platz. Durch die Glastür die Treppe hinauf. Sie öffnet mit dem Ellbogen, steigt aus den Schuhen:
– Ich bin’s!
Und noch einmal.
Es ist ein recht schwerer Blumenkohl. Die Sonne scheint Streifen auf den Boden.
Sie wohnen über dem Schneideraum, daher stammt auch der unfreiwillige Stufenschnitt. Sie versucht es mit einem Schornstein, aber die Hälfte der Haare fällt herunter. Sie föhnt sie mit Schaum und dem Spiegel auf einem Esstischstuhl, sie selbst kniet auf dem Teppich. Sie haben immer Teppichboden. Es ist eine Eckwohnung, die von außen nach nichts aussieht.
Das Wohnzimmer ist passend zum Kerzenständer gestrichen. In Altrosa, wobei sie die Kerze nicht anzünden. Oder sie zünden sie zweimal an, um festzustellen, dass sie rußt. Sie befinden sich viel am Fenster und auf dem Sofa, gerne mit der Wochenzeitung.
Sie bringt von der Hüttentour ein verkehrtes Besteckset mit nach Hause. Jetzt haben sie ein versilbertes mit der Gravierung IB. Sie legt die Platzdeckchen auf den Tisch, brät zwei Fische für sie beide. Es sind Aalmuttern, die da in der Pfanne zerfallen. Ihre Mutter schlägt die Hände zusammen. Das ist im letzten Jahr. Und keine Erinnerung an Abzugshauben.
2
Am dritten April sagt ihre Mutter:
– Ich habe wohl einen Stein verschluckt.
Sie gehen beim Stadion spazieren, die Anemonen sind da. Eine Gruppe kleiner Jungen spielt Fußball, unter Geheul und Geschrei, einer von ihnen weint am Torpfosten. Ihre Mutter trägt den Wintermantel. Sie wollen später Hamburger essen, deshalb der Spaziergang. Selbst trägt sie einen Isländerpullover, es ist noch zu früh, der Wind zieht durch die Maschen.
– Einen Stein, meinst du?, sagt sie, und ihre Mutter nickt.
– Einen schweren. Hier.
Sie bleibt einen Augenblick stehen und legt eine Hand auf ihren Mantel, unterhalb der Brust. Dann gehen sie weiter zum See. Dort zeigen sich im Gesträuch verstreute Krokusse, aber sie machen sich nichts aus Krokussen.
Auf dem Rückweg treffen sie Palle, ihre Mutter hebt vor Freude ein Bein. Palle arbeitet beim Kleidermann, manchmal kommt er rüber und isst sein mitgebrachtes Mittagessen bei ihrer Mutter im Laden. Scheint die Sonne, sitzen sie an der Hintertür, mit den Füßen draußen. Er muss eilig zu seiner Nichte, hat eine Torte auf dem Gepäckträger. Er dreht sich um und winkt ihnen zu, das Fahrrad schlenkert.
Sie reden nicht auf dem Heimweg. Erst kurz vor dem Platz sagt ihre Mutter:
– Ich glaube, ich würde Palle gerne irgendwann zu einem Rinderbraten einladen. Was meinst du?
– Tu das doch.
– Rinderbraten, so was macht man nicht nur für sich.
Sie räumt ihr Zimmer um. Die Pinnwand landet beim Fenster. Sie besitzt eine Sammlung von Zeitungsausschnitten und Postkarten und Fotos. Die Ausschnitte hängen an einer einzigen Reißzwecke, sie rollen sich über den Sommer zusammen. Das Fenster weist zum Hof hinaus, sie schaut dem Ampfer am Rückgebäude beim Wachsen zu. Die Mülltonne dort unten ist voller Haare. Eines Tages sieht sie sogar ein Paar geflochtene Zöpfe. Sie ist so überrascht, dass sie den Tonnendeckel zuknallt, und sie tritt in Kaffeesatz, da ist immer so viel Kaffeesatz.
Im Juni schafft ihre Mutter ihr Marmeladenbrötchen nicht mehr. Gewöhnlich isst sie dieses plus eines mit Honig und einen halben Toast mit Käse. Die andere Hälfte packt sie dann ein, um sie mit in den Laden zu nehmen. Jetzt sitzt sie da und trommelt mit den Nägeln auf die Tischplatte neben dem Teller, es ist Erdbeermarmelade, sie pustet sich eine Locke aus dem Gesicht. Sie hat wirklich keinen Hunger. Aber so geht es ja ganz vielen, dass sie so früh noch keinen Hunger haben.
Sie selbst wandert zwischen ihrem Joghurt und dem Flurspiegel hin und her, sie hat in einer Stunde Deutschprüfung, zieht sich eine andere Bluse an.
– Du wuselst herum, sagt ihre Mutter.
– Ich muss mich beeilen.
– Setz dich doch hin.
– Dann komme ich zu spät.
– Du hast noch genug Zeit.
– Habe ich nicht.
– Die ist hübsch, vielleicht magst du nur den Kragen noch aufstellen.
– Das macht doch außer dir niemand mehr.
– Na. Ja, das stimmt wohl, sagt ihre Mutter und blickt auf den Teller, beugt und streckt ihre Finger.
Einer der Zeitungsausschnitte stammt aus Politiken, sie findet ihn auf dem Gehsteig vor dem Bäcker. Es ist ihr neu, dass man die Zeitung hier beim Bäcker kaufen kann, und das kann man auch nicht, sagt die Bäckersfrau. Jemand hat sie selbst mitgebracht und dann verloren. Sie ist vom Vortag, und um darin zu blättern, legen sie sie auf die Theke. Das müssen wohl Touristen gewesen sein. Sie kauft ein Körnerbrötchen und eine kleine Packung Butter.
Zum Schulabschluss führen die Lehrer einen Sketch auf. Ihre Mutter klatscht und klatscht, und zwischendurch schwenkt sie das Liederheft vor sich, was eine Welle in Gang setzt. Sie öffnen die Tür der Halle zu den Feldern hin. Das ist eigentlich der Notausgang und damit streng verboten. Alles ist strahlend grün und blau dort draußen. Während der Schülerrede, in einer kurzen, atemlosen Pause, hört man zuerst den Kuckuck, dann den Kiebitz, und alle lachen.
3
Sie hat Schwierigkeiten mit ihrer künftigen Schultasche, die eigentlich ein Rucksack sein soll. Die Gurte sind zu kurz, und sie können nicht justiert werden. Sie kauft ihn zu Beginn der Sommerferien, gibt all ihr Geld dafür aus. Dabei will sie doch mit Lone und Lones Cousine ausgehen. Die Cousine ist von zu Hause ausgezogen, sie wohnt über dem alten Eisenwarenhändler. Sie braut Apfelwein aus Lageräpfeln von ihrer Großmutter, der sie sagt, sie koche daraus Kompott. Sie sitzen in der kleinen Wohnung der Cousine, jede mit ihrem hohen Glas, und hören Musik, sie singen mit, und wenn die Töne zu hoch werden, bewegt sie nur die Lippen. Sie weiß nicht, ob die anderen es bemerken. Der Apfelwein sickert in Arme und Beine, die Füße wippen auf dem Flickenteppich. Sie will aufhören, sich so sehr auf Sachen und Dinge zu fokussieren. Sie denkt an das Wort Substantiv, ob es das richtige ist. Sie operiert auch immer noch mit roten und schwarzen Buchstaben, und das, wie manches andere, macht ihr Angst, wenn sie ans Gymnasium denkt.
Die Cousine hat unter dem Dachfenster eine Kaktussammlung stehen. Die betrachten sie, machen verschiedene Typen aus:
– Erdbeere, Banane, Cowboy.
Wenn sie die Köpfe hinausstrecken, können sie beinahe den Wasserturm sehen. Auf der anderen Seite hängt die Abendsonne über dem Platz, in der Wohnung ist ein Fenster geöffnet.
Ihre Mutter sitzt im Sessel, die Wochenzeitung vor sich, das ist für sie Entspannung, die Augen auf den Seiten ruhen zu lassen, ohne zu lesen. Die Zeitung raschelt, sie will weiter nichts. Sie trägt ihre weichen Sachen. Ab und an kommt es vor, dass jemand unangemeldet klingelt. Aus diesem Grund hat sie gelernt, unter Fensterhöhe durch den Raum zu gleiten. Ihr Magen grummelt und lärmt, eine Fliege hebt von der Armlehne ab. Sie ist schon so weit, dass sie keine Insekten mehr töten kann. Zurzeit sind einige kleine grünflügelige Exemplare in der Küche, die setzt sie vorsichtig auf die Außenfensterbank. Jetzt steht sie auf, sie bekommt Halsschmerzen von allen Arten von Zug, es braucht nur eine Schwalbe vorbeizufliegen. Sie schließt das Fenster mit einem Knall, es scheppert kurz in der Hauptstraße.
Die Cousine zieht das Dachfenster herunter auf Lones Kopf, sie fallen alle drei um vor Lachen. Sie lachen und lachen. Die bestrumpfte Ferse der Cousine landet in ihrem Mund, und sie macht Spuckbewegungen, Lone schlägt in die Luft über ihrem Kopf:
– Au, au.
Eines der hohen Gläser ist umgefallen. Sie hat ein langes Haar auf der Zunge, fischt es aus dem weit geöffneten Mund. Die Cousine kommt auf die Füße und rettet einen Kaktus. Sie will selbst auch aufstehen, stolpert aber über die Teppichecke. Alles fängt von vorne an, der Himmel ist noch immer blau. Lone liegt da und schluchzt. Sie geht nicht aufs Gymnasium, beginnt bald eine Lehre als Köchin. Sie ist Fürsprecherin für eine natürliche Fettschicht in gusseisernen Pfannen. Sie wollen ins Step In, doch vor Mitternacht geht kein normaler Mensch dorthin. Und so haben sie noch zweieinhalb Stunden.
Sie rauschen hinaus auf die Straße, um zu sehen, was da geboten ist. Lone hat eine Beule. Sie werfen Steinchen auf Schilder, bis jemand kommt. Es ist ein Mann mit zwei Hunden, der eine interessiert sich für Lones Schuh. Der Mann zerrt hart an der Leine:
– Ne ne, nix da, sagt er.
Sie setzen sich auf eine Eingangstreppe und kichern. Als er verschwindet, werfen sie noch mehr Steinchen. Lone nimmt eine ganze Handvoll. Die Luft ist leicht säuerlich, vielleicht kommt das vom Apfelwein.
Ihre Mutter denkt an Niederschlag, Hagel auf Zeltdach. Sie liegt auf dem Rücken im Bett. Wolkenbruch in einem Schrebergarten, schwimmende Kartoffeln. Sie steht in einem gehäkelten Kleid bis zu den Knöcheln im Wasser, dieses Leben ist nichts für sie. Das ist sechzehn Jahre her. Aufklarung von Osten, das Kind in einer Trage auf dem Gartentisch. Sie dreht sich auf den Bauch um. Wenn sie endlich einschläft, wacht sie jede Nacht nach vierzig Minuten auf. Am Anfang wankt sie noch in die Küche und setzt Kaffee auf. Das ist im vergangenen Februar. Sie wäscht sich, schafft es sogar, einen Rollbraten in den Ofen zu schieben. Jeden Vormittag betrachtet sie im Laden ihre dunklen Augenringe, greift nach der Abdeckcreme Cloud. Ein einziges Mal ist sie kurz davor, eine Kundin anzuzischen, das ist so gar nicht sie. Sie sagt es ins Kopfkissen hinein:
– Das bin nicht ich!
Dann lächelt sie und denkt an etwas, das sie nicht vergessen will zu erzählen. Ein Auto bremst draußen auf der Straße, sie dreht sich wieder um.
Die Cousine hält das eine Taxi der Stadt an, aber es gibt bis zwei Uhr eine Warteliste, silberne Hochzeit im Hotel E4. Oder sie könnten jetzt gleich einsteigen, er muss dann ohnehin vom Hafen ins Zentrum. Lone sitzt auf einer Eingangstreppe, den Kopf in die Hände gestützt, dann will sie lieber mit dem Rad fahren. Die Cousine weiß nicht, was sie will. Sie können sich nicht entscheiden, und das Taxi fährt weiter. Radfahren geht allerdings gar nicht. Die Cousine hat ihr Rad in Onsevig stehen, und ihr eigenes hat einen Platten. Das passiert im Vorjahr, sie fährt über ein Brett.
Sie wollen den Rest des Apfelweins holen, aber der ist inzwischen warm. Tatsächlich ist es auch kein besonders guter Abend zum Ausgehen, die Leute bekommen ihr Geld erst in der nächsten Woche. Sie geht noch mit Lone bis zur Ecke. Sie schauen Friseurpreise an, saugen die Wangen nach innen, sagen dann für immer ade.
4
Sie stellt sich den Roman Gehsteiggedanken als einen dicken Wälzer vor, basierend auf den Beobachtungen, die sie über die Jahre auf dem Weg zur Schule und zurück gemacht hat. Diese Arbeit ist schon seit der vierten Klasse im Gange, auch wenn sie vorläufig noch nichts niedergeschrieben hat. Jetzt richtet sie sich mit Block und Kugelschreiber auf dem Sofa ein. Sie wird zur Kaffeetrinkerin, kocht in der Regel gleich eine ganze Kanne, und die fasst insgesamt vier große Tassen. Sie legt die Füße auf den Couchtisch und den Block auf ihre Beine. Sie weiß nicht, wo sie beginnen soll.
Am dritten Tag lässt sich ein Taubenpaar oben auf dem Dach nieder. Das inspiriert, sie schreibt eine lange gereimte Strophe über ihr Gackern, währenddessen leert sie zwei Kannen Kaffee. Doch dann wird ihr richtig schlecht, und sie kann vor lauter Übelkeit weder sitzen noch stehen, spürt starke Unruhe in sämtlichen Haarwurzeln. Sie holt sich einen Keks und sieht ihr Spiegelbild, der Kiefer hängt, selten war sie so blass. Als ihre Mutter vom Laden nach Hause kommt, liegt sie unter der Wolldecke und zittert. Sie schaut Tennis ohne Ton, ihre Mutter ordnet die Dinge auf der Fensterbank:
– Nein, wie sie da oben gurren. Ist noch Kaffee da?, fragt sie.
Jeden Tag nach der Arbeit hübscht ihre Mutter als Allererstes die Wohnung auf. Im Winter legt sie davor nicht einmal den Mantel ab. Ganz anders im Sommer, da zieht sie sich bis auf die Unterwäsche aus, sobald sie zur Tür hereinkommt. Dann dreht sie ihre Runde, stellt Sachen an ihren Platz zurück und gießt die Pflanzen, räumt den Esstisch auf.
Sie bietet zwischendurch mit leiser Stimme ihre Unterstützung an. Es stimmt schon, dass sie Unordnung schafft, aber sie ist ja auch selbst müde nach ihrem Tagwerk, jetzt ist sie zum Beispiel für eine Woche Urlaubsvertretung unten im Schneideraum, mit Beginn gestern. Sie fegt und wäscht ab und an Haare. Sie notiert Termine und steht mit Umhängen bereit. Sie trägt Clogs, von jemand anderem eingelaufen. Als sie um Viertel nach sechs die Abrechnung machen, knickt sie um, und das Oberleder reißt. Sie lässt sich nichts anmerken, stellt die Schuhe zurück in den Schrank. Da ist es doch besser, bei Annelise zu putzen. Da bekommt man Milch und Birnen aus dem Garten. Doch seit das Hauptbüro geschlossen ist, braucht Annelise keine Hilfe mehr. Sie sitzt von morgens bis abends auf einem Hocker vor ihrem Haus. Ihre Mutter arbeitet vor ihrer Mutter im Laden, deshalb rufen sie sich immer zu, dass sie bitte Grüße ausrichten sollen.
Ansonsten geschieht dies und das in den Sommerferien. Sie sortiert die Fotos im Album neu und backt zwei Sorten Weißbrot. Sie übernimmt ein paar Stunden im Laden, als ihre Mutter zur Untersuchung muss. Es ist ein stiller Tag, es kommen nur drei Kunden herein. Eine von ihnen ist eine frühere Mitschülerin aus der Parallelklasse, sie sieht sich Lippenstifte an. Sie probiert viele verschiedene, ihr Handrücken ist am Ende ganz rosa. Sie heißt Janine. Sie hat einen Pony und eine richtige Damenhandtasche. Nach etwa zwanzig Minuten zieht sie ein Taschentuch aus der Tasche, tupft ihre Hand ab.
– Du könntest auch ein Kosmetiktuch haben, sagt sie und will ihr eines über die Theke reichen.
– Nein danke, ich habe empfindliche Haut.
– Ah, okay. Fährst du denn in den Urlaub?
– Nein, ich gehe zu einer Party. Wir fahren zu Weihnachten nach Norwegen.
– Na, dann gute Reise, sagt sie und berichtigt sich, während die Türglocke, bestehend aus vier kleinen Kuhglocken an einer Kette, klingelt und dingelt.
Sie sind mit ihrer Wäsche auf der monatlichen Tour nach Holeby, die Wäscherei befindet sich im Nebengebäude eines alten Bauernhofs. Sie fahren mit dem Regionalbus, es ist Sonntag, der Geldbeutel ihrer Mutter ist schwer von Münzen. Während die Maschinen waschen, gehen sie die Straße auf und ab. Sie zieht ihre Schuhe aus, der Asphalt ist warm. Entlang der Gehsteige welken Studenten- und Ringelblumen dahin. Sie gehen bis zu den Einfamilienhäusern und einmal herum, dann ist es vier Uhr, und sie eilen zurück. Doch dann geht die Uhr verkehrt, es ist noch immer reichlich Zeit. Sie sitzen auf dem Wäschetisch und spielen »Das Schiff ist beladen mit«, sie verwenden eine verlorene Socke als Schiff.
– Das Schiff ist beladen mit S, sagt sie und wirft.
– Scheiße, sagt ihre Mutter, die Wäschereifrau kommt, sie lachen in je ihre Tasche. Und sie bekommen eine Schale Himbeeren geschenkt, sie balancieren davon, mit den Beeren oben auf der schweren Wäsche.
5
Sie wohnen auch in einer Zweizimmerwohnung am Stadtwald. Hier macht sie Bekanntschaft mit der Freude an Baumkronen, die sich lautlos draußen vor dem Fenster bewegen. Ihre Mutter will den Einzug feiern, sie schickt sie zu Brugsen, etwas richtig Gutes kaufen. Sie darf wählen, was immer sie will. Selbst bleibt sie zu Hause und befreit Dinge und Figuren aus Zeitungspapier. Der Teppichboden brennt, er besteht zu vierzig Prozent aus Nylon. Viel mehr haben sie auch gar nicht als die Glastrolle und den Optimisten. Sie steht mit einer Tischlampe auf, geht zur Fensterbank. Sie könnte vielleicht Vorhänge häkeln, wenn das nicht zu sehr in Mode kommt. Im Supermarkt gibt es derweil so viele Regale und Möglichkeiten, Garnelen und Baguette und warme Leberpastete, am Ende nimmt sie eine Dose Thunfisch und zwei Brötchen, sie wählt den Waldweg nach Hause. Ihre Mutter steht am Fenster und winkt mit der Tischlampe. An der Hauswand wächst eine Rose, sie ist gelb oder eher gelblich, blüht bis ultimo Juli.
6
Am Tag vor Schulbeginn besteht sie darauf, dass sie wach bleiben und gegen Mitternacht runter in den Hinterhof gehen. Man kann wohl Meteorenschwärme sehen, sie hat jemanden davon reden hören. Ihre Mutter nimmt ein Sitzkissen mit. Leider ist der Hof teilweise erhellt durch eine Lampe beim Bierlager. Ihre Mutter legt sich umgehend auf den Beton und ihren Kopf auf das Kissen, sie faltet die Hände vor der Brust, ihr Gesicht glänzt von der Nachtcreme:
– Das sind Flugzeuge, sagt sie.
– Es hat doch noch gar nicht angefangen.
Es raschelt unter dem Ampfer, das einzige andere Geräusch ist ein elektrisches Brummen. Sie selbst bleibt stehen, die Arme lang am Körper, den Kopf in den Nacken gelegt. Das Licht am Lager verlischt.
– Weck mich um halb acht auf, ja?, sagt ihre Mutter.
– Kannst du nicht für zwei Minuten die Klappe halten? Außerdem fährt der Bus um Viertel nach sieben, sagt sie.
– Von Rødbyhavn?
– Nein, von da kommt er.
– Das meinte ich doch, sagt ihre Mutter, und kurz darauf:
– Bist du nicht höllisch nervös?
– Doch, Mama, sagt sie mit großen Buchstaben, jetzt geschieht etwas im linken Gesichtsfeld, aber dann geht die Lagerlampe wieder an, jemand räuspert sich angestrengt hinter der Hecke.
Am nächsten Morgen hat sie noch Schlaf in den Augen. Kaltes Wasser hilft und Zeit und an etwas anderes zu denken. Sie denkt an die Fliege auf der Fensterbank, wofür sie sich wohl entscheidet nach dem Apfel.
7
Ihre Mutter verliert sich beim Haarlack in Gedanken. Einmal fährt sie in einem Seitenwagen beinahe bis Karleby, mit wehendem Halstuch. Die Bäume sind gelb und rot. Sie verwechseln welke Blätter auf einem Hofplatz mit rennenden Mäusen. Die Luft kann im Herbst so frisch sein, ohne all den Staub von Blumen und Beeten. Eine Diskussion findet statt, sie besteht auf kaltem Essen, ist zu nichts anderem bereit. Sie steigt ab, wandert den Rest des Weges an einem stillgelegten Eisenbahngleis entlang. Ihre Schuhe hält sie in der Hand. Sie würde nicht sagen, dass sie es sich nicht anders wünscht. Aber sie schafft den drastischen Wechsel zum Alltag nicht. Gekabbel über einen Aal. Schweigen. Da will sie lieber allein sein, doch sie ist nicht allein.
8
Im Ort wohnen 2572 Menschen. Und dennoch hat sie Tove Dunk noch nie gesehen. Tove trägt eine Lammfellweste, sie verwendet das Wort Lunch. Jeden Morgen im Bus kann sie Toves Altstimme vom hinteren Ende her hören. Selbst sitzt sie mittig, die Beine an die Rückenlehne vor sich gedrückt, sie blickt hinaus auf Häuser und Höfe.
Es ist Ende August, es regnet. Leute steigen an Kieswegen und Haltestellen ein, sie grüßen durch den Mittelgang hinunter. Ab Hillested hat sie die Sitzbank nicht mehr für sich allein, ein Mädchen aus der Mathe-B setzt sich neben sie, es tropft von ihren langen Haaren:
– Oh, entschuldige, sagt sie.
– Macht nichts.
– Ich habe sie eben gewaschen. Und Gott sei Dank nicht geföhnt.
– Man darf auch Glück haben.
– Das gibt es ja oft.
– Wie man es nimmt.
Das Mädchen holt eine Plastikbox aus ihrer Tasche:
– Möchtest du eine Traube?
– Nein danke.
– Fastest du etwa?
– Nee.
– Ah, okay. Ich dachte, du wärst mit Tove Dunk befreundet.
Vor der Endstation klart es auf. Sie gehen in kleinen Gruppen zum Gymnasium, sie hält sich an zwei Jungen aus dem Ahornvej, sie kennen einander von früher. Am Einkaufszentrum gehen die Jungen aber zum Kiosk weiter. Sie bleibt einen Augenblick stehen, überlegt, ob sie Geld dabeihat, was sie jedoch nicht hat. Auf dem Zentrumsplatz geht sie um eine große Pfütze herum. Tove Dunk läuft auf der anderen Uferseite, führt vor ihrer Stirn eine Hand durch die Luft und schüttelt sie:
– Puh, das ist mal ein feuchter Tag, sagt sie.
Sie lächeln beide. Dann gehen sie nebeneinander an der Kneipe vorbei. Auf dem Parkplatz sagt Tove Dunk:
– Kannst du mir die bitte kurz abnehmen?
Sie reicht ihr ihre Tasche, schlüpft aus dem Regenmantel. Unter der Fellweste trägt sie eine gestreifte Bluse mit Goldfäden, die zieht sie jetzt ein wenig zurecht.
– Super, danke fürs Halten, sagt sie.
Es bleiben noch zwei Minuten, bis es klingelt. Sie beschleunigen, reden nicht auf den letzten Metern. Kurz vor dem Hauptgebäude hört sie sich sagen:
– Ich faste gerade.
Und dann geht die Tür auf, es ist der Musiklehrer mit Tasse und Thermoskanne:
– Die Damen, sagt er, Tove Dunk lächelt:
– Bis dann, sagt sie und hebt zwei Finger.
Am selben Tag ist in der Pause ein Schülertreffen, es geht um die Anschaffung eines Getränkeautomaten. Man trifft sich in einem unordentlichen Kellerraum, genannt Kantine. Die Wortführerin sitzt im Schneidersitz auf einem Tisch, gleichzeitig geht das Gerücht, sie sei konservativ. Sie müssen sich zwischen kalten und warmen Getränken entscheiden. Außerdem soll eine automatenverantwortliche Person gewählt werden, man könne auch über eine Turnuslösung nachdenken. Was aber ein gewisses Risiko bedeuten würde, weil durchaus eine ordentliche Summe im Automaten liegen könnte. Die Debatte entwickelt sich. Ein Typ in Wüstenstiefeln schüttelt mehrmals den Kopf. Ein anderer fällt rücklings mit dem Stuhl um, landet auf einem Haufen Sporttaschen, reichlich Geschrei.
Auf dem Weg zurück zur Baracke sieht sie ihn mit den Wüstenstiefeln wieder, er steht in einer kleineren Gruppe draußen auf der Wiese. Sie gehen alle in die Abschlussklasse, jetzt beißen sie der Reihe nach von einem Brot ab. Eben als sie vorbeigeht, sagt einer von ihnen:
– Sie untergraben sich selbst.
Und der Stiefeltyp antwortet:
– Das ist total abstrakt.
Sie sitzt in Mathematik neben Hafni. Hafni transportiert ihre Bücher in einem Korb und trägt Pluderhosen. Sie ist so nett, Ergebnisse auf einen kleinen Block zu schreiben, noch bevor man fragen kann. Hafni ist in einen aus der Mathe-C verliebt, sie haben zusammen Russisch. Sie verfällt ihm Hals über Kopf in der ersten Stunde, seiner Haare wegen. Plus wegen der Plakatrollen, die jederzeit aus seinem Rucksack herausschauen, Hafni ist ganz schlecht deshalb:
– Ich habe Bauchschmerzen, und sicher falle ich durch, sagt sie, während sie ihren Korb aufräumt. Sie legt nach der Stunde alles auf den Tisch und packt neu ein. Als Nächstes haben sie Sport, sie gehen zusammen zur Umkleide. Hafni will am liebsten wie beim letzten Mal laufen gehen, was sie auch dürfen. Sie laufen durch das Einkaufszentrum zum Reformhaus. Schauen sich Tee und Brennnesselseife an, dann laufen sie zum Süßwarenladen und kaufen Softeis. Und das essen sie unter einem Baum.
In der letzten Stunde haben sie Geschichte. Sie sitzt ganz hinten und schreibt eine Liste von Dingen, die sie an sich verändern möchte. Vielleicht kann sie sich eine alte Matrosenjacke kaufen, sie überlegt auch, mit dem Malen anzufangen. Die Geschichtslehrerin trägt einen Jeansrock, sie hält ihre Brille in der Hand. Wenn sie eine Frage stellt, setzt sie die Brille auf und blickt in die Klasse. Sie sprechen über die feudale Gesellschaft, die Geschichtslehrerin zeichnet eine Figur an die Tafel, ihre Haare sind im Nacken kurz geschnitten. Jetzt ist der Himmel über den großen Schrägfenstern blau. Die Lehrerin dreht sich wieder um, schiebt die Brille auf die Nase:
– Was kennzeichnet das einfache Volk, come on?, sagt sie und geht ein wenig in die Knie.
Aus irgendeinem Grund fühlt sie sich bemüßigt zu antworten, ohne zuvor die Hand zu heben:
– Das ist total abstrakt, sagt sie, die Geschichtslehrerin legt den Kopf schief, die Knie noch immer gebeugt:
– Ja, also. Wie das?, sagt sie, aber da schickt zum Glück schon jemand eine Packung Butterkekse herum.
Auf dem Weg zur Haltestelle will sie ihre Brotzeit aus der Tasche holen. Als sie aber nach der Hauptstraße abbiegt, sieht sie Tove Dunk vorne auf einem großen Granitstein stehen. Ein paar aus der elften Klasse sitzen um sie herum im Gras. Sie lässt ihre Brotzeit schnell wieder in die Tasche gleiten, geht in normalem Tempo weiter die Hauswand entlang. Tove Dunk entdeckt sie und ruft:
– Willst du mit ins Prog Rock?
– Äh, was?, sagt sie, während sie die Straße überquert, niemand hört es.
– Gut, dass du da bist, sagt Tove Dunk und hüpft herunter.
Die anderen stehen auf, und so gehen sie als Grüppchen gemeinsam das letzte Stück zum Bus.
9
Im Poppelvej haben sie ein Regalmöbel mit eingebautem Spiegel und Barschrank. Sie stellen eine Flasche Glühwein hinein. Und vor dem Spiegel frisieren sie sich, wenn der andere gerade besetzt ist. Es gibt ihnen nichts, im Einfamilienhaus zu wohnen, die Türen sind aus Pappe. Sie will eine mit der Ferse schließen, und die Ferse geht durch wie nichts. Ihre Mutter wäscht sich im Waschbecken die Füße, und das Becken fällt herunter. Sie fängt es auf halbem Weg auf, es ist ein anstrengendes Manöver, auch wegen des Fußes. Der Eigentümer meint, es sei besser, sie zögen wieder aus. Jetzt soll das Haus an einen Witwer vermietet werden, er kommt zur Besichtigung. Ihre Mutter kocht am Vortag Dorschrogen. Doch dann bringt er einen Weihnachtsstern mit, und seine Jacke ist viel zu groß. Außerdem glaubt er zunächst, wohl wegen des Spiegels, hinter dem Regal sei noch ein weiteres Zimmer. Sie geben vor, seinen Irrtum nicht zu bemerken, auch dann noch, als er ihn erkennt. Ihre Mutter begleitet ihn ins Schlafzimmer, führt das Rollo vor. Er spricht über das Bett, als gehe es in die Vermietung ein, er legt sich sogar hinein. Sie eilen hinaus, sehen einander erst wieder an, als er in sein Auto steigt, oder vielleicht auch erst, als er die Autotür zuwirft.
10
Jeden Tag hat ihre Mutter einen stillen Moment auf der Eingangstreppe, wenn die Hauptstraße ganz ruhig ist, die Nachmittagssonne scheint in Arnes Radiogeschäft. Ein Hund wartet angeleint. Sie ist schon im achten Jahr im Laden, sie hat freie Hand mit fast allem von Einrichtung bis Sortiment. Sie bekommt sogar einen Kurs im Beschriften bezahlt, weigert sich aber, Büstenhalter zu schreiben. Sie wischt Kleiderständer ab und putzt die Glastheke und stellt sich nach draußen, lässt die Tür hinter sich offen. Schaut die Straße hinauf und hinunter. Keine Menschenseele, nur der Rücken der Bäckersfrau. Sie füllt den Mund mit Luft und hält sich die Nase zu. Seit Neuestem rauscht es recht beträchtlich in ihrem einen Ohr, außerdem hört sie ab und an ihre eigene Stimme nachhallen, wenn sie spricht.
– Irgendwie hallt es in meinem Kopf, sagt sie am selben Abend, als sie sich zu dem erwähnten Rinderbraten an den Tisch setzen.
– Irgendwie hören wir das auch, sagt Palle und versprüht dabei das im Mund zusammengelaufene Wasser, die Soße wogt, das Gelächter wächst an, sie biegen sich vor Lachen über den Tisch, müssen sich alle erst lange die Augen trocknen, bevor sie etwas essen können. Es ist wegen der Tabletten, eine Nebenwirkung. Jetzt lässt der Druck im rechten Ohr nach, der Sonnenstrahl wandert ein wenig. Die Straße erwacht wieder zum Leben, ein älteres Paar kommt aus dem Brugsen gerollt, der Hund erhebt sich.
Gleich hinter der Regionalbushaltestelle fliegt ihr etwas ins Auge, sie stellt die Schultasche auf eine Bank und fischt es heraus. Und hebt und senkt die Schultern, sie ist an diesem Tag völlig falsch gekleidet, in den Pausen zieht sie ihren kurzen Pullover hoch und runter, bis Hafni ihren Arm festhält:
– Das macht mich wahnsinnig!
– Man kann meinen Bauch sehen.
– Welchen Bauch?, sagt Hafni, und unter anderem deshalb weicht sie einen Augenblick später von ihrem Heimweg ab und kauft bei Brugsen einen Riegel Nougat mit Nüssen. Sie trifft beim Hinausgehen im Windfang eine alte Klassenkameradin von der Volksschule, wühlt vermeidend in Tasche wie Auge, eilt dann über die Straße und hinein in den Laden:
– Ich bin’s!
– Hey you, ruft ihre Mutter aus dem Hinterzimmer, und nach ein paar Minuten, die sie mit Bügeln aus Pappe verbracht haben, als sie mit dem Nougat nach Hause weiterwill:
– Ciao, ciao.
Darauf erwidert sie wie gewöhnlich nichts, begnügt sich mit einem sehr langsamen Winken beim Hinausgehen.
11
Sie ist bei Tove Dunk zum Abendtee eingeladen. Draußen von der Straße aus kann sie die Eltern beim Abwasch sehen, das Fenster steht offen, das Radio läuft. Sie sind hierher zugezogen, ihr Vater hat eine gute Stelle bei der Gemeinde. Er winkt ihr mit dem Spültuch. Sie wartet auf der Eingangstreppe, weiß nicht, ob sie noch anklopfen soll. Es vergeht eine ganze Weile. Alle ihre Namen stehen an der Tür. Endlich wird sie geöffnet, von Tove in einem orangefarbenen Rock:
– Komm rein, den habe ich von meiner Mutter geerbt, sagt sie.
Sie will die Chinaschuhe ausziehen, aber Tove schüttelt den Kopf. Der Ofen bullert los, Tove zieht eine Grimasse. Sie gehen durch das Wohnzimmer und hinaus auf die Terrasse, die Sonne hängt tief hinter ein paar hohen Kiefern am unteren Ende des Gartens. Der Vater begrüßt sie von der Terrassentür, die Mutter ruft ihr von hinter ihm ein Hallo zu. Dann wird drinnen der Fernseher angeschaltet. Die Luft ist kühl, es riecht nach vergorenem Fallobst. Tove hat Tassen und Milch auf den Gartentisch gestellt, sie setzen sich.
– Oder lass uns doch gleich Tee kochen, sagt Tove dann, sie stehen wieder auf, gehen hinein und durchs Wohnzimmer, hinter den Eltern vorbei. In der Küche trocknen zwei Spültücher auf der Heizung. Das Wasser hat offensichtlich schon gekocht, Tove gießt es in die Teekanne. Sie öffnet einen Schrank:
– Magst du Brie mit Honig?
– Ich glaube schon.
– Und dazu gäbe es Knäckebrot.
– Okay.
– Wir haben noch Knäckebrot, ruft die Mutter sehr laut aus dem Wohnzimmer, Tove zieht die Augenbrauen hoch:
– Ja, danke auch, ruft sie ebenso laut, schlägt sich mit einem Löffel gegen die Stirn. Sie gehen wieder durch das Wohnzimmer, Tablett beziehungsweise Teekanne tragend, die Eltern sitzen mit dem Rücken zu ihnen in der Sofaecke, die Mutter mit ihrem Kopf auf der Schulter des Vaters.
– Könnt ihr das nicht bitte leiser stellen? Man hört ja nicht mal mehr seine eigenen Gedanken, sagt Tove auf dem Weg nach draußen, und einen Augenblick später, als sie sich an den Gartentisch setzen:
– Spießer.
Da beginnen sie beide zu lachen, Toves Lachen ist hell und recht langgezogen, sie hören gar nicht mehr auf, auch, weil in der Teekanne nur Wasser ist, und wegen des Bries. Nach einigen Minuten taucht die Mutter in der Terrassentür auf, lächelnd:
– Was erheitert euch denn so?, fragt sie, da lachen sie ein wenig weniger.
Kurz vor acht wird an den Carport geklopft. Es sind der Stiefeltyp und einer, der Bob heißt. Sie kommen mit dem Rad von Gerringe, haben eine Tüte mit Bier dabei. Plus Pflaumen von irgendwo unterwegs, viele davon sind ein wenig zermatscht wegen der Bierflaschen. Sie setzen sich zusammen an den Gartentisch. Bob zündet eine Zigarette an, er bläst Rauch in Richtung der Mücken. Nach einer Weile steht Toves Mutter wieder in der Terrassentür:
– Vielleicht wollt ihr lieber hier drinnen sitzen, damit ihr nicht krank werdet, sagt sie.
– Möchten Sie eine Pflaume?, fragt Bob.
– Danke, sehr gerne, sagt sie und kommt zu ihnen hinaus, nimmt sich eine. Und isst sie, am Ende des Tisches stehend.
– Die sind gut, sagt sie.
– Von kurz vor Nebbelunde, sagt Bob.
– Von den Keramikern?, fragt sie.
– Nein, einfach von einem Baum, sagt Bob.
– Wir setzen uns gleich rein, sagt Tove, und ihre Mutter nickt, sie hat noch etwas Pflaume im Mund:
– Mhm, sagt sie.
Sie bleiben sitzen, es vergehen anderthalb Stunden. Sie hält die Bierflasche, die immer kälter wird, in den Händen. Toves Zähne klappern ein paarmal, Bob scheint unbeeinträchtigt von der Temperatur. Er lehnt sich mit seinem Bier Nummer drei über den Tisch, trinkt in kleinen ruhigen Schlucken. Dann wird es aber doch zu kalt, und sie stehen auf. Tove nimmt das Tablett, die anderen folgen ihr mit Bier und Stuhlkissen. Jetzt ist jedoch die Terrassentür zu, und sie müssen durch den Vordereingang hinein.
– Schmeißt die Kissen einfach dahin, sagt Tove und nickt in Richtung Ofen, sie geht weiter in die Küche, Bob zur Toilette.
– Wo, glaubst du, hat sie gemeint?, fragt der Stiefeltyp, er heißt Steffen.
– Vielleicht da, sagt sie und legt die Kissen auf ein Schuhregal, sie gehen weiter durch den Flur und gucken in ein Zimmer, aber es ist nicht Toves. Dann kommt Tove mit einem Schal um die Schultern zurück, sie öffnet die richtige Tür, die zu ihrem Zimmer, und schaltet das Deckenlicht an, macht es schnell wieder aus, holt Kerzen.
Die Bierflaschen sind durcheinandergeraten, sie wissen nicht, welche wem gehört. Bob hebt eine Flasche hoch, deren Etikett ganz zerrupft ist:
– Wer von uns hat die schwächsten Nerven?, fragt er, und es ist ihr Bier, sie nimmt es ihm ab, trinkt einen Schluck. Sie sitzen eine Weile schweigend da. Bob dreht sich auf seinem Stuhl um und beäugt das Plattenregal, zieht eine Platte heraus, hält sie vor sich. Tove geht auf die Toilette. Ein Streifen Licht fällt auf Steffens Bein, er hat das eine über das andere geschlagen. Er schaut ihr weiterhin in die Augen. Draußen im Flur sagt Tove etwas, ihr Vater antwortet.
Um Viertel vor elf brechen sie auf. Tove begleitet sie hinaus auf die Straße, noch immer in den Schal gewickelt. Sie verabreden, in zwei Wochen zusammen zur Eröffnung eines Literaturcafés in Nakskov zu gehen, sie sind alle drei im Förderverein. Sie kann auch beitreten, für zwanzig Kronen. Steffen hat vielleicht noch ein paar Einzahlungsscheine zu Hause. Es ist windstill, der Himmel schwarz und voller Sterne. Bob springt aufs Fahrrad, Steffen wühlt in seiner Hosentasche, hüpft dann hinten auf. Bevor sie um die Kurve biegen, rufen sie:
– Tschüs, ihr beiden!
– Danke für den schönen Abend!
– Schlaft gut! Danke fürs Bier, ruft Tove von ihrer Einfahrt.
Sie selbst ist inzwischen ein paar Meter weiter, sie bleibt einen Augenblick stehen und dreht sich um:
– Ja, danke für den Brie, ruft sie gerade noch rechtzeitig, bevor Toves Tür zugeht.
12
An der Kreuzung bekommen sie ein neues Sofa. Eines, das als gebraucht verkauft wird, aber es ist nicht gebraucht. Es ist mit rotem Velours bezogen und hat Fransen. Sie stellen es ans Fenster, eine Ratte verirrt sich hinein und unter die Fransen. Sie kommt aus dem Hotel, ihre Mutter jagt sie hinaus. Von jetzt an wollen sie aber mit Schaufeln schlafen. Wenn ein Lastwagen abbiegt, sieht es so aus, als wäre er auf dem Weg in ihr Wohnzimmer. Einer der Fahrer winkt mit seiner Zigarette. Er ist es auch, der ihnen beim nächsten Umzug hilft, trägt so gut wie alles allein. Dennoch können sie sich ewig lange seinen Namen nicht merken. Holger oder so ähnlich.
13
In Kalenderwoche 38 beginnt das neue Semester der Abendschule. Sie selbst hat sie beide für den Kurs angemeldet, Leben und Lebensphilosophie. Er findet in ihrem alten Klassenzimmer statt, der Lehrer heißt Per Tønnesen. Ihre Mutter zieht ihre weiße Bluse an und die Hose mit Abnäher. Sie ist ihr inzwischen zu groß, aber sie weigert sich, sie wegzugeben, besonders nach der Sache mit Bruno. In der Vorwoche kommt er angerannt, als sie vom Laden nach Hause unterwegs ist, überhaupt rennt er zu viel. Sie steht mit dem Tagesumsatz vor der Bank, da ist er hinter ihr:
– Verträgst du die Wahrheit, meine Liebe? Die Hose schlackert um deinen Hintern, und früher hast du sie so perfekt ausgefüllt.
Sie dreht sich langsam um, eiskalt bis in Arme und Beine, sogar bis in die Handtasche hinein:
– Was soll ich denn jetzt damit anfangen, Bruno?, sagt sie und atmet einmal tief durch, marschiert dann den Gehsteig entlang, so hart, wie Stöckelschuhe und Körpergewicht es zulassen, wackelt aber ab dem Acacia demonstrativ mit den Hüften, sie kann spüren, wie er noch immer starrt.
Leider kommt der Kurs wohl nicht zustande, weil sich insgesamt nur vier angemeldet haben. Die beiden anderen Teilnehmer sind ein Ehepaar aus Nysted, die Frau ist blind. Per Tønnesen sitzt mit der Liste am Lehrerpult. Sie warten ab, ob nicht im letzten Augenblick noch jemand auftaucht. Ihre Mutter studiert eine Ansammlung kleiner Löcher in der Tischplatte, sie stammen von einem Zirkel.
– Die stammen von einem Zirkel, sagt sie.
– Ah ja, sagt ihre Mutter.
– Was?, fragt die blinde Frau.
– In der Tischplatte, sagt ihr Mann.
– Das weiß ich, weil dies mein früheres Klassenzimmer ist, hört sie sich selbst mit einer unbekannten erwachsenen Stimme sagen, sie spricht sämtliche Silben sehr deutlich aus. Dabei kann die Frau ja durchaus gut hören. Ihre Mutter lächelt dem Ehepaar zu:
– Wir wohnen nämlich hier in der Stadt, sagt sie und zeigt aus dem Fenster.
– Ah so ist das, sagt der Mann.
– Ah ja, sagt die Frau und nickt.
– Aber Nysted ist auch schön, sagt ihre Mutter, und dann nicken sie alle bis auf Per Tønnesen, der sitzt mit hinter dem Kopf verschränkten Armen da, die Ärmel seiner karierten Jacke sind zu kurz.
Die neue Stimmführung bleibt ihr noch eine Weile. Auch wenn der Kurs nicht zustande kommt, wirkt es verkehrt, einfach aufzustehen und zu gehen. Sie reden über dies und das, ausgehend vom Titel des Kurses.
– Jetzt arbeite ich ja selbst in dem Bereich, sagt der Mann.
Er ist in seiner Freizeit Reiseleiter, in fast allen Ferien sind sie unterwegs. Sie waren unter anderem ganze elf Mal auf Madeira.
– Als meine Frau noch sehen konnte, hat sie die Wanderungen organisiert, sagt er, sie nicken wieder alle zusammen, Per Tønnesen mit dem Kinn auf der Faust. Wasser strömt durch eine Leitung, jemand öffnet unten in der Lehrerküche einen Wasserhahn. Sie lehnt sich vor, sieht die Frau an:
– Das muss ein Verlust sein, sagt sie.
– Man lernt, damit zu leben, sagt die Frau.
– Wäre es da nicht eigentlich besser, blind geboren zu sein? Dann weiß man nicht, was man verloren hat, sagt ihre Mutter, jetzt horcht Per Tønnesen auf, er räuspert sich, sagt aber nichts.