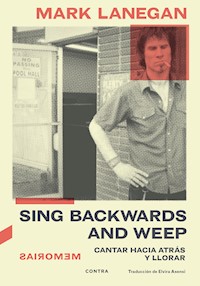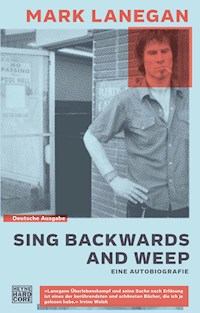
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Er hätte der Jim Morrison unserer Zeit sein können. Ausgestattet mit einer unverwechselbaren Stimme und Charisma, stieg Mark Lanegan Anfang der Neunzigerjahre mit seiner Band The Screaming Trees zu einer der Topbands der Grunge-Ära auf. Um dann umso tiefer abzustürzen. Drogensucht, Obdachlosigkeit und Straßenkriminalität waren die Folge. Doch während viele seiner Freunde wie Kurt Cobain das Jahrzehnt nicht überlebten, gelang Lanegan die Rückkehr auf die Bühne und war bis zu seinem Tod 2022 außergewöhnlich produktiv. Die unveränderte Neuausgabe von Mark Lanegans Autobiografie jetzt unter dem Originaltitel »Sing backwards and weep«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
DASBUCH
Von hinten im Bandbus bis nach ganz vorne an die Bar, vom abgeranzten Hotel in die Notaufnahme, auf der Bühne, hinter der Bühne: Sing backwards and weep schildert die ernüchternde Wirklichkeit hinter einer oft allzu romantisierend dargestellten Dekade der Rockmusik, erzählt von einem, der sie hautnah gelebt hat und seine eigenen Verfehlungen als Außenseiter, Schläger, Blackout-Trinker und Misanthrop mit brutaler Ehrlichkeit offenbart.
Als Mark Lanegan Mitte der 1980er-Jahre in Seattles Musikszene auftauchte, war er bloß ein weiteres »arrogantes, sich selbst hassendes Arschloch, das im Rock’n’Roll einen Ausweg suchte.« Innerhalb eines Jahrzehnts brachte er es als Frontmann der Grunge-Vorzeigeband The Screaming Trees zu Majorlabel-Ruhm, bevor er tief fiel und sich als abgewrackter Crack-Dealer und obdachloser Heroinsüchtiger durchschleppte, während seine besten Freunde mit Bands wie Nirvana, Alice in Chains oder Soundgarden an die Spitze der Charts schossen.
In seiner Autobiografie nimmt Lanegan den Leser mit in die düsteren, drogenverseuchten Gassen von Seattle, erweckt die damals brodelnde, alternative Grungeszene noch einmal zum Leben. Er schildert den Aufstieg und Fall der Screaming Trees, einer berüchtigten Acid-Rockband, die sich von den kleinsten Bars bis zu den größten Festivals der Welt hochspielte und deren Musik bis heute nachhallt. Lanegans erzählt mit brutaler Ehrlichkeit von seinen persönlichen Katastrophen, seinem Kampf mit der Drogensucht, der in Obdachlosigkeit, Straßenkriminalität und dem Tod einiger seiner engsten Freunde endet.
DERAUTOR
Mark Lanegan ist ein amerikanischer Sänger und Songwriter. Von 1983 bis 2000 war er Frontmann der Screaming Trees. Bereits 1990 erschien sein erstes Soloalbum, dem bis heute rund ein Dutzend weitere folgten. Zudem kollaborierte er mit Bands und Musikern wie Kurt Cobain, Pearl Jam, Marianne Faithfull, Moby, Queens of the Stone Age, UNKLE, Greg Dulli, PJ Harvey oder Isobell Campbell. Er lebt in Los Angeles.
MARKLANEGAN
SINGBACKWARDS
ANDWEEP
EINEAUTOBIOGRAFIE
AUSDEMAMERIKANISCHEN
VONNICOLAIVONSCHWEDER-SCHREINER
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel SINGBACKWARDSANDWEEP bei Hachette Books, an imprint of Perseus Books, LLC, a subsidiary of Hachette Book Group, Inc.
Die Arbeit des Übersetzers am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Unter www.heyne-hardcore.de finden Sie das komplette Hardcore-Programm, den monatlichen Newsletter sowie alles rund um das Hardcore-Universum.
@heyne.hardcore
Copyright © 2020 by Mark Lanegan
Copyright © 2021 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Lektorat: Markus Naegele
Redaktion: Thomas Brill
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, Memmingen
unter Verwendung des Originalumschlags von Alex Camlin/Chris Hannah
Umschlagabbildung: Anna Hrnjak
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29884-5V001
Für Tony
Und all meine anderen abwesenden Freunde
Fix
It’s true
It keeps raining baby
So crystalline in my head
Gonna watch from the balcony
Sing backwards and weep
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
1 JUGENDJAHREEINESJUNKIES
2 DASFRAGILEKÖNIGREICH
3 VERFÜHRTUNDVERARSCHT
4 WENNDUWIEDERANFÄNGST, ISTES, ALSHÄTTESTDUNIEAUFGEHÖRT
5 MEATLOAF
6 KLEINEDOLCHE
7 GEFEUERT, WIEDERANGEHEUERTUNDTAUSENDFORMENVONANGST
8 SCHICKESOUTFIT
9 YEAH, THISISTHECOPS!
10 HOUSEOFPAIN
11 BLUTIMWASSER
12 ERSCHÖPFTUNDAUSGEBRANNT
13 VIELSPASSMITDEMIDIOTEN
14 NICHTSCHLECHT, JUNGERMANN
15 TAKEMETOTHERIVER
16 JEFFREYLEEPIERCE
17 HABENSIEDENNACHTPORTIERGERUFEN?
18 DASISTGENIAL, HÖRSTDUDASNICHT?
19 SPANKINGTHEMONKEY
20 PARASITENKIND
21 TAGEDERFINSTERNIS
22 MEERDESSCHRECKENS
23 GOFUCK A DONKEY
24 WIEDERANDERNADEL
25 MÄNNERABENDMITJERRY
26 ZEITENDESWAHNSINNS
27 MISSAUSTRALIA 1971
28 RACHEISTSÜSS
29 LOTTOGEWINN
30 LUCKY
31 ISTDASLIEBE?
32 FAMILIENTREFFEN
33 ICHHABGRASGERAUCHT – HIV-POSITIV
34 AUSGOLDSCHEISSEMACHEN
35 EINEDICKETRÄNE
36 VONWU-TANGZUWAYLON
37 SPIELMITDEMTOD
38 WIRSEHENUNSINMIAMI, MANN!
39 NOTUNDELEND
40 EISKALTEGEISTERBAHNEUROPA
41 BAUMWOLLFIEBER
42 LETZTESPROSSEN
43 SEELENSTÜRME, ERLEUCHTUNGUNDWIEDERGEBURT
EPILOG – DERWOLFIMSEEHUNDPELZ
DANKSAGUNG
PROLOG
»POLIZEI.«
Mir war nicht gleich klar, was er meinte, zumal ich in Gedanken bei meinem ersten Schuss war, dem ersehnten Ende meiner Morgenroutine, dem Moment, an dem der dumpfe Schmerz allmählich nachließ.
»Polizei«, flüsterte der afrikanische Taxifahrer noch mal mit starkem Akzent, während er die Augen verdrehte und kurz die Schultern hochzog, woraufhin ich in den Rückspiegel sah und die drei jungen Typen in dem Van hinter uns entdeckte, definitiv Undercover-Cops, die dringend ein Opfer suchten. Zum Beispiel mich.
Mein eins neunzig großer Crossdressing-Drogen-Buddy St. Louis Simon und ich hatten gerade jeweils ein Tütchen Heroin und Koks organisiert, beides hatte ich relativ sorglos in meiner offenen Hemdtasche verstaut. Vorne in meiner engen Hose steckte außerdem eine Packung neuer Spritzen. Ich hatte nicht unbedingt damit gerechnet, der Polizei über den Weg zu laufen. Jetzt fühlte ich mich komplett ausgeliefert.
Zehn Blocks weiter war klar, dass wir verfolgt wurden. Wir fuhren durch Capitol Hill in Seattle, und als das Taxi in der Nähe meiner Wohnung hielt, sprang ich raus und lief möglichst unauffällig die Straße lang. Simon stieg auf der anderen Seite aus, er trug einen prolligen Jeansrock und Schuhe mit Keilabsatz, in denen er noch größer wirkte, und als er auf ein Baugrundstück zwischen zwei Häusern abbog, sah ich aus dem Augenwinkel, wie zwei Typen ihn zu Boden rangen. Schlechtes Zeichen. Ich war fast an der Ecke, als mir plötzlich ein kleiner junger Cop in Jeans und Muscleshirt vor die Füße sprang, mir seine Marke vor die Nase hielt und meinte: »Moment mal, Freundchen! Wo willst du denn so schnell hin?«
Ich hob automatisch die Hände und machte ein möglichst dämliches, ahnungsloses Gesicht.
»Nach Hause, wieso?« Ich zeigte auf das Haus, in dem ich wohnte.
»Was ist das?«, fragte er und griff nach dem Dope in meiner Hemdtasche.
»Was soll der Scheiß, Mann? Ich wohn hier! Was wollen Sie?«, rief ich mit gespielter Empörung und wich ein Stück zurück. Ich stellte mir vor, wie dreckig es mir im Knast ergehen würde, bevor mich jemand auf Kaution rausholen konnte, zumal ich mir wie gesagt noch keinen Schuss gesetzt hatte. Etwas weiter sah ich Simon und den Taxifahrer in Handschellen auf der Bordsteinkante sitzen, die Füße im Rinnstein. Der Rücksitz aus dem Taxi war komplett herausgerissen.
»Okay, Mann, ich will deinen Ausweis sehen.«
Ich sah meinen Pass oben auf dem Couchtisch liegen, neben Crackpfeifen und gebrauchten Spritzen. Keine Option.
»Den hab ich nicht dabei. Mein Name ist Mark Lanegan.«
Der Cop kniff die Augen zusammen, musterte mich und sagte: »Warst du nicht mal Sänger?«
Nachdem er mich zu seinem Überwachungswagen begleitet hatte, holte er ein kleines Schwarz-Weiß-Foto vom Armaturenbrett: ein Typ, der wegen Autodiebstahl gesucht wurde und mir ähnlich sah. Ich musste es mit seinem Kugelschreiber signieren, dann ließ er uns gehen.
1
JUGENDJAHRE EINES JUNKIES
ICHKAMIMNOVEMBER 1964 MITDERNABELSCHNURum den Hals per Kaiserschnitt auf die Welt und wuchs dann auf der falschen Seite der Cascade Mountains im kleinen Städtchen Ellensburg im Osten des Bundesstaates Washington auf. In meiner Familie gab es Bergarbeiter, Holzfäller, Schmuggler, Kleinbauern aus South Dakota, Kriminelle, Sträflinge und Hillbillys der übelsten Sorte. Sie stammten aus Irland, Schottland und anderen Teilen Großbritanniens. Meine Großmutter mütterlicherseits war in Wales geboren, ihre Eltern waren echte Waliser. Die Namen meiner Eltern, Onkel, Tanten und Großeltern wanderten direkt aus den Appalachen von einem Trailerpark zum nächsten bis in die Wüste Ost-Washingtons. Namen wie Marshall und Floyd, meine Großväter, oder Ella und Emma, meine Großmütter. Roy, Marvin und Virgil, meine Onkel. Margie, Donna und Laverne, meine Tanten. Dale, mein Vater. Floy, meine Mutter. Meine ältere Schwester nannten sie Trina. Ich kam als Einziger mit einem nicht-hinterwäldlerischen Weißbrot-Spießernamen davon, einem Namen, den ich erst hasste und für den ich dann Gott dankte, als ich erfuhr, dass meine Mutter mich ursprünglich Lance nennen wollte. Lance Lanegan. Etwas Lächerlicheres, Erniedrigenderes konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, und ich war meinem Vater dankbar, dass er es verhindert hatte. Danach konnte ich mit Mark leben. Aber es war mir lieber, wenn man mich mit meinem Nachnamen ansprach, Lanegan. Wenn ich jemanden kennenlernte, stellte ich mich immer mit meinem zweiten Vornamen vor, William. Als wäre es Gedankenübertragung, nannten mich die meisten Lehrer, Trainer und Bekannten trotzdem Lanegan.
Meine Eltern stammten beide aus extrem ärmlichen, entbehrungsreichen Verhältnissen. Ihr Leben war schon in jungen Jahren von Tragödien geprägt. Beide waren sie in ihrer jeweiligen Großfamilie die Ersten, die aufs College gingen. Beide wurden Lehrer. Die Schule war für mich ein absolutes No-Go.
Ich saß da, gefangen hinter meinem Tisch, und machte mir erst gar nicht die Mühe zuzuhören. Stattdessen träumte ich von meiner ersten Liebe: Baseball. Nach der Schule spielte ich stundenlang auf dem Nachbarsgrundstück, bis es irgendwann zu dunkel war. Dann schlurfte ich nach Hause und ließ die unvermeidlichen Schimpftiraden meiner Mutter über mich ergehen. Vor allem regte sie sich darüber auf (auch wenn ihre Angriffe in alle Richtungen gingen), dass ich nie zu Hause war. Dabei war sie selbst der Grund dafür. Um ihren Attacken aus dem Weg zu gehen, suchten meine Schwester Trina und ich immer wieder nach Ausreden, nicht nach Hause zu müssen. Soweit ich zurückdenken kann, gingen Trina und ich uns außerdem auch gegenseitig an die Gurgel. Da mein Vater kaum zu Hause war, war ich den beiden Frauen ständig ausgeliefert. Für meine Mutter gab es offenbar nichts Schöneres, als mich zu schikanieren und alles, wofür ich mich interessierte, in den Dreck zu ziehen. Während sie mir eine scheuerte, war einer ihrer Lieblingssprüche: »Du bist nicht mein Sohn!« Ich wünschte nur, sie hätte recht gehabt. Als Sechsjährige hatte sie mit ansehen müssen, wie ihr Vater im Vorgarten ihres Elternhauses ermordet wurde, war dann unter Männern in Holzfällerlagern aufgewachsen, wo ihre Mutter als Köchin arbeitete, und hatte sich schließlich zu einem gehässigen Menschen entwickelt. »Eine verdammte Hexe«, wie mein Vater manchmal sagte.
Als meine Eltern sich trennten, war für mich klar, dass ich bei meinem Vater bleiben würde. Obwohl er immer eine tiefe, stille Traurigkeit ausstrahlte, war er ein herzensguter, fürsorglicher Mann, der mich allerdings schon damals kaum unter Kontrolle bekam.
Ich klaute Snickers, Milky Way und andere Riegel aus dem Laden gegenüber meiner Schule und verkaufte sie an meine Klassenkameraden. Ich war besessen von diesem Spiel, bei dem man Münzen gegen eine Mauer warf, und wer am nächsten dran war, bekam das Geld. In jeder Pause trommelte ich meine Mitschüler zusammen und war sauer, wenn es klingelte und wir wieder in die Klasse mussten. Der Vater von einem Freund tingelte durch Bars und Kneipen und verkaufte den Betreibern Lotteriebretter und Spielautomaten, an denen die Betrunkenen ihre Dollars loswerden konnten. An einem Wochenende übernachtete ich bei meinem Freund, als seine Eltern weg waren.
»Hey, Matt, lass mal das Zeug von deinem Dad auschecken.«
Das war das Stichwort. Wir kletterten durch ein Fenster in den Schuppen, in dem er seine Ware lagerte. Ich schnappte mir ein paar von seinen Lotteriebrettern und nahm sie mit nach Hause. Schon damals litt ich an diesem verteufelten Zwangsverhalten, und wann immer sich die Gelegenheit ergab, musste ich zuschlagen. Genug Zeit hatte ich, also machte ich mich an die Arbeit. Während der nächsten Tage hebelte ich mit einem Schlitzschraubenzieher die Lotteriebretter auf, ganz vorsichtig, möglichst ohne sichtbare Schäden zu hinterlassen. Stundenlang rollte ich die kleinen Zettel auseinander, holte die 20er-, 50er- und 100er-Dollar-Gewinne raus und steckte die 1er, 2er, 5er und die Nieten wieder zurück. Dann klebte ich die beiden Hälften wieder zusammen. Und zwar so sauber, dass man absolut nichts merkte. Ich lief mit den Spielbrettern in meiner Sporttasche den ganzen Tag durch die Schule und ließ die Kids für einen Dollar ihr Glück versuchen. Natürlich gewann niemand größere Summen, die hatte ich ja vorher alle entfernt, zur Freude meines Freundes Matt, der sich königlich amüsierte.
Diese zwanghafte Abzockerei beanspruchte mein gesamtes Denken und Handeln. Es war das Erste, woran ich dachte, wenn ich aufwachte, und das Letzte, bevor ich ins Bett ging. Bei einigen Mitschülern machte ich mich nicht unbedingt beliebt damit. Meine aggressive Art, ihnen ihr Geld abnehmen zu wollen, war zu viel für sie. Es spielte keine Rolle, wie viel oder wenig Geld ich hatte. Ich heckte ständig etwas aus, um an ein paar Scheine zu kommen, nur dann fühlte ich mich lebendig. Es sollte noch schlimmer kommen.
In der Junior High fing ich an, meinem Alten Bierdosen aus seinen endlosen Beständen zu klauen und in meiner Tasche in die Schule zu schmuggeln. Er war ausgebildeter Tischler und hatte im Keller neben meinem Zimmer eine komplette Bar und einen Raum zum Kartenspielen mit seinen Jungs eingerichtet. Das Holz bekam er umsonst, wenn er in der Gegend Scheunen abriss Die ergatterten Biere trank ich zwischen den Unterrichtsstunden in einer Hausmeisterkammer oder in der Pause im Gebüsch auf dem Schulhof. Dann fing ich an, Gras zu rauchen, als einer von insgesamt drei Jugendlichen in der Mittelstufe meines kleinen Städtchens. Außerdem wurde ich zum Dieb. In jeder Stunde bat ich, auf Toilette gehen zu dürfen, lief dann in die Umkleide der Sporthalle und durchsuchte die Hosentaschen der Schüler, die ihre Sachen nicht einschlossen. Kleingeld, Scheine, ich nahm alles, was ich kriegen konnte. Die einzige Stunde, in der ich nichts stahl, war mein eigener Sportunterricht. Erwischt wurde ich nie.
Mein Vater verwendete nicht viel Zeit auf meine Erziehung. Da er selbst Unmengen trank und sein Leben lang am liebsten die ganze Nacht hindurch mit seinen Buddys Karten spielte oder Frauen nachstellte, gab er es schnell auf, mich zu kontrollieren. Also streifte ich fröhlich und ungehemmt durch die Gegend. Nach den unangenehmen Jahren unter der Fuchtel meiner Mutter liebte ich meinen Vater für die neu gewonnene Freiheit, meinen jeweiligen inneren Drang ausleben zu können, meine Begeisterung, meine aufkeimenden perversen Neigungen. Ich kam mir vor wie das glücklichste Kind weit und breit, keine Regeln, keine Uhrzeiten, kein Nichts. Mit zwölf war ich ein notorischer Zocker, Jungalkoholiker, Dieb und Pornofan. Ich besaß eine beeindruckende Sammlung an Pornoheften. Die meisten hatte ich aus den Müllcontainern der Studentenwohnungen auf dem Campus gefischt. Obwohl ich allein mit meinem Vater und ein paar Hunden in einem großen Haus lebte, wusste ich nicht, wo ich sie lagern sollte.
Schon als meine Eltern noch zusammen waren, musste ich alles verstecken, was nicht für fremde Augen bestimmt war. Als ich neun war, fand meine Mutter eine Packung unbenutzter Kondome, die ich aus einem Mülleimer geholt hatte, und rastete völlig aus. Kurz bevor sie sich trennten, entdeckte sie eine Glaspfeife in meinem Zimmer und schickte mich zum Psychologen. Der meinte zu mir: »Ich glaube, es ist deine Mutter, die Hilfe braucht, nicht du.« Trotzdem, das Einzige, was mein Dad nicht hinnahm, war, dass sein dreizehnjähriger Sohn Marihuana rauchte. Manchmal versteckte ich mein Gras und die Rauchutensilien – Bongs, Papers und anderes – in der Hundehütte neben dem Carport. Mehrmals musste ich feststellen, dass die Sachen nicht einfach weg, sondern zerstört worden waren, entweder kaputtgetreten oder mit dem Hammer zerschlagen. Irgendwann hatte ich verstanden und suchte mir ein neues Versteck.
Für meinen Dad sagten Taten mehr als Worte. Ich könnte wahrscheinlich sämtliche wichtigen Unterhaltungen, die wir je hatten, an anderthalb Händen abzählen. Eines Abends rief er mich nach oben.
»Mark, komm hoch. Wir müssen reden.«
Ich nahm an, dass die Cops mal wieder da waren und ihm erzählt hatten, weswegen sie mich suchten und wie viel Zeit er hatte, mit mir auf der Wache zu erscheinen.
»Klar, Dad. Was gibt’s?«
»Also«, sagte er. »Ich bin Lehrer, und in meiner Klasse sitzen Kids, die nicht halb so viele Chancen und Fähigkeiten haben wie du. Jedes Jahr gibt es ein oder zwei Neue, bei denen ich das ganz klare Gefühl habe, dass sie eines Tages im Knast oder zu früh im Grab landen. Du wirst dich wundern, wie oft ich recht behalte.
Junge, wenn ich mir so ansehe, wie du durchs Leben gehst, einfach so nach Lust und Laune, bekomme ich allmählich ein ähnliches Gefühl. Du glaubst, die Regeln, die für andere gelten, gelten nicht für dich. Ich hab dich heute zu mir gerufen, weil ich glaube, dass du zwar schon ein paar bittere Lektionen gelernt hast, mit Sicherheit aber noch einiges auf dich zukommt. Und das wird hart und schmerzhaft werden. Du bist genau wie dein Onkel Virgil. Vom Tag seiner Geburt an bis zu seinem Tod hat er nichts als Kummer, Ärger und Probleme gehabt.«
Mein Onkel Virgil war im Altenheim an Alkoholismus gestorben, mit dreiundvierzig. Er fuhr jahrelang auf Zügen kreuz und quer durchs Land, ein echter Hobo. Als College-Student reiste mein Vater immer wieder durch den ganzen Nordwesten, nur um irgendwo die Kaution für seinen Bruder zu bezahlen. So oft, wie er ihn aus dem Knast holen musste, war er irgendwann natürlich nicht mehr gut auf ihn zu sprechen. Virgil machte weiter, bis er eines Nachts besoffen aus dem Zug fiel, unter die Räder kam und beide Beine verlor. Mein Vater erzählte mir, er sei bei ihm im Krankenzimmer gewesen, als er zu sich kam und feststellte, dass er keine Beine mehr hatte. »Was hat er gesagt?«, fragte ich ihn. In seiner lakonischen Art meinte er nur: »Na ja, richtig glücklich war er nicht.« Als mein Vater und ich nach dem Tod meiner Großmutter ihr Haus ausräumten, bevor es abgerissen wurde, entdeckten wir einen Schuhkarton voll mit Postkarten, die Virgil von überall aus den USA geschrieben hatte. Sie fingen alle gleich an, er schrieb, wo er gerade war und welche Art von Hilfsjob er ausübte. Und alle endeten auch genau gleich. Jede einzelne Karte, die er seiner Mutter schickte.
»Mark«, sagte mein Vater. »Du scheinst nicht in der Lage zu sein, dich zu ändern. Offenbar bist du unbelehrbar.«
Unbelehrbar war eines seiner Lieblingsworte. Ich gab mir Mühe, nicht mit den Augen zu rollen.
»Ich schlage also vor, du fängst direkt an, dich abzuhärten, und damit meine ich nicht, dass du dich prügeln sollst. Das tust du schon genug, und ich hab keine Lust mehr, für deine kaputten Hände zu bezahlen.«
Irgendwie schaffte ich es, mir bei jeder Auseinandersetzung einen Knöchel zu brechen.
»Du musst deinen Körper und deinen Geist stählen. Da, wo du hingehst, mein Sohn, brauchst du jedes Fünkchen Verstand und alle Kraft, die du hast, um zu überleben. Ich weiß nicht, warum, aber so bist du nun mal. Genau wie Virgil, verdammt«, sagte er und schüttelte den Kopf. Er hatte recht. Von allen Menschen, die ich kannte, zog ich anscheinend die Scheiße an wie kein anderer. Prügeleien waren bei mir seit der Grundschule an der Tagesordnung. Mit vierzehn hatte mir ein erwachsener Mann vor einer Kneipe am Rand eines Trailerparks mit der Faust ins Gesicht geschlagen, weil ich ihn bat, mir und meinen Freunden ein Bier zu kaufen. Zeit meines Lebens trage ich einen kleinen schwarzen Punkt ins Gesicht tätowiert, nachdem mir ein Junge mit einem Stift das Auge ausstechen wollte.
Wenn ich zurückdenke, wie ich als Kind auf dem Fußboden neben Virgil in seinem Rollstuhl mit der Decke auf dem Schoß saß, kam er mir dagegen immer vor wie das genaue Gegenteil von dem zerrissenen, missmutigen Kerl, als den mein Vater ihn beschrieb.
Wenn ich auf die hohle Prothese klopfte, die er unter der Hose trug, legte er den Kopf in den Nacken und brüllte vor Lachen. Sein rabenschwarzes, zurückgegeltes Haar erinnerte mich an Elvis Presley.
Eines Tages sah ich in Ellensburgs einzigem Comic- und Plattenladen Ace Books and Records ein seltsam faszinierendes Foto von einem Mann mit nacktem Oberkörper auf dem Cover der Musikzeitschrift Creem. Ich fragte den Besitzer, Tim Nelson, wer das sei.
»Das, Junge, ist Iggy Pop.«
In meinem kulturell isolierten Heimatkaff lief im Radio immer nur Country. Niemand in Ellensburg wusste, wer Jimi Hendrix war, obwohl er im gerade mal hundertfünfzig Kilometer entfernten Seattle geboren wurde. Tim spielte mir ein paar frühe Punk-Singles vor, und ich war sofort hin und weg. »Anarchy in the U.K.« von den Sex Pistols war eine Offenbarung und sollte augenblicklich und für immer mein Leben verändern. Ich war vollkommen gebannt von dieser aggressiven, wütenden Musik. Als Kind besaß ich eine Alice-Cooper-Platte, die ich rauf und runter hörte, aber das hier hatte etwas Exotisches, es packte mich auf eine Weise, die ich nicht erklären konnte. Ich wusste nur, dass ich mehr davon brauchte.
Innerhalb weniger Tage tauschte ich meine gesamte Comic-Sammlung aus Kindertagen gegen Schallplatten ein: Sex Pistols, Damned, Stranglers, die Ramones, Iggy, David Bowie, die New York Dolls und Velvet Underground. Es grenzte an ein Wunder, dass es so etwas bei uns überhaupt gab, aber Tim Nelson war ein Unikum. Er sah aus wie ein Hippie, hatte aber einen breit gefächerten Geschmack und interessierte sich für alles, was neu und anders war. Ich dankte Gott, dass ich diese Platten entdeckt hatte, und hörte sie mir jahrelang allein zu Hause an.
Die regelmäßigen Auseinandersetzungen mit der Polizei trugen kaum dazu bei, mein Verhältnis zu Autoritätspersonen zu verbessern. Mit fünfzehn wurde ich wegen ein paar Autoradios vernommen, die auf dem Gelände eines Autohauses gestohlen wurden. Ich kannte den Typen, der dafür verantwortlich war, und als ich ihnen den Namen nicht liefern wollte, holten sie Captain Kuchin persönlich dazu und ließen mich mit ihm allein. Fabian Kuchin galt als harter Knochen. Einer seiner Arme war eingegipst, wahrscheinlich dank einer gewaltsamen Festnahme oder Kneipenschlägerei.
»Hör zu, Junge, ich frag dich noch mal. Wer hat die Autoradios geklaut?«
»Ich weiß es nicht.«
Kaum hatte ich die Worte ausgesprochen, zog er mir seinen Gips über den Schädel, sodass ich vom Stuhl kippte und zu Boden fiel.
»Vielleicht denkst du das nächste Mal ein bisschen länger nach, wenn ich dich etwas frage.«
Es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, dass mich die Bullen in Ellensburg verprügelten. Ein paar Jahre darauf schlugen mir nach einer Feier am Unabhängigkeitstag ein paar Deputys mit ihren Knüppeln in die Eier und auf den Hinterkopf und drückten mich mit dem Gesicht auf den Asphalt.
Kuchin wurde später verhaftet, als er Undercover-FBI-Agenten Kokain verkaufen wollte. Er musste mickrige 25 000 Dollar Strafe zahlen und wurde ein Jahr von der Arbeit freigestellt, ein Paradebeispiel für die Korruption innerhalb der hiesigen Polizei, die es schon immer auf mich abgesehen hatte. Trotzdem freute es mich, von Kuchins Verhaftung zu hören. Ich hatte ihm immer das Schlimmste gewünscht.
*
INDERHIGHSCHOOLSPIELTEICH mit Begeisterung Baseball und widerwillig American Football. Ich war einer von zwei Quarterbacks in unserem Team, und wir waren extrem schlecht. Okay, ich konnte werfen, und der andere Quarterback konnte laufen, aber deswegen waren wir noch lange keine Gewinner-Kombi. Unser Tight End war ein Riese, schon mit sechzehn zwei Meter groß, ein kräftiger, schneller Spieler mit Händen wie Küchensieben. Wann immer ich zurückfiel, um zu werfen, in den wenigen Sekunden, die mir blieben, bevor ich von der gegnerischen Verteidigung umgerannt wurde, war er der Einzige, den ich anspielen konnte. Egal wie oft ich einen perfekten Pass warf, der Ball prallte jedes Mal von seinen Händen, seinem Helm, Visier oder Oberkörper ab, es war zum Totlachen. Auf ihn wartete eine zehnjährige erfolgreiche Karriere in der NFL, allerdings als Lineman. Ein Koloss, der einfach nur blocken musste, ohne je den Ball zu berühren. Nach dem Spiel humpelten wir meistens geschlagen vom Feld, hielten uns die grünblauen Ärsche und schleppten uns in die Umkleide.
Ich war der Außenseiter. Obwohl meine Position Führungsqualitäten voraussetzte, begegneten mir die meisten Teamkollegen mit kaum verhohlener Ablehnung. Ihr Interesse an Notendurchschnitten, Cheerleader-Freundinnen und Schulfesten war mir fremd. Ich musste schmunzeln, wenn ich sah, wie sie in der Schule voneinander abschrieben. Ich hatte nicht mal Lust zu schummeln, so scheißegal war mir das alles. In meiner ganzen Highschool-Zeit machte ich nicht ein einziges Mal die Hausaufgaben. Es kümmerte mich einen Dreck, ob ich in einem Fach durchfiel oder, aus einer Laune des Schicksals heraus, bestand. Dafür behandelte man mich mit einer Mischung aus Neugier, Abneigung und Angst. Ich hielt mich von den anderen fern und ließ mir von niemandem etwas gefallen. Das verleitete einige vermeintlich harte Typen dazu, mir auf die Nerven gehen zu wollen.
Im Bus auf der Heimfahrt nach einem verlorenen Spiel fragte jemand, was ich auf meinem Walkman hörte. Daraufhin wurde mein Punkrock-Tape diskret herumgereicht, sodass das gesamte Team sich über mich lustig machen konnte. Ich werde nie vergessen, wie alle lachten und mich anstarrten wie einen Irren. Ein Runningback, einer der beliebtesten Jungs aus der Mannschaft, warf mir zur Freude der anderen einen Eiswürfel an den Kopf. Als ich ihn hinten im Bus zusammenschlug, brach ich mir dabei die Hand und musste den Rest der Saison selbst als Runningback spielen, mit meiner Wurfhand in Gips und mehreren Schichten Schaumgummi und Bandagen.
Außerhalb der Saison war ich inzwischen Vollalkoholiker. Jeden Tag nach der Schule stieg ich auf dem Nachhauseweg bei einem Lebensmittelladen aus und klaute eine Halbliterflasche MD 20/20, ein Likörwein, auch bekannt als Mad Dog. Ich steckte mir die Flasche vorne in die Hose, marschierte locker durch die Tür und dann in den Park und trank sie aus. Danach lief ich zurück und holte mir noch eine. Die flachen Dinger schienen wie gemacht, um den Fusel leichter stehlen zu können.
Nach der zweiten Flasche ging ich zum Campus und klaute ein Fahrrad. Die betrunkene, mühselige Heimfahrt war meistens unterbrochen von mehreren Stürzen, bevor ich an einen Kanal kam, der etwa einen halben Kilometer von zu Hause entfernt durch die Felder führte. Ich warf das Fahrrad ins Wasser, lief über die Brücke und dann den Rest zu Fuß. Das ging ein paar Jahre so.
Mein Vater wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und verlor seinen Führerschein. Gleichzeitig bestand ich meine Prüfung, und während alle anderen ihre Scheine und Autos bekamen, musste ich warten, bis mein Vater seine Strafe abgebüßt hatte und wieder versichert war, bevor ich selbst loslegen konnte. Er saß sechs Wochenenden im Gefängnis und musste ein saftiges Bußgeld zahlen. Es brachte mich zur Weißglut, dass ich sechs Monate nach der bestandenen Prüfung noch immer nicht Auto fahren durfte. Nach einer gefühlten Ewigkeit bekam ich den Schein dann mit fast siebzehn. Eines Nachmittags nahm ich ein Mädchen mit auf eine Fahrt über den Schotterweg am Kanal entlang, um dort ein paar Bier zu trinken und hoffentlich zu vögeln. Irgendwann stieg sie aus und ging in die Büsche pinkeln. Als sie zurückkam, bebte sie quasi vor Aufregung.
»Mark, komm mal mit, das musst du dir ansehen!«
Sie ging mit mir zu dem inzwischen ausgetrockneten Kanal, in dem die verrosteten, von Schilfrohr bedeckten Skelette von mehr als siebzig Fahrrädern lagen. Ich spürte, wie mir die Schamesröte ins Gesicht stieg.
»Verrückt«, sagte ich und brachte sie zurück zum Auto. Meine kleinen Geheimnisse. Ich würde auf keinen Fall jemals irgendetwas davon aufgeben.
Im Sommer meines vorletzten Schuljahres beschloss ich endlich, mit dem scheiß Football aufzuhören. Mein einziger Freund in der Mannschaft, ein tougher, cleverer Großer-Bruder-Ersatz namens Dean »Zeek« Duzenski, hatte im Jahr davor seinen Abschluss gemacht. Er war mein Saufkumpan, Mentor und manchmal, wenn die Situation es erforderte, mein Beschützer. Als ich mich eines Tages zum Training umziehen wollte, hatte mir jemand Limonade in den Helm gekippt. Der »Scherzkeks« war der größte und stärkste Lineman in unserem Team, ein riesiger Schwarzer, der an die hundertfünfzig Kilo wog und Waddell Snyder hieß. Er hatte es auf mich abgesehen und wischte mir bei jeder Gelegenheit eins aus. Das gesamte Team sah nach dem Training staunend mit an, wie Zeek dieses massige, langsame, unglückselige Großmaul zehn Minuten lang auf ungeheuer ausgeklügelte Art komplett auseinandernahm. So was hatte ich noch nicht erlebt. Er bearbeitete das Gesicht dieses Riesenbabys so lange mit Faustschlägen, bis es kaum noch zu erkennen war. Natürlich wagte es Del Snyder danach nie wieder, mich auch nur anzusprechen. Auch mit den anderen aus der Mannschaft und ihren pubertären Interessen hatte ich rein gar nichts am Hut, und unseren Chefcoach hasste ich von Anfang an. Dass er mich rumkommandierte wie einen Gefreiten im Bootcamp, ging mir ziemlich gegen den Strich.
Als ich zum Sommertraining meiner letzten Saison nicht erschien, hielt der Coach es für nötig, bei mir zu Hause aufzutauchen. Da ich trotzdem nicht mitkommen wollte, wurde er wütend, hielt mir in unserem Garten den Finger vor die Brust und nannte mich einen Drückeberger und Loser. Irgendwann kam mein Vater, der auch als Lehrer an meiner Highschool unterrichtete, aus dem Haus.
»Hey, Coach«, rief er, »sieh zu, dass du dich von meinem Grundstück verpisst, bevor ich die Bullen hole.«
Ich musste laut lachen. Auch wenn mein Dad dauernd verdammt oder Bullshit sagte, hatte ich ihn noch nie zu jemandem sagen hören, er solle sich verpissen. Dass er sich das für meinen Coach – seinen Kollegen – aufgespart hatte, bereitete mir unermessliche Freude.
*
NACHDEMWIRSTUNDENLANGBEIMIR zu Hause getrunken hatten, überredete ich eines Abends einen Freund zu einem Plan, der mir seit Jahren durch den Kopf ging. Wir fuhren in seinem Jeep raus in die Pampa, bis wir den Wagen meiner verhassten Bewährungshelferin gefunden hatten. Er stand auf einem Acker, auf dem das Heu für das Vieh ihres Mannes lagerte, ein Lieferwagen, mit dem sie zwischen ihren Feldern rumfuhren. Während mein Kumpel Maschinenteile und Werkzeuge mitgehen ließ, schlug ich mit einem Vorschlaghammer auf den Wagen ein. Auf dem Nachhauseweg ging das Autoradio immer wieder aus, und als wir beide nach unten griffen, um an den Kabeln rumzufummeln, ließ mein Kumpel, betrunken wie er war, kurz die Straße aus dem Auge, sodass wir direkt im Graben landeten.
Ich wurde aus dem Jeep geschleudert und schlitterte quer über den Asphalt. Als ich mir die Haare aus dem Gesicht streichen wollte, hielt ich meinen halben Skalp in der Hand. Mein Kopf war an der Seite aufgeplatzt. Meinem Freund hatte es den Daumen weggefetzt.
Wir liefen fast anderthalb Kilometer bis zur nächsten Farm, während mein Kumpel seinen Daumen festhielt, vor Schmerzen jaulte und ihm das Blut aus der Wunde schoss. Es war vier Uhr morgens, als wir an die Tür klopften und um Hilfe baten. Der Eigentümer begrüßte uns mit vorgehaltenem Gewehr. Als wir in seiner Küche standen und auf den Krankenwagen warteten, starrte ich auf die Blutlache, die sich auf dem alten Linoleumboden ausbreitete. Auf dem Krankenhausbett las mir ein Polizist meine Rechte vor.
Als mein Fall vor Gericht kam, wurden auch meine bisherigen Vergehen mit berücksichtigt: Vandalismus, Autoeinbrüche, illegale Müllentsorgung, widerrechtliches Betreten eines Grundstücks, sechsundzwanzig Verwarnungen wegen Alkoholkonsums als Minderjähriger, Ladendiebstahl von Alkohol, Besitz von Marihuana, Fahrraddiebstahl, Diebstahl von Werkzeug, Autoteilen und Motorradteilen, Urinieren in der Öffentlichkeit, Diebstahl von Bierfässern und Zapfhähnen, Versicherungsbetrug, Diebstahl von Autoradios, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Einbruch, Hehlerei und, bei der zweiten Verhaftung wegen Urinierens in der Öffentlichkeit, eine Anzeige wegen ungebührlichen Benehmens. Ich wurde des Vandalismus, Diebstahls und Alkoholkonsums als Minderjähriger für schuldig befunden und angesichts meines langen Vorstrafenregisters als Jugendlicher zu achtzehn Monaten Gefängnis verurteilt. Absitzen sollte ich sie in der Strafvollzugsanstalt von Shelton, Washington. Bei der Urteilsverkündung sah sich der Richter mein Vorstrafenregister an und wandte sich dann direkt an mich.
»Hat jemals irgendwer versucht, dir zu helfen, mein Junge?«
Ich antwortete nicht.
»Wenn ich mir die Liste hier anschaue, hast du ganz offensichtlich ein Alkohol- und Drogenproblem. Jeder dieser Anklagepunkte hat mit Drogen und Alkohol zu tun.«
Ich sagte immer noch nichts.
»Frau Staatsanwältin, ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum Sie einen Achtzehnjährigen, der noch zur Highschool geht, ins Gefängnis stecken wollen. Ich bin geradezu schockiert, dass Sie nicht auf die Idee gekommen sind, dem Jungen zu helfen.
Mr. Lanegan, ich gebe Ihnen eine einmalige Chance. Ich kann Ihnen nur eindringlich raten, in sich zu gehen. Ich setze die Strafe zur Bewährung aus, unter der Bedingung, dass Sie eine einjährige ambulante Drogentherapie antreten. Das Gericht verordnet Ihnen außerdem die regelmäßige, beaufsichtigte Einnahme des Medikaments Antabus. Sollten Sie sich nicht an diese Anordnung halten, habe ich keine Bedenken, Sie für anderthalb Jahre nach Shelton zu schicken.«
Wie benommen verließ ich das Gericht. Mir war klar, dass der Richter ein dickes Auge für mich zugedrückt hatte. Meine größte Sorge war allerdings, wie ich weiter trinken sollte, wenn ich ein Medikament einnahm, dessen Wirkung darin bestand, dass man davon gleichzeitig sterbenskrank wurde. Als Kind hatte ich einmal mitten im Winter in einem Park in der Stadt einen Indianer, der das Zeug genommen hatte, Alkohol trinken sehen. Der Mann lag stöhnend auf einem Picknicktisch und sah hundeelend aus. Ich würde mich jedenfalls hüten, das Schicksal herauszufordern.
Allerdings gab es 1982 in meinem Programm noch nicht mal einen Urintest. Ich konsumierte und verkaufte also weiter jeden Tag Gras und LSD. Fast täglich nahm ich vor der Schule ein bisschen Acid, rauchte etwas Gras, sprang dann in meinen Truck und fuhr zur Schule. An vier Abenden in der Woche ging ich zur Therapie. Wenn der Drogenberater durch den Raum schritt und jeden in der Gruppe fragte: »Na, clean und nüchtern?«, war ich oft entweder stoned oder auf LSD.
Zu Beginn meiner letzten Baseball-Saison war ich so gut in Form wie nie zuvor. Ich hatte eine exzellente Trefferquote, manchmal war ich vierter oder fünfter Batter, je nach gegnerischer Aufstellung, das waren die wichtigsten Positionen in der Schlagreihenfolge. Das Pitching lief ebenfalls reibungslos. Wenn wir führten, wurde ich bei den letzten Innings als Closer eingesetzt. Da ich mindestens doppelt so hart warf wie unser erster Pitcher, bekam ich entweder einen Strike nach dem anderen oder traf den Batter mit voller Wucht am Körper oder Kopf, was aufs selbe hinauslief.
Mein wohlverdienter wilder Ruf verschaffte mir einen Vorteil, wenn ein neuer Schlagmann eingesetzt wurde. Niemand wollte von einem Fastball getroffen werden, und ein- oder zweimal beendete ich ein Spiel mit drei Strikeouts hintereinander. Nach Jahren der Mittelmäßigkeit setzte sich mein unbändiger Siegeswille endlich durch. Und es ging das Gerücht, dass die Scouts der College-Teams inzwischen bei unseren Spielen auftauchten, wobei es mit meinem unterirdischen Notendurchschnitt so gut wie unmöglich war, dass ich es aufs College schaffte. Baseball hatte mich als Kind vor meiner Mutter gerettet, aber es würde mich wohl kaum aus dieser abgestandenen Pisslache namens Ellensburg holen.
Der stellvertretende Schulleiter erschien eines Tages zum Training und nahm unseren Coach Taylor beiseite. Wir hörten nicht, was sie sagten, aber als der Coach die Mütze zu Boden warf und sich vor dem Schulleiter aufbaute wie ein aufgebrachter Profitrainer im Streit mit dem Schiedsrichter, lachten meine Teamkameraden. Ich lachte mit. Bis mich der Coach zu sich rief.
Die Schulleitung hatte erfahren, dass ich im vorigen Semester in Hauswirtschaftslehre durchgefallen war und damit nicht die nötige Anzahl an Kursen bestanden hatte, um am Sportunterricht teilzunehmen. Der Konrektor hatte den Coach informiert, dass meine Baseballkarriere beendet war.
Taylor war nicht bereit, diese Entscheidung hinzunehmen, also ging er zur Hauswirtschaftslehrerin, die mich letztendlich verpfiffen hatte. Sie einigten sich auf einen Deal. Wenn ich eine Stunde früher zur Schule kommen und an ihrem Unterricht teilnehmen würde, dürfte ich weiter Baseball spielen, für mich das einzig Wichtige. Ich fragte mich, wie das gehen sollte, zumal ich um die Uhrzeit normalerweise zu Hause meine erste Bong rauchte, erklärte mich aber einverstanden. Ich hätte mich auf so ziemlich alles eingelassen, um weiter spielen zu können.
Am ersten Tag meines Frühkurses in Hauswirtschaftslehre II musste meine Lehrerin sich erst mal ein paar Dinge von der Seele reden.
»Mark Lanegan. Du bist einer der Schüler an dieser Schule, bei deren Anblick mir echt schlecht wird.«
Damit hatte ich nicht gerechnet.
»Ich weiß, du hältst dich für Joe Cool, aber da irrst du dich leider gewaltig. Du bist ein kleines Stück Dreck, sonst nichts. Ich habe mich nur darauf eingelassen, damit du siehst, wer du wirklich bist, auch wenn ich selbst das schon weiß. Und glaube ja nicht, du könntest mir oder sonst wem irgendwas vormachen. Ich weiß genau, dass du jeden Tag Marihuana rauchst.«
Was den letzten Teil betraf, hatte sie vollkommen recht.
»Wenn du glaubst, das wird hier ein Kinderspiel, irrst du dich ebenfalls. Der Unterricht wird dir sehr viel schwerer vorkommen, da du ja letztes Mal offenbar der Meinung warst, das Ganze wäre ein Witz. Es ist kein Witz, Freundchen. Du wirst jede Menge Hausaufgaben bekommen, und ich erwarte, dass du sie am nächsten Morgen erledigt hast. Sollte das irgendwann mal nicht der Fall sein, ist unser Deal geplatzt. Ich wünsche dir viel Glück.«
Das alles um sieben Uhr morgens? Ihre Feindseligkeit überraschte mich, denn obwohl ich im vorigen Semester nicht oft zum Unterricht erschienen war, hatte ich nie Ärger oder Krach gemacht oder auch nur im Unterricht geredet. Okay, für meine Semesterarbeit hatte ich ein F bekommen, obwohl es wirklich das Einfachste war, was man sich vorstellen konnte. Man musste nur zwei exakt gleich lange Stücke Nylon aneinandernähen. Aber wie quasi alles, wofür man irgendeinen Quatsch lernen musste, den man nie im Leben brauchen würde, überstieg selbst das meine Fähigkeiten. Irgendwie war ich bei ihr angeeckt, und jetzt genoss sie es, sich rächen zu können. Ich war kein Mathegenie, aber hier musste man nur eins und eins zusammenzählen. Sie hatte gar nicht vorgehabt, mir zu helfen, im Gegenteil, sie wollte mir schaden. Und es mir unmöglich machen, die Auflagen zu erfüllen. Das hätte genauso gut von meiner Mutter kommen können.
Ich verspürte eine mir unbekannte Traurigkeit. Mein Lebenstraum, Baseball zu spielen, war geplatzt. Neben Punkmusik, mich betrinken und Frauen flachlegen war es das Einzige, wofür ich mich interessierte. Da saß ich also, ein Stück Dreck, das irgendwann auf der Müllhalde landen würde.
»Danke, dass Sie mich über Ihre noblen Absichten aufklären, Mrs. Stevens. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl, als Ihr großzügiges Angebot abzulehnen.«
Ich drehte mich um und ging.
Als ich an jenem Tag zu spät zum Training kam und meinem Coach meine sorgfältig zusammengelegte Ausrüstung überreichte, sah er mich an, als müsste er weinen. Vielleicht hatte ich aber auch nur das Gefühl, selbst gleich loszuflennen.
»Tut mir leid, Coach«, sagte ich, »aber der Deal klappt nicht. Das wird nichts. Sie will mich von vornherein durchfallen lassen.«
Ich schaffte gerade noch meinen Abschluss, mit dem schlechtestmöglichen Durchschnitt und einem Zeugnis, das ein wohlwollender Kollege meines Vaters gefälscht hatte. Nachdem ich mein einjähriges Drogen-und-Alkohol-Programm durchgezogen hatte, ersuchte mein Pflichtverteidiger das Gericht, mein Vorstrafenregister zu löschen. Ich zog in eine Studentenwohnung, arbeitete die Miete ab, indem ich den ganzen Tag Teppiche schamponierte, verkaufte Gras und LSD und machte jede Nacht Party. Eines Nachmittags nahm ich zu viel LSD und kam auf einen extrem langen, schlechten Trip. Meine Freunde mussten mich in einen Teppich rollen, um mich ruhigzustellen. Als ich am nächsten Morgen an meiner Bong zog, katapultierte es mich direkt zurück in den Albtraum. Das passierte danach jedes Mal, wenn ich Gras rauchte. Meinen Trick, mich vom Trinken abzuhalten, indem ich stattdessen Marihuana und LSD nahm, konnte ich mir von da an abschminken. Also ergab ich mich ganz dem Alkohol.
Wenn ich trank, hatte ich fast jedes Mal einen Blackout. Ich besaß eine Yamaha 750. Ursprünglich hatte ich es auf einen gebrauchten Triumph-Chopper abgesehen, konnte ihn mir aber nicht leisten und tröstete mich mit einem in meinen Augen minderwertigen japanischen Bike. Trotzdem liebte ich meine 750er und das Gefühl von Freiheit, das sie mir gab. Oft fuhr ich betrunken Hunderte von Kilometern und, da es keine Helmpflicht gab, ohne Helm. Ich ging in irgendein runtergekommenes Motel, torkelte zum Empfang und fragte: »Wie spät ist es? Was für ein Tag ist heute? Wo sind wir hier?« Mit dröhnendem Kopf und furchtbarem Kater lief ich am nächsten Tag durch das Scheißkaff, an das ich mich null erinnerte, bis ich endlich meine Maschine gefunden hatte. Verrückterweise schaffte ich es, mit diesem Irrsinn weiterzumachen, ohne zu sterben. Ein einziges Mal stürzte ich, als ich an einer Ampel stand. Ich war zu besoffen, um das Ding zu halten, und kippte einfach um.
Meine Highschool-Freundin Deborah hatte das College abgebrochen, war wieder in der Stadt und zog bei mir ein. Ich beschloss, mit dem Trinken aufzuhören, versuchte es auch ein ganzes Jahr lang, scheiterte aber immer wieder. Über den Freitagabend kam ich nie hinaus. Ich trank vierundzwanzig Stunden, keine Drogen, nur Alkohol und kein Schlaf. Die nächsten vierundzwanzig Stunden war ich ohnmächtig. Danach achtundvierzig Stunden Delirium tremens. Ich lag auf dem Rücken im Bett mit dem großen schwarzen Wählscheibentelefon auf der Brust und wartete darauf, den Krankenwagen zu rufen, da ich glaubte, jeden Moment sterben zu müssen.
Kaum war wieder Freitag, knickte ich trotz bester Absichten, nüchtern zu bleiben, irgendwann unweigerlich ein, und alles fing von vorne an. Diese unerträgliche Achterbahnfahrt belastete mich sowohl psychisch als auch körperlich so sehr, dass ich tatsächlich überlegte, mich umzubringen. Wenn so mein Leben aussehen würde, wollte ich lieber tot sein.
Während ich als Erntehelfer auf den Erbsenfeldern schuftete, beschloss ich, nach Las Vegas zu gehen, um im Restaurant eines Cousins zu arbeiten. Am Tag bevor ich der Plackerei im ländlichen Redneck-Kaff Washington entkommen sollte, zerquetschte mir ein Traktor bei einem Arbeitsunfall die Beine. Ich war bettlägerig, hatte entsetzliche Schmerzen und ärgerte mich zu Tode. Ich würde nie lebend aus Ellensburg rauskommen.
Deborah hatte mittlerweile genug gelitten und verließ mich für den Boss der Pizzeria, in der sie arbeitete. Vor Wut schlug ich mit meiner Krücke sämtliche Fenster meiner Wohnung ein und versank dann in tiefster Verzweiflung. Nach drei Tagen stillem Zorn und ohne Schlaf stellte ich fest, dass ich den Freitagabend überstanden hatte. Das hatte ich ein Jahr lang vergeblich versucht.
Ich wurde schon als Säufer abgestempelt, bevor ich überhaupt legal Alkohol trinken durfte. Mit achtzehn hatte ich einen Vollbart, betrank mich in Bars regelmäßig bis zur Besinnungslosigkeit und zog dabei ungewollt die Aufmerksamkeit auf mich, was häufig zu Gewalt führte. Mehrmals wachte ich im Gefängnis auf und musste mir vorsichtig das Kissen vom Gesicht ziehen, weil es am Blut festgeklebt war. Nachdem der Liebeskummer mich vom Alkohol weggebracht hatte, litt ich an Schlaflosigkeit und lief nächtelang zu Fuß Kette rauchend durch Ellensburg. Hin und wieder wurde ich von der Polizei angehalten. Sie hatten es vom ersten Tag an auf mich abgesehen, und es erfüllte mich mit Genugtuung, wenn sie feststellten, dass ich weder betrunken war noch irgendwas angestellt hatte, und mich wieder gehen lassen mussten. Kurz vor meinem einundzwanzigsten Geburtstag wurde ich dann erstaunlicherweise Sänger einer aufstrebenden Undergroundband mit jeder Menge potenzieller weiblicher Begleitung. Zum Glück hatte Deborah mich verlassen.
*
ZUMERSTENMALSAHICHVan Conner als Kind im Planschbecken seines Vorgartens. Er lächelte mich an, als ich auf dem Weg in die Grundschule war. Bei einer Stadt mit achttausend Einwohnern wusste ich von da an, wer er war, aber ansonsten hatten wir nichts miteinander zu tun. Dann trafen wir uns zufällig beim Nachsitzen in meinem letzten Highschool-Jahr. Er war erst in der Zehnten, aber seit sechs Jahren der erste andere Mensch in Ellensburg, der Punk hörte. Sein Bruder Lee und er waren Riesen, an die eins neunzig groß und zirka hundertfünfzig Kilo schwer. Van kam öfter zu mir nach Hause, kaufte und rauchte bei mir Gras, und wir lachten und hörten Musik.
Das nächste Mal begegneten wir uns, nachdem ich mit dem Trinken aufgehört hatte.
»Hey, Mann. Schön, dich zu sehen! Was treibst du so?«
»Eigentlich nichts. Ich such grad einen Job. Bisschen Kohle verdienen und dann weg hier. Mit dem Dealen hab ich aufgehört. Ich kiff auch nicht mehr. Trinken auch nicht.«
»Hey, weißt du was? Mein Dad meinte vorhin erst, wir bräuchten jemanden, der Sachen für den Laden eintreibt. Du wärst bestimmt perfekt.«
»Was genau muss ich da machen?« Ich war interessiert.
»Du sammelst die Fernseher und Videorekorder von den Pennern ein, die ihre Raten nicht bezahlen.«
»Klar, Mann, bin dabei. Wann soll ich anfangen?«
»Am besten gleich. Komm, wir gehen direkt zu Gary.«
Ich fand es irgendwie komisch, dass Van seine Eltern beim Vornamen nannte, aber die Familie galt in der Stadt allgemein als exzentrisch. Sieben Kinder, vier davon ungewöhnlich groß für ihr Alter, im Grunde aber für jedes Alter. Gary Conner war ein ehemaliger Grundschuldirektor, der jetzt die beliebteste Videothek im Ort betrieb und nebenbei elektronische Geräte per Mietkauf an Geringverdiener anbot. Er stellte mich vom Fleck weg ein.
Mein Vater war inzwischen zum Einsiedler geworden und in eine Hütte tief in den Cascade Mountains gezogen, die von der Straße aus nur mit Schneeschuhen zu erreichen war. Er hatte mir seinen Truck überlassen, einen Chevy Baujahr 53 mit 3-Gang-Lenkradschaltung. Ich fuhr den ganzen Tag quer durchs County und sammelte Geräte ein, die die Leute nicht freiwillig wieder hergeben wollten. Ich war relativ kräftig, fast eins neunzig groß und neunzig Kilo schwer. Im ländlichen Washington war Gewalt so normal und banal wie Fastfood, man wuchs quasi damit auf. Ich lernte schnell, mir von niemandem etwas gefallen zu lassen. Als Kind hatte mein Freund Duzenski mir beigebracht, sofort zuzuschlagen, wenn einem jemand dumm kam. Als regelmäßig sturzbesoffenem Einzelgänger und Außenseiter kam mir das zugute. Mit dem entscheidenden ersten Schlag war allerdings nicht immer gleich alles geregelt, sodass Gewalt ein durchaus gängiges Kommunikationsmittel wurde, eine zweite Sprache, die ich bald beherrschte.
Die armen Rednecks, denen ich die Sachen abnehmen musste, waren auch nicht ganz ohne. Ich hatte immer einen Baseballschläger aus Aluminium und eine gestohlene .22er-Pistole mit starkem Rechtsdrall dabei. Es gab fast jeden Tag Auseinandersetzungen, aber normalerweise bekam ich, was ich wollte. Ein paarmal handelte ich getreu dem Motto »Vorsicht ist besser als Nachsicht« und kehrte mit leeren Händen zu Gary zurück. Dann musste er den säumigen Käufer vor Gericht bringen, und ich verlor meine Provision. Aber scheiß drauf, jemanden wegen eines Fernsehers zu töten, war es nicht wert.
Ich betrat den Laden durch eine Hintertür, wo Van und sein älterer Bruder Lee in einem großen Raum mit ihrer Band probten. Van war der Sänger, Lee an der Gitarre, ein frommer junger Naturbursche namens Mark Pickerel an den Drums und noch irgendein Typ am Bass. Eines Abends hörte ich von draußen, wie sie ein Stück von Echo and the Bunnymen spielten, und ich dachte: Gar nicht mal so schlecht.
Irgendwann bot Gary mir einen Job hinterm Tresen an, zumal ich praktisch alle unbezahlten Geräte eingesammelt hatte und er seine eigenen Söhne offenbar nicht dazu bewegen konnte, im Laden zu arbeiten.
»Hey, Mann, hast du noch dein Schlagzeug?«, fragte Van mich eines Tages, als wir allein im Laden standen. Es war kein komplettes Set, nur eine Standtom, ein Ride-Becken und eine Hi-Hat, die ein Arbeitskollege im Restaurant mir vor Jahren im Tausch gegen Gras gegeben hatte.
»Nee, Mann, hab ich nicht mehr. Warum?«
»Pickerel und ich haben keinen Bock mehr auf Lee. Wir wollen eine neue Band gründen. Er singt, und ich spiel Gitarre. Wir wollen dich als Drummer.«
»Van, ich kann überhaupt kein scheiß Schlagzeug spielen, spinnst du? Sorry, Mann, aber nein danke.«
»Ist ganz einfach. Pickerel bringt es dir bei. Du bist der Einzige, den wir kennen, der auf dieselbe Musik steht wie wir.«
Der junge Mark Pickerel spielte nicht nur sehr gut Schlagzeug, er war auch ein guter Sänger.
»Ich denk drüber nach, Mann, aber ich kann euch nicht versprechen, dass es klappt.«
Mit der bisherigen Band hatten sie Punk- und New-Wave-Coverversionen vor einem desinteressierten Publikum auf Schulfesten, Kirchenveranstaltungen und anderen selbst organisierten Gigs in der Gegend gespielt. Ich sah nicht, was das bringen sollte. Es führte zu nichts.
Eines Abends musste ich Gary etwas von der Arbeit nach Hause bringen, und seine Frau Cathy bestand darauf, dass ich mit ihnen zu Abend aß, obwohl Van gar nicht da war.
»Mark, arbeitest du gern im Laden? Ich habe gehört, du hast denselben Musikgeschmack wie unsere Jungs.«
»Ja, Ma’am, gefällt mir sehr gut. Danke, dass Sie mich eingestellt haben. Vor Van kannte ich niemanden, der auf dieselbe Musik steht wie ich. Ich bin echt froh, dass wir Freunde geworden sind.«
»Du weißt sicher auch, dass Lee eigene Songs schreibt, oder? Ich finde sie wirklich sehr gut. Lee! Lee!«, brüllte sie vom Küchentisch.
Von irgendwo aus dem Haus kam eine wütende Stimme.
»Was? Lass mich in Ruhe. Scheiße nochmal, ich bin beschäftigt!«
Ich nahm an, das war Lee. Ich kannte ihn vom Sehen, aber wir hatten uns noch nie unterhalten.
»Lee! Komm her. Nimm Mark mit und spiel ihm deine Songs vor!«
Lee kam in die Küche gestampft. Ohne mich anzusehen, sagte er: »Okay, komm mit.«
Ich folgte ihm in sein Zimmer. Überall stand psychedelisches Zeug rum, und an den lila-grün gestrichenen Wänden hingen verschnörkelte Hippieteppiche. Ich dachte, ich spinne – war der Typ ein verdammter Deadhead?
»Okay, ich hab hier einen Song, an dem ich arbeite. Willst du ihn hören?«
Ich wollte, aber zuerst hatte ich eine Frage. »Was ist das für ein Kassettenrekorder?«
Ich hatte noch nie jemanden eigene Musik aufnehmen sehen.
»Das ist kein Kassettenrekorder, das ist ein Tascam, ein Vierspurgerät. Damit kann ich auf jede Spur ein anderes Instrument aufnehmen und sie am Ende zusammenmischen, und fertig ist das Demo.«
»Und Gesang? Nimmst du den auch damit auf?«
»Klar, ich kann Spuren bouncen und hab dann wieder welche frei, zum Beispiel für den Gesang«, meinte er. Ich verstand kein Wort. »Egal. Hier, mein neuer Song.«
Er reichte mir den Kopfhörer, ich setzte ihn auf, und er drückte auf Play. Die Nummer war schnell und gitarrenlastig. Sie hatte einige gute Hooks, und der Gesang war überraschend catchy. Vom Text verstand ich nur wenig, aber soweit ich es mitbekam, klang er eher abgedroschen. Das war weder Punk noch irgendwie modern, nicht wie die Sachen, die ich aus ihrem Proberaum kannte, dafür aber rau und aggressiv. Trotz des bescheuerten Textes erschien mir das Demo ziemlich cool, eine Art roher Diamant. Ich war beeindruckt, dass dieser schräge Typ so etwas in seinem Zimmer fabriziert hatte.
»Das ist super, Mann! Wie viele hast du davon?«
»So an die fünfzig bis fünfundsiebzig. Ich mach das schon seit ein paar Jahren.«
»Jesus!«
Ich konnte es nicht fassen. Van hatte nie etwas davon erzählt.
»Kann ich noch was hören?«
Die nächsten Stunden verbrachte ich mit Lee allein in seinem Zimmer und hörte mir einen Haufen ungeschliffener, eingängiger Sixties-Garage-Nummern an. Ich hatte keine Ahnung, dass er oder sonst irgendwer in der Stadt so etwas draufhatte.
»Hey, Mann, pass auf, jetzt spiel ich dir mal das hier vor.« Und schon kam der nächste Song im selben Stil.
»Willst du mal was drauf singen? Van hat mir von deiner ersten Band erzählt.«
Mit fünfzehn hatte ich als Putzhilfe in einem Laden namens Hi-Way Grill gearbeitet und war dazu verdonnert worden, in der öden Band der beiden Köche zu singen. Nach nur einem Auftritt wurde ich wieder gefeuert, einer langweiligen Party, bei der wir Styx, Van Halen und sogar »My Sharona« gecovert hatten.
Ich musste lachen, als Lee vorschlug, ich sollte zu seiner Musik singen, war gleichzeitig aber fasziniert von diesem Freak, seiner Vierspurmaschine und seinen Songs. Innerhalb der nächsten Stunde schrieben wir zusammen einen platten Text und die passende Gesangsmelodie. Wir nahmen meinen Gesang in seinem Zimmer auf, und fertig war eine peinliche Garage-Retro-Nummer namens »Pictures in My Mind«.
Auf der Fahrt nach Hause dachte ich nach. Van und Pickerel wollten ihn loswerden, aber mir hatte es Spaß gemacht, mit diesem merkwürdigen, schweigsamen Kerl einen Song zu schreiben und aufzunehmen. Warum wollten sie sich ausgerechnet von dem einzigen Typen trennen, der eigene Musik machte, dem einzigen, der mehr wollte, als nur Songs zu covern, wie all die anderen bescheuerten Bands im Ort? Lee war an etwas dran, und ich wollte dabei sein.
»Ich hab gehört, Lee und du, ihr habt gestern einen Song geschrieben?«, meinte Van, als ich ihn am nächsten Tag bei der Arbeit sah. »Bist du jetzt sein neuer Kumpel? Dann wärst du nämlich der Erste.«
»So weit würde ich nicht gehen. Er redet nicht viel. Aber ihr seid verrückt, wenn ihr ihn rausschmeißt. Warum hast du mir nie was von seinen Songs erzählt? Fünfundsiebzig Stück, verdammte Scheiße, Mann! Ich hab mir ein paar angehört. Der Junge hat echt Talent. Bei den Texten ist noch Luft nach oben, aber abgesehen von der fragwürdigen ›Leadgitarre‹ über allem sind die Sachen ziemlich cool. Seine Hooks sind genial.«
Van sah mich verblüfft an.
»Ich hab mir nie groß Gedanken darüber gemacht«, sagte er. »Für mich war das immer sein Hobby und das Covern unser eigentliches Ding.«
»Das siehst du genau falsch rum. Als richtige Band musst du eigene Songs haben. Ich sag dir was, ich spiel mit dir und Pickerel in einer Band. Aber nur, wenn du deinen Bruder wieder mitmachen lässt und wir seine Songs spielen.«
Van schwieg eine Weile.
»Okay. Meine Mom ist sowieso an die Decke gegangen, als sie gehört hat, dass wir ihn rausschmeißen wollen. Du singst. Ich spiele Bass. Pix bleibt an den Drums.«
»Abgemacht«, sagte ich.
Wir benannten uns nach einem alten Electro-Harmonix-Effektgerät namens Screaming Tree. Witzigerweise war es ein Treble Booster, dabei klang Lees Gitarre sowieso schon total dünn und schrill.
Mit der Zeit stellte sich heraus, dass Lee und ich nicht gut miteinander klarkamen. Ich versuchte mein Bestes, nett zu ihm zu sein, aber es war, als würde ich mit einem Stein reden. Bei ihm gab es nur zwei Zustände, stumm oder wütend. Oft hörte ich ihn seinen Dad am Telefon anschreien: »Leck mich, Gary!« Er bediente sich an der Ladenkasse, als wäre es sein Bankkonto. Er kam rein, schnappte sich ein paar Hunderter, sagte seinem Vater, er könne ihn mal, und verschwand wieder.
Obwohl wir an jenem ersten Abend so viel Spaß gehabt hatten, bat er mich nie wieder, an einem Gesangspart oder Text mitzuarbeiten. Auch wenn ich sein Talent für eingängige Hooks durchaus erkannte, ging mir alles andere immer mehr auf die Nerven. Seine Texte waren grottenschlecht, voller Plattitüden über Schmetterlinge, Regenbögen, lächelnde Katzen, vollkommen sinnloser Müll. Ich versuchte mit allen Mitteln, ihn in eine coolere, zeitgemäßere Richtung zu bringen, doch es funktionierte nicht. Die Worte hatten sich schon zu tief in den Song, in die Hooks und die Melodie eingegraben. Hin und wieder änderte ich sie so ab, dass sie klanglich noch passten, aber für mich auch einen Sinn ergaben. Es war ein Kampf, der einen wahnsinnig machen konnte und den ich selten, wenn überhaupt je, gewann.
Aber wenn die Screaming Trees mich dafür aus Ellensburg rausholen konnten … seit ich denken konnte, hasste ich dieses tote Redneck-Kaff, die ignoranten, rechten White-Trash-Heubauern und Rinderzüchter, die dauernd übers Wetter redeten, hasste den ständigen peitschenden Wind, der den Fäulnisgeruch von Kuhscheiße durch die ganze Gegend blies. Ich wusste, da draußen wartete eine Welt auf mich, und ich hatte auch schon mehrmals versucht abzuhauen. Mit fünfzehn bewarb ich mich bei der Nationalgarde und quälte mich durch den achtstündigen Test, der genauso gut in Hieroglyphen hätte verfasst sein können. Seite um Seite ließ ich unausgefüllt, da ich kein einziges Wort verstand. Dann bat ich meinen Vater, seine Einwilligung zurückzuziehen, nachdem ich feststellte, dass ich mich gerade mal für die niedrigsten Jobs qualifiziert hatte, die tiefste Sprosse auf der Leiter. Ich schloss mich einem Wanderzirkus an, wurde aber komischerweise wieder gefeuert, weil ich mich weigerte, mir die Haare abzuschneiden. Schlechte Noten und eine Gefängnisstrafe hatten meine Baseballkarriere zerstört, sodass mir auch dieser Weg verschlossen blieb. Meine kaputten Beine taten ein Übriges. Irgendwie lag ein Fluch auf mir, ich fühlte mich gefangen in einem Teufelskreis aus sinnloser Arbeit und Kleinkriminalität, streifte ziellos und mit starrem Blick durch die Stadt und wünschte mir nichts mehr, als meiner Heimatstadt und diesem kranken, düsteren Geist, den sie in mir heraufbeschwor, zu entkommen.
Das Perverse, Fremde hatte mich schon immer fasziniert. Als junger Teenager sah ich ein altes Foto von einem volltätowierten Mann und fing sofort an, mich mit einer Nähnadel zu stechen, die ich mit Faden umwickelte und in ein Glas Tusche tauchte, das ich im College-Buchladen gestohlen hatte. Der Mann war von groben Knast-Tattoos übersät, aber als ich das Foto betrachtete, wusste ich sofort, dass ich eines Tages auch so aussehen würde. Als ich William Burroughs’ Buch Junkie in die Finger bekam, wusste ich außerdem, dass ich eines Tages heroinsüchtig sein würde. Während ich als Zehnjähriger unter den Tribünen unseres College-Footballfelds herumstöberte, fand ich ein Exemplar von Anaïs Nins Delta der Venus. Nach der Lektüre entwickelte ich ausgefeilte sexuelle Fantasien und geheime Obsessionen jeder erdenklichen Art. Ich suchte Aufregung, Abenteuer, Dekadenz, Verdorbenheit, irgendwas und alles, und nichts davon würde ich in diesem abgeschiedenen, verstaubten Kuhkaff finden. Wenn diese Band einen Ausweg bedeutete und mir das Leben ermöglichte, nach dem ich mich so sehr sehnte, war das alle Erniedrigungen, Entbehrungen und Qualen wert.
2
DAS FRAGILE KÖNIGREICH
NUR