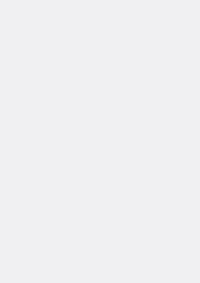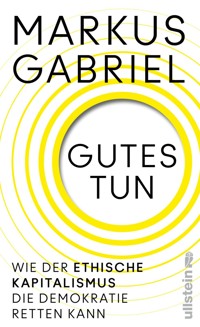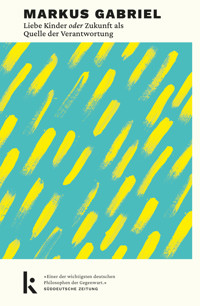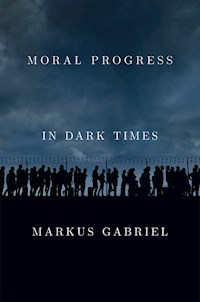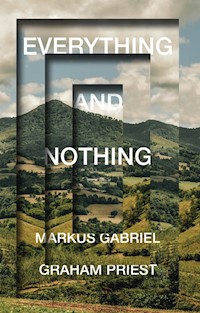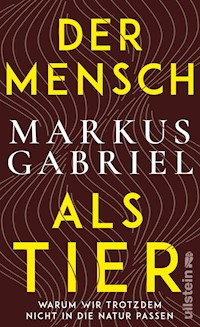25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sinnfeldtheorie
- Sprache: Deutsch
Die neuzeitliche Ontologie nimmt seit Kant und Frege an, Existenz sei keine (gewöhnliche) Eigenschaft. Damit wird die alte Frage nach dem Sinn von Sein in einem veränderten Rahmen neu formuliert. Allerdings wird dabei vorausgesetzt, die Bedeutung von »Existenz« ließe sich ohne Rekurs auf Sinnkategorien verständlich machen, gleichzeitig wird Existenz an logische Funktionen wie den Existenzquantor oder den Mengenbegriff zurückgebunden. Gegen diese Annahmen vertritt Markus Gabriel in seinem originellen neuen Buch eine Ontologie der Sinnfelder: Zu existieren heißt, in einem Sinnfeld zu erscheinen. Überraschenderweise spricht laut Gabriel genau dies für einen neuen Realismus in der Ontologie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 852
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Die neuzeitliche Ontologie nimmt seit Kant und Frege an, Existenz sei keine (gewöhnliche) Eigenschaft. Damit wird die alte Frage nach dem Sinn von Sein in einem veränderten Rahmen neu formuliert. Allerdings wird dabei vorausgesetzt, die Bedeutung von »Existenz« ließe sich ohne Rekurs auf Sinnkategorien verständlich machen, gleichzeitig wird Existenz an logische Funktionen wie den Existenzquantor oder den Mengenbegriff zurückgebunden. Gegen diese Annahmen vertritt Markus Gabriel in seinem originellen neuen Buch eine Ontologie der Sinnfelder: Zu existieren heißt, in einem Sinnfeld zu erscheinen. Überraschenderweise spricht laut Gabriel genau dies für einen neuen Realismus in der Ontologie.
Markus Gabriel ist Professor für Philosophie an der Universität Bonn und Direktor des Internationalen Zentrums für Philosophie NRW. Im Suhrkamp Verlag sind erschienen: Skeptizismus und Idealismus in der Antike (stw 1919) sowie Der Neue Realismus (Hg., stw 2099).
Markus Gabriel
Sinn und Existenz
Eine realistische Ontologie
Suhrkamp
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Der folgende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2116.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2016
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
eISBN 978-3-518-73872-6
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort
Einleitung
I. Negative Ontologie
§1 Existenz ist keine eigentliche Eigenschaft
§2 Warum weder Kant noch Frege?
§2a Kant und die Existenz der Welt
§2b Frege und die Existenz von Begriffen
§3 Probleme der mengentheoretischen Ontologie
§4 Gegenstandsbereiche und Sinnfelder
§5 Sinnfelder und die Bedeutung von »Existenz«
§6 Die Keine-Welt-Anschauung
II. Positive Ontologie
§7 Indefinit viele Sinnfelder
§8 Flache und formale Ontologie
§9 Wirklichkeit und Möglichkeit (Modalitäten I)
§10 Notwendigkeit, Kontingenz und logische Zeit (Modalitäten II)
§11 Formen des Wissens: Der epistemologische Pluralismus
§12 Sinne als Eigenschaften der Dinge an sich
Literaturverzeichnis
Vorwort
Dieses Buch sollte ursprünglich eine Übersetzung meiner Abhandlung Fields of Sense werden, deren Grundzüge ich 2013 während einer Gastprofessur am Department of Philosophy der UC Berkeley ausgearbeitet habe.[1] Seit der Einreichung des englischen Manuskripts hat die internationale Debatte über den Neuen Realismus in seinen verschiedenen Spielarten freilich Fahrt aufgenommen. Deswegen habe ich die Publikation der deutschen Version auch zum Anlass genommen, das Manuskript im Licht vorgetragener Einwände zum Teil umzuarbeiten, Konturen einzelner Argumente zu schärfen usw. Überdies wurde mir bei der Übersetzungsarbeit klar, dass die Artikulation philosophischer Gedanken teilweise davon abhängt, welche Zielgruppe angesprochen werden soll – diese variiert nicht unerheblich mit derjenigen Sprache, in der eine philosophische Argumentation dargestellt wird. Dennoch möchte ich an dieser Stelle wiederholen, was ich bereits im Vorwort zu Fields of Sense betont habe: Die internationale Debatte um den Neuen Realismus nimmt ihren Ausgangspunkt von der Einsicht, dass die Unterscheidung der Philosophie in analytische und kontinentale (europäische, hermeneutische usw.) Philosophie sachlich längst obsolet ist. Sie dient heute allenfalls zur Zementierung von Gruppenidentitäten und ist in dem Maße sogar unvernünftig, in dem suggeriert wird, alle philosophische Theoriebildung sei letztlich eine Art lokaler Folklore, die eine »angelsächsisch«, die andere »deutsch«, »französisch«, »italienisch« oder was auch immer (ganz zu schweigen von der absurden Konstruktion eines »fernöstlichen Denkens«). Es ist bemerkenswert, dass der antiquierte Ausdruck »angelsächsische Philosophie« bis heute zirkuliert und nahelegt, diese bestehe nicht nur aus auf Englisch geschriebenen Texten und geführten Diskussionen, sondern habe überdies eine kulturelle Dimension, an der keiner partizipiert, wenn er kein echter Angelsachse ist, selbst wenn er sich auf Englisch ausdrückt.
Nicht besser steht es um die »deutsche« oder die »französische« Philosophie, sofern mit diesen Benennungen unterstellt wird, es gebe gleichsam philosophische »Volksgeister« oder »Nationalcharaktere«, die etwa Hegel an Kant schmieden und beide von Susan Haack und Martha Nussbaum bzw. Jacques Derrida und René Descartes trennen. Dagegen knüpft der Neue Realismus von vornherein an die radikale Ablehnung eines kulturalistischen Relativismus an, der davon ausgeht, dass sich hinter jedem Anspruch auf Vernunft eine lokale Kultur verbirgt, die autonom und hinter dem Rücken der Akteure absteckt, was als gültige Überlegung anerkannt werden wird.
Der vorliegende Beitrag zum Neuen Realismus verdankt seine ersten Impulse nicht zufällig einem Forschungsaufenthalt als Postdoc des DAAD 2005/2006 am Department of Philosophy der New York University. Damals hatte Thomas Nagel gerade begonnen, Geist und Kosmos zu konzipieren, und Paul Boghossian diskutierte die erste Fassung von Angst vor der Wahrheit.[2] Auch die Fortsetzung der regelmäßigen Gespräche mit Thomas Nagel während meiner Zeit an der New School for Social Research (2008/2009) haben dazu beigetragen, mich von der Existenz objektiver Vernunftstrukturen zu überzeugen, denen man sich zwar unter lokalen Bedingungen nähern muss, die aber nicht dadurch unterminiert und auf eine problematische Weise relativiert werden, dass jede philosophische Ausbildung sich anhand verschiedener Präferenzen vollzieht, die ihrerseits an Traditionsbildungen und Wirkungsgeschichten gebunden sind. Kurzum: der Neue Realismus knüpft methodologisch an Habermas’ geflügeltes Wort der »Einheit der Vernunft in der Vielfalt ihrer Stimmen« an.
Der Hintergrund meiner eigenen philosophischen Ausbildung in Heidelberg bringt es mit sich, die Auflagen an eine gelungene Theoriekonstruktion in Anspruch zu nehmen, die der nachkantische (bisweilen auch als »deutsche« bezeichnete) Idealismus ausgearbeitet hat. Meines Erachtens gibt es sehr gute Gründe dafür, dass die vor allem von Kant und Hegel (aber auch von Fichte und Schelling) ausgearbeiteten Reflexionstheorien weiterhin im Rennen sind. Jenseits spezifischer Argumente und Beiträge zur Lösung gegebener philosophischer Probleme haben diese Denker nämlich darauf hingewiesen, dass es allgemeine Bedingungen gelungener Theoriekonstruktion in der Philosophie gibt, auf die man insbesondere dann stößt, wenn man sich fragt, was eine Theorie letztlich über ihre eigenen Aussagebedingungen aussagt.[3] Die in diesem Buch vorgelegte Darstellung einer realistischen Ontologie unter den Vorzeichen des Neuen Realismus versteht sich methodologisch ausdrücklich als eine Anknüpfung an solche klassischen/systematischen Theoriebedingungen. Sie bringt diese aber in den Kontext der gegenwärtigen Debattenlandschaft ein, die freilich durch maßgebliche philosophische Arbeiten zum Realismusbegriff und zur Erneuerung der Metaphysik geformt wurde, die überwiegend im englischsprachigen, häufig als »analytisch« kursierenden Rahmen entstanden sind. Gleichzeitig spielt die Auseinandersetzung mit der neueren Philosophie in Frankreich, vor allem mit Quentin Meillassoux’ einflussreichem Nach der Endlichkeit sowie mit Alain Badious Beiträgen zur Ontologie, eine zentrale Rolle.[4]
Bevor die eigentliche Arbeit aufgenommen werden kann, ist hier noch der Ort, um mich bei einigen Institutionen und Personen für die vielfältige Unterstützung zu bedanken, ohne welche dieses Buchprojekt nicht realisiert worden wäre. An erster Stelle gilt mein Dank der Universität Bonn und dem Käte Hamburger Kolleg »Recht als Kultur« für die Gewährung einer Reihe von Forschungssemestern, während deren die Grundlinien meines Beitrags zum Neuen Realismus konzipiert werden konnten. Ebenso danke ich dem Istituto italiano per gli studi filosofici für seine Gastfreundschaft in den Jahren 2009-2012. Die dort gehaltenen Vorlesungen sind 2012 unter dem Titel Il senso dell’esistenza erschienen, bei welcher Gelegenheit ich einige der Ideen der Sinnfeldontologie zum ersten Mal ausführlich diskutieren konnte.[5] An dieser Stelle gebührt mein Dank Maurizio Ferraris, mit dem in Neapel das bisher nicht abgerissene Gespräch über den Neuen Realismus begann, aus dem 2012 auch eine große internationale Tagung in Bonn hervorging.[6] Ich danke weiterhin Hans Sluga dafür, dass er meinen Aufenthalt in Berkeley ermöglicht hat, sowie den dortigen Philosophinnen und Philosophen für die Gastfreundschaft und die vielfältigen Diskussionen der hier ausgeführten Überlegungen. Die Hauptarbeit meiner eigenen Übersetzung des ursprünglich auf Englisch geschriebenen Buchs konnte ich während meines Aufenthalts als Senior External Fellow am Freiburg Institute of Advanced Studies fertigstellen, wofür ich mich hiermit auch bedanken möchte.
Meine Überlegungen wurden in den letzten Jahren maßgeblich durch philosophische Gespräche mit vielen Personen geschärft, die ich nicht alle aufzählen kann. Dennoch möchte ich einige nennen, auf die in meinen Augen ein Fortschritt an Klarheit hinsichtlich der Thesen und Argumente zurückgeht, die im Folgenden ausgeführt werden: Marius Bartmann, Jocelyn Benoist, Paul Boghossian, Ray Brassier, G. Anthony Bruno, Otávio Bueno, James Conant, Deborah Danowski, Mario de Caro, Eduardo Viveiros de Castro, David Espinet, Paul Cesar Duque Estrada, Maurizio Ferraris, Günter Figal, Michael Forster, Manfred Frank, Marcela García, Marin Geier, Jean-Christophe Goddard, Iain Grant, Graham Harman, Wolfram Hogrebe, Robert Howell, Alexander Kanev, Tobias Keiling, Andrea Kern, Anton Friedrich Koch, Max Kötter, Paul Livingston, Jocelyn Maclure, Andrea Le Moli, Eduardo Luft, Quentin Meillassoux, Nikola Mirkovic, Thomas Nagel, Rodrigo Nunes, Robert Pippin, Sebastian Rödl, Jens Rometsch, Abby Rutherford, Rainer Schäfer, Dorothee Schmitt, John Searle, Umrao Sethi, Hans Sluga, Vadim Vasilyev, Conrad Wald und Stephan Zimmermann. Besonders hervorzuheben sind Umrao Sethi und Rainer Schäfer. Während Umrao die vorletzte Fassung des englischen Texts kritisch kommentiert und damit eine weitere Umarbeitung nötig machte, hat Rainer Schäfer seinerseits und mit demselben Ergebnis die vorletzte Fassung des deutschen Texts bearbeitet. Ob und inwiefern ich allen Einwänden und Nachfragen angemessen Rechnung getragen habe, ist damit freilich noch nicht entschieden. Ich danke auch Thomas Buchheim dafür, dass er im Philosophischen Jahrbuch eine Jahrbuchkontroverse veranstaltet, dank deren mir derzeit ausführliche kritische Einsprüche von Claus Beisbart, Catharine Diehl/Tobias Rosefeldt, Marcela García, Volker Gerhardt, Johannes Hübner, Anton Friedrich Koch, Sebastian Rödl und Pirmin Stekeler-Weithofer vorliegen, auf die ich im Rahmen von Repliken im Philosophischen Jahrbuch antworten werde bzw. bereits geantwortet habe. Zum Teil ist diese Diskussion noch in dieses Buch eingeflossen. Was den Rahmen dieser ersten Ausarbeitung der Grundlinien einer Sinnfeldontologie sprengt und umfangreiche Ausflüge in andere Gebiete der Philosophie zur Verteidigung der Grundideen gegen einschlägige Einwände verlangt, wird neben meinen Repliken im Philosophischen Jahrbuch an anderer Stelle ausgeführt.[7]
Abschließend möchte ich mich noch bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – vor allem bei Marin Geier, Yonca Sicimoglu und Conrad Wald – für die Durchsicht des Manuskripts sowie ihre redaktionelle Arbeit bei der Erstellung der Bibliographie bedanken.
Einleitung
Ontologie und Metaphysik erfreuen sich trotz der in den letzten Jahrhunderten mehrfach verkündeten Aussicht auf ein nachmetaphysisches Zeitalter seit geraumer Zeit wieder großer Beliebtheit. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Viele dieser Gründe speisen sich aus dem inzwischen aufgekommenen Unbehagen an der Annahme, dass man die Beantwortung der Frage, was es gibt (oder was es wirklich gibt), erfolgreich an die Naturwissenschaften delegieren kann. Die Metaphysikkritik hatte im Gefolge Kants zunächst ja gerade dadurch Fahrt aufgenommen, dass es möglich schien, Existenzfragen in der philosophischen Reflexion insofern auszuklammern, als es in dieser nur um die Analyse unserer allgemeinsten ontologischen Verpflichtungen gehe. Kant hat dabei die folgenschwere Formulierung in den Raum gestellt, dass die kategorialen Strukturen, die vormals die Ontologie zu entdecken beabsichtigte, in Wahrheit »bloß Prinzipien der Exposition der Erscheinungen« seien und dass deswegen auch
der stolze Name einer Ontologie, welche sich anmaßt, von den Dingen überhaupt synthetische Erkenntnis a priori in einer systematischen Doktrin zu geben […] dem bescheidenen einer bloßen Analytik des reinen Verstandes Platz machen[1]
müsse. An anderen Stellen versteht er Ontologie als die »Wissenschaft von den allgemeinern Eigenschaften aller Dinge«.[2] Dies kann man so verstehen, dass Kant damit gegen die Möglichkeit argumentiert, eine Theorie aller Dinge überhaupt zu liefern, die nicht nur absolut allgemein ist, sondern die uns überdies neue (synthetische) Erkenntnisse über alle Dinge verschafft, indem sie ihre allgemeinen Eigenschaften untersucht.
Wenn auch im Einzelnen mit anders gelagerten Argumenten, stößt in neuerer Zeit unter anderem Hilary Putnam in Ethics without Ontology in ein ähnliches Horn, wenn er die Ontologie mit seinen bekannten Argumenten für die begriffliche Relativität unterminieren möchte, um zu zeigen, dass es kein auf ewig festgelegtes Grundinventar der Wirklichkeit und damit anscheinend auch keine allgemeinsten Eigenschaften der Dinge geben kann.
Damit steht Putnam freilich am Ende der Geschichte der Metaphysikkritik seit Kant, die sich immer wieder darauf beruft, dass wir nicht aus dem Lehnstuhl heraus a priori erkennen können, wie die Welt oder die Wirklichkeit im Ganzen beschaffen ist. Kant hat freilich genaugenommen vor allem gegen eine Ding-Ontologie argumentiert, die annimmt, wir könnten informative (synthetische) Urteile über alle Dinge überhaupt formulieren, da er »Wirklichkeit« an mögliche Erfahrung bindet und damit sicherstellt, dass alles, was wirklich ist, (unter idealisierten Bedingungen) erkennbar ist. Statt zu meinen, wir seien dadurch auch schon de facto imstande, synthetische Urteile über alles, was es überhaupt gibt (über alle Dinge), zu fällen, aus denen Wissen (also rechtfertigbares, »sowohl subjektiv als objektiv zureichende[s] Fürwahrhalten«[3]) abgeleitet werden kann, müssten wir unser Vokabular unter die Lupe nehmen, sofern es uns vorspiegelt, wir hätten es mit den kategorialen Grundstrukturen einer allumfassenden Wirklichkeit aller Dinge aufgenommen, während wir doch letztlich immer nur Modelle oder Weltbilder entwerfen könnten. Diese seien dadurch vereinheitlicht, dass sie den methodischen Gang unseres empirischen Informationserwerbs steuerten. Wir hätten demnach zwar methodisch gesehen ontologische Verpflichtungen einzugehen, diese ließen aber niemals einen Schluss darauf zu, wie die Dinge an sich beschaffen sind, was also die ontologischen Wahrheiten sind.[4] Diese rücken damit – wie seinerzeit bereits Hegel in seiner Kantkritik moniert hat – potenziell in die Ferne eines unerkennbaren Jenseits.
Überlegungen der kantischen Form laufen auf einen ontologischen Antirealismus hinaus. Bei diesem handelt es sich meiner Auffassung nach um die These, dass wir die Grundbegriffe der Ontologie – Existenz, Möglichkeit, Wirklichkeit, Notwendigkeit, Wesen, Substanz, Ding, Eigenschaft usw. – nur dann vollständig verstehen, wenn wir unsere prägende Verwendung dieser Begriffe in Betracht ziehen.[5] In der Tat erfüllen diese Begriffe immer auch eine theoretische Rolle in unseren Überlegungen darüber, wie wir uns eine gegebene Wirklichkeit verständlich machen können. Sie gehören zum System menschlicher Überzeugungen. Daraus schließen ontologische Antirealisten seit Kant, dass die Analyse dieser Begriffe uns nicht etwa der Wirklichkeit oder der Welt an sich näher bringe, sondern bestenfalls logische Formen im Sinne von Formen des (menschlichen) Denkens beschreibe. Ob und inwiefern unsere besten theoretischen ontologischen bzw. metaphysischen Modelle der Welt an sich (allem, was es überhaupt gibt) entsprechen, ließe sich im Allgemeinen nicht entscheiden – was Kant selber in der Tat annimmt. Denn in dieser Hinsicht ist es schlichtweg eines der Hauptresultate der Kritik der reinen Vernunft, dass wir hinsichtlich der absoluten Totalität aller Dinge, die es überhaupt gibt, keine Erkenntnis und damit auch kein Wissen erlangen können.
Vieles spricht gegen die (von Kant freilich nicht unqualifiziert geteilte) Annahme, daraus folge auch, dass wir niemals etwas im Vollsinne wissen, da wir immer nur Modelle entwerfen, die sich von der Wirklichkeit inhaltlich und strukturell radikal unterscheiden könnten. Deshalb ist es schon seit längerem zu einer Renaissance von Ontologie und Metaphysik in verschiedenen Traditionen der Philosophie gekommen. Die Phänomenologie hat spätestens mit Heidegger – und zwar gerade im Ausgang von einer bestimmten Kant-Deutung – eine klare ontologische Wende vollzogen (wenn auch weiterhin in metaphysikkritscher Absicht), und die analytische Ontologie und Metaphysik stehen trotz aller Einsprüche von Seiten Carnaps, Quines oder Putnams in voller Blüte. Wie Theodore Sider ausführt, läuft schon die Bestreitung unserer Fähigkeit, logisch relevante Grundstrukturen der Dinge überhaupt oder der Dinge im Allgemeinen zu erkennen, darauf hinaus, dass man sich ein metaphysisches Bild von ihnen gemacht hat.[6] Man hat ja Überzeugungen dahingehend gebildet, dass die ontologischen Grundbegriffe irgendwie nicht direkt von Dingen, sondern etwa von unseren begrifflichen Rahmen handeln, was aber voraussetzt, dass man Wissensansprüche hinsichtlich der Frage erhebt, warum es sich so verhält. Dies setzt aber voraus, dass man irgendeinen Zugriff auf die vermeintlich schwer oder gar nicht theoretisch zugänglichen Dinge hat, der uns Gründe dafür liefert, einige von ihnen (als Dinge an sich) auf der anderen Seite einer Grenze zu verorten.
Und warum sollten die Bedingungen dafür, dass wir überhaupt etwas erkennen können, uns auch ausgerechnet dabei im Weg stehen, etwas zu erkennen? Um dafür zu argumentieren, reicht es sicherlich nicht hin, den Ausdruck »Ding an sich« so zu verwenden, dass er sich nur auf etwas beziehen soll, das prinzipiell nicht das erkennbare Element der Erkenntnisrelation sein kann. Dann ist es zwar wahr, dass wir Dinge an sich niemals erkennen können, doch um den Preis, dass diese These keinerlei Informationsgehalt mehr hat.
Um eine informative, bestreitbare These über die prinzipielle Unerkennbarkeit einer bestimmten Art von Dingen plausibel zu machen, wird man schon in irgendeinem Sinn Ontologie und Metaphysik betrieben haben und damit – offiziellen Bescheidenheitsfloskeln zum Trotz – sehr wohl einen Ausgriff auf das Ganze aller Dinge überhaupt in Anspruch genommen haben. Deswegen votiert Sider zu Recht für einen ontologischen Realismus, wobei er insbesondere sehr allgemeine Gründe dafür liefert, anzunehmen, dass wir ansonsten nicht einmal davon ausgehen könnten, dass es überhaupt Strukturen gibt, die wir erkennen können.[7] Auf irgendeiner Ebene müssen wir einfach damit rechnen, dass es natürliche Arten gibt, das heißt Einteilungen der Wirklichkeit selber, die nicht lediglich deswegen bestehen, weil wir ein bestimmtes Vokabular zum Einsatz bringen, das eine theoretische Rolle in unseren begrifflichen Rahmen spielt. Oder um eine auf Platon zurückgehende und von David Lewis wiederbelebte Metapher zu benutzen: Zumindest einige unserer ontologischen Grundbegriffe »teilen die Natur entlang ihren Fugen ein (carving nature at its joints)«.[8]
Während ich Reflexionen dieser Art in gewisser Hinsicht für zutreffend halte, laufen sie Gefahr, einer zentralen, aber in dieser Debatte zu wenig beachteten Einsicht Kants zuwiderzulaufen. Sie lautet, dass jedenfalls die Wirklichkeit im Ganzen, die er kurzum als »die Welt« bezeichnet, kein Gegenstand der objektstufigen Erkenntnis, ja nicht einmal ein Gegenstand des Wissens ist.[9] Dies spielt eine entscheidende Rolle in Kants Vorbehalten gegenüber Ontologie und Metaphysik im vorkritischen, nichtkantischen Sinne. Diese unterstellen nämlich in seinen Augen, dass es eine Wirklichkeit gibt, die völlig unabhängig von allen epistemischen Systemen eine allgemeine Struktur aufweist, die festlegt, was der Fall ist bzw., noch allgemeiner: was der Fall sein kann. Dagegen weist Kant insbesondere darauf hin, dass solche Behauptungen sich niemals als eine begründete Generalisierung des lokalen Erfolgs der Naturwissenschaften erweisen lassen. Vor allem unsere allgemeinsten Annahmen darüber, wie derjenige Bereich verfasst ist, den wir »die Natur« nennen, kommen schlichtweg nicht dadurch zustande, dass wir die Natur untersuchen und ihre Fugen entdecken. In der minimalsten Version der kopernikanischen Wende hält Kant mit guten Gründen dagegen, indem er darauf hinweist, dass wir überhaupt nur nach Fugen der Natur Ausschau halten können, indem wir schon Begriffe investieren, die uns den Gegenstandsbereich unserer empirischen Untersuchungen als vereinheitlicht zugänglich machen.
Dabei hält Kant freilich am Weltbegriff fest, deutet diesen aber so um, dass die Welt nicht mehr der Name für den Gegenstand unserer metaphysischen oder gar naturwissenschaftlichen Untersuchungen ist. Sie wird vielmehr zum »Feld möglicher Erfahrung«,[10] das dadurch zusammengehalten wird, dass wir eine systematische Einheit als regulative Idee unterstellen. Kurzum, Kant weist darauf hin, dass die Welt jedenfalls kein Gegenstand in der Welt ist, weswegen wir ihr auch nicht als Geist oder als theoriebildendes Bewusstsein gegenüberstehen können, um nun herauszufinden, wie die Welt unabhängig von unserem Bewusstsein beschaffen ist.[11]
Einer weitverbreiteten und naheliegenden Annahme zufolge handelt die Ontologie davon, »was es gibt«,[12] bzw. davon, was es »wirklich« gibt. Im gleichen Atemzug könnte man nahtlos hinzufügen, die Ontologie beschäftige sich mit der Frage, wie »die Wirklichkeit« oder »die Realität« an sich beschaffen seien, das heißt unabhängig von unseren Urteilen oder Vorurteilen hinsichtlich ihrer intrinsischen Komposition. Die Ontologie befaßt sich demnach allenfalls indirekt mit der Frage, wie wir wissen können, was es (wirklich) gibt – ein Thema, das dann ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, wenn Gründe dafür angeführt werden, dass es nicht ohne weiteres möglich ist, von unseren Urteilen hinsichtlich der Wirklichkeit abzusehen.
Wenn man also davon ausgeht, dass es in der Ontologie unter Abstraktion von unseren Einstellungen im Allgemeinen um dasjenige geht, was es (wirklich) gibt, verwundert es nicht, dass die Ontologie spätestens seit den Eleaten im Ruf steht, unsere alltäglichen Überzeugungen zumindest potenziell radikal zu unterminieren. Vor diesem Hintergrund entwickelten schon Platon und Aristoteles jeweils eine Ontologie in dem sehr anspruchsvollen Sinn einer Theorie des Zusammenhangs zwischen dem, was es (wirklich) gibt, und den grundlegenden Strukturen unseres logisch disziplinierten Denkens. Beiden ging es darum, die revisionären Bestrebungen der Eleaten und anderer vorsokratischer Metaphysiker im Zaum zu halten.
Die antiken Metaphysiker haben die Frage nach Sinn und Bedeutung von »Sein« häufig als eine Form des Strebens nach einer übermenschlichen, geradezu göttlichen Einsicht präsentiert, ein Streben, das die Meinungen der Sterblichen potenziell transzendiert. Aus diesem Grund traten Skeptizismus und Metaphysik schon früh gemeinsam auf.[13] Unsere alltäglichen Überzeugungen (die »Meinungen der Sterblichen«) seien lediglich auf Denkverhältnisse mittlerer Skalen zugeschnitten, weshalb wir im Alltag zu Opfern von Illusionen würden, wozu Überzeugungen gehören wie diejenige, dass sich mesoskopische Körper durch den Raum bewegen, bzw. die noch einfachere, dass es überhaupt stabile mesoskopische Körper gibt bzw., noch radikaler, dass es überhaupt eine Pluralität von Dingen oder Gegenstände, das heißt Seiende im Plural, gibt. Bis heute hören wir, die Ontologie gehe in diesem Sinn den Dingen auf den Grund und präpariere die »fundamentale Natur der Wirklichkeit (the fundamental nature of reality)« aus den potenziell irreführenden Erscheinungen heraus, die irgendwann Anlaß zu unseren artspezifischen Illusionen gegeben haben mögen.
In diesem Szenario treten Ontologie und Metaphysik als Alliierte auf in dem Sinne, dass die Ontologie nicht etwa bloß als eine Antwort auf die Frage eingeführt wird, was es eigentlich bedeutet, wenn etwas »ist« oder »existiert« (oder, was traditionell als schwieriger empfunden wird, was es eigentlich bedeutet, wenn etwas nicht »ist« oder nicht »existiert«). Stattdessen wird der Ontologie die viel anspruchsvollere Aufgabe in die Schuhe geschoben, sich neben der notorisch schwierigen Frage nach dem »Sinn von ›Sein‹« auch noch mit dem Unterschied von Sein und Schein zu befassen, das heißt, Sein oder Existenz nicht neutral hinsichtlich der Frage nach Wahrheit und Irrtum zu beurteilen, sondern die Seinsfrage von vornherein hinsichtlich unserer Meinungen über die Tiefenstruktur der Wirklichkeit zu entscheiden.
Diese heute gängige Arbeitsteilung ordnet die Ontologie der Metaphysik unter, wobei Letztere als die substantiellere Untersuchung gesehen wird, eine Untersuchung, die in der griechischen Philosophie kaum zufällig auf die Frage nach der Substanz führte. Aristoteles identifiziert als Erster ausdrücklich und folgerichtig die Frage nach der Bedeutung von »Sein« bzw. »Seiendem« (τί τὸ ὄν;) mit der Frage nach der Substanz (τίς ἡ οὐσία;).[14]
Die vielfältigen Wendungen der antiken Metaphysik resultieren in der Tat aus der allgemein akzeptierten Idee, dass es einen grundlegenden substantiellen Unterschied gibt, der »das wahre Wesen der Dinge« von der Art und Weise trennt, wie die Dinge dank unserer Anwesenheit unter ihnen erscheinen. Dies erlaubt dann unter Umständen, die Erscheinungen aufgrund ihrer Fehleranfälligkeit zu denunzieren und immer schon für bloße Erscheinungen zu halten. Die Erscheinungen stehen notgedrungen unter Verdacht, wenn wir die Meinungen der Sterblichen für einen verzerrten oder perspektivisch einseitigen Zugang zur grundlegenden Wirklichkeit halten.
Trotz der vielfältigen metaphysikkritischen, teilweise begrüßenswerten Anstrengungen der letzten zweihundert Jahre – von Kants Trennung von Erkenntnistheorie und Metaphysik bis zu der Kritik der traditionellen Metaphysik insgesamt etwa bei Heidegger, Carnap, Wittgenstein, Rorty, Derrida und Habermas – ist die gegenwärtige Ontologie zu den Vorsokratikern zurückgekehrt. Dabei herrscht dem Zeitgeist gemäß eine nur äußerst selten in Frage gestellte Spielart der materialistischen Varianten der vorsokratischen Metaphysik vor. Die Analytische Metaphysik greift den Substanzbegriff auf eine solche Weise wieder auf, dass natürliche Arten nicht mehr mit eidetischen Strukturen allgemeiner Art, sondern nun mit denjenigen Gegenständen identifiziert werden, die sich im Universum vorfinden. In der gegenwärtigen Analytischen Metaphysik kehrt der Ausdruck »grundlegende Natur der Wirklichkeit (fundamental nature of reality)« immer wieder. Dort geht es um begriffliche Probleme, die auftauchen, wenn wir versuchen, »die allgemeine Beschaffenheit der Welt und ihrer Bewohner«[15] zu explizieren. Der hier zum Tragen kommende metaphysische Sinn des Ausdrucks »Realität« wird bereits von Russell folgendermaßen erläutert:
Wenn ich wie jetzt über Realität spreche, dann kann ich das Gemeinte am besten erklären, indem ich sage, daß ich damit alles meine, was in einer vollständigen Beschreibung der Welt erwähnt werden müßte.[16]
Keineswegs möchte ich das Offensichtliche leugnen, nämlich dass die Methode und das Maß an logischer und argumentativer Raffinesse, das in der jüngsten metaphysischen Debatte zum Tragen kommt, einen signifikanten Fortschritt im Vergleich zu den Zeiten Demokrits darstellt. Gleichwohl ist es allzu deutlich, dass der Prämissenrahmen der gegenwärtigen Analytischen Metaphysik uns ein Weltbild zumutet, das wir als Ausgangspunkt aller folgenden Argumente hinnehmen sollen. Dieses Weltbild erinnert an die uralte Idee von »Atomen im Leeren«, nur dass dieses Weltbild nun durch die genauere Bestimmung der Reichweite unserer Projektionen durch quantifizierende Strukturen ergänzt wird, die das rohe physische und von sich her schon glatt individuierte Material überlagern.[17]
Ein Großteil der Arbeiten, welche die jüngsten Diskussionen ausgelöst haben – insbesondere die ontologischen und meta-ontologischen Debatten, die man mit Carnap, Quine, Putnam oder David Lewis verbindet –, basiert auf der materialistischen Prämisse, dass dasjenige, was wirklich ist, paradigmatisch durch den Theorierahmen einer als vereinheitlicht gedachten Physik definiert wird, sodass uns nur noch übrig bleibt, die menschlich-allzumenschlichen Projektionen von demjenigen abzuziehen, was wirklich ist.
Nennen wir dies etwas grobschlächtig die naturalistische Metaphysik. Diese geht davon aus, dass die Wirklichkeit ein Bereich ist, der sich aus natürlichen Arten zusammensetzt, die genau deswegen natürlich und wirklich sind, weil sie in der Ontologie der als vereinheitlicht gedachten Physik vorkommen. Die gegenwärtige Analytische Metaphysik ist deswegen wörtlich eine Meta-Physik, das heißt der Versuch, die Grundbegriffe zu klären, die angeblich von der Physik in Anspruch genommen werden müssen, um sicherzustellen, dass die Wirklichkeit sich im Wesentlichen nicht darum kümmert, dass es urteilende, denkende und handelnde Wesen gibt. Während Platon und Aristoteles meinten, es gebe Gegenstandsbereiche, die keiner physikalischen Untersuchung zugänglich sind, reduziert sich Metaphysik heute meist auf eine Reflexion auf die Grundbegriffe der Physik. Die Wirklichkeit wird auf diese Weise an den von der Physik (bzw. dem Ensemble der Naturwissenschaften) untersuchten Gegenstandsbereich gebunden, den ich als »das Universum« bezeichnen und damit von »der Welt« unterscheiden werde, die dieser terminologischen Festlegung zufolge auch nicht-physikalische (bzw. nicht naturwissenschaftlich erforschbare) Gegenstandsbereiche enthalten kann.
Im Folgenden werde ich eine Ontologie entwickeln, die man als Metaphysik im klassischen Sinn einer Verpflichtung auf die Existenz nicht-physikalischer Gegenstandsbereiche verstehen kann, wobei ich freilich zusätzlich dafür argumentieren werde, dass es überhaupt keine Welt im Sinne eines Bereichs aller physikalischen und nicht-physikalischen Bereiche gibt. Die Existenz nicht-physikalischer Gegenstandsbereiche erscheint nur dann als »mysteriös« oder vielleicht gar als »supranaturalistisch«, wenn man sich zuvor eine metaphysische Vorstellung von der Physik gemacht hat. Man muss unterstellen, dass es genau eine Wirklichkeit gibt, die ihrerseits dadurch vereinheitlicht ist, dass sie nur solches enthält, was der naturwissenschaftlichen Forschung – bzw. demjenigen, was man sich darunter vorstellt – zugänglich ist.
Der Prämissenrahmen der naturalistischen Metaphysik erklärt allererst die Attraktivität von Themen der gegenwärtigen Analytischen Metaphysik, etwa der Frage der mereologischen Komposition und damit die Diskussion der Frage, ob die Wirklichkeit an sich aus allen erdenklichen Kombinationen von »Materiebrocken« besteht, was natürlich auch die zeitlichen Teile vierdimensionaler Dinge mit einschlösse.[18] Die grundlegende und eigentlich auf den Prüfstand zu stellende Annahme lautet, dass Wirklichkeit prinzipiell physische Wirklichkeit ist und dass es sich bei dieser um die gesamte vierdimensionale Raumzeit handelt. Dies erlaubt die Annahme, dass mein Tisch gerade nur ein zeitlicher Teil des ganzen Tisches ist, bei dem es sich um ein vierdimensionales Ding handelt, das sich durch die Zeit in einer ähnlichen Weise erstreckt, in der es räumlich ausgedehnt ist.[19] Wie eine Liebende in Ferdinand von Schirachs Tabu sagt: »Du bist nie ganz da […]. Es ist immer nur ein Teil von dir da, aber ein anderer Teil ist nicht da.«[20]
Natürlich haben sich längst kritische Stimmen zu Wort gemeldet und eine Reihe von Diagnosen angeboten, die uns verständlich machen sollen, warum die naturalistische Metaphysik sich in Probleme mit Zeit und Raum verstrickt, die sie dann weit über den legitimen Rahmen der Wissenschaftstheorie hinaus ausdehnt. Sebastian Rödl hat etwa dargelegt, dass die zugrundeliegende Verwirrung dieser Diskussionen einerseits in einer fehlgeleiteten Zeitlogik und andererseits in einer fehlgeleiteten Handlungstheorie gründet.[21] Andere, etwa Eli Hirsch, argumentieren dafür, dass wir Strawsons Unterscheidung zwischen deskriptiver und revisionärer Metaphysik auf die Ontologie ausdehnen sollten, damit wir triviale Existenzaussagen – wie die Aussage, es gebe Hände und Berge – vor ihrer übereilten metaphysischen Umdeutung und Destruktion schützen können.[22] Die sogenannten objektorientierten Ontologen, allen voran Graham Harman, folgen Heidegger in der Ansicht, dass wir »das Ding«, also die Dinge, die in unserer sinnvollen Interaktion mit »der Welt« auftauchen, nicht ontologisch, also theoretisch verzerrend, unterminieren dürfen.[23]
Dabei fügt Harman hinzu, dass man solche Dinge nicht nur unterminieren kann, indem man nach einer Mikrowirklichkeit Ausschau hält, die mesoskopische Gegenstände trägt (auf der diese oder Wahrheiten über diese supervenieren). Es gebe andererseits ebenso prominente Manöver der »Überminierung (overmining)« mesoskopischer Dinge, indem man diese von oben herab in allgemeinen eidetischen Strukturen fundiert, etwa in einem apriorischen transzendentalen Bewusstsein oder in einem konstruktivistischen Theorieüberbau.[24]
Dieser Skalierung zufolge hängen viele Probleme der gegenwärtigen Ontologie von Entscheidungen ab, wie man die Wirklichkeit »mittelgroße[r] Exemplare von Trockenwaren (moderate sized specimens of dry goods)« einschätzt,[25] wie eine berühmte und immer wiederkehrende Formulierung Austins lautet. Unter veränderten Vorzeichen, aber mit einer ähnlichen Absicht spricht Stanley Cavell von dem »spezifische[n] Objekt«,[26] dessen Natur und unabhängige Wirklichkeit in der Philosophie in Frage gestellt wird. Solche Dinge sind etwa die antiken Beispiele von Türmen, die aus der Ferne eckig aussehen, die aber aus der Nähe betrachtet rund sind, im Wasser gekrümmt erscheinende Stöcke und in der neuzeitlichen und gegenwärtigen Philosophie Äpfel, Tische und Stühle. Diese Gegenstände sind paradigmatisch unter Verdacht geraten, weil sie, wie John Campbell in einem anderen Kontext festgehalten hat, durch die frühneuzeitliche Physik mitsamt den Sinneserfahrungen in unseren Kopf verschoben wurden.[27]
Das Gebiet der Ontologie ist sowohl in seiner historischen als auch nur in seiner gegenwärtigen Ausdehnung unüberschaubar. Dabei sind in den letzten Jahrzehnten neue Disziplinen entstanden, die geschaffen wurden, um einen allgemein akzeptablen methodologischen Rahmen zu entwickeln, insbesondere die Metametaphysik und die Metaontologie.[28] Die Reflexion auf die Wahrheitsbedingungen der ontologischen Untersuchung als solcher soll Klarheit im Dickicht schaffen. Um solche Versuche ist es allerdings dann nicht gut bestellt, wenn viele der Annahmen, die ich in diesen einführenden Paragrafen skizziert habe, in der Tat auf einen Irrweg führen, von dem es kein Zurück mehr gibt.
Das vorliegende Buch will demgegenüber ein neues Licht auf die traditionellen Fragen werfen, die unter den Oberbegriffen »Ontologie« und »Metaphysik« versammelt sind, indem es zwei Ideen aufgibt. Erstens die Assoziation von Ontologie und Metaphysik und zweitens die Idee, dass es eine vereinheitliche Totalität dessen gibt, was existiert, ob man diese Totalität nun »die Welt«, »das Sein«, »die Realität«, »das Universum«, »den Kosmos« oder »die Wirklichkeit« nennt.[29] Dagegen wird die positive Ontologie der Sinnfelder gesetzt, der zufolge es unzählige Sinnfelder gibt: bei einigen handelt es sich um objektiv bestehende Bereiche, in denen Gegenstände durch Regeln individuiert werden, unter denen sie stehen, sofern sie zu einem gegebenen Bereich gehören. Andere dagegen sind nicht von der Art, dass wir ihnen objektive Existenz zuschreiben, also derart, dass sie auch dann existiert hätten, wenn es niemals Begriffsverwender gegeben hätte.
Die These, dass unseren klassischen Totalitätsbegriffen kein Gegenstandsbereich entspricht, habe ich in Grundzügen bereits in Warum es die Welt nicht gibt vorgestellt.[30] Das vorliegende Buch arbeitet die dort skizzierte Ontologie aus und antwortet auf eine Reihe von Einwänden und Nachfragen, die in der Zwischenzeit in verschiedenen Kontexten erhoben wurden.[31] Dabei werde ich insbesondere auch eine Antwort auf die Frage geben, unter welchen Bedingungen wir Zugang zu denjenigen Strukturen haben, die ich als »Sinnfelder« bezeichne. Damit betreibe ich hier Ontologie im klassischen, doppelten Sinn: Auf der einen Seite verstehe ich Ontologie als eine systematische Beantwortung der Frage, was Existenz ist, die sich mit der Frage, was »Existenz« eigentlich bedeutet, überschneidet. Auf der anderen Seite meine ich, dass wir dabei immer auch im Auge behalten müssen, unter welchen Bedingungen wir diese Frage überhaupt stellen und beantworten können, ein Theorieformat, das ich an anderer Stelle als »transzendentale Ontologie« bezeichnet habe.[32] Deswegen wird es im Folgenden auch um Fragen der Erkenntnistheorie gehen, sofern diese dazu beitragen, uns Zugang zu Dingen an sich, das heißt hier zu solchen Dingen zu gewähren, die auch dann existiert hätten, wenn es niemals Begriffsverwender gegeben hätte.
Um nach diesen einleitenden Bemerkungen mit der eigentlichen Arbeit zu beginnen, ist es nötig, ein Vorverständnis der Termini zu erzielen, die ich verwenden werde. Da wäre an erster Stelle natürlich der Terminus »Ontologie«. Darunter verstehe ich, wie gesagt, die systematische Untersuchung von Existenz. Natürlich gibt es eine Reihe traditioneller Probleme, die vom Begriff des »Seins« herrühren, und ich bestreite nicht, dass einige dieser Probleme bestehen bleiben, auch wenn man Ontologie primär als Frage nach Sinn und Bedeutung von »Existenz« definiert. Es ist jedoch bekannt, dass »Sein« mit notorischen Ambiguitäten behaftet ist, wozu etwa die verschiedenen Gebrauchsweisen dieses Ausdrucks in Existenz- und Identitätsaussagen zählen, ganz zu schweigen von der Kopula und Fragen der Prädikationstheorie. Besonders problematisch ist, dass traditionell ein Unterschied zwischen »Sein« und »Existenz« gemacht und mit den Modalitäten »Möglichkeit« und »Wirklichkeit« verbunden wird, sodass mögliche Gegenstände zwar immerhin ein Sein, aber eben keine Existenz haben sollen, was seinerzeit bei der Erklärung von Gottes Allmacht helfen sollte, die es ihm erlaubt, neue Gegenstände bzw. überhaupt Gegenstände hervorzubringen. Diese spezifische Gemengelage gehört allerdings in das Gefüge der hier ab initio abgelehnten Identifikation von Ontologie und Metaphysik und kommt allenfalls beiläufig im Zuge der Diskussion des Meinongianismus zur Sprache. Denn dieser meint im Allgemeinen, dass es mehr Gegenstände gibt als diejenigen, die existieren, und unterscheidet demnach zwischen verschiedenen Gegenstandsarten, indem er ihnen verschiedene Seinsarten zuordnet.
Von der Ontologie unterscheide ich die Metaphysik dadurch, dass es sich bei dieser meistens um eine Theorie der Totalität alles dessen, was existiert, handelt, eine Theorie, die ich auch als die Untersuchung der Welt als Welt bezeichne.[33] Dies kann verschiedene Formen annehmen. Die Metaphysik kann die Totalität etwa als eine allumfassende Entität verstehen (heute etwa als das Universum im Sinne des maximalen raumzeitlichen ausgedehnten »Superdinges«), als eine deutlich komplexere Substanz (wie Spinoza) oder auch als die Totalität der Tatsachen.
Man darf dabei nicht vergessen, dass die Idee der Totalität als methodologisch in die Zukunft projizierte regulative Idee (Kant), als ultimativer Horizont (von einigen Phänomenologen vertreten) oder eben auch als diskursive Voraussetzung erfolgreicher Kommunikation (Habermas) genauso metaphysisch ist wie die naheliegendere Idee, dass die Totalität gänzlich von unseren Konzeptualisierungsleistungen, kommunikativen Akten und weltbildenden Entwürfen unabhängig ist. Denn diese heuristischen Spielarten unterstellen, dass der Totalitätsbegriff kohärent ist, und limitieren nur unseren Zugang zu demjenigen, worauf er zutreffen würde.
Die Metaphysik entspringt unserem Bedürfnis, zu entdecken, wie die Wirklichkeit an sich ist. Das legt von vornherein nahe, unter »Wirklichkeit« irgendeinen Bereich zu verstehen, der unabhängig davon ist, dass wir uns gedanklich oder sprachlich vermittelt auf ihn beziehen, was ich als »Welt ohne Zuschauer« bezeichne.[34] Üblicherweise kommt man auf diesem Weg bei der Totalität dessen an, was ohnehin der Fall ist, was Bernard Williams als »absolute Konzeption der Realität« bezeichnet hat.[35] Was ohnehin der Fall ist, besteht unabhängig von Geist, Bewusstsein oder sonstigen Einstellungen, die epistemische Systeme ins Spiel bringen, um einen falliblen Kontakt mit demjenigen aufzunehmen, was auch ohne sie so gewesen wäre, wie es nun einmal ist.
Vor diesem Hintergrund wird der Unterschied zwischen Sein und Schein dann metaphysisch gezogen, wenn man annimmt, dass es eine scheinfreie Wirklichkeit gibt, der wir uns mehr oder weniger erfolgreich durch Theoriebildung nähern. Dieser Arbeitsteilung zufolge steht die Theoriebildung a priori unter Scheinverdacht, was meines Erachtens gegen diese Arbeitsteilung spricht. Selbst wenn Totalität freilich nicht immer das explizite Thema des Unterfangens ist, zu konstatieren, was Sein im Unterschied zum Schein ist, bleibt doch die Vorstellung leitend, dass es eine vereinheitlichte Wirklichkeit gibt, die alles »trägt«, was wirklich ist, eine Wirklichkeit, die mindestens dadurch zusammenhängt, dass sie »unabhängig von den Aktivitäten von wissenden und handelnden Subjekten ist, sofern solche vorhanden sind«,[36] wie Robert Brandom einmal schrieb.
Diesem Bild zufolge sind wir mit einem Dualismus von Sein und Schein konfrontiert. Es verleitet zu allerlei vertrauten Manövern, welche die Lücke zwischen Sein und Schein entweder schließen wollen oder dafür argumentieren, dass die Lücke in der Theoriekonstruktion keinen Schaden anrichtet. Wie man sich auch wendet, selbst wenn man bei einem Dualismus von Wirklichkeit an sich und ihrer Erscheinung für uns bleiben will, man wird sich der Frage stellen müssen, wie es sich dann mit dem Bereich verhält, der beide umspannt, das heißt mit dem echten Gesamtbereich dessen, was existiert. Versteht man unter »Welt« den Gesamtbereich dessen, was existiert, kann man die Theoriebildung von der Welt nicht ausschließen. Ein irgendwie gearteter Dualismus von Geist und Welt ist hinfällig, wenn man den Begriff der Totalität nicht schon so interpretiert, dass zur Totalität eigentlich nur eine bestimmte Wirklichkeit gehört, etwa diejenige, die durch die Naturwissenschaften untersucht wird. Solange man im Rahmen des metaphysischen Projekts operiert, muss man jedenfalls Stellung zu der Frage beziehen, wie es sein kann, dass es den Schein überhaupt gibt.[37]
Es gibt viele Formen von Metaphysik. Allerdings haben sie alle gemeinsam, dass sie mit einer vereinheitlichten Wirklichkeit, der Welt, rechnen, die mindestens dadurch vereinheitlicht ist, dass alles, was existiert, zu einem nicht weiter überschreitbaren Ganzen gehört. In diesem Sinn ist jede Metaphysik eine Form des Monismus.[38] Immer wird es irgendeine zumindest formale Eigenschaft geben, die den Gegenstandsbereich der metaphysischen Untersuchung vereinheitlicht.
Aus der technischen Perspektive der gegenwärtigen Analytischen Ontologie entspricht der Bereich vereinheitlichter, allumfassender Wirklichkeit der Idee unrestringierter Quantifikation.[39] Eine der gegenwärtigen Metaphysik vertraute methodologische Idee geht dementsprechend vom Begriff der Quantifikation aus. Man kann anscheinend umstandslos zwischen restringierter Quantifikation, also etwa der Behauptung, es gebe kein Bier mehr (nämlich etwa im Kühlschrank oder im Supermarkt), und unrestringierter Quantifikation unterscheiden, etwa in der Form der Behauptung, es gebe (überhaupt) keine Einhörner. In der Ontologie scheint es um unrestringierte Quantifikation zu gehen, also um die Frage, was es (überhaupt wirklich) gibt.
Entgegen dieser Auffassung der Ontologie entwickle ich einen ontologischen Pluralismus, der die Frage nach der Bedeutung von »Existenz« so beantwortet, dass wir keinen allumfassenden Gegenstandsbereich postulieren müssen, der unrestringierte Existenzfragen beantwortet. Gleichzeitig ist die dabei zustande kommende Position realistisch in dem Sinn, dass die behauptete Pluralität von Bereichen (von Sinnfeldern) nicht nur deswegen vorliegt, weil wir durch diskursive Praktiken oder epistemische Systeme irgendeiner Art dafür sorgen, dass es eine Vielheit von Bereichen gibt. Dadurch unterscheidet sich die hier entwickelte Position deutlich von der Strategie, die Schwierigkeiten der naturalistischen Metaphysik durch Sprachspielpluralismus oder einen fiktionalistisch zu konstruierenden, nicht wirklich existierenden Überhang zu zähmen.[40] Es reicht einfach nicht hin zu behaupten, dass es neben dem naturwissenschaftlich zugänglichen Universum zwar nicht wirklich auch noch andere Bereiche gibt, dass wir aber immerhin berechtigt sind, so zu reden, als ob dies so wäre, zumal wir ohnehin niemals einen vollständigen Überblick über die naturwissenschaftlichen Tatsachen erlangen werden.
Die geläufige Distinktion zwischen restringierter und unrestringierter Quantifikation könnte man freilich einsetzen, um Ontologie und Metaphysik so zu verquicken, dass man sagt, Sein sei der unrestringierte Bereich und Schein der Raum der Restriktionen. Der Schein einer auf unsere mesoskopischen Skalen zugeschnittenen Lebenswelt werde durch kontextsensitive, vielleicht gar in einem präzisierten Sinne vage, jedenfalls unordentliche Parameter generiert, die den Ordnungen restringierter Quantifikation entsprechen.[41]
Die Annahme unrestringierter Quantifikation beruft sich auf den linguistischen Befund, dass einige Existenzaussagen Unbedingtheit beanspruchen, etwa generische negative Existenzaussagen wie »Hexen existieren nicht«. Die Frage: »Existiert Bier?« scheint nur peripher mit Kühlschränken, primär hingegen mit der Existenz von Bier überhaupt befasst zu sein. Man könnte dann etwa den Ausdruck »es gibt« restringiert auffassen und »existiert« immer unrestringiert, was teilweise unserer alltäglichen Sprachpraxis entspricht.[42] Eine der Hauptthesen der folgenden Abhandlung lautet hingegen, dass Existenzaussagen immer lokal gebunden sind. Was existiert, kommt immer in einem Bereich vor, ohne dass es einen Bereich aller Bereiche (die Welt) geben kann, der zusätzlich zu allem anderen Existierenden auch noch existiert.
So verstanden vertrete ich in diesem Buch einen meta-metaphysischen Nihilismus, das heißt die These, dass sich die Metaphysik buchstäblich mit gar nichts beschäftigt, dass es also weder einen Gegenstand noch einen Gegenstandsbereich gibt, auf den sich ihre unrestringierten Aussagen beziehen. Das ist in vielem nicht weit von Kant entfernt, wobei er nicht so weit ging, die Existenz der Gegenstände der Metaphysik (die »Weltbegriffe«:[43] Gott, Welt, Seele) zu bestreiten, sondern sich darauf beschränkte zu bestreiten, dass wir solchen Begriffen entsprechende Gegenstände erkennen können.
Die Metaphysik bezieht sich auf gar nichts, auch nicht irgendwie indirekt oder sotto voce – auch nicht auf »das Ungegenständliche« oder »das Unaussprechliche«. Wie Frank Ramsey einmal gesagt hat: »[W]ovon man nicht sprechen kann, darüber kann man nicht sprechen, und man kann es auch nicht pfeifen«.[44]
Den meta-metaphysischen Nihilismus nenne ich auch die Keine-Welt-Anschauung, das heißt die Anschauung, dass es die Welt nicht gibt, dass sie nicht existiert. Bei dieser Annahme handelt es sich entsprechend um das radikale Gegenteil jeder Weltanschauung. Diese Position sollte man tunlichst vom metaphysischen Nihilismus unterscheiden, das heißt von der These, dass überhaupt nichts existiert, was immer noch eine metaphysische These wäre (was auch immer es genau bedeuten würde, sie zu vertreten).
Je nachdem, welche konkrete Konzeption von Metaphysik man vorzieht, wird man meine negative Existenzaussage von der Nicht-Existenz der Welt verschieden auffassen. In den Augen einiger werde ich bestreiten, dass es eine vereinheitliche Entität gibt, die den Namen »die Welt«, »die Wirklichkeit« oder »die Natur« trägt.[45] In den Augen anderer werde ich bestreiten, dass es einen vereinheitlichten Bereich von Tatsachen gibt, eine einzige allumfassende »Gegenstandssphäre«, die durch diese oder jene begriffliche Operation als vereinheitlicht vorgestellt wird.[46] Eine andere Gruppe wird wiederum (und ebenfalls zu Recht) meinen, dass ich bestreite, dass es absolut unrestringierte Quantifikation gibt bzw. noch genauer: dass die Einführung eines absolut unrestringierten Allquantors ontologische Implikationen hat. Denn selbst wenn es einen Allquantor geben mag, der sich über alles überhaupt erstrecken soll, ist nicht klar, unter welchen Bedingungen er sich damit auf alles, was existiert, erstreckt, sodass hier wiederum die eigentliche ontologische Frage zu beantworten wäre, ob der Existenzquantor überhaupt etwas mit Existenz oder nicht doch nur etwas mit Quantifikation zu tun hat. Für diese Gruppe werde ich mich eines zusätzlichen Argumentationsstrangs bedienen, da ich nicht nur behaupte, dass es keine informative unbedingte Quantifikation gibt, sondern insbesondere auch dafür argumentieren werde, dass selbst wenn es in irgendeinem Sinn unrestringierte Quantifikation gäbe (also etwa vom Typ: überhaupt alle Junggesellen sind unverheiratete Männer), dies jedenfalls zu keinem Zuwachs an metaphysischem Wissen führte.
Im Allgemeinen bestreite ich, dass der Existenzbegriff oder Existenz überhaupt auf relevante Weise mit Quantifikation verknüpft ist. Zwar können wir Existenzaussagen mit Quantifikation verbinden und etwa sagen, dass einiges von dem, was existiert, ein Pferd ist. Doch daran sieht man bereits, dass nur dann einiges von dem, was existiert, ein Pferd sein kann, wenn Pferde auch unabhängig davon existieren, dass es sich bei ihnen um einige (um mehr als keines) handelt bzw. dass es sich bei vielem um mehr als keines handeln mag, ohne dass es deswegen im intendierten Sinn existieren muss. Ich lehne die Idee ab, dass die Bedeutung von »Existenz« vollständig oder relevant durch die Sprache der Quantifikation ersetzt oder in diese übersetzt werden kann. Insbesondere meine ich auch nicht, dass der Existenzbegriff relevant mit denjenigen Begriffen verknüpft ist, die wir verwenden, um Mengenlehre zu betreiben oder uns verständlich zu machen, was Mengen sind. Existenz ist überhaupt kein mathematischer oder logischer Begriff bzw. keine mathematische oder logische Eigenschaft, schon weil es vage, unordentliche und unvollständige Gegenstände gibt, etwa halbe Kuchen, die nicht ohne Umwege kompatibel mit der Annahme eines metaphysischen Orts sind, der von diskret individuierten Einzeldingen bevölkert ist.
Einige der Argumente, die zum Einsatz kommen, sind von Putnams Überlegungen inspiriert, die er gegen den metaphysischen Realismus in seinem Sinn ins Feld geführt hat. Ich vertrete hier einen ontologischen Realismus, der gerade nicht wie der metaphysische Realismus meint, es gebe genau eine Menge von Gegenständen oder Tatsachen, die unabhängig davon ontisch individuiert sind, dass wir Theorien über sie entwickeln.
Um mein Lieblingsbeispiel etwas zu variieren, kann man sich dies anhand von Vulkanen verständlich machen. (Aus freundlichem Entgegenkommen bitte ich alle Vulkanskeptiker, die Existenz von Vulkanen einmal zuzugestehen.) Nehmen wir an, wir stünden vor dem Ätna in Sizilien. Der alte metaphysische Realismus (den Putnam durchaus überzeugend ausgehebelt hat) behauptete, dass die Existenz des Ätnas darin besteht, dass es wirklich einen Vulkan in der Raumzeitregion gibt, die wir Sizilien nennen, wie auch immer wir uns zu dieser Tatsache verhalten. Dies bedeutet, dass es genau eine komplizierte Beschreibung gibt, die den Vulkan vollständig individuiert, eine Beschreibung, die ganz wesentlich dadurch spezifiziert wird, dass sie unsere menschlichen-allzumenschlichen Individuationsbedingungen, das heißt insbesondere unsere Sinnesorgane und ihre Physiologie, unerwähnt lässt. Wir sollen eben nichts zum Vulkan in seiner lupenreinen »Vulkanität« hinzufügen, da der alte metaphysische Realismus ein prinzipiell gleichsam semantisch kaltes Universum unterstellt. Ein altbackener metaphysischer Realismus postuliert demnach eine Wirklichkeit, die davon unabhängig ist, wie oder ob wir über sie nachdenken, das heißt eine »geist-unabhängige (mind-independent)« Wirklichkeit. Entsprechend behauptet ein altbackener Antirealismus, dass wir Vulkane in irgendeinem komplizierten Sinn hervorbringen, indem wir sie individuieren.
Ein Argument für einen Vulkan-Antirealismus könnte sich auf einen allgemeinen Berg-und-Tal-Antirealismus berufen. Der Gedanke ginge von der scheinbar offensichtlichen Tatsache aus, dass wir eine Region aus einer bestimmten Perspektive betrachten, wenn wir sie in Berg und Tal einteilen, nämlich aus der Perspektive von Lebewesen, die aufrecht auf der Erdoberfläche stehen. Doch was wäre, wenn ein Marsianer auf die Erde käme, der so gebaut ist, dass er auf seiner linken Hand läuft und sich – von der Gravitationskraft ziemlich unbedrängt – in allerlei Richtungen bewegen kann? Aus dessen räumlicher Perspektive wird es manchmal so aussehen, als ob er einen Berg hinunterläuft, wenn er sich dem nähert, was wir »Berg« nennen. »Berg« und »Tal« verwenden wir jedenfalls so, dass eine bestimmte räumliche Perspektive impliziert ist, die durch eine beliebige Perspektivendrehung aufgeweicht werden kann. Ein Tal kann eine Bergfunktion übernehmen, wenn man nur anders klettert, und ein Berg ist für uns jedenfalls auch durch seine Bergfunktion individuiert. Ein Berg ist nicht nur ein bestimmter Brocken, sondern einer, der räumlich so-und-so hervorragt und relativ zu Überlebens- und Aufenthaltsinteressen eine Funktion erfüllt (etwa beschwerlich zu besteigen zu sein). An sich gäbe es demnach weder Berge noch Täler, sondern etwas anderes – wie auch immer man dies dann näher ausfüllt. Argumente dieses Typs – zu denen man noch das Vagheitsproblem, wo der Berg anfängt und das Tal aufhört, hinzufügen könnte – sollen zeigen, dass die Bedeutung von »Berg« und »Tal« (zumindest partiell) interessenrelativ ist, insbesondere relativ auf perspektivisch erworbene oder verankerte Begriffe.
Einer der Protagonisten in Ferdinand von Schirachs Roman Tabu weist in einem ähnlichen Geist darauf hin, dass die Schweiz fast so groß ist wie Argentinien. Sein Argument ist ganz einfach: Wenn man die Alpen und sonstigen Hügel der Schweiz glattbügelte oder ausrollte wie einen Kuchenteig, würde man erkennen, dass die Oberfläche der Schweiz sehr viel größer ist, als wir glauben.[47] So gesehen verschwinden die Berge im Begriff der allgemeinen Oberfläche, die ein Staat gerade für sich reklamiert. Sie sind sozusagen bloße Modi einer umfassenderen Substanz, metaphysisch unwirkliche Beulen, von denen man in einer absolut objektiven Beschreibung der Wirklichkeit abstrahieren muss.
Wenn der Realismus mit einer maximalen Einstellungs- oder Geistunabhängigkeit verbunden wird, kann man Argumente aus der fiktiven Exobiologie oder, etwas irdischer: ethnologische Untersuchungen verwenden, um eine ganze Reihe etablierter Kategorien zu unterminieren. Im Extremfall wird daraus ein radikaler Konstruktivismus im Sinn der These, dass wir alle Gegenstände dadurch hervorbringen, dass wir sie epistemisch individuieren – auch wenn man vielleicht immerhin noch eine prima materia (die er »Welt« nennt) einräumen möchte, einen reinen Weltteig, der durch unsere begrifflichen Backkünste leider immer nur in konstruierte Tatsachen zerfällt.[48]
Im Folgenden wird es darum gehen, den Eindruck aus dem Weg zu räumen, dass der so verstandene metaphysische Realismus und sein Gegenstück, der metaphysische Antirealismus, unsere einzigen Optionen sind. Genau gegen diese Dichotomie richtet sich die Debatte um den Neuen Realismus.[49]
Der Neue Realismus ist im Allgemeinen die Idee, dass der Realismus nicht mit der Annahme einer geist- oder perspektiven-unabhängigen Realität oder Wirklichkeit operieren muss (was keineswegs impliziert, dass es keine Außenwelt gibt!). Der Realismus besteht gerade nicht in der metaphysischen Anerkennung einer bestimmten Art von Gegenständen (etwa von natürlichen Arten).[50]
Die Distinktion zwischen natürlichen Arten und (sozialen) Konstruktionen, die heute in allen Wissenschaftszweigen Vertreter findet, dient dazu, die alte kritische Unterscheidung zwischen unserem Beitrag zur Erfahrung und dem Beitrag der Dinge vorzunehmen. Man will ja nicht seine eigenen Projektionen mit den Gegenständen selbst verwechseln. Doch damit übersieht man leicht das Offensichtliche, nämlich dass unsere theoretischen Konstruktionen gerade dazu dienen, Gegenstände epistemisch so zu individuieren, dass dies ihren ontischen Individuationsbedingungen entspricht. Diese scheinbare Trivialität wird viel leichter übersehen, als man vermuten könnte. Deswegen ist es keineswegs überflüssig, einige realistische Plattitüden, die wir leicht aus den Augen verlieren, auch im Rahmen der Ontologie zu diskutieren. In diesem minimalen Sinn stimme ich Heideggers Hinweis zu, dass es in der Philosophie durchaus um das Selbstverständliche und Belanglose geht, das uns aber leicht entgleitet, weil wir metaphysische Hintergrundannahmen treffen, die uns in der Form eines Weltbildes entgegentreten. Wie er in seiner Vorlesung Die Grundprobleme der Phänomenologie sagt:
Auch kümmert uns nicht, was wir mit der Feststellung der vermeintlichen Trivialitäten anfangen, ob wir damit in die Geheimnisse der Welt und des Daseins eindringen oder nicht. Uns kümmert einzig das eine, daß uns diese triviale Feststellung und das in ihr Gemeinte nicht entgleitet, – daß wir es uns vielleicht noch näher bringen. Vielleicht schlägt dann die vermeintliche Trivialität in völlige Rätselhaftigkeit um. Vielleicht wird diese Belanglosigkeit zu einem der aufregendsten Probleme für den, der philosophieren kann, das heißt für den, der verstehen gelernt hat, daß das Selbstverständliche das wahre und einzige Thema der Philosophie ist.[51]
Den ontologischen Pluralismus werde ich im Folgenden um einen epistemologischen Pluralismus ergänzen, sodass sich die These ergibt, dass es weder einen singulären vereinheitlichten Bereich aperspektivischer Wirklichkeit (die Welt) noch einen singulären vereinheitlichten Bereich des (menschlichen) Wissens als solchen gibt. Zu behaupten, dass es keinen vereinheitlichten Gegenstand gibt, den man als »das (menschliche) Wissen überhaupt« bezeichnen könnte, läuft keineswegs darauf hinaus, zu bestreiten, dass wir überhaupt etwas wissen. Ganz im Gegenteil werde ich dafür argumentieren, dass die Vereinheitlichung der Formen des (propositionalen) Wissens jedenfalls nicht dadurch erzielt werden kann, dass man eine allgemeine Beziehung zur Welt dergestalt annimmt, dass die jeweiligen Wissensformen sich auf verschiedene Welt- oder Wirklichkeitssektoren beziehen, die an sich und nahtlos in ein schon bestehendes Ganzes integriert sind.
Neben der Keine-Welt-Anschauung gibt es weitere Argumente dafür, dass Wissen nicht vereinheitlicht werden kann, Argumente, die in den erkenntnistheoretischen §§11-12 zur Sprache kommen werden. Die Hauptlinie meiner Argumentation verbleibt im Rahmen einer Ausbuchstabierung der Keine-Welt-Anschauung. Der epistemologische Pluralismus ist eine ziemlich liberale Haltung, da er eine Pluralität von (propositionalen) Wissensformen anerkennt, die nicht etwa von der allgemeinsten Methode zusammengehalten werden, die man verwenden sollte, um herauszufinden, was so alles der Fall ist, um unseren Fund dann in einer privilegierten diskursiven Praxis (der »Wissenschaft«) zu rechtfertigen. Die Wissenschaft ist ebenso wenig ein anzustrebender Singular wie die Welt. Beides liegt nur so lange nahe, wie man unterstellt, dass es eine aperspektivische Welt ohne Zuschauer einerseits und eine rein perspektivische Welt der Zuschauer andererseits gibt.[52]
Um zu vermeiden, dass man in den Dualismus von Geist und Welt abgleitet, werde ich im Folgenden statt von »Perspektiven« von »Sinnen« sprechen. Der hier zur Verwendung kommende Sinnbegriff schreibt sich von einer bestimmten Frege-Deutung her. Diese Deutung versteht fregesche Sinne erstens als objektive Arten des Gegebenseins, die mit Gegenständen unabhängig davon zusammenhängen, um welche Art von Gegenständen es sich handelt. Zweitens (was als Frege-Deutung natürlich ebenfalls anfechtbar ist) werden Sinne als Eigenschaften von Gegenständen und nicht etwa als Arten, sich Gegenstände zugänglich zu machen, verstanden. Meiner Lesart nach ist auch Freges Sinn-Theorie primär ontologisch motiviert, indem sie zu seiner Rekonstruktion der Bedeutung von »Existenz« gehört. Es handelt sich bei ihr nur in einem abgeleiteten Sinn um eine Theorie des Wissens- oder Informationserwerbs, nämlich eben insofern, als Sinn eine wichtige Rolle in unserem Verstehen sprachlicher Bedeutung spielt, was für Frege allerdings nur ein Nebenschauplatz ist.[53] Seine Philosophie hat somit ziemlich wenig mit der Abwendung von der Ontologie und der Hinwendung zur Analyse der Sprache zu schaffen, wogegen er sich sogar avant la lettre ziemlich kritisch äußert, da er ja gerade die natürliche Sprache von den Verführungen ihrer gleißenden Oberfläche befreien möchte.[54]
Vorab kann man sagen, dass Frege in meiner Deutung dafür hält, dass es gar keine Gegenstände jenseits ihrer vielfältigen Arten des Gegebenseins gibt. Er meint, zu existieren bedeute, unter einen Begriff zu fallen, wobei Begriffe ihrerseits durch ihre Sinne (und damit niemals rein extensional) individuiert werden. In dieser Deutung bleibt kein Platz zwischen den Sinnen und den Gegenständen dergestalt, dass wir ein Reich reiner fregescher Bedeutungen (ein Reich der sinnfreien Begriffsumfänge) postulieren könnten, das sich unterhalb der Schwelle seiner Artikulation in Arten des Gegebenseins befindet. Sinne sind so verstanden Eigenschaften oder »Merkmale (features)« von Gegenständen, wie Mark Johnston jüngst in ähnlicher Absicht vorgeschlagen hat.[55]
In diesem Kontext werde ich eine ontologische Spielart des Deskriptivismus entwerfen und diese gegen einige von Kripkes Standardeinwänden gegen den Deskriptivismus als Theorie der sprachlichen Bedeutung von Eigennamen in Schutz nehmen. Kripke hat überzeugend nachgewiesen, dass ein unqualifizierter Deskriptivismus keine funktionierende Theorie der sprachlichen Bedeutung von Eigennamen sein kann. Denn wir sind imstande, uns sprachlich auf Gegenstände in unserer Umgebung mit ungenauen Beschreibungen zu beziehen, das heißt mit Beschreibungen, die nicht auf die eigentlich gemeinten Gegenstände zutreffen, die uns aber dennoch »in Verbindung« mit ihnen setzen. Sobald der Kontakt hergestellt ist, können wir unsere Beschreibungen revidieren (»Stimmt, es ist nicht Petra, sondern Anja, die sich mit Salim unterhält«). Dies spricht dafür, dass es einen objektiven (bis zu einem gewissen Grad auch rein kausalen) Kontakt mit Gegenständen geben muss, der nicht durch unsere Beschreibungen vermittelt ist und der es uns dennoch ermöglicht, sprachlich auf etwas Bezug zu nehmen.
Kripkes semantische Überlegungen zeigen allerdings nicht mehr, als dass wir uns auch mit schlechten Beschreibungen auf Gegenstände beziehen können, was noch nicht beweist, dass Gegenstände unabhängig von allen Beschreibungen existieren können, die tatsächlich auf sie zutreffen. Die These, dass es keine Gegenstände jenseits oder diesseits der Sinnschwelle gibt, befindet sich freilich nicht ohne weiteres in Konflikt mit Kripkes Einsichten im Rahmen einer Theorie sprachlicher Bezugnahme. Dies bliebe im Einzelnen zu prüfen. Im Folgenden werde ich allerdings davon ausgehen, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen der These gibt, dass Gegenstände notwendigerweise Eigenschaften haben, die die logische Form von Beschreibungen aufweisen (ontologischer Deskriptivismus), und der semantischen These, dass Eigennamen die logische Form von Beschreibungen aufweisen.
Es hat sich bereits im 20. Jahrhundert eingebürgert, von Gegenstandsbereichen, -sphären, -gebieten oder -regionen zu reden, um dasjenige zu bezeichnen, worauf sich restringierte quantifizierte Aussagen beziehen. Wenn man von allen französischen Vegetariern oder von den natürlichen Zahlen spricht, setzt man einen Gegenstandsbereich voraus, auf den die für wahr gehaltenen Aussagen sich richten. Statt von Gegenstandsbereichen spreche ich von Sinnfeldern. Eines der Motive dahinter besteht darin, hervorzuheben, dass Felder Strukturen zur Verfügung stellen, die Gegenstände zur Erscheinung bringen, ganz unabhängig davon, unter welchen Bedingungen wir epistemische Identitätskriterien projizieren oder in Anschlag bringen. Die Art, wie Felder Gegenstände zur Erscheinung bringen (die Regeln, die festlegen, um welches Sinnfeld es sich handelt), bezeichne ich als »Sinn«.
Die Rede von »Gegenstandsbereichen« oder gar von »Mengen« suggeriert allzu leicht, dass die Demarkationen der Bereiche oder Mengen irgendwie mit Prädikaten in Verbindung stehen, die wir hervorbringen oder konstruieren, um sodann in einem zweiten Schritt Entdeckungen darüber zu reklamieren, was auf Gegenstände in diesen Bereichen oder auf Elemente von Mengen im Allgemeinen zutrifft. Als ontologischer Realist möchte ich dagegen daran festhalten, dass es bereichsartige Feldstrukturen gibt, die unabhängig davon ausgebreitet vorliegen, dass wir epistemische Identitätskriterien im Rahmen ihrer Entdeckung in Anschlag bringen.
Der ontologische Realismus verbindet sich mit einer pluralistischen Feldtheorie, die ich für eine Konsequenz der Keine-Welt-Anschauung halte. Der vorgestellte Realismus ist dabei dadurch ontologisch, dass er von einer Analyse des Existenzbegriffs seinen Ausgangspunkt nimmt. Gleichzeitig vertrete ich einen epistemologischen Realismus, der sich zum ontologischen gesellt. Dabei spielt ein anderer Sinn von »Realismus« eine wichtige Rolle, nämlich der Sinn, in dem wir den Realismus für eine Verpflichtung auf die Annahme eines ungehinderten Zugangs zu demjenigen, was es gibt, halten – ein Zugang, der in einigen paradigmatischen Fällen auf Wissen hinausläuft.
Crispin Wright hat darauf hingewiesen, dass wir mit dem Ausdruck »Realismus« zwei sehr allgemeine Denkrichtungen verbinden. Einerseits gehen wir die bescheidene Verpflichtung ein, dass es irgendetwas gibt, das unabhängig von unseren Einstellungen ontisch individuiert ist. Andererseits wird der Ausdruck Realismus gerade im erkenntnistheoretischen Kontext häufig für die anspruchsvollere These reserviert,
dass jede Art von Übereinstimmung, die es zwischen unseren Gedanken und der Welt geben mag, zwar unabhängig von einer menschlichen kognitiven Tätigkeit festgelegt (worden) ist, dass wir aber in günstigen Umständen in der Lage sind, die Welt richtig zu erfassen, und dass wir oft auch in der Lage sind, die Wahrheit über sie zu erkennen.[56]
Der epistemologische Realismus, dem ich auch verpflichtet bin, nimmt an, dass es solche günstigen Umstände gibt, wenn wir in diesen auch nicht »die Welt richtig« erfassen, sondern Tatsachen, die in einem Sinnfeld bestehen, das jeweils nur eines unter indefinit vielen ist. Ein erfolgreicher und damit ungehinderter Zugang zu Tatsachen ist dabei im Allgemeinen weder ein unmittelbarer oder rein sinnlicher noch ein kausaler oder mentaler Zugang. Wenn ich ungehindert wahrnehme, dass gerade Kinder auf dem Schulhof gegenüber spielen, ist mein Zugang ungehindert (es gelingt mir ja, etwas über diese Kinder zu wissen), was nicht heißt, dass keinerlei »Filter« mit von der Partie sind. Doch diese sind auf die Wirklichkeit hin »durchsichtig«, wobei diese Transparenz nichts damit zu tun hat, dass wir unseren mentalen Beitrag zum Erfolgsfall des Wissens einfach aus Naivität übersehen. Man wird allerdings nicht imstande sein, den Wissensbegriff über eine Analyse unserer mentalen Zustände vollständig zu verstehen, da es zur Intentionalität gehört – wie uns schon Husserl und Heidegger und später Sartre eingeschärft haben –, dass wir uns auf etwas beziehen, das nicht selbst von der Art der Bezugnahme ist.[57]
Bis zu einem gewissen Grad stimme ich demnach dem alten phänomenologischen Argument zu, dem zufolge wir selbst dann mit einer Wirklichkeit konfrontiert sind, wenn wir von einer tiefsitzenden Illusion in Beschlag genommen werden, ja selbst dann, wenn wir uns in einer globalen Halluzination vom cartesischen oder Matrix-Typ befinden. Jede Erklärung, die epistemische »Vermittler« ansetzt, die zwischen uns und die Tatsachen oder Dinge an sich treten, muss imstande sein zu erklären, wie der erkenntnistheoretisch in Anspruch genommene Zugriff auf das vermeintliche Interface gelingen kann.[58] Damit gehört das Interface aber seinerseits zum Teppich der Tatsachen, es ist ein Gegenstand der theoretischen Bezugnahme in der höherstufigen Erklärung gelingender oder scheiternder Bezugnahme auf eine nicht ihrerseits intentionale Wirklichkeit, der wir freilich in jedem Fall Strukturen unterstellen müssen, die es ermöglichen, dass sie uns überhaupt erscheint. Folglich haben wir selbst dann einen ungehinderten Zugang zu einer Wirklichkeit, wenn wir uns im skeptischen Szenario einer globalen Halluzination befinden, jedenfalls so lange, wie wir diese Möglichkeit theoretisch erwägen. Der »Interface-Skeptizismus« beweist deshalb bestenfalls, dass wir häufig oder meistens den ungehinderten Zugang zum Interface mit einem nur vermeintlichen ungehinderten Zugang zu etwas anderem verwechseln.
Ein einfaches Beispiel mag dieses Argument illustrieren. Wenn es überhaupt sinnvoll und kohärent behauptbar ist, dass Wiesen in Wahrheit nicht grün sind, dass sie durch unsere neuronalen Filter grün eingefärbt werden (dass sie nur »im« visuellen Kortex grün sind), bedeutet dies ja nicht, dass wir keinen Zugang zu etwas Grünem haben. Grün wäre dann nur nicht die Eigenschaft von Wiesen, sondern die Eigenschaft unseres Interfaces (etwa des Gehirns), in der kausalen Konfrontation mit Wiesen in einen internen, nur phänomenal zugänglichen Grünzustand einzutreten (wie auch immer man dies genauer beschreiben oder erklären mag). Damit hat man das Grün nicht »aus der Welt« geschafft, sondern es nur an einen anderen Ort verfrachtet; man hat es den Wiesen genommen und dem Geist gegeben.
Der eigentliche Punkt der Einführung skeptischer Szenarien vom Halluzinationstyp besteht darin, eine alternative Erklärung anzubieten, die derjenigen, die wir normalerweise vorziehen, überlegen ist, eine Erklärung, die wir nicht dadurch ausschließen können, dass wir darauf bestehen, unser vorherige Erklärung sei doch als Schluss auf die beste Erklärung schon gut genug gewesen. Der Grund dafür ist ganz einfach: Die beste Erklärung ist diejenige, die den Tatsachen entspricht. Wenn wir uns in einer globalen Halluzination des cartesischen Typs befinden, ist die beste Erklärung dafür, dass uns etwas so-und-so erscheint (als grüne Wiese), eben diejenige, die Tatsachen hinsichtlich dessen erwähnt, dass wir uns in einem solchen Szenario befinden.