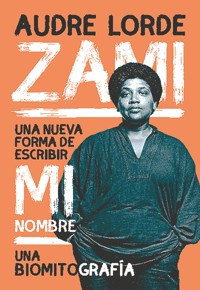Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Audre Lorde ist die revolutionäre Denkerin und Ikone des Schwarzen Feminismus
Audre Lorde wusste, was es heißt, als Bedrohung zu gelten: als feministische Dichterin, als Schwarze Frau in einer weißen akademischen Welt, als lesbische Mutter eines Sohnes. Viele „Formen menschlicher Verblendung haben ein und dieselbe Wurzel: die Unfähigkeit, Unterschiedlichkeit als eine dynamische Kraft zu begreifen, die bereichernd ist, nicht bedrohlich“. Lorde widmete ihr Schaffen dem Kampf gegen Unterdrückung. Verschiedenheit und Schwesternschaft, Zorn, Erotik und Sprache wurden zu kraftvollen Waffen. In ihren Texten über Rassismus, Patriarchat und Klasse finden wir Antworten auf die brennenden Fragen der Gegenwart – ein halbes Jahrhundert nach Erscheinen beweist der Band seine erschreckende Aktualität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Audre Lorde ist die revolutionäre Denkerin und Ikone des Schwarzen FeminismusAudre Lorde wusste, was es heißt, als Bedrohung zu gelten: als feministische Dichterin, als Schwarze Frau in einer weißen akademischen Welt, als lesbische Mutter eines Sohnes. Viele »Formen menschlicher Verblendung haben ein und dieselbe Wurzel: die Unfähigkeit, Unterschiedlichkeit als eine dynamische Kraft zu begreifen, die bereichernd ist, nicht bedrohlich«. Lorde widmete ihr Schaffen dem Kampf gegen Unterdrückung. Verschiedenheit und Schwesternschaft, Zorn, Erotik und Sprache wurden zu kraftvollen Waffen. In ihren Texten über Rassismus, Patriarchat und Klasse finden wir Antworten auf die brennenden Fragen der Gegenwart — ein halbes Jahrhundert nach Erscheinen beweist der Band seine erschreckende Aktualität.
Audre Lorde
Sister Outsider
Essays
Aus dem Englischen von Eva Bonné und Marion Kraft
Carl Hanser Verlag
Inhalt
Die Werkzeuge der Herrschenden werden das Haus der Herrschenden niemals einreißen
Vom Nutzen der Wut: Wie Frauen auf Rassismus reagieren
Lyrik ist kein Luxus
Die Verwandlung von Schweigen in Sprache und Handeln
An der Oberfläche kratzen: Einige Anmerkungen zu dem, was liebende Frauen hindert
Vom Nutzen der Erotik: Erotik als Macht
Sexismus: Eine amerikanische Krankheit in Blackface
Ein offener Brief an Mary Daly
Man Child: Antworten einer Schwarzen, lesbischen Feministin
Ein Interview: Audre Lorde und Adrienne Rich
Alter, Race, Klasse und Gender: Frauen definieren Verschiedenheit neu
Von den Sechzigerjahren lernen
Auge in Auge: Schwarze Frauen, Hass und Wut
Notizen von einer Russlandreise
Wieder in Grenada: Ein Zwischenbericht
Anhang
Anmerkungen
Die Werkzeuge der Herrschenden werden das Haus der Herrschenden niemals einreißen
Vor einem Jahr lud mich die geisteswissenschaftliche Fakultät einer New Yorker Universität zu einer Konferenz ein. Man bat mich, einen Vortrag über die Unterschiede im Leben amerikanischer Frauen zu halten — Unterschiede bezüglich Race, Sexualität, Klasse und Alter. Derlei Aspekte auszublenden kann die feministische Diskussion über das Persönliche und das Politische nur schwächen.
Es zeugt von einer besonderen akademischen Arroganz, über feministische Theorie zu sprechen, ohne die zahlreichen Unterschiede zwischen uns Frauen zu beleuchten und ohne die wichtigen Beiträge von Schwarzen Frauen, Frauen des globalen Südens, queeren Frauen und von Armut betroffenen Frauen zu berücksichtigen. Und dennoch finde ich, eine Schwarze, lesbische Feministin, mich hier auf dem einzigen Podium wieder, das die Positionen Schwarzer Feministinnen und Lesben thematisiert. Eine traurige Ausrichtung für eine Konferenz in einem Land, wo Rassismus, Sexismus und Homophobie eng miteinander verwoben sind. Wer das Programm liest, muss zu dem Schluss kommen, lesbische und Schwarze Frauen hätten nichts zu Existentialismus oder Erotik zu sagen, zu Frauenkultur und Schweigen, zu neuen feministischen Theorien oder zu Heterosexualität und Macht. Was hat es auf der persönlichen wie auf der politischen Ebene zu bedeuten, wenn die einzigen beiden Schwarzen Teilnehmerinnen dieser Konferenz auf den letzten Drücker eingeladen wurden? Was bedeutet es, wenn die Werkzeuge eines rassistischen Patriarchats benutzt werden, um die Auswirkungen ebenjenes Patriarchats zu analysieren? Es bedeutet, dass allenfalls oberflächliche Veränderungen möglich und gestattet sind.
Dass weder die Positionen von lesbischen Frauen noch die von Women of Color einbezogen wurden, hinterlässt in den Ergebnissen dieser Konferenz eine beträchtliche Lücke. Beispielsweise fiel mir in einem Vortrag über materielle Beziehungen zwischen Frauen ein Entweder-oder-Modell von Fürsorge auf, das all meinen Erfahrungen als lesbischer Schwarzer zuwiderläuft. Auf Gegenseitigkeit oder geteilter Verantwortung basierende Systeme und Wechselbeziehungen, wie sie unter Lesben und an Frauen orientierten Frauen üblich sind, fanden keinerlei Beachtung. Dabei trifft die These des Vortrags, dass »Frauen, die nach Emanzipation streben, vielleicht einen zu hohen Preis dafür zahlen«, ausschließlich auf das patriarchalische Versorgermodell zu.
Für Frauen ist der Wunsch oder das Bedürfnis, einander zu unterstützen, nicht pathologisch, sondern eine Lösung, und das zu erkennen gibt ihnen ihre wahre Stärke zurück. Genau diese Art wahrer Verbundenheit fürchtet die patriarchalische Welt so sehr. Die einzige gesellschaftliche Machtposition, die Frauen innerhalb patriarchalischer Strukturen offensteht, ist die der Mutterschaft.
Gegenseitige Unterstützung eröffnet Frauen die Möglichkeit, frei zu leben und zu sein — nicht um benutzt zu werden, sondern um zu gestalten. Dies ist der Unterschied zwischen passiver Existenz und aktivem Leben.
Unterschiede zwischen Frauen lediglich zu tolerieren wäre blanker Reformismus und die totale Verleugnung ihrer schöpferischen Funktion. Unterschiede gilt es nicht bloß auszuhalten; erst durch sie entstehen die Gegensätze, zwischen denen unsere Kreativität dialektische Funken schlägt. Nur so verliert die Notwendigkeit wechselseitiger weiblicher Unterstützung den Anschein von Bedrohung. Indem wir unterschiedliche Stärken als gleichwertig anerkennen, können aus ihrer Wechselwirkung neue Formen des Daseins entstehen, und der Mut und die Entschlossenheit, auch dann zu handeln, wenn der Ausgang ungewiss ist.
Indem wir unsere Unterschiede in eine ausgeglichene Wechselbeziehung treten lassen, gewinnen wir an Sicherheit; diese Sicherheit erlaubt uns, in das Chaos aus bestehendem Wissen einzutauchen und mit echten Zukunftsvisionen zurückzukehren und mit der Kraft, jene Veränderungen anzustoßen, die für unsere Visionen die Voraussetzung sind. Unterschiede stellen eine urwüchsige und belastbare Verbindung her, die für jede Einzelne von uns gewinnbringend sein kann.
Man hat Frauen beigebracht, Unterschiede entweder zu ignorieren oder sie als Ursache für Spaltung und Misstrauen zu betrachten statt als Antrieb für Veränderung. Ohne Gemeinschaft gibt es keine Befreiung, sondern nur einen brüchigen, zeitlich begrenzten Waffenstillstand zwischen der Einzelnen und ihrer Unterdrückung. Trotzdem darf Gemeinschaft nicht das Abwerfen unserer Unterschiede bedeuten, und sie sollte auch nicht die jämmerliche Behauptung aufstellen, diese Unterschiede existierten nicht.
Diejenigen von uns, die nicht zum Kreis der von der Gesellschaft als akzeptabel definierten Frauen gehören, werden in den Schmelztiegel der Abweichung gezwungen: von Armut betroffen, lesbisch, Schwarz, älter. Sie wissen, dass zu überleben keine akademische Qualifikation ist. Im Interesse des Überlebens muss man lernen, für sich einzustehen, selbst wenn man unbeliebt ist und beizeiten sogar beschimpft wird. Man muss lernen, sich mit jenen zu verbünden, die ebenfalls an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurden, und zusammen mit ihnen für eine Welt zu kämpfen, in der sich alle Menschen entfalten können. Wir müssen lernen, unsere Unterschiedlichkeiten in Stärken zu verwandeln. Denn die Werkzeuge der Herrschenden werden das Haus der Herrschenden niemals einreißen. Sie mögen uns im Einzelfall gestatten, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, aber sie werden uns niemals darin bestärken, wirkliche Veränderungen herbeizuführen. Diese Vorstellung erscheint nur jenen Frauen bedrohlich, die immer noch glauben, sie fänden allein im Haus der Herrschenden Hilfe und Unterstützung.
Von Armut betroffene Frauen und Women of Color wissen, dass alltägliche eheliche Sklaverei und Prostitution nicht dasselbe sind, denn es sind ihre Töchter, die in der 42nd Street stehen. Wenn ihr weißen amerikanischen Feministinnen glaubt, euch weder mit unserer Unterschiedlichkeit befassen zu müssen noch mit der daraus resultierenden vielgestaltigen Beschaffenheit unserer Unterdrückung — wie wollt ihr dann mit der Tatsache umgehen, dass die Frauen, die eure Häuser putzen und eure Kinder betreuen, während ihr an Konferenzen über feministische Theorie teilnehmt, meist von Armut betroffene Women of Color sind? Welche Theorie bildet die Grundlage für feministischen Rassismus?
In einer Welt der Chancengleichheit können unterschiedliche Sichtweisen zur Basis für politisches Handeln werden. Doch solange feministische Akademikerinnen daran scheitern, Unterschiede als eine wesentliche Stärke zu begreifen, werden sie über die erste Lektion des Patriarchats niemals hinauskommen. In unserer Welt sollten wir »teile und herrsche« durch »bestimme über dich selbst und ermächtige dich« ersetzen.
Warum wurden nicht mehr Women of Color für diese Konferenz angefragt? Warum wurden zwei Anrufe bei mir als ausreichend erachtet? Bin ich die Einzige, die einen Kontakt zu Schwarzen Feministinnen herstellen kann? Der Vortrag der Schwarzen Podiumsteilnehmerin schloss mit dem Hinweis auf die Kraft und Bedeutung der Liebe zwischen Frauen; aber wie steht es um die Zusammenarbeit von weißen Frauen und Women of Color, die einander nicht lieben?
In akademischen feministischen Kreisen lautet die Antwort auf derlei Fragen meist: »Wir wussten nicht, wen wir fragen sollten.« Auf diese Weise schleichen sie sich aus der Verantwortung, mit derselben Ausrede schließen sie die Werke Schwarzer Künstlerinnen von ihren Ausstellungen aus und die Texte Schwarzer Autorinnen aus ihren Leselisten und ihren feministischen Publikationen, mal abgesehen von der gelegentlichen Sonderausgabe zu »Frauen in der Dritten Welt«. In einem Vortrag hat Adrienne Rich kürzlich hervorgehoben, dass ihr weißen Feministinnen in den vergangenen zehn Jahren enorm viel dazugelernt habt. Warum habt ihr dann nichts über Schwarze Frauen gelernt und über die Unterschiede zwischen uns, zwischen weißen und Schwarzen Frauen, obwohl das doch der Schlüssel zum Fortbestand unserer Bewegung ist?
Wir Frauen werden bis heute dazu aufgefordert, den Abgrund der männlichen Ignoranz zu überbrücken und Männer über unsere Existenz und unsere Bedürfnisse aufzuklären. Die Unterdrückten mit den Belangen der Herrschenden beschäftigt zu halten ist ein uraltes und unverzichtbares Werkzeug der Unterdrückung. Und nun hören wir, es sei die Aufgabe von uns Women of Color, weiße Frauen — gegen deren gewaltigen Widerstand — über unsere Existenz, unsere Unterschiede und unsere jeweiligen Rollen im gemeinsamen Überlebenskampf aufzuklären. Das ist reine Energieverschwendung und eine tragische Wiederholung rassistischen, patriarchalischen Denkens.
Simone de Beauvoir hat einmal gesagt: »Das Wissen um die wahren Bedingungen unseres Lebens muss uns die Kraft zum Leben und Gründe für unser Handeln geben.«
Rassismus und Homophobie bestimmen hier und heute unser aller Leben. Ich fordere jede Einzelne von euch eindringlich auf, sich an den Ort des tief in eurem Inneren verborgenen Wissens zu begeben und euch eurem Schrecken und eurer Abscheu vor Verschiedenheit zu stellen. Seht, wessen Gesicht sie tragen. Dann können wir unsere Entscheidungen endlich im Licht des Persönlichen und des Politischen treffen.
Vom Nutzen der Wut: Wie Frauen auf Rassismus reagieren
Rassismus. Der Glaube an die natürliche Überlegenheit einer »Rasse« über alle anderen, die daraus implizit und offensichtlich ihr Recht zur Dominanz ableitet.
Reaktionen von Frauen auf Rassismus. Meine Antwort auf Rassismus ist Wut. Mein ganzes Leben lang habe ich mit dieser Wut gelebt, ich habe sie ignoriert, von ihr gezehrt und gelernt, sie zu nutzen, bevor sie meine Visionen in Schutt und Asche legen konnte. Aus meiner Angst vor der Wut habe ich nichts gelernt. Auch ihr werdet aus eurer Angst vor der Wut nichts lernen.
Frauen, die auf Rassismus reagieren, reagieren auf ihre Wut; sie sind wütend auf Ausgrenzung, auf nie hinterfragte Privilegien, auf rassistische Verzerrungen, auf Schweigen, Missbrauch, Stereotypisierungen, Abwehrhaltungen, falsche Bezeichnungen, Verrat und Vereinnahmung.
Meine Wut ist eine Antwort auf rassistische Einstellungen und die daraus resultierenden Taten und Vermessenheiten. Falls ihr solche Haltungen gegenüber anderen Frauen einnehmt, dann sind mein Ärger und die Ängste, die er bei euch hervorruft, wie Schlaglichter, mit deren Hilfe ihr euch weiterentwickeln könnt. Genauso habe ich gelernt, meinem Ärger Ausdruck zu verleihen und daran zu wachsen. Es geht hier um tatsächliche Veränderungen, nicht um Schuld. Schuld und Abwehr sind wie die Ziegelsteine einer Mauer, gegen die wir alle anrennen; sie bringen niemanden weiter.
Ich möchte an dieser Stelle keine theoretische Diskussion führen; stattdessen werde ich euch ein paar Beispiele dafür nennen, wie Frauen manchmal miteinander umgehen. Aus Zeitgründen halte ich mich kurz. Aber ihr solltet wissen, dass es sich nur um einen Bruchteil solcher Erfahrungen aus meinem Leben handelt.
Zum Beispiel:
Auf einer wissenschaftlichen Konferenz äußere ich unverblümt meine Wut, woraufhin eine weiße Frau entgegnet: »Sag mir gern, was du fühlst, aber formuliere es nicht so harsch, sonst kann ich dir nicht zuhören.« Aber ist es wirklich meine Ausdrucksweise, die sie vom Zuhören abhält, oder nicht vielmehr die bedrohliche Botschaft dahinter, die ihr Leben verändern könnte?
An einer Universität in den Südstaaten wird auf einer Veranstaltung des Fachbereichs Women’s Studies eine Woche lang über Schwarze und weiße Frauen diskutiert; den Abschluss bildet die Lesung einer Schwarzen Frau. »Was nehmt ihr aus dieser Woche mit?«, frage ich. Die gesprächigste der anwesenden Weißen antwortet: »Ich glaube, ich habe viel gelernt. Ich habe das Gefühl, dass Schwarze Frauen mich jetzt tatsächlich besser verstehen; sie haben nun eine Vorstellung davon, wo ich herkomme.« Als machte die Frage, wer sie versteht, den Kern des Rassismusproblems aus!
Seit fünfzehn Jahren behauptet die Frauenbewegung, sich um die Belange und die Zukunft aller Frauen zu kümmern. Doch immer noch höre ich dieselbe Frage, egal auf welchem Universitätscampus: »Wie sollen wir uns mit Rassismus beschäftigen, wenn keine Woman of Color teilnimmt?« Oder, und das ist die Kehrseite dieser Frage: »Wir haben in unserem Fachbereich niemanden, der in der Lage wäre, die Werke Schwarzer Autorinnen zu unterrichten.« Mit anderen Worten: Rassismus ist das Problem Schwarzer Frauen, das Problem von Women of Color, und nur sie können sich damit auseinandersetzen.
Nach einer Lesung aus meiner Sammlung Gedichte für zornige Frauen fragt mich eine Weiße: »Wirst du auch etwas darüber schreiben, wie wir mit unserer Wut umgehen können? Das wäre ganz wichtig.« Ich frage: »Wie nutzt du deine Wut?« Ich wende mich von ihrem ausdruckslosen Blick ab, bevor sie mich dazu auffordern kann, an ihrer Selbstzerstörung teilzunehmen. Es ist nicht meine Aufgabe, ihren Zorn stellvertretend für sie zu fühlen.
Weiße Frauen haben begonnen, sich mit ihrer Beziehung zu Schwarzen Frauen auseinanderzusetzen, aber häufig stelle ich fest, dass sie sich dabei auf die Kinder von damals beschränken, auf die Children of Color von der anderen Straßenseite; auf das geliebte Kindermädchen, die Mitschülerin aus der zweiten Klasse — auf zärtliche Erinnerungen an etwas, das einst mysteriös, faszinierend, bestenfalls neutral erschien. Ihr verdrängt, welche Haltungen ihr euch damals bei eurem schallenden Gelächter über Rastus und Alfalfa von den Kleinen Strolchen angeeignet habt, ebenso wie die eindeutige Botschaft des Taschentuchs, das eure Mutter auf der Parkbank ausbreitete, nachdem ich dort gesessen hatte. Ihr verdrängt die entmenschlichenden, tief eingebrannten Bilder aus der Sitcom Amos ’n’ Andy und die humorigen Gutenachtgeschichten eures Daddys.
1967 schiebe ich meine zweijährige Tochter in einem Einkaufswagen durch einen Supermarkt in Eastchester, als ein kleines weißes Mädchen im Wagen ihrer Mutter an uns vorbeirollt und aufgeregt ruft: »Oh, guck mal, Mami, ein Baby-Dienstmädchen!« Und eure Mutter bedeutet euch, still zu sein, korrigiert euch aber nicht. Jetzt, fünfzehn Jahre später, könnt ihr auf einer Konferenz zum Thema Rassismus über die lustige Anekdote lachen, aber ich höre den Schrecken und die Anspannung aus eurer Stimme heraus.
Eine weiße Literaturwissenschaftlerin freut sich über einen Sammelband mit Werken von Women of Color, in dem aber keine Schwarzen Autorinnen vertreten sind: »So kann ich mich mit Rassismus befassen, ohne die Schroffheit Schwarzer Frauen in Kauf nehmen zu müssen«, sagt sie zu mir.
Auf einer internationalen Kulturveranstaltung für Frauen unterbricht eine namhafte weiße amerikanische Dichterin eine Lesung von Women of Color, um ein eigenes Gedicht vorzutragen, und eilt dann weiter zu einem »wichtigen Podium«.
Wenn sich Frauen in der Wissenschaft ernsthaft einen Dialog über Rassismus wünschen, müssen sie als Erstes die Bedürfnisse und die Lebensbedingungen anderer Frauen anerkennen. Wenn eine Akademikerin sagt: »Ich kann mir das nicht leisten«, will sie damit vielleicht zum Ausdruck bringen, dass sie ihr Budget so einsetzt und nicht anders. Wenn eine Sozialhilfeempfängerin sagt: »Ich kann mir das nicht leisten«, bringt sie zum Ausdruck, dass sie mit einem Betrag auskommen muss, der schon 1972 ihren Lebensunterhalt nicht decken konnte, und dass sie oft nicht genug zu essen hat. Trotzdem müssen von Armut betroffene Frauen und Women of Color, die hier einen Vortrag halten oder einen Workshop leiten wollen, Teilnahmegebühren zahlen — für eine Konferenz der National Women’s Studies Association im Jahr 1981, die sich der Auseinandersetzung mit Rassismus verpflichtet hat. Für viele Women of Color ist die Teilnahme daher unmöglich, zum Beispiel für Wilmette Brown von der Bewegung Black Women for Wages for Housework. Handelt es sich hier einfach nur um ein weiteres Beispiel für wissenschaftliche Diskussionen über das Leben, die im abgeschotteten akademischen Milieu ablaufen?
Den anwesenden weißen Frauen mögen solche Haltungen vielleicht bekannt vorkommen, doch meine Worte richten sich vor allem an meine Sisters of Color, die Tausende solcher Begegnungen erlebt und überlebt haben — meine Sisters of Color, die wie ich immer noch vor mühsam gebändigter Wut zittern und die ihre Wut manchmal als nutzlos oder störend (die beiden häufigsten Anschuldigungen) in Zweifel ziehen. Euch möchte ich etwas über die Wut erzählen, meine Wut, und über das, was ich auf meinen Erkundungsreisen durch ihr Herrschaftsgebiet gelernt habe.
Alles kann genutzt werden / was nicht verschwendet / du wirst das erinnern müssen / wenn man dich der Zerstörung beschuldigt.
Jede Frau hat ein reiches Arsenal an Wut; damit kann sie gegen ebenjene individuelle und strukturelle Unterdrückung angehen, die die Wut hervorgerufen hat. Zielgerichtete Wut setzt Kraft und Energie frei, die dem Fortschritt und der Veränderung dienen. Ich spreche hier nicht von simplen Meinungsänderungen, von zeitweise geglätteten Wogen oder von der Fähigkeit, zu lächeln und sich gut zu fühlen. Ich spreche von einem grundlegenden, radikalen Wandel der Einstellungen, die unser Leben bestimmen.
Ich habe Situationen erlebt, in denen weiße Frauen eine rassistische Bemerkung hören, das Gesagte verurteilen und voller Zorn darüber sind, aber aus Angst im Schweigen verharren. Die nicht verbalisierte Wut tickt in ihnen wie eine Zeitbombe, und in der Regel wird sie später der ersten Woman of Color entgegengeschleudert, die Rassismus anspricht.
Wird Wut jedoch formuliert und in konstruktives und zukunftsorientiertes Handeln umgesetzt, wirkt sie befreiend, stärkend und klärend, denn im mühsamen Prozess dieser Verwandlung merken wir, wer trotz aller Differenzen unsere Verbündeten sind und wer unsere Feindinnen.
Wut ist voller Wissen und Energie. Wenn ich von Women of Color spreche, meine ich nicht nur Schwarze Frauen. Wenn eine Woman of Color, die nicht Schwarz ist, mir vorwirft, ich würde sie unsichtbar machen, weil ich ihren Kampf gegen Rassismus mit meinem gleichsetze, sollte ich ihr zuhören. Wir beide vergeuden sonst unsere Zeit damit, miteinander um die Wahrheit zu ringen. Macht mich eine Schwester darauf aufmerksam, dass ich an ihrer Unterdrückung beteiligt bin, ob bewusst oder unbewusst, wäre es wenig sinnvoll, auf ihre Wut mit Wut zu antworten; der Inhalt unseres Austausches würde in der Abwehrreaktion untergehen. Das wäre reine Energieverschwendung. Ja, es ist keine leichte Aufgabe, stillzuhalten und zu hören, wie eine andere Frau einen Schmerz beschreibt, den ich nicht teile oder zu dem ich gar selbst beigetragen habe.
Wir befinden uns hier an einem geschützten Ort, weit weg von unseren Alltagskämpfen. Das darf uns nicht blind machen für die Stärke und Komplexität der Mächte, denen wir gegenüberstehen, und auch nicht für das allzu Menschliche in unserer Umgebung. Wir sind nicht hier, um in einem politischen und sozialen Vakuum Rassismus zu analysieren. Wir stecken in den Klauen eines Systems, in dem Rassismus und Sexismus nicht nur allgegenwärtig und akzeptiert sind, sondern die Voraussetzung für jeglichen Profit. Frauen, die sich mit Rassismus auseinandersetzen, stellen für die Aufrechterhaltung dieses Systems natürlich eine Gefahr dar; die Lokalpresse hat daher versucht, die Konferenz zu diskreditieren. Als Ablenkungsmanöver richtete sie ihr Augenmerk auf die Unterbringungsmöglichkeiten für Lesben. Offenbar wagen Zeitungen wie der Hartforder Courant nicht, das Thema direkt anzusprechen, um das es hier geht: Rassismus. Es könnte zu offensichtlich werden, dass Frauen dabei sind, ihre repressiven Lebensbedingungen zu überprüfen und zu verändern.
Den Mainstream-Medien gefällt es nicht, dass Frauen, insbesondere weiße Frauen, sich mit Rassismus auseinandersetzen. Sie wollen, dass wir Rassismus als unveränderlichen Bestandteil der DNA unseres Lebens billigen, wie die Dunkelheit am Abend oder eine harmlose Erkältung.
Wir arbeiten in einem Klima von Konkurrenz und Bedrohung. Das liegt gewiss nicht an der Wut, die wir aufeinander haben, sondern am weitverbreiteten Hass auf Frauen, People of Color, Homosexuelle und von Armut betroffene Menschen — auf alle, die ihre Lebensbedingungen hinterfragen, sich gegen Unterdrückung wehren und auf gemeinsames, wirksames Handeln hinarbeiten.
Frauen sollten um die Bedeutung von Wut wissen und sie unmittelbar und erfinderisch in die Rassismusdebatte einfließen lassen, statt sich ihrer Angst vor der Wut zu ergeben. Genauso wenig sollten wir uns von Angst dazu verführen lassen, uns die harte Arbeit zu ersparen und mit weniger zufriedenzugeben als mit absoluter Ehrlichkeit. Wir müssen das Thema Rassismus in all seinen Erscheinungsformen, mit großer Ernsthaftigkeit und der damit verbundenen Wut angehen. Denn ihr könnt euch sicher sein, dass unsere Gegner ihren Hass auf uns und das, womit wir uns hier beschäftigen, ebenfalls sehr ernst nehmen.
Doch während wir uns mit dem oft schmerzhaften Anblick unserer Wut aufeinander befassen, sollten wir nicht vergessen, dass unsere Wut nicht der Grund dafür ist, dass wir daran denken müssen, nachts die Haustür abzuschließen und niemals allein durch die Straßen von Hartford zu laufen. Der Grund dafür ist der Hass, der in den Straßen lauert und uns alle zerstören will, sobald wir, anstatt der akademischen Rhetorik zu frönen, auf echte Veränderungen hinarbeiten.
Dieser Hass und unsere Wut sind sehr verschieden. Hass ist die Raserei jener, die gegen uns sind, und sein Ziel ist Tod und Zerstörung. Wut ist der Schmerz über Verwerfungen unter Gleichgesinnten, und ihr Ziel ist Veränderung. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Man hat uns beigebracht, hinter jeglicher Unterschiedlichkeit, die über das biologische Geschlecht hinausgeht, Zerstörung zu wittern. Wenn Schwarze und weiße Frauen dem Ärger aufeinander ins Auge sehen, wenn sie ihn nicht bestreiten, ihm nicht mit Schuldgefühlen begegnen und ihn auch nicht reglos und schweigend hinnehmen, ist das an sich schon ein ketzerischer, fruchtbarer Akt. Wenn wir uns trotz aller Unterschiedlichkeiten auf Augenhöhe begegnen, widerlegen wir die Mythen, die sich seit jeher um Verschiedenheit ranken. Diese Mythen spalten uns, und wir sollten uns fragen: Wer profitiert davon?
Women of Color in amerika wachsen mit einer Sinfonie des Zorns auf: Zorn darauf, dass sie zum Schweigen gebracht werden, dass man sie benachteiligt, dass sie, selbst wenn sie überleben, in einer Welt existieren müssen, die ihnen ganz selbstverständlich ihre Menschlichkeit abspricht und ihr bloßes Dasein verabscheut, es sei denn, sie stehen der Welt zu Diensten. Ich spreche von Sinfonie und nicht von Kakofonie, weil wir gelernt haben, unsere Wut zu orchestrieren; andernfalls würde sie uns zerreißen. Wir haben gelernt, sie zu navigieren und im Alltag Stärke, Kraft und Erkenntnis aus ihr zu schöpfen. Einige von uns haben diese heikle Lektion verpasst und es nicht überlebt. Ein Teil meiner Wut gedenkt meiner gefallenen Schwestern.
Wut ist eine angemessene Reaktion auf rassistische Haltungen, und sie darf sich steigern, wenn diese Haltungen zu immergleichem Verhalten führen. Jene von euch Anwesenden, die den Zorn einer Woman of Color mehr fürchten als die eigene, unhinterfragte rassistische Haltung, möchte ich fragen: Ist die Wut von Women of Color wirklich bedrohlicher als der Frauenhass, der alle Aspekte unseres Lebens einfärbt?
Nicht die Wut anderer Frauen wird uns ruinieren, sondern unsere Weigerung, innezuhalten und auf den Rhythmus der Wut zu lauschen, Schlüsse daraus zu ziehen, über die Art des Ausdrucks hinwegzusehen, zum Inhalt vorzudringen und die Wut als Quelle von Empowerment zu nutzen.
Ich kann meine Wut nicht verstecken, bloß um euch Schuldgefühle, Verletzungen oder eure eigenen, wütenden Gegenreaktionen zu ersparen. Das käme einer Beleidigung und Trivialisierung unserer gemeinsamen Anstrengungen gleich. Schuldgefühle sind keine Antwort auf Wut; sie sind die Antwort auf das eigene Handeln beziehungsweise Nichthandeln. Falls sie etwas verändern, sind sie tatsächlich nützlich, weil sie dann keine Schuldgefühle im eigentlichen Sinn mehr sind, sondern dämmerndes Wissen. Viel häufiger aber ist Schuld nur ein anderes Wort für Ohnmacht oder für eine Abwehrreaktion, die einen Austausch verhindert. Sie ist ein Mittel, die eigene Ignoranz zu wahren und die Dinge so zu belassen, wie sie sind; sie ist der ultimative Schutz vor Veränderung.
Die meisten Frauen haben noch keinen Weg gefunden, sich konstruktiv mit ihrer Wut auseinanderzusetzen. In der Vergangenheit haben sich sogenannte Consciousness-Raising-Groups mit der Frage befasst, wie Frauen ihrem Ärger — der sich in der Regel gegen Männer richtet — Ausdruck verleihen können. Doch die Teilnehmerinnen waren in erster Linie Weiße, die sich der Sprache ihrer eigenen Unterdrückung bedienten. Über bestehende Unterschiede zwischen Frauen in Bezug auf Race, Hautfarbe, Alter, Klasse oder sexuelle Identität wurde kaum gesprochen. Es gab augenscheinlich kaum ein Bedürfnis, Widersprüche im eigenen Verhalten zu beleuchten, etwa wenn Frauen Teil der Unterdrückung sind. Genauso wenig wurden Werkzeuge für den Umgang mit der Wut anderer Frauen entwickelt; man wich ihr aus, lenkte von ihr ab oder ergriff unter dem Deckmantel der Schuldgefühle die Flucht.
Mit Schuldgefühlen kann ich wenig anfangen, weder mit meinen eigenen noch mit euren. Sie sind nur eine weitere Möglichkeit, bewusstes Handeln zu vermeiden, Zeit zu gewinnen, dringend notwendige und klare Entscheidungen aufzuschieben und dem nahenden Sturm auszuweichen, der entweder die Erde nähren oder Bäume fällen wird. Wenn ich voller Wut zu euch spreche, habe ich wenigstens zu sprechen versucht. Ich habe euch weder mit der Waffe bedroht noch euch auf offener Straße erschossen; ich habe nicht den blutverschmierten Leichnam eurer Schwester betrachtet und gefragt: »Was hat sie getan, um das zu verdienen?« Genauso reagierten zwei weiße Frauen, als die Bürgerrechtlerin Mary Church Terrell ihnen von dem Mord an einer schwangeren Schwarzen berichtete, die man gelyncht und ihr anschließend das Baby aus dem Leib gerissen hatte. Das war im Jahr 1921, kurz nachdem die Suffragette Alice Paul es abgelehnt hatte, sich öffentlich für das Neunzehnte Amendment für alle Frauen auszusprechen. Sie weigerte sich, Women of Color miteinzubeziehen, obwohl diese einen großen Teil zum Gleichstellungsgesetz beigetragen hatten.
Wut aufeinander wird Frauen nicht umbringen, wenn sie ihre Anliegen klar formulieren und mindestens so aufmerksam auf die Inhalte lauschen, wie sie sich gegen den Ton verwahren. Wenn wir unsere Wut verdrängen, gelangen wir niemals zu einer Einsicht. Dann bleiben wir in altbekannten Mustern haften, die vertraut wirken, aber in Wahrheit tödlich sind. Ich bemühe mich, den Mehrwert meiner Wut zu erkennen, genau wie ihre Grenzen.
Frauen, die zur Angst erzogen wurden, fürchten oft, die Wut könnte sie vernichten. Sie sind mit männlich geprägten Vorstellungen von Brutalität und Gewalt aufgewachsen und überzeugt, dass ihr Leben vom guten Willen patriarchalischer Macht abhängt; dass der Ärger anderer um jeden Preis vermieden werden muss, da er nichts als Schmerz bringt und immer eine Reaktion auf das eigene Verhalten ist; vielleicht waren sie böse Mädchen, haben den Erwartungen nicht entsprochen oder etwas getan, was sie nicht durften. Und wenn sie ihre Machtlosigkeit akzeptieren, kann Wut sie tatsächlich zerstören.
Wir können unsere Unterschiede kreativ nutzen. Wir haben verzerrte Vorstellungen übernommen, aber wir sollten einander ohne Schuldzuweisungen begegnen, denn nun können wir etwas verändern. Aus der vielgestaltigen weiblichen Wut lässt sich eine Menge lernen, denn unsere Unterschiede verleihen uns Macht. Wut unter Gleichgesinnten ist Antrieb zum Wandel, nicht zum Zerwürfnis; durch das Unbehagen und das Verlustgefühl, das sie manchmal auslöst, entwickeln wir uns weiter.
Meine Antwort auf Rassismus ist Wut. Die Wut hat nur dann Risse in meinem Leben hinterlassen, wenn sie unausgesprochen blieb und niemandem nützte. Sie erfüllte ihren Zweck in Klassenräumen ohne Licht und Lernen, wo die Arbeiten und die Geschichte Schwarzer Frauen mit keinem Atemzug erwähnt wurden. Das Feuer meiner Wut hat mich gewärmt, als ich mich im eisigen, verständnislosen Blick weißer Frauen wiederfand, die in meinen Erfahrungen und den Erfahrungen meiner Leute nichts anderes sahen als neue Anlässe für Angst und Schuld. Meine Wut ist keine Ausrede für andere, sich ihren blinden Flecken nicht zu stellen, kein Grund, sich den Konsequenzen des eigenen Handelns zu entziehen.
Wenn wir Women of Color von der Wut erzählen, die unsere Begegnungen mit weißen Frauen so oft begleitet, sagt man uns, wir würden »eine Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit erzeugen«, »weiße Frauen davon abhalten, ihre Schuldgefühle zu überwinden«, oder »vertrauensvoller Kommunikation und Zusammenarbeit« im Weg stehen. Diese Zitate stammen aus Briefen, die ich in den letzten zwei Jahren von Frauen der National Women’s Studies Association erhalten habe. Eine schrieb: »Weil du Schwarz und lesbisch bist, sprichst du mit der moralischen Überlegenheit einer Leidenden«. Ja, ich bin Schwarz und lesbisch, aber was ihr in meiner Stimme hört, ist nicht Leid, sondern Zorn; es ist Wut, nicht moralische Überlegenheit. Da gibt es einen Unterschied.
Ihr sucht nach Entschuldigungen oder gebt vor, eingeschüchtert zu sein, nur um euch nicht mit den Gefühlen Schwarzer Frauen auseinanderzusetzen. Doch das macht keine von uns stärker, sondern ist einfach nur ein weiterer Versuch, eure Augen vor Rassismus zu verschließen und eure unausgesprochenen Privilegien vollumfänglich zu erhalten. Das Schuldgefühl ist nur eine von vielen Möglichkeiten, andere zum Objekt zu machen. Ständig werden die Unterdrückten aufgefordert, sich noch ein kleines bisschen weiter zu strecken und so die Kluft zwischen den Blinden und den Sehenden zu überbrücken. Von Schwarzen Frauen wird erwartet, dass sie ihre Wut ausschließlich für das Seelenheil und die Lernprozesse anderer Menschen zur Verfügung stellen. Aber diese Zeiten sind vorbei. Meine Wut hat Schmerz für mich bedeutet, aber ich verdanke ihr auch mein Überleben. Bevor ich sie aufgebe, müsste ich sicher sein, dass es auf dem Weg zur Erkenntnis einen mindestens ebenso machtvollen Ersatz für sie gibt.
Welche Frau ist so begeistert von ihrer eigenen Unterdrückung, dass sie ihren Schuhabdruck im Gesicht einer anderen nicht erkennt? Welche Frau heißt die Bedingungen ihrer eigenen Unterdrückung so willkommen wie eine Eintrittskarte in den Club der Gerechten, wo sie vor dem kalten Wind der Selbsterkenntnis sicher ist?
Ich bin eine Schwarze, lesbische Woman of Color, deren Kinder regelmäßig zu essen bekommen, weil ich an der Universität arbeite. Wenn ihre vollen Bäuche mich daran hindern, meine Gemeinsamkeiten mit einer anderen Woman of Color zu sehen, die keine Arbeit findet und deren Kinder nichts zu essen haben, oder mit einer, die gar keine Kinder hat, weil ihr Unterleib nach einer illegalen Abtreibung oder Sterilisation eine schwärende Wunde ist; wenn ich nicht anerkenne, dass sich eine Lesbe gegen Kinder entscheidet oder sich nicht outet, weil sie die Unterstützung ihrer homophoben Community nicht verlieren will; wenn eine Frau das Schweigen einem weiteren Sterben vorzieht, wenn sie panische Angst hat, meine Wut könnte die ihre zum Explodieren bringen; wenn es mir nicht gelingt, in all diesen Frauen einen Teil meiner selbst zu erkennen, dann trage ich nicht nur zu ihrer, sondern auch zu meiner Unterdrückung bei. Der Zorn, der zwischen uns steht, sollte unser gegenseitiges Verständnis fördern und uns stärken, statt Ausflüchte und Schuldgefühle zu liefern, die uns noch weiter einander entfremden. Ich bin nicht frei, solange eine einzige Frau unfrei ist, selbst wenn ihre Fesseln sich von meinen unterscheiden. Und ich bin nicht frei, solange noch eine einzige Person of Color in Ketten liegt, und genauso lange seid auch ihr nicht frei.
Ich spreche hier als Woman of Color, deren Ziel nicht Zerstörung ist, sondern Überleben. Keine Frau ist dafür verantwortlich, auf die Psyche der Unterdrückenden einzuwirken, nicht einmal wenn diese Psyche in einem weiblichen Körper steckt. Ich habe meine Wut genährt wie eine Wölfin ihr Junges, und ich habe Erleuchtung, Lachen, Schutz und Wärme gefunden, wo es kein Licht gab, keine Nahrung, keine Schwestern und keine Zuflucht. Wir sind keine Göttinnen, keine Matriarchinnen und keine Horte göttlicher Vergebung. Wir sind weder die flammende Hand des Jüngsten Gerichts noch Vollstreckerinnen der Geißelung. Wir sind Frauen, die immer wieder auf die Macht des Weiblichen zurückgeworfen werden. Wir haben gelernt, unsere Wut zu verwerten wie das Fleisch von toten Tieren, trotz Beulen und Schrammen haben wir uns verändert und überlebt und sind daran gewachsen. In Angela Wilsons Worten: Wir sind auf dem Weg. Mit oder ohne weiße Frauen. Wir nutzen jedes Mittel, das wir uns erkämpft haben, auch unsere Wut, um eine Welt zu erschaffen, in der sich unsere Schwestern entfalten können, in der unsere Kinder erfahren, was Liebe ist, und in der der Wunsch, einer Frau in all ihrer wundersamen Verschiedenheit zu begegnen und sie zu berühren, keine zerstörerischen Impulse mehr auslöst.
Denn es ist nicht die Wut Schwarzer Frauen, die wie eine giftige Flüssigkeit über den Globus rinnt. Es ist nicht meine Wut, die Raketen zündet, mehr als sechzigtausend Dollar pro Sekunde für Geschosse und anderes Kriegs- und Todesgerät ausgibt, Kinder in Städten umbringt, Nervengas und chemische Waffen hortet und unsere Töchter und die Erde vergewaltigt. Es ist nicht die Wut Schwarzer Frauen, die sich in blinde, unmenschliche Gewalt verwandelt, eine Gewalt, die uns auslöschen wird, wenn wir uns ihr nicht mit dem widersetzen, was wir haben: unserer Fähigkeit, die Bedingungen, unter denen wir leben und arbeiten, zu hinterfragen und zu ändern und die Zukunft neu zu denken und zu gestalten, Wut um schmerzliche Wut und Stein um noch so schweren Stein; eine Zukunft, die durch unsere Unterschiedlichkeit befruchtet und im Einklang mit der Erde ist.
Wir heißen alle Frauen willkommen, die uns von Angesicht zu Angesicht begegnen wollen, jenseits von Schuld und Objektifizierung.
Lyrik ist kein Luxus
Die Beschaffenheit des Lichts, in dem wir unser Leben prüfen, hat direkte Auswirkungen auf das, was wir erleben, und auf die Veränderungen, die wir während unseres Lebens zu bewirken hoffen. In diesem Licht gestalten wir die Vorstellungen aus, mit deren Hilfe wir unsere Magie bewirken und in die Realität umsetzen. Dichtung ist Erleuchtung, denn im Gedicht benennen wir, was vor dem Gedicht namenlos und ohne Form war, schon erspürt, aber noch nicht geboren. Wahre Lyrik entspringt aus verdichteter Erfahrung und bringt den Gedanken hervor, wie der Traum das Konzept, das Gefühl die Vorstellung und das Wissen Verständnis hervorbringt.
Wenn wir lernen, die Intimität des prüfenden Blicks zu ertragen und unter ihm zu wachsen; wenn wir lernen, das Resultat jener Prüfung als Energiequelle zu nutzen, verlieren die Ängste, die unser Leben beherrschen und unser Schweigen erzwingen, ihre Macht über uns.
Denn jede Frau hat einen dunklen Ort in sich, wo ihr wahres Wesen im Verborgenen gedeiht und sich schließlich erhebt, »kräftig wie eine Kastanie, Stütze gegen Albträume von Schwäche« und Ohnmacht.
Dieser Ort des Möglichen in uns ist dunkel, uralt und versteckt; in der Dunkelheit haben unsere Fähigkeiten überlebt und sind noch stärker geworden. Tief in sich verfügt jede von uns über unglaubliche Reserven von Kreativität und Kraft, von unbeachteten und unausgesprochenen Empfindungen und Gefühlen. Die weibliche Macht in uns allen ist weder weiß noch oberflächlich, sondern dunkel, uralt und tief.
Wenn wir das Leben nach Art der Europäer als Problem auffassen, das gelöst werden muss, verlassen wir uns beim Versuch, uns zu befreien, allein auf unser Denken; denn das Denken, haben uns die weißen Vorväter erzählt, sei besonders kostbar.
Doch wenn wir uns auf unsere ursprüngliche, nicht-europäische Sicht auf das Leben besinnen und begreifen, dass man es erfahren und gestalten kann, werden wir zunehmend in der Lage sein, unsere Gefühle wertzuschätzen und aus den verborgenen Machtquellen zu schöpfen, denen wahres Wissen und damit nachhaltiges Handeln entspringen.
Ich bin überzeugt, dass wir Frauen in diesem historischen Moment die Vereinbarkeit dieser beiden Sichtweisen in uns tragen. Sie garantiert unser Überleben, und am nächsten kommen wir ihr in unseren Gedichten. Ich spreche hier nicht von den sterilen Wortspielen der weißen Väter, die den Begriff Dichtung verdreht haben, um ihren verzweifelten Wunsch nach Vorstellungskraft ohne Erkenntnis zu verschleiern, sondern von Dichtung als Offenbarung und konzentrierter Erfahrung.
Aus diesem Grund ist Lyrik für Frauen kein Luxus. Für uns ist sie überlebensnotwendig. Sie bestimmt über die Eigenschaften des Lichts, in dem unsere Träume vom Überleben und unsere Hoffnung auf Veränderung Gestalt annehmen — zunächst im Gewand der Sprache, dann als Konzept und zuletzt als konkrete Tat. Zu dichten ist eine Möglichkeit, das Namenlose zu benennen, so dass es gedacht werden kann. Der Weg an den fernen Horizont unserer Hoffnungen und Ängste ist gepflastert mit Gedichten, die wir aus dem Fels unserer alltäglichen Erfahrungen herausgeschlagen haben.
Indem wir unsere Gefühle wahrnehmen, akzeptieren und ehrlich erforschen, werden sie zu unserem Tempel und zum Laichgrund für radikale und gewagte Ideen. Sie werden zu einer Zuflucht für unsere Unterschiedlichkeit, die für Veränderungen und für wirksames Handeln unabdingbar ist. Ich könnte auf der Stelle mindestens zehn Gedanken aufzählen, die ich unerträglich, unverständlich oder beängstigend gefunden hätte, wären sie mir nicht unmittelbar nach einem Traum oder in einem Gedicht begegnet. Das ist keine Einbildung, sondern die disziplinierte und achtsame Erkundung einer Regung: Etwas »fühlt sich richtig an«. Wir können lernen, unsere Empfindungen zu respektieren und in Sprache zu überführen, damit sie geteilt werden können. Und wo diese Sprache noch nicht existiert, hilft uns das Dichten, sie zu gestalten. Dichtung ist nicht nur Traum und Vision, sondern das Skelett und das Gerüst unseres Lebens. Sie ist die Grundlage für eine andere Zukunft und eine Brücke über unsere Angst vor dem Unbekannten.
Möglichkeiten sind weder unerschöpflich, noch sind sie immer sofort umsetzbar, deswegen ist es manchmal nicht leicht, sich den Glauben an sie zu bewahren. Manchmal arbeiten wir lange und angestrengt daran, einen Brückenkopf des echten Widerstands gegen die uns vorherbestimmten Tode zu bauen, nur damit dieser Brückenkopf am Ende doch angegriffen wird — von Gerüchten, die zu fürchten man uns gelehrt hat, oder von verweigerter Zustimmung, die wir, wie man uns weismachen wollte, doch unbedingt zu unserer eigenen Sicherheit brauchen. Denn man hat uns scheinbar wohlwollend unterstellt, wir seien kindlich, könnten nicht universal denken, seien unbeständig und sinnlich. Mit diesen Vorwürfen wurden wir geschwächt und kleingehalten. Wer aber stellt die Frage: Verändere ich wirklich die Aura, das Denken und die Träume meines Gegenübers, oder bewege ich es lediglich zu einer zeitweisen Verhaltensänderung? Obwohl Letzteres keine geringe Leistung darstellt, dürfen wir nicht vergessen, dass die Notwendigkeit der tatsächlichen Veränderung unserer Lebensgrundlagen bestehen bleibt.
Ich denke, also bin ich — das haben die weißen Väter uns gesagt. Die Schwarze Mutter in uns, die Dichterin, flüstert uns hingegen in unseren Träumen zu: Ich fühle, also kann ich frei sein. Dichtung formt die Sprache, die wir brauchen, um diese revolutionäre Forderung auszudrücken und Freiheit zu erlangen.
Gleichzeitig lehrt uns die Erfahrung, wie wichtig es ist, im Hier und Jetzt zu handeln. Unsere Kinder können nicht träumen, ohne zu leben, sie können nicht leben, ohne genährt zu werden, und wer außer uns sollte ihnen die echte Nahrung geben, ohne die sich ihre Träume nicht von unseren unterscheiden würden? »Wenn wir eines Tages die Welt verändern sollen, müssen wir wenigstens die Chance bekommen, erwachsen zu werden!«, ruft das Kind.
Manchmal betäuben wir uns mit Träumen von neuen Ideen: Der Kopf wird uns retten, das Hirn allein wird uns befreien. Doch es gibt keine neuen Ideen, die in den Kulissen stehen und darauf warten, uns als Frauen und als Menschen zu retten. Da sind nur alte, vergessene Ideen, die immer wieder neu angeordnet oder fortgeschrieben oder in uns wiederentdeckt werden, zusammen mit dem frischen Mut, sie zu erproben. Wir müssen uns und einander Mut machen, jene ketzerischen Taten zu vollbringen, die unsere Träume uns zeigen und die unser altes Denken verunglimpft. An der vordersten Front unseres Strebens nach Veränderung steht die Dichtung und zeigt uns unsere Möglichkeiten auf. Unsere Gedichte ziehen die Schlüsse aus uns selbst und drücken aus, was wir im Innersten fühlen und umzusetzen (oder mit unserem Handeln in Einklang zu bringen) wagen, unsere Ängste, Hoffnungen und liebgewonnenen Schreckensvisionen.
Denn in einer Gesellschaft, die sich über Profitstreben, lineare Machtverteilung und institutionelle Entmenschlichung organisiert, war das Überleben unserer Gefühle nicht vorgesehen. Gefühle wurden als unvermeidliche Dreingabe oder netter Zeitvertreib geduldet, und man erwartete von ihnen, vor dem Denken niederzuknien wie die Frau vor dem Mann. Aber die Frauen haben überlebt, als Dichterinnen. Und es gibt kein neues Leid, denn wir haben längst alles erlitten. Das Wissen darum verbirgt sich am selben Ort wie unsere Macht, und in unseren Träumen gelangen beide erneut an die Oberfläche und weisen uns den Weg in die Freiheit. Unsere Träume verwirklichen sich durch unsere Gedichte, die uns die Kraft und den Mut geben, zu sehen, zu fühlen, zu sprechen und Risiken einzugehen.
Wenn wir die Notwendigkeit, zu träumen und aus tiefstem Herzen nach der Verheißung zu streben, als Luxus abtun, geben wir den Kern und die Quelle unserer Macht und unseres Frauseins preis, die Zukunft unserer Welten.
Denn es gibt keine neuen Ideen. Es gibt nur neue Wege, sie zu erproben; zu erkunden, wie sie sich an einem Sonntagmorgen um sieben anfühlen, nach dem Brunch, während des Liebesakts, im Krieg, beim Gebären oder beim Trauern um die Toten; während wir die alten Sehnsüchte ertragen und mit den alten Drohungen ringen oder mit unserer Angst, stumm, ohnmächtig und allein zu sein; während wir neue Möglichkeiten und Stärken in uns entdecken.
Die Verwandlung von Schweigen in Sprache und Handeln
Immer wieder gelange ich zu der Einsicht, dass ich das, was mir am wichtigsten ist, aussprechen, in Worte fassen und mitteilen muss, selbst auf die Gefahr hin, dass es beschädigt oder missverstanden wird. Zu sprechen hilft mir mehr als alles andere. Ich bin eine Schwarze, lesbische Dichterin, doch noch bedeutsamer ist die Tatsache, dass ich am Leben bin und es fast nicht mehr wäre. Vor nicht einmal zwei Monaten erklärten mir ein Arzt und eine Ärztin, ich müsse mich einer Brustoperation unterziehen und der Tumor sei mit einer Wahrscheinlichkeit von sechzig bis achtzig Prozent bösartig. Zwischen dieser Nachricht und der Operation lagen drei Wochen Höllenqualen und die unfreiwillige Neuorganisation meines gesamten Lebens. Nach dem Eingriff stellte sich heraus, dass die Geschwulst gutartig war.