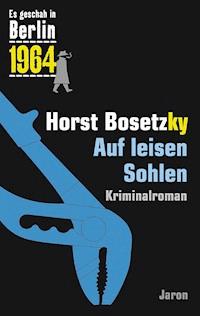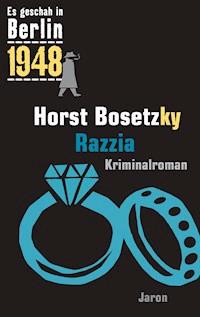Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin liegt Heinrich Zille zu Füßen. Mit seinen Zeichnungen hat der Maler liebevoll wie kein anderer den Alltag der einfachen Leute abgebildet. Fasziniert von Leben und Werk des Künstlers, geht im Jahre 1928 ein junger Schriftsteller daran, das Drehbuch für einen biographischen Zille-Film zu verfassen – einen der ersten Tonfilme der Welt. Da berichtet eine Berliner Boulevardzeitung, der kränkelnde „Pinselheinrich“ zeichne seit Jahren nicht mehr selbst, sondern lasse seine Bilder von dem Malerfreund Max Liebermann anfertigen. Horst Bosetzky entwirft in seinem Roman „Skandal um Zille“ ein lebensnahes und farbenfrohes literarisches Porträt des beliebten Berliner Malers – von seiner entbehrungsvollen Kindheit über seinen mühseligen künstlerischen Aufstieg bis zu jenen Jahren, in denen er als „Vater Zille“ fast einem Stadtheiligen gleichkam. Eine beeindruckende Hommage an Heinrich Zille und sein „Milljöh“.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Horst Bosetzky
Skandal um Zille
Roman
Jaron Verlag
Originalausgabe
1. Auflage 2013
© 2013 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer + Möhring, Berlin
1. digitale Auflage 2013: Zeilenwert GmbH
ISBN 978-3-955529-202-5
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
Impressum
Zitat
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Abspann
Literatur
Je mehr ich erfahre über ihn, desto mehr verwächst er mit mir …
Stefan Heym, Der König David Bericht
Eins
Die Tunneleule war auf dem Bahnhof Kochstraße noch nicht ganz zum Stehen gekommen, da hatte Konrad Kowollek schon die Türen aufgerissen und war hinausgesprungen. Dass er dabei wartende Fahrgäste touchierte und eine schmächtige Frau fast zu Boden riss, interessierte ihn wenig. Tempo war angesagt, und wer in Berlin lebte, sollte nicht jammern, wenn es hektisch wurde. Außerdem war Kowollek Reporter und genoss damit das Vorrecht, es eilig haben zu dürfen. Der Kampf auf dem Berliner Zeitungsmarkt war hart, manchmal ging es um Sekunden. 148 Tageszeitungen konnte man kaufen, Kowollek hatte sie kürzlich alle durchgezählt. Sein Berliner Boulevard Blatt (BBB) hatte es schwer, gegen die B.Z. am Mittag und eine weitere Zeitung anzukommen, die dreimal am Tag erschien und ausgerechnet den Namen Tempo trug.
Kowollek hastete die schmale Bahnhofstreppe hinauf, überholte mehrere jüngere Männer mit dem Ehrgeiz eines Leichtathleten und fluchte gewaltig, als er auf dem Mittelstreifen der Friedrichstraße warten musste, um etliche Autos und Straßenbahnen vorbeifahren zu lassen. Endlich konnte er die Fahrbahn überqueren und Kurs auf das Geschäftshaus nehmen, in dem sich die Redaktion des BBB eingenistet hatte.
An der Ecke Friedrichstraße und Kochstraße standen einige fliegende Händler, die den Passanten marktschreierisch ihre Zeitungen unter die Nase hielten. »BBB heute: Berliner Schlittschuh-Club trotzt der Eishockey-Nationalmannschaft ein 4:4 ab. – Der Magistrat erlässt Richtlinien für die Verwaltung der öffentlichen Bedürfnisanstalten. – Der dänische Schriftsteller Martin Andersen Nexö liest im Bürgersaal des Roten Rathauses. – BBB, stets das Allerneuste von der Spree!«
Damit kann man doch keinen Blumentopp gewinnen!, dachte Kowollek. Wegen solcher Schlagzeilen kaufte sicherlich niemand eine Zeitung. Kein Wunder, dass sie beim BBB noch immer tiefrote Zahlen schrieben.
Er hetzte die Straße entlang. Nicht ohne einen Blick auf die Litfaßsäulen und die anderen Reklameflächen zu werfen. Überall hingen Plakate, die auf den nächsten Zille-Ball im Sportpalast aufmerksam machten. Am 4. Februar 1928 war es wieder so weit. Kowollek freute sich. Das kam seinem Vorhaben zugute.
Er stürmte am Pförtner ebenso vorbei wie an der Vorzimmerdame des Chefredakteurs. Niemand hielt ihn auf, er konnte sich das erlauben.
»Ich muss dringend zu Herrn Rummler! Ist er da?«
»Ja, er ist in seinem Büro.«
Kowollek klopfte an, wartete jedoch nicht auf das »Herein!«, sondern betrat unaufgefordert das Zimmer.
Reinhard Rummler war es gewohnt, dass seine Reporter wie »des Wahnsinns kesse Beute« wirkten, wie es im Volke hieß. Erich Kästner hatte ihm vor kurzem erzählt, dass er an einem Berlin-Roman sitze, Arbeitstitel Fabian, und ihm auch schon daraus vorgelesen. Einige Sätze hatte sich Rummler gemerkt: Hinsichtlich der Bewohner gleicht Berlin längst einem Irrenhaus. Oder: Man halte hier jeden Menschen, mit Ausnahme der Kinder und der Greise, bevor das Gegenteil nicht unwiderleglich bewiesen ist, für verrückt. Rummler hatte mit seinem Kneifer und dem Schnauzbart à la Kaiser Wilhelm eine gewisse Ähnlichkeit mit Theodor Wolff vom Berliner Tageblatt, einzig dessen zur Tolle aufgetürmten Haare fehlten ihm. Die Frisur des Chefredakteurs vom BBB ließ eher an Hindenburg denken.
»Ich habe eine unglaubliche Geschichte, die wird unsere Zeitung in der Publikumsgunst aufsteigen lassen wie eine Silvesterrakete!«, begann Kowollek das Gespräch.
Rummler rückte ihm einen Stuhl zurecht. »Sie machen mich neugierig! Setzen Sie sich, Kowollek, und schießen Sie los!«
Das ließ sich Kowollek nicht zweimal sagen. »Was ist das Süßeste im Leben? Skandal ist immer das Süßeste! Ich habe etwas herausgefunden, das ungeheuerlich ist. Hier …« Kowollek riss ein Photo aus seiner Aktentasche, das Heinrich Zille und Max Liebermann dicht nebeneinander zeigte. »Das ist der Einstieg für meine Recherchen gewesen.«
»Und?«, fragte Rummler. »Was steckt dahinter?«
»Die größte Kunstfälschergeschichte, die es je gegeben hat.« Rummler lehnte sich zurück. »Erzählen Sie …«
»Es geht um Heinrich Zille, den zurzeit populärsten Berliner, Berlins beste Marke sozusagen. Aber …« Kowollek holte noch einmal tief Luft, ehe er richtig loslegte. »Heinrich Zille kann aufgrund seiner zahlreichen Krankheiten und der Depression seit dem Tod seiner Frau im Jahre 1919 schon lange nicht mehr malen und zeichnen. Seit einiger Zeit liegt er nur noch im Bett und starrt an die Decke. Eine Katastrophe für ihn und für alle, die von der Marke Heinrich Zille profitieren. Denn Zille muss weiterhin seine Bilder verkaufen – wovon soll er sonst leben? Seine Freunde haben eine Idee. Max Liebermann, der ein vielseitig begabtes Genie ist, zeichnet und malt nun oben in Zilles Wohnung in der Sophie-Charlotten-Straße reihenweise Zille-Bilder. Die Texte setzt Hermann Frey darunter, der Schlager wie Immer an der Wand lang und Wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt? geschrieben hat. Dieses Gespann ist sagenhaft! Die Welt will betrogen sein! Doch nicht genug damit – es gibt Hinweise darauf, dass Firmen, die mit Zilles Auftritten Geld verdienen, Doppelgänger engagiert haben.«
Rummler war begeistert. »Das ist eine heiße Kiste, Kowollek, bleiben Sie an dieser Geschichte unbedingt dran! Wenn Sie Ihren Verdacht belegen können, kommen wir damit groß heraus. Überschrift: Skandal um Zille! Aber Indizien reichen mir nicht, Kowollek, ich brauche Beweise.«
Selbstbildnis
Zwei
Heinrich Zille lag auf dem Bett und starrte gegen die Decke. Bekleidet war er nur mit einem Nachthemd und langen weißen Unterhosen. Er war zu müde und zu zerschlagen, um aufzustehen und zu den Freunden im Nebenzimmer zu gehen, aber zu wach, um zu schlafen. Er hätte gern an seinen Sohn Hans geschrieben, der Lehrer war und in Vorpommern lebte, aber die Gicht in den Fingern machte es unmöglich, einen Kopierstift zu halten. Schon seit Ewigkeiten hatte Zille keine Nacht mehr durchschlafen können. Die Krämpfe in den Beinen ließen ihn immer wieder auffahren. Sie waren eine Folge seiner Zuckerkrankheit, ebenso wie der Harndrang, der ihn alle zwei Stunden zwang, zur Toilette zu eilen. Ließen ihn diese beiden Quälgeister einmal in Ruhe, dann plagten ihn Schreckensträume. Manchmal sehnte er den Tod herbei, die Erlösung von allem, dann wieder hing er am Leben, denn an ein Dasein nach dem Tode glaubte er nicht. Frömmigkeit war nie seine Sache gewesen. Er nahm sich vor, in den nächsten Tagen ein neues Bild zu zeichnen: Er liegt auf dem Sterbebett – der Sensenmann kommt, ihn zu holen. Darunter würde er schreiben: Kein Zweck, mein Herr, der Zille ist unsterblich. Ein wenig verbittert murmelte er, dass Humor offenbar nicht gegen Krankheit und Altern immun mache.
In Gedanken formulierte Zille, was er seinem Sohn schreiben wollte, wenn die Schmerzen in den Fingern nachließen:
Ich bin arm dran, und Sorgen verschiedenster Art drücken mich. Ich werde weiß wohin eingeladen, schreibe ab, werde besucht, lasse mich verleugnen, verkrieche mich, will arbeiten … aber immer schwerer wird’s. Jetzt, da ich alt bin, verstehe ich den Wert des Alters: Ich habe jetzt drei Ärzte. Vorläufig ist nichts Gesundes von mir zu erwarten. Es ist mir auch egal … Ich kann nicht mehr die Treppen laufen. Bin müde … müde … müde. Ich lass mich aber nirgends hinholen, leb in meiner Stube mit meinen vier Piepmätzen. Mir fällt schreiben schwer. Es gehen so viele von mir, die noch jünger sind, dass ich mich wundere, warum sie mich nicht mitnehmen.
Draußen an der Wohnungstür drückte jemand auf den Klingelknopf. Er zuckte zusammen. Hoffentlich nicht noch mehr Besuch! Es reichte doch schon, dass Max Liebermann und Hermann Frey nebenan saßen und warteten, bis es ihm besserging.
Frau Riethmüller kam herein, die Nachbarin, die ihm die Wirtschaft führte, seit seine Schwiegertochter erkrankt war.
»Draußen steht ein älteres Ehepaar, und die Frau behauptet, Sie gut zu kennen.«
Zille richtete sich ein wenig auf. »Wer isset denn?«
»Sie sagt, sie hätte unter dem Namen Senta Söneland mit Ihnen Bekanntschaft gemacht.«
»Richtig, ick hab se mal jemalt. Die hat auch vor da letzten Fülmprämjere wat Berlinischet jesungen. Imma rin mit die beeden!«
Senta Söneland, inzwischen 46 Jahre alt, stand in der Zimmertür. An ihrer Seite hatte sie einen erheblich älteren Mann, den ehemaligen Offizier und nunmehrigen Direktor der Horch-Werke Karlernst Krocker.
»Dürfen wir eintreten, Herr Professor?«
»Nenn mir nich Professor, nenn mir Heinrich.«
»Jut, mach ick.«
Zille erhob sich überraschend behende von seinem Lager und begrüßte die Schauspielerin mit einer herzlichen Umarmung, während es bei Direktor Krocker nicht mehr wurde als ein Händedruck.
Die Söneland holte ein dickes Paket aus ihrem Einkaufsnetz.
»Ham wir dir mitgebracht, statt Blumen. Ein Stück Hasenbraten. Hat mein Mann selba jeschossen – und ooch jebraten.«
»Danke, Herr Major!«, rief Zille.
»Die Zeiten sind vorbei …«
»Major war’n Se aba, als wa uns det erste Mal jesehn ham, in eem Weinlokal.« Zille konnte sich noch genau daran erinnern. Senta Söneland und er hatten in einer Jury des Acht-Uhr-Abendblattes gesessen, um die beste Bezeichnung für den neuen Verkehrsturm am Potsdamer Platz zu prämieren. »Die Mehrzahl war für ›Oberkieker‹, aber die andern ham mächtich jemeckert. Det jute Essen hat uns jetröstet – nur ick hatte Schwierigkeiten, mein Huhn mit Messa und Jabel zu zerleg’n.«
Krocker gab sich ein wenig von oben herab. »Unseren Hasenbraten dürfen Sie gern mit den Fingern essen – wenn Sie allein sind.«
»Bring det mal in die Küche!«, sagte Senta Sönland zu ihrem Mann.
Zille sah sie an. »Nee, Senta, du bist ja ’ne janz nette Person, dabei hab ick imma jehört, du bist ’n Biest. Wie kannste denn sowat mit Monokel und Smoking heiraten?«
»Zilleken, das mit dem Biest stimmt, aber der ›Sowat‹ ist ein hervorragender Kaufmann, und wir leben seit achtzehn Jahren in glücklicher Ehe. Wie geht’s dir so?«
»Ach, mir jeht et mies, seit meine Hulda tot is. Ick mach nich mehr lange, det Wassa steht ma schon bis an de Knie.«
»Ach was, Zilleken, du machst bis hundert. Jetzt wollen wir dich mal knipsen. Ick an deina jrünen Seite.« Sie wandte ihren Kopf Richtung Tür. »Karlernst, bringste mal den Photoapparat mit rin?«
»Photographieren wollta ma?« Er sah an sich hinunter. »Mit die Beene?«
»Die Hauptsache ist dein Kopp.«
Frau Riethmüller hatte das gehört und kam ins Zimmer, um das Photographieren zu verhindern. »Sie begehen ein Verbrechen an dem Mann.«
Zille machte eine Handbewegung, die sie beruhigen sollte.
»Lassen Se ma, Frau Riethmüller, ick sterbe schon nich, wenn et mal blitzt – und falls doch, denn jeschieht es in Sentas Armen und is ’n schöna Tod.«
Zille vor seiner Staffelei. Hinter der Staffelei Senta Söneland (Photographie)
Während Zille mit der Söneland und ihrem Mann angeregt plauderte und ein wenig aus seinem seelischen Tief gerissen wurde, saßen Max Liebermann und Hermann Frey im Nebenzimmer und waren schwer beschäftigt. Vor dem Fenster standen zwei Staffeleien, und Liebermann war dabei, auf beiden im Zille-Stil zu zeichnen. Auf dem ersten Bild war die Siegessäule zu sehen – nicht gekrönt von der Viktoria, sondern von Heinrich Zille.
»Det is nich schlecht, det könnte jehn, wenn wa drunta schreim: Det passende Jeschenk zu mei’m Jeburtstach – die Siebzigsäule.«
»Hm …« Liebermann war nicht begeistert von Freys Vorschlag. »Det andere Bild is mir politischer.«
Mit dicker schwarzer Kreide suchte er die Zeichnung zu vollenden. Sie zeigte einen Marktplatz mit fünf Ständen. Am ersten waren Priester und Bischöfe zu sehen, am zweiten der König und einige Herren vom Hochadel, am dritten hatten sich Fabrikherren, Kaufleute und Bankiers versammelt – unter ihnen Borsig, Siemens und Bleichenröder – und am vierten Bauern ihr Obst und Gemüse ausgebreitet.
»Und nun der fünfte Stand …« Liebermann überlegte einen Augenblick. »Wat hat unsa Heinrich im Büro der National-Film darum jerungen, det et eenen doppelten Titel jibt! Nich nur Die Verrufenen, sondan ooch noch Der fünfte Stand. Darum ooch dieset Bild. Aba wat soll ick am fünften Stand für Fijuren hinmalen?«
»Am besten welche aus sei’m Milljöh.«
»Det ick da nich von alleene drauf jekommen bin.« Max Liebermann begann, eine dralle Prostituierte und ihren Luden, eine Mutter mit einem tuberkulösen Kind und eine verhärmte Bettlerin zu zeichnen.
»Da muss aber Zille selba noch mit ruff!«, sagte Hermann Frey. Liebermann verstand das nicht. »Wieso’n dette?«
»Weil ick unta det Bild schreim will, wat a selba unta einen abjelehnten Entwurf zum Fülm-Plakat jeschriem hat: Das sind Wir ja alle! ›Wir‹ jroß.«
»Na schön.«
Als die Söneland und ihr Mann gegangen waren, hatte sich Zille wieder aufs Bett gelegt und Frau Riethmüller gebeten, den beiden Freunden im Nebenzimmer zu sagen, sie möchten sich noch ein Viertelstündchen gedulden. »Det is ma allet zu ville.«
Dann raffte er sich auf, und sie saßen zu dritt am Kaffeetisch und redeten über allerlei Neuigkeiten. Den Kaffee hatten sie schon ausgetrunken und waren inzwischen beim Rheinwein angekommen.
Zille füllte den Freunden die Gläser. »Endlich darf ick euch mal reinen Wein einschenken, ohne det ihr meckert.«
Max Liebermann hob sein Glas. »Uff deine Jesundheit, lieba Heinrich!«
Zille wehrte ab. »Lass det mit dem Heinrich. Immer wenn ick in’n Spiejel gucke, denn denk ich: Mein Gott, Joethe!«
»Wieso Goethe?« Hermann Frey kapierte das nicht.
»Na, Faust, erster Teil: Heinrich! Mir graut ’ s vor dir.”
Max Liebermann schnauzte ihn an: »Janz Berlin himmelt dich an – keen Mensch graust sich vor dir. Jeh mal wieda unta de Leute!«
»Die Jelejenheit is jünstig.« Hermann Frey sah Zille an.
»Heinrich, wenn de jetzt untawegs bist, denn brauchste für die Straßenbahn, für’n Bus und de S- und U-Bahn nur noch eenen Fahrschein – mit dem kannste dann von eem Verkehrsmittel in det andere umsteijen.«
»Güldet der Fahrschein ooch für ’n Leichenwagen?«, wollte Zille wissen.
»Ja, aba nich raus bis nach Stahnsdorf uff’n neuen Friedhof, det is zu weit.«
»Dann übaleje ick mir det mit dem Sterben doch noch mal«, erklärte Zille. »Wat jibt et sonst Neuet?«
»Nüscht Jutet.« Max Liebermann berichtete von der schweren Gasexplosion im Mietshaus Landsberger Allee Nr. 115 / 116, bei der 17 Menschen verletzt und 90 obdachlos geworden waren.
»Und ’n paar Familien haben ihre janze Habe valor’n.«
»Bei Jas is mir nie janz wohl.« Zille schüttelte sich. »Eena will sich umbringen und dreht ’n Jashahn uff, der andere is zu tütelich und macht’n nicht zu, wenn a jekocht hat, der Dritte lässt de Kartoffeln übakochen, so det die Flamme ausjeht.«
»Zurück zum Lagerfeuer!«, forderte Max Liebermann. »Auf allen zentralen Plätzen in Berlin unterhält der Magistrat offne Feuer, und jeder kommt mit seim Fleisch hin, um et da am Spieß braten zu lassen.«
»Feuer frei!«, rief Zille.
»Nich Feuer frei, sondern Hermann Frey! Ich muss doch sehr bitten.«
Max Liebermann tat so, als sei er entsetzt. »Meine Herren, wo bleibt das Niveau?«
Hermann Frey begann darauf, freiheraus zu singen: »Die Menschen sind glücklich, die Menschen sind froh, / denn wieder einmal reden und lachen sie weit unter ihrem Niveau!«
Frau Riethmüller erschien in der Tür und fragte, ob sie noch eine Flasche Wein bringen solle.
Hermann Frey hob die rechte Hand und winkte ihr freudig zu. »Bringen Sie nur! Wir müssen uns gebührend auf den nahenden Geburtstag unseres Meisters einstimmen.«
Heinrich Zille verzog das Gesicht. »Hört bloß uff damit! Wenn ick am 9. Januar in’t Bett jehe, dann wünsche ick mir, det ick erst am 11. wieda uffwache. So könnt ick den Jeburtstach einfach übaspringen.«
»Mensch, Heinrich«, mahnte ihn Hermann Frey, »janz Berlin will dir jratulieren und dir ’n Ständchen und ’n paar Blumen bringen, jede Zeitung will ’n Photo von dir im Blatt haben.«
»Und ick will nüscht weita als meine Ruhe ham!«
Max Liebermann meldete sich zu Wort. »Ich erinnere an Fontane, der Melusine im Stechlin sagen lässt: Sich abschließen heißt sich einmauern, und sich einmauern ist Tod.«
Hermann Frey nickt. »Det is dit Stichwort: dein Bejräbnis, Heinrich. Wenn de dir vor Oojen führst, det janz Berlin da uff de Beene is, denn muss dich dit doch wieda uffrichten.«
»Na, wer weeß, wat noch allet kommt. Prost!«
Drei
Johannes Banofsky war 1895 in Friedrichshagen bei Berlin als Sohn eines Lehrers zur Welt gekommen und Opfer einer frühkindlichen Prägung ganz besonderer Art geworden. Sein Vater hatte des Öfteren führende Mitglieder des Friedrichshagener Dichterkreises zu Gast gehabt, etwa Max Dauthendey, Richard Dehmel, Max Halbe, Knut Hamsun, Maximilian Harden, Gerhart Hauptmann, Peter Hille und Erich Mühsam. Letzterer hatte ihn ganz besonders beeindruckt, und so suchte Banofsky diesem in seiner äußeren Erscheinung zeitlebens zu gleichen.
Bei diesem Hintergrund nahm es nicht wunder, dass er schon als Zehnjähriger erklärt hatte, einmal Dichter werden zu wollen. Angesichts seiner mangelnden schulischen Leistungen, auch im Fach Deutsch, erschien dieser Wunsch seinen Eltern jedoch geradezu lächerlich, und so gaben sie ihn nach Abschluss der Volksschule 1909 zu einem Zimmermann in die Lehre. Dort glänzte Banofsky, schaffte die Gesellenprüfung ohne jede Mühe und zog dann, wie es Brauch war, durch halb Europa und erlebte manches Abenteuer. Wieder zurück in Berlin, brachte er seine Eindrücke zu Papier. Sein Roman Auf Schusters Rappen erschien 1920, wurde aber kein großer Erfolg, weil die Menschen nach Kriegsende anderes im Kopf hatten, als sich mit schöngeistiger Lektüre zu befassen.
Auch Johannes Banofsky war Soldat gewesen, hatte an vielen Fronten im Osten wie im Westen gekämpft, jedoch nur kleinere Verwundungen davongetragen. Nach dem Krieg hatte er sich bei einer Cousine in Rüdersdorf eingemietet und bei der May-Film GmbH Arbeit als Kulissenbauer gefunden.
In Joe Mays Filmstadt Woltersdorf, einem Vorläufer Hollywoods, wurden Abenteuerfilme wie Die Herrin der Welt (1919) und Das indische Grabmal (1921) gedreht. Banofsky ließ sich von der Begeisterung für den Film anstecken und versuchte alsbald sein Glück als Schauspieler. Nach ein paar Wochen Unterricht in einer erstklassigen Schauspielschule bekam er bei verschiedenen Produktionsfirmen kleinere Rollen, sogar der große Jules Greenbaum besetzte ihn einige Male. Zuletzt hatte man ihn in einer Nebenrolle in Zilles Die Verrufenen bewundern können.
Darüber hinaus hatte Banofsky einen Hang zur Malerei und einige Semester Kunstgeschichte an der Hochschule für Bildende Künste studiert.
Fragte man ihn, womit er seinen Lebensunterhalt verdiene, antwortete er stets: »Ich schlage mich so durch.« Derzeit hatte er keinerlei Einkünfte, konnte sich aber von den Zuwendungen seiner Eltern immerhin ein winziges Zimmer in der Köpenicker Straße leisten und musste nicht verhungern. Außerdem verdiente seine Freundin Cilly als Schneiderin auch ein bisschen was.
Als Banofsky Mitte Januar 1928 über das Filmgelände der U FA in Berlin-Tempelhof schlenderte, geschah dies nicht in der Erwartung, womöglich für einen plötzlich erkrankten Statisten einspringen zu können, sondern in der Hoffnung, Thea von Harbou zu treffen, die er in seiner Woltersdorfer Zeit aus der Ferne angehimmelt hatte. Sie hatte ihre Karriere zwar als Schauspielerin begonnen, war aber als Schriftstellerin bekannt geworden. Zu ihrer wahren Berufung sollten Drehbücher werden. Für Joe May hatte sie die erste Fassung von geschrieben und für Erich Pommer das Drehbuch zu . Regie hatte dort ein gewisser Fritz Lang geführt. Mit dem war sie inzwischen verheiratet, wenn es auch hieß, in ihrer Ehe krisele es anhaltend.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!