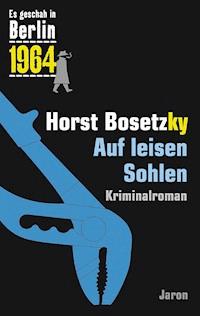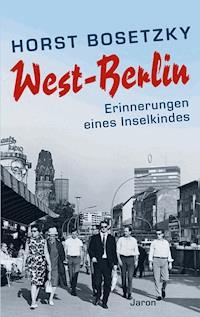Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Berlin 1943: Der nur mäßig erfolgreiche Kriminalpolizist Franzke, ein überzeugter NS- Mann, wird mit der Klärung einer Serie von Frauenmorden beauftragt. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf den geistig behinderten Lüdke. Diesen versucht Franzke, von seinem Geltungsdrang getrieben, der ungelösten Sexualmorde zu überführen … In seinem atmosphärisch dichten Roman greift Bosetzky den authentischen Fall des vermeintlichen Massenmörders Bruno Lüdke auf, der zum Sündenbock der NS-Justiz wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Bosetzky
Der Teufel von Köpenick
Roman
Jaron Verlag
Taschenbuchausgabe
1. Auflage dieser Ausgabe 2015
© 2009 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin.
Foto: © [www.abracus.de]
(Bolle-Milchwagen vor dem Berliner Schloss, 1921)
Satz: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2015
ISBN 978-3-95552-210-0
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Eins - 1921
Zwei - 1921
Drei - 1932/33
Vier - 1932
Fünf - 1933–1937
Sechs - 1938
Sieben - 1939–1943
Acht - 1943
Neun - 1943
Zehn - 1943
Elf - 1943
Zwölf - 1943
Dreizehn - 1944
Vierzehn - 1944
Fünfzehn - 1945
Nachwort zur Originalausgabe 2009
Quellenverzeichnis
Eins
1921
Bruno Lüdke war dreizehn Jahre alt und saß links außen in der ersten Reihe, so dass er nach dem rotbäckigen Apfel greifen konnte, den der Klassenlehrer in die Höhe hielt.
»Den … den … den will ich essen, bitte!«
Pennigstorff riss den Arm zurück. »Tut mir leid, Bruno, den brauche ich noch zu Unterrichtszwecken. Sage mir doch einmal, wie kann man den Apfel teilen, damit drei Leute Stücke bekommen, die dieselbe Größe haben?«
Bruno Lüdke schloss die Augen, und man sah, wie es in ihm arbeitete. »Na, in die … die … die Mitte durch und noch mal, det gibt vier … vier … vier Stücke. Da gibt man jedem von die … die … die Menschen eins, und eins bleibt übrig.«
»Gut, Bruno! Aber ohne dass ein Stück übrigbleibt.«
»Dann gehe ich lieber in … in … un … un … unseren Garten und hole eine ganze Kiepe mit Äpfel«, entschied Bruno Lüdke. »Dann kriegt jeder ganz … ganz … ganz viele, und die kann er dann so lange essen, bis … bis … bis er kotzen muss.«
»Brechen!«, rief der Amtsarzt, der gekommen war, um sich ein Bild vom Leistungsstand der Jungen zu machen. Die »Hilfsschule in Cöpenick« war ein wenig in Verruf geraten.
Pennigstorff wechselte das Thema, denn er wollte Bruno Lüdke nicht quälen.
Je mehr Druck der Junge verspürte, desto ärger wurde es mit seinem Stottern, und umso mehr Mühe hatte er, auf Anhieb das richtige Wort zu finden.
»Sag einmal, Bruno, wer war Bismarck?«
»Der hat die … die … die große Straße in … in … in Charlottenburg.«
»Du kennst dich aber gut aus in Berlin«, lobte ihn der Lehrer.
Bruno Lüdke strahlte. »Ick sitz ja auch bei … bei … bei Vatan imma vorne uff’m Bock mit druff. Wäsche ausfahrn.«
Der Amtsarzt beschloss, die Sache selber in die Hand zu nehmen. »Was ist denn Religion, Bruno?«
»Wenn die … die … die Leute in die Kirche gehen.«
»Richtig! Und was machen sie da?«
Bruno Lüdke nickte. »Ja!«
Pennigstorff lächelte ihn an. »Warst du schon einmal in der Kirche, Bruno?«
»Wenn der … der … der Blitz in den Kirchturm einschlägt, dann … dann … dann ist das ganz laut. So laut!« Bruno Lüdke hämmerte mit beiden Fäusten auf sein Pult.
Der Amtsarzt fühlte sich an den Krieg erinnert und fragte Bruno Lüdke, was denn Krieg sei.
»Da … da … da kriegen alle was auf die … die … die Mütze.«
Nach Beendigung der Stunde stand der Amtsarzt noch ein paar Minuten mit dem Klassenlehrer zusammen, um mit ihm über Bruno Lüdke und die anderen dreißig Jungen der »Hilfsschule zu Cöpenick« zu reden. Er hatte sich vor seinem Besuch bei Pennigstorff in Eugen Bleulers Lehrbuch der Psychiatrieüber die Psychopathologie der Oligophrenien schlaugemacht und konnte nun den Fachmann spielen. »Wir unterscheiden drei Grade von Schwachsinn«, referierte er. »Die Idiotie, die Imbezillität und die Debiliät. Die Idiotie ist der höchste Grad. Idioten lernen gar nicht oder nur mangelhaft zu sprechen, sie sind pflegebedürftig, können keinerlei Schulwissen aufnehmen und auch keinerlei Erwerb nachgehen. Debile am anderen Ende der Skala können, wenn auch nur mit Mühe, den Abschluss der Volksschule schaffen und ihr Brot mit einfachen Arbeiten verdienen. Imbezille wie Bruno Lüdke liegen in der Mitte und können im Regelfall viel mehr, als sie selbst wissen.«
»Also meinen Sie, Herr Doktor, dass er seinen Weg gehen wird?«
»Sicher! Seine Eltern haben doch diese Wäscherei, da kann er sich immer nützlich machen, zumal er ja ordentlich erzogen ist und sich leicht in die Familienordnung einfügt, wie mir seine Mutter versichert hat.«
Pennigstorff nickte. »Ja, er ist wirklich ein lieber und umgänglicher Mensch.«
Der Kietz, unterhalb des Schlosses am östlichen Ufer der Dahme gelegen und bereits 1375 in den Chroniken erwähnt, war ursprünglich eine slawische Fischersiedlung und selbständige Landgemeinde. Als eine der drei Vorstädte war sie 1898 Teil Köpenicks geworden und hatte seither ihren Charakter erheblich verändert. Die Zahl der Fischer war zurückgegangen, und Handwerker und kleinere Geschäfte hatten sich hier angesiedelt, so auch die Wäscherei Otto Lüdke in der Grünen Trift. Diese verlief quer durch das Kietzer Feld, reichte von der Müggelheimer Straße beziehungsweise dem Müggelheimer Damm bis hinunter zum Lienhardweg und ließ bestenfalls an märkische Ackerbauerstädtchen denken, da sie nur wenig Charme besaß.
Am südöstlichen Rand der Köpenicker Altstadt lag der Punkt, an dem die Wendenschloß- und die Müggelheimer Straße – später Müggelheimer Damm – sich trafen, um dann radial nach Süden beziehungsweise Südosten zu laufen und sich für die Siedlung Wendenschloß und die Kietzer Vorstadt zu öffnen. Ein Dreieck aber ergab sich nicht, da am unteren Ende eine durchgehende Straße, welche die Hypotenuse abgegeben hätte, fehlte und sich alles wie ein Trichter zum Wald hin öffnete, zur Nachtheide und den Müggelbergen.
Bruno Lüdke liebte es, mit einem dicken Knüppel in der Hand, seiner Keule, durch die Gegend zu stromern, und hörte er, dass ihn gehässige Nachbarn einen Urmenschen oder Neandertaler nannten, so verstand er es nicht, denn er fühlte sich wie ein Wolf oder ein Bär. Er hatte keinen Plan, er wollte nichts, er folgte nur den Stimuli, die er registrierte. Sah er einen Apfel am Baum, dann wollte er ihn pflücken und essen. Hörte er einen Kuckuck rufen, dann wollte er ihn sehen. Ratterte irgendwo eine Straßenbahn, hatte er Lust, ein Stück mit ihr zu fahren, tutete es oben an der Spree oder dem Müggelsee, dann wollte er wissen, ob das ein weißer Ausflugsdampfer oder ein schwarzer Schlepper war. Entdeckte er Pilze und Beeren, so sammelte er sie in seiner Mütze, waren es Kamille oder Schafgarbe, riss er sie heraus und brachte die Büschel der Mutter. Bruno Lüdke war eins mit sich und der Welt und so glücklich, wie es normale Menschen niemals sein konnten.
Der Pfarrer musste, sah er Bruno, unwillkürlich an die Bergpredigt denken: Selig sind, die da geistlich arm sind; denn das Himmelreich ist ihrer. Da hatte einer das Himmelreich auf Erden gefunden, und sein Sohn, der Philosophie studierte, meinte, dass der Mensch ein Unfall des Kosmos sei und Gott besser beraten gewesen wäre, wenn er die Schöpfung auf der Stufe der Schimpansen und Orang-Utans für immer angehalten hätte.
Sein Cousin befand daraufhin: »Intelligenz ist Mist!«
Erwin und Frieda Nickholz hatten lange gespart und sich nach Kriegsende am Sandschurrepfad ein knapp eintausend Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Im Sommer 1921 war ihr Einfamilienhaus fertig geworden, und sie waren von Oberschöneweide, wo Nickholz bei der AEG als Buchhalter beschäftigt war, hinaus aufs Kietzer Feld gezogen. Auch des Kindes wegen, das unterwegs war. Zu Fuß und noch schneller mit dem Fahrrad war Nickholz in ein paar Minuten an der Straßenbahnhaltestelle und konnte mit der Linie 83 fast bis ins Büro fahren. Und nach knapp anderthalb Kilometern war man am Müggelsee, was beide als Naturmenschen besonders freute. Kennengelernt hatten sie sich im Betrieb, aber mit Beginn ihrer Schwangerschaft war Frieda Nickholz zu Hause geblieben, weil ihr oft übel war. Eine kleine Erbschaft sorgte dafür, dass sie auch so einigermaßen über die Runden kamen. Einiges ließ sich ja auch sparen, beispielsweise wenn sie im Garten Gemüse anbauten und ihren Obstbäumen eine ausreichende Pflege angedeihen ließen.
Beide hätten also allen Grund gehabt, wunschlos glücklich zu sein, doch Frieda Nickholz litt unter der Einsamkeit hier jwd und kam vor Angst fast um, wenn ihr Mann einmal später von der Arbeit heimkehrte.
»Du, Erwin, heute ist wieder dieser Neandertaler durch die Gegend gelaufen. Hast du mal nachgefragt, wer das ist?«
»Ja, die Frau im Milchladen sagt, dass das nur der ›doofe Bruno‹ sein kann, der aus der Wäscherei in der Grünen Trift.«
»Immer, wenn ich den sehe, läuft es mir eiskalt den Rücken runter.« Frieda Nickholz schüttelte sich. »Für unser Kind ist das bestimmt nicht gut.«
Auch Erwin Nickholz fürchtete, der Fötus könne geschädigt werden, wenn seine Frau beim Anblick des Jungen zusammenzuckte. »Ich verstehe nicht, warum man diesen Kretin nicht wegsperrt. So was gehört in die Irrenanstalt!«
»Kannst du das nicht mal beantragen?«
Erwin Nickholz war nicht der Mann, der sich gern mit den Behörden anlegte, und so antwortete er nur ausweichend: »Die Milchfrau sagt, das geht nicht, solange er keinem Menschen was zuleide getan hat.«
»Muss also erst etwas passieren?«
»Es wird schon nicht.«
Frieda Nickholz konnte es nicht fassen. »Dann darf er also weiterhin bei uns am Zaun stehen bleiben und mich anglotzen? Wie ich die Blumen gieße, wie ich die Wäsche aufhänge? Apropos Wäsche, mir fehlen ein Bettlaken und zwei Schlüpfer. Die wird er geklaut haben.«
Erwin Nickholz lachte. »Fremde Wäsche wird er doch zu Hause genug haben.«
»Wie heißen die Männer, die …?« Sie musste im Lexikon nachsehen, um darauf zu kommen, dass sie Fetischisten meinte, aber auch Voyeure und Exhibitionisten. »So einer ist das, und eines Tages fällt er über mich her.«
»Was soll ich denn machen, Frieda? Ich kann ihn doch nicht einfach erschießen. Und unser Staat, all diese Waschlappen! Aber«, er stand auf und nahm sie in die Arme, »morgen kaufe ich dir einen Hund.«
Otto Lüdke hustete anhaltend. Mit seiner Lunge stand es nicht zum Besten. Kein Wunder, denn jahrelang hatte er heiße und ätzende Dämpfe einatmen müssen. Auch seine Hände waren voll von Rissen und Schrunden. Aber das gehörte halt zu seinem Beruf, und es gab Schlimmeres. Immerhin konnte er sich an den Tagen erholen, an denen er auf dem Kutschbock saß und frische Wäsche ausfuhr beziehungsweise schmutzige abholte. Zwar musste er von den Brosamen leben, die von den Tischen der großen, industriellen Wäschereien fielen, der von Spindler etwa am anderen Ende Köpenicks, aber es reichte für ihn und seine Familie zum Leben. Was wollte man mehr? Eine bessere Frau als seine Emma konnte er sich gar nicht vorstellen, und auch die älteren Kinder gediehen prächtig. Nur Bruno machte ihnen Sorgen.
Gerade wieder schrie seine Frau über den Hof, ob nicht einer wüsste, wo Bruno stecke.
Nein, niemand hatte ihn in den letzten anderthalb Stunden gesehen.
»Wir warten noch eine halbe Stunde, dann suchen wir ihn!«
Emma Lüdke dachte das, was sie in diesem Falle immer dachte: Womit habe ich das nur verdient?
Als Zweijähriger war ihr Bruno von einem Leiterwagen gefallen und hart mit dem Hinterkopf auf das Kopfsteinpflaster aufgeschlagen. Der Arzt hatte von einer Gehirnerschütterung gesprochen, und nach ein paar Tagen war Bruno auch wieder so munter gewesen wie früher, doch irgendetwas musste in seinem Kopf kaputtgegangen sein, denn von nun an blieb er in allem, was mit dem Denken und Sprechen zu tun hatte, deutlich hinter den Kindern seines Alters zurück. Vor allem war er zu langsam. Brauchten andere fünf Sekunden, um herauszufinden, was zwei mal zwei ergab, waren es bei ihm fünf Minuten, und es konnte vorkommen, dass dann auch noch eine Fünf auf seiner Schiefertafel stand. So kam es, dass er das Klassenziel der sechsten Klasse mehrfach nicht erreichte und auf die Hilfsschule musste.
Ob Otto und Emma Lüdke dieses Kind liebten? Nein, sicher nicht, aber nie wären sie auf den Gedanken gekommen, ihren Bruno in ein Heim zu geben. Es war so, wie es war. Er gehörte zu ihnen, und es war ihre Pflicht, ihn durchs Leben zu bringen. Nie würde er in der Lage sein, die Wäscherei zu übernehmen, wenn sie einmal aufs Altenteil gingen, aber nützlich machen konnte er sich allemal. Es musste halt gehen. Irgendwie. Sie wussten, dass es Leute gab, die nicht bei ihnen waschen ließen, weil sie fürchteten, Bruno würde bei ihnen auftauchen. Dafür aber gab es andere, die aus Mitleid mit ihnen ihre schmutzige Wäsche in die Grüne Trift brachten. Es glich sich also wieder aus.
Natürlich konnten sie mit der Firma W. Spindler nicht mithalten, der »Anstalt zur chemischen Reinigung, Wäscherei und Färberei« drüben in Spindlersfeld, Deutschlands größtem Wäschereibetrieb. Aber dafür waren die gerade von der Schering AG geschluckt worden, während sie, Lüdkes, weiterhin Herren im eigenen Hause sein durften. Und so klein war ihr Betrieb nun auch wieder nicht. Die große Halle war streng in zwei Abteilungen gegliedert: Eine war die »unreine Seite«, die andere die »reine Seite«. Auf der Seite mit der schmutzigen Wäsche, wo es an den Bottichen und Trommeln giftig dampfte und wallte, waren vorwiegend Männer am Werke, auf der anderen, wo die Bett- und Tischwäsche durch die Mangel gedreht und geplättet wurde, beherrschten Frauen das Bild. Zusätzlich gab es die Halle, in der die Wäsche zum Trocknen aufgehängt wurde, und die große Wiese, auf der im Sommer die Stücke zum Bleichen ausgelegt wurden. Hinzu kamen der Fuhrbetrieb und das Büro, denn alle Geschäftsvorgänge mussten registriert sowie Einnahmen und Ausgaben penibel festgehalten werden. Dies war das Reich von Emma Lüdke, während sich ihr Mann vornehmlich um den Betrieb und die An- und Auslieferung der Wäsche zu kümmern hatte. Ihre wichtigsten Kunden waren Gaststätten, kleine Hotels und Pensionen, Belegkrankenhäuser, Arztpraxen, das eine oder andere Altersheim sowie mittlere Industrie- und Handwerksbetriebe, in denen das Tragen von Kitteln zur Pflicht gehörte. Der gewöhnliche Bürger hatte es in der Regel nicht so dicke, dass er seine Wäsche hätte weggeben können, und die Hausfrau zog einmal im Monat zur großen Wäsche nach oben in die Waschküche oder nach unten in den Keller, um mit Hilfe naher Verwandter für saubere Bettlaken, Tisch- und Taschentücher, Unterhosen und Unterhemden sowie Strümpfe und Socken zu sorgen. Höchstens Riesenteile wie Gardinen und Stores wurden in die Wäscherei gebracht.
»Hat einer Bruno gesehen?«, fragte Emma Lüdke, nachdem eine Dreiviertelstunde vergangen war. Niemand hatte ihn gesehen, also gab sie Weisung, dass alle, die nicht unbedingt im Betrieb verbleiben mussten, ausschwärmen sollten, um ihn zu suchen, wobei die Planquadrate vorab festgelegt wurden.
Otto Lüdke war der Bereich um den Kuhgraben und die Neuen Wiesen bis hin zum Müggelsee zugefallen, und er schwang sich aufs Fahrrad, um alles abzuklappern. Ob nun Instinkt oder Zufall, meistens war er es, der Bruno fand.
Auch heute befürchtete er, dass sein Sohn wieder etwas anstellen würde. Alles harmlose Sachen, aber die Berliner regten sich gern darüber auf. Dabei war es doch eher so, dass die Leute Bruno gefährdeten und nicht Bruno die Leute. Ein Rentner hinten an der Nachtheide hatte schon gedroht, Bruno in Notwehr zu erschießen, wenn der es wagen sollte, sein Grundstück zu betreten.
Bruno Lüdke liebte alle Tiere. Nicht die in den Ställen und Käfigen, sondern die im Wald und die auf den Feldern und Wiesen. Die brauchten nicht zur Schule zu gehen und mussten nicht jeden Tag dieselbe Arbeit machen. Die waren frei und konnten fliegen und laufen, wohin sie wollten. Sie durften alles, was ihnen in den Sinn kam, ohne dass jemand gemeckert hätte. Sie mussten nur aufpassen, dass sie nicht gefressen wurden. Deshalb wäre er auch gern ein Adler, ein Löwe, ein Elefant, ein Wolf oder ein Bär gewesen. An die wagte sich niemand heran. Auch an ihn, Bruno, wagte sich niemand heran. Weil er der Stärkste war.
Heute war er aber kein Tier, heute war er ein Neandertaler. Das hatte ihm am Müggelsee ein Radfahrer hinterhergerufen, als der beim Ausweichen fast gestürzt wäre. »Ab in den Wald, du Neandertaler!«
Pennigstorff hatte ihm erklärt, was ein Neandertaler war: einer unserer Vorfahren, der, mit Fellen bekleidet, in einer Felshöhle lebte und mit einer Keule durch die Wälder zog.
Ein Fell hatte Bruno schnell gefunden – die alte Fuchsstola seiner Mutter. Als Keule diente ihm der abgebrochene Stiel einer Grabgabel. Felsen gab es am Kuhgraben nicht, so musste er sich seine Höhle aus Zweigen und Blättern bauen. Aber da drinnen zu hocken war langweilig, also zog er lieber los, um etwas zu erleben.
Erst ging er durch die Straßen. Deren Namen wusste er nicht, da er die Straßenschilder nicht lesen konnte, von der Grünen Trift einmal abgesehen. Dennoch konnte er sie auseinanderhalten, denn die Bäume, Zäune, Straßenbeläge und Häuser waren immer ganz unterschiedlich. Noch nie hatte er sich verlaufen. Manchmal schnitzte er sich als Markierung in die Baumrinden ein Kreuz, ein Herz oder ein L.
L. wie Lüdke, das hatte er sich eingeprägt. Auf diese Idee war er gekommen, als er seinen Vater einmal gefragt hatte, warum denn Wotan, ihr Schäferhund, gegen alle Bäume und Laternenpfähle pinkeln würde.
»Der hinterlässt da seine Duftmarken, damit er wieder nach Hause findet.«
Das hatte Bruno anfangs auch getan, doch spätestens nach einer Stunde war von seinem Urin nichts mehr zu sehen gewesen. Während der Suche nach seinen Spuren hatte er beobachtet, dass jemand ein Herz und ein paar Buchstaben in den Stamm geschnitzt hatte. Gar nicht so dumm, dachte er, das konnte er auch. Überhaupt, sein Taschenmesser war sein ganzer Stolz. Das hatte nicht nur zwei Klingen, eine kleine und eine große, sondern auch noch eine Nagelfeile und einen Schraubenzieher. Der ließ sich vielfach einsetzen.
»Hörst du Idiot wohl auf damit, unser Namensschild abzuschrauben!« Ein Mann kam aus seinem Haus gestürzt und hetzte zum Zaun, um Bruno Lüdke zu vertreiben.
Der sammelte in letzter Zeit Schilder jeglicher Art, und dieses Namensschild hier war besonders schön, oval und sicherlich aus Gold, so sehr glänzte es. Der Name war schön lang und hatte Buchstaben, die nach oben und unten weggingen.
Herr Gollenberg riss den Gartenschlauch vom Boden, drehte den Hahn auf und richtete den Strahl auf Bruno Lüdke.
Der freute sich anfangs über die Erfrischung, aber dann tat es in den Augen weh, und er machte, dass er weiterkam.
Bruno Lüdke liebte kleine Kinder, und er spielte gern mit ihnen. Am liebsten Galopprennen, seit ihn sein Vater einmal mitgenommen hatte nach Hoppegarten. Das hatte er sich gemerkt, weil sich das so nach Hoppe, hoppe Reiter anhörte.
Vor einem Grundstück spielten ein paar Kinder mit Murmeln.
Bruno Lüdke blieb stehen, um ihnen dabei zuzusehen. »Ich auch mal!«
Sie ließen ihn mitmachen.
Als alle Murmeln ihm Loch waren, bot er ihnen an, Galopprennen mit ihm zu spielen. Dazu kniete er sich auf den Gehweg, hüpfte auf allen vieren herum und wieherte so laut, dass es mehrere hundert Meter weit schallte.
Die Kinder amüsierten sich.
»Einer ist jetzt der … der … der …«
Auf das Wort Jockey kam er nicht.
»… der … der … der Reiter.«
Karl-Heinz, blond und fünf Jahre alt, wagte es.
Doch kaum war er auf Brunos Rücken gekrabbelt, kam die Mutter aus dem Haus gelaufen. »Runter da! Und du …«, das war an Bruno gerichtet, »du lässt die Kinder in Ruhe, sonst …«
Bruno Lüdke ließ den kleinen Karl-Heinz wieder absteigen, richtete sich auf, griff sich seine Keule und lief weiter in Richtung Kuhgraben.
Ein Stückchen weiter kniete eine Frau, die viel jünger war als seine Mutter, in ihrem Gemüsebeet und zupfte Unkraut. Als Bruno genauer hinsah, kribbelte es in seinem Puscher, der ganz lang und steif wurde. Das passierte jetzt öfter, und er hatte Angst, dass er deswegen zum Arzt musste. Aber weh tat es ja nicht, wenn er da anfasste. Im Gegenteil, das war schön. Er fing an, vorn an ihm zu reiben.
Da entdeckte ihn die junge Frau, erschrak, sprang auf und schrie: »Hermann, da ist der Exhibitionist wieder! Komm mal schnell her!«
Bruno Lüdke wusste nicht, was das war, ein Ex … Ex …, aber dass es nichts Gutes sein konnte, hatte er am Klang des Wortes erkannt. Das waren seine Feinde, die Frau und ihr Mann. Also lief er los und verschwand kurz darauf im Wald.
Hier war er sicher, hier konnte ihm keiner was. Am besten, er setzte sich in ein Schiff und fuhr nach Amerika. Das konnte, seiner Meinung nach, nicht so weit weg von Köpenick sein, denn ein Onkel von ihm hatte neulich gesagt, er würde auch bald über den großen Teich gehen. Was ein Teich war, wusste Bruno, und der große Teich, das konnte nur der Müggelsee sein. Am anderen Ufer lag also Amerika.
Als er am Ufer stand, kam es ihm ganz nahe vor. Große weiße Dampfer fuhren hinüber. Da musste man nur aufpassen, dass nicht plötzlich ein Riese aus dem Ozean kam und den Dampfer versenkte. Der Onkel hatte was von Ozeanriesen erzählt.
Schwimmen konnte Bruno Lüdke nicht, sonst wäre er nach Amerika hinübergeschwommen. Aber rudern konnte er, und als er an einen Steg kam, an dem ein Ruderkahn lag, sprang er hinein. Eine Kette gab es nicht, der Strick war schnell losgebunden. Erst als er sich abgestoßen hatte und schon gut zehn Meter vom Ufer entfernt war, merkte er, dass im Kahn keine Ruder lagen. Mit den Händen als Paddel wollte er zum Steg zurück, doch der Wind wehte vom Ufer her und trieb ihn nach Amerika hinüber.
Es war ein Riesenspaß. Pech nur, dass ihn mitten auf dem See ein Boot der Wasserschutzpolizei stoppte. Sein Vater war an Bord, und alle schimpften ihn tüchtig aus. Weil er das Boot geklaut hatte und damit losgefahren war, obwohl er gar nicht schwimmen konnte.
»Aber das … das … das Boot kann doch schwimmen«, sagte Bruno.
Zwei
1921
Heinz Franzkes Hand war bereits oben, noch bevor der Lehrer seine Frage richtig formuliert hatte, und zudem schnipste er auch noch mit Daumen und Mittelfinger. Das wurde zwar auf dem Gymnasium nicht gern gesehen, brachte ihm aber dennoch den gewünschten Erfolg, und er wurde aufgerufen.
»Franzke, was verstehen wir unter der Benrather Linie?«
»Die Benrather Linie markiert in der Entwicklung der deutschen Sprache, das heißt bei der sogenannten zweiten Lautverschiebung, die Grenze zwischen dem ober- und dem niederdeutschen Gebiet.« Franzke hatte, nachdem er aufgesprungen war, kerzengerade dagestanden und so artikuliert gesprochen wie kaum ein anderer Schüler in Steglitz.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!