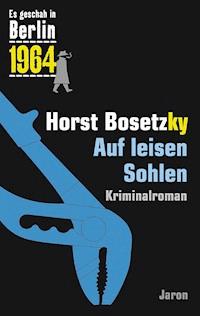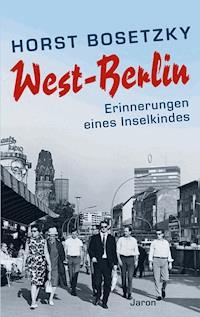Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Horst Bosetzky, Bestsellerautor seit fast einem halben Jahrhundert, nimmt uns anlässlich seines 80. Geburtstags mit auf eine höchst vergnügliche wie informative Reise. Er erinnert sich an Orte, die ihn prägten und ihm zur Heimat geworden sind. In 61 Stationen führt uns der Urberliner zu Städten, Plätzen, Seen und Flüssen, die ihm ans Herz gewachsen sind und zu denen es ihn immer wieder zurückzieht – in seiner Heimatstadt, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und dem deutsch-polnischen Grenzland. Dabei macht er ebenso an bekannten Orten wie Lehnin, Küstrin oder Neuruppin halt wie an zahlreichen unbekannten Kleinoden der Region. Ein höchst unterhaltsames Erinnerungsbuch voller Anekdoten und sehr persönlicher Erlebnisse des Autors, das zugleich jedem, der sich selbst auf Entdeckungstour »von der Ostsee über Berlin bis zum Spreewald« begeben möchte, vielerlei wertvolle Anregungen gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horst Bosetzky
Streifzüge durch meine Heimat
Von der Ostsee über Berlin bis zum Spreewald
Jaron Verlag
Originalausgabe
1. Auflage 2017
© 2017 Jaron Verlag GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Jede Verwertung des Werkes und aller seiner Teile ist nur mit Zustimmung des Verlages erlaubt.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien.
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin, unter Verwendung eines Fotos von Günter Schneider, Berlin
E-Book-Umsetzung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
ISBN 978-3-95552-238-4
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Zwei literarische Leben: Horst Bosetzky wird 80von Norbert Jaron
Vorwort
Brandenburg
Die Gosener Berge
Oranienburg
Bad Belzig und Wiesenburg
Bad Freienwalde und Falkenberg / Mark
Am westlichen Ufer der Oder
Groß Pankow und die Prignitz
Ferch und der Schwielowsee
Wildenbruch und der Große Seddiner See
Kyritz und Kampehl
Potsdam und Sanssouci
Brandenburg an der Havel und der Beetzsee
Neuruppin und Fehrbellin
Rheinsberg
Guben
Bohsdorf mit Grodk und Senftenberg
Bad Wilsnack und die Plattenburg
Von Beeskow nach Branitz
Templin
Storkow und der Scharmützelsee
Jüterbog und Kloster Zinna
Der Stechlin
Von Königs Wusterhausen aus
Zwischen Angermünde und Prenzlau
Fürstenberg / Havel
Gransee und Zehdenick
Von Birkenwerder zum Werbellinsee
Lindow und der Wutzsee
Wassersuppe
Buckow, Müncheberg und die Märkische Schweiz
Baruth, Dahme und Luckau
Kloster Lehnin, Klaistow und Werder / Havel
Strausberg und der Gamengrund
Erkner, die Löcknitz und der Werlsee
Lychen und Himmelpfort
Kloster Chorin, der Parsteiner See und Bernau
Im Spreewald
Die Krausnicker Berge und Märkisch Buchholz
Dicht hinter Brandenburgs Grenzen
Küstrin und Schloss Tamsel
In den Weiten der Terra Transoderana
Von Zieko zur Lutherstadt Wittenberg
Die Müritz
Die Ostsee mit Göhren, Zingst und Kühlungsborn
Havelberg und Tangermünde
Die Feldberger Seenlandschaft und Carwitz
Berlin
Mein Neukölln
An den Ufern der Havel
Auf dem Campus der Freien Universität Berlin
Westend und das Olympiastadion
Der Kiez Bundesplatz und der Hohe Bogen
In und um Schmöckwitz
Von Tegel bis Heiligensee
Die Müggelberge und der Müggelsee
Die Gropiusstadt und der Britzer Garten
Der Teufelsberg
Die Zitadelle Spandau
Berliner Dampferfahrten
Zoo und Tiergarten
Die Orte meiner Täter und Stadtheiligen
Standort Kudamm-Karree
Zu Besuch in Kreuzberg SO 36
Frohnau und der Friedhof an der Hainbuchenstraße
Zwei literarische Leben: Horst Bosetzky wird 80
Wenn ein großer Schriftsteller sein 80. Lebensjahr vollendet, darf man ein wenig Rückschau halten – auch wenn man sich, seiner Leserschaft und nicht zuletzt ihm selbst wünscht, dass dem Jubilanten noch viele weitere Jahrzehnte produktiven literarischen Schaffens vergönnt sein mögen.
Horst Bosetzky blickt auf zwei höchst erfolgreiche schriftstellerische Leben zurück. Das erste begann 1971 mit seinem Kriminalroman Zu einem Mord gehören zwei und machte ihn innerhalb kürzester Zeit zu einem der bekanntesten deutschsprachigen Krimiautoren. Bosetzkys literarhistorischer Verdienst war, dass er – gemeinsam mit einigen weiteren Schriftstellern wie Hansjörg Martin oder Richard Hey – das Genre nachhaltig in Deutschland voranbrachte. Vormals als Trivialliteratur verschmäht, wurde der Krimi durch diese Autoren gesellschaftsfähig, und zwar in Form eines politisch dezidiert kritischen »Soziokrimis«, der sich thematischer Ansätze bediente, die in den Jahren zuvor in Skandinavien entwickelt worden waren. In schneller Abfolge veröffentlichte Bosetzky über ein Dutzend Erfolgsromane, darunter Einer von uns beiden (1972) und Kein Reihenhaus für Robin Hood (1979), die verfilmt wurden.
Sein erstes schriftstellerisches Leben ließ Prof. Dr. Horst Bosetzky allerdings einen gewissen -ky führen. Wer sich hinter dem Kürzel verbarg, wussten über Jahre nur einige wenige Eingeweihte im Rowohlt Verlag. Noch befürchtete der angesehene Wissenschaftler, es würde seiner Laufbahn schaden, wenn die Öffentlichkeit erführe, dass er stillheimlich Krimis verfasste. Der Fachwelt war der promovierte Soziologe, der fast drei Jahrzehnte lang an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Berlin lehrte, als einer der führenden Köpfe im Bereich der Verwaltungs- und Organisationssoziologie bekannt.
Derlei Befürchtungen waren längst obsolet, als der mittlerweile hochangesehene Schriftsteller Anfang der 1990er-Jahre unter seinem Klarnamen sein zweites literarisches Leben begann. Dieses als sein Verleger begleiten zu dürfen ist mir bis heute eine große Freude. Weit über den Kriminalroman hinausgehend – diesen aber nie vernachlässigend –, erschrieb sich Bosetzky den Ruf des wohl erfolgreichsten Berliner Unterhaltungsschriftstellers unserer Zeit.
Unsere Zusammenarbeit begann mit einem Flop. Daran trugen aber weder Autor noch Verleger die Schuld, sondern der berüchtigte »Kaufhauserpresser Dagobert«, dessen Identität von der Polizei gelüftet wurde, als wir gerade einen höchst vergnüglichen Erzählband veröffentlicht hatten, der sich augenzwinkernd die Frage stellte, wer wohl hinter Dagobert stecke.
Unserem größten gemeinsamen Reinfall folgte unser größter gemeinsamer Erfolg: der autobiografisch geprägte Familienroman Brennholz für Kartoffelschalen (1995). In ihm kam einer der wohl wichtigsten literarischen Fertigkeiten des Autors zum Tragen, die noch viele weitere seiner Werke bestimmen sollte: seine unvergleichliche Art, Lokal- und Zeitkolorit einzufangen. Von klein auf ein sehr aufmerksamer Beobachter seiner Umwelt, schaffte er es auf beispiellose Weise, ein äußerst lebendiges Abbild der Berliner Nachkriegszeit zu zeichnen.
Seine Fähigkeit, im Einzelnen das Allgemeine erkennbar werden zu lassen, mit kleinen Strichen gesellschaftliche Zustände und eine bestimmte Ära gegenwärtig zu machen, bestimmt neben seinen zahlreichen Familienromanen auch seine dokumentarischen Spannungsromane. Einige von denen gehören zu dem literarisch Besten, was Bosetzky in den letzten 25 Jahren geschaffen hat: Wie ein Tier (1995), Der kalte Engel (2002) oder Der Teufel von Köpenick (2009). Mit psychologischem Gespür machte der Autor in diesen Romanen das Denken und Fühlen von Menschen plausibel, die sich furchtbarster Verbrechen schuldig gemacht hatten. Dasselbe Feingefühl für die Beweggründe seiner Figuren kam aber auch zum Ausdruck, wenn er sich in seinen biografischen Romanen den großen Persönlichkeiten der Berliner Geschichte zuwandte, so in Kempinski erobert Berlin (2010).
Ganz dem Krimi abgeschworen hat der Autor aber auch in seinem zweiten schriftstellerischen Leben nicht. Im Gegenteil, 2007 begründete er mit dem Jaron Verlag die erfolgreichste Berliner Krimiserie unserer Zeit: Es geschah in Berlin, Kennern als »Kappe-Reihe« bekannt.
Was für ein Buch sollte sich der Jaron Verlag von seinem wichtigsten Romanautor zu dessen Geburtstag wünschen? Drei Passionen ziehen sich durch Horst Bosetzkys Leben. Die erste heißt Fußball. Darüber lassen sich leider nur schwer gute belletristische Bücher machen (auch wenn wir es mal versuchten: mit dem weithin vergessenen Roman Kante Krümel Kracher, 2004). Seine zweite Passion ist der öffentliche Nahverkehr. Über den hat Horst Bosetzky schon so manches schöne Buch verfasst (zuletzt Mit Genuss in Taxe, Bahn und Bus, 2016). Also setzten wir auf seine dritte Leidenschaft: die unermüdliche Erkundung seiner geliebten Heimatregion. Wer wie ich oft das Glück hatte, ihn über die Landschaften und Seen, Städte und Flecken vor allem Brandenburgs erzählen zu hören, weiß, wie viel Interessantes er zu berichten weiß. Das Lesenswerteste davon hat er nun zu Papier gebracht. Entstanden ist eine höchst vergnügliche literarische Reise von der Ostseeküste über Berlin bis zum Spreewald – und zugleich eine Art Quintessenz eines bewegten Lebens.
Lieber Horst, mein Verlagsteam und ich ganz besonders danken dir für dieses Buch und für all die anderen Werke, die wir mit dir realisieren durften. Wir wünschen uns und deinen Lesern, die gar nicht genug bekommen können von deinen mal spannenden, mal tiefgründigen, mal humorvollen, immer aber höchst unterhaltsamen Büchern, dass dir noch so manches schriftstellerische Glanzstück gelingen möge.
Norbert Jaron
Vorwort
Die Anregung zu diesem Buch stammt von meinem verehrten Verleger Dr. Norbert Jaron. Ich hätte mich aber nicht an die Arbeit gemacht, wenn ich nicht zeitgleich in dem Buch Je älter desto besser von Ernst Pöppel und Beatrice Wagner auf eine Abhandlung über das episodische Gedächtnis gestoßen wäre, in der es unter anderem heißt: Das episodische Gedächtnis ist eine der drei Wissensformen, aus denen sich das Langzeitgedächtnis zusammensetzt. Hier werden ausschließlich Bilder und Episoden aus der eigenen Biografie gespeichert, die einen emotionalen Stellenwert für uns haben. Ich möchte auf den folgenden Seiten die Orte beschreiben, zu denen es mich immer wieder hinzieht und an denen ich »faustische Augenblicke« erlebe: Verweile doch! du bist so schön!
Passend für ein Vorwort ist auch ein Zitat von Otto von Bismarck aus dem Jahre 1847: Wie schön ist es, eine Heimat zu haben und eine Heimat, mit der man durch Geburt, Erinnerungen und Liebe verwachsen ist. Ich sehe Berlin als meine Heimat an und nehme noch Brandenburg und die Terra Transoderana dazu, aber auch Teile von Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Alle haben sie mit mir das getan, was Heimaten mit einem Menschen machen: Sie sozialisieren ihn, prägen seinen Charakter, seine Mentalität und seine Einstellungen, kurzum, sie schaffen seine Ich-Identität und sorgen für seine Abgrenzung gegenüber dem, was ihm nicht Heimat ist, also der Fremde.
Für mich hat es vor allem zwei Anlässe gegeben, durch meine Heimat zu wandern: die Einladungen zu Lesungen und die allmonatliche Gruppenwanderung mit Freunden und Verwandten. Durch Brandenburg bin ich bereits als Kind unzählige Male gestreift – in Gedanken. Auch als West-Berliner zur DDR-Zeit habe ich wieder und wieder in einem Heft geblättert, das schon meinen Vater geleitet hatte: in dem von ihm für zwei Mark gekauften Kartenbuch für Fahrt und Wanderung – 1000 Wege um Berlin, herausgegeben von der Berliner Morgenpost. Es ist undatiert, muss aber zwischen 1930 und 1940 erschienen sein.
Mit den Gosener Bergen will ich anfangen, weil es heißt, dass ich dort gezeugt worden bin, und mit dem Frohnauer Friedhof schließen, weil ich dort einmal begraben sein werde.
Es muss aber vor Beginn des ersten Streifzugs noch gesagt werden, dass ich dieses Buch nicht für mich schreibe, sondern für möglichst viele meiner lieben Mitmenschen, die lohnende Ziele für ihre Ausflüge in das weitere Berliner Umland suchen oder interessante Kieze in der Stadt selbst, die ihnen noch unvertraut sind.
Brandenburg
Die Gosener Berge
Ich habe in »meinem« Gosen nie gelebt, aber es geht die Sage, dass ich auf den Höhen der Gosener Berge gezeugt worden bin. Es muss im Mai 1937 gewesen sein. Zu Hause hatten es meine Eltern schwer, sich ungestört zu lieben, denn in ihrer Familien-WG am Neuköllner Weichselplatz lebten sie mit den Eltern meiner Mutter, meinem Urgroßvater sowie der Schwester meiner Mutter nebst deren Mann zusammen. Nur in ihrem Faltboot waren sie allein. Allerdings, ich hatte selbst solch ein Boot und wage die These, dass sich mitten auf einem Gewässer nur erfahrene Akrobaten erfolgreich paaren können. Also werden meine Eltern, Hildegard und Otto, von Schmöckwitz her über den Seddinsee kommend, wohl auf Gosener Territorium angelegt und sich in einer schützenden Sandkuhle unter märkischen Tannen ans Werk gemacht haben.
Gosen, heute Gosen-Neu Zittau, liegt im Bundesland Brandenburg, das am nordöstlichen Ufer des Seddinsees so richtig imperialistisch dem großen Berlin ein Stück Land abgenommen hat. Gegründet worden sein soll es im Jahre 1752 von Friedrich dem Großen als »Spinnerdorf«. Nicht etwa, dass der Preußenkönig die damalige Kreativszene Berlins hierher umsiedeln wollte – nein, es sollten hier Maulbeerbäume angepflanzt und ihre Wolle versponnen werden. Die Gosener Berge nun, bis zu achtzig Meter hoch, gehören zum Teil noch zu Berlin. Dies gilt auch für das Areal, auf dem in den Jahren 1905/06 das Ausflugslokal »Schillerwarte« mit einem Aussichtsturm errichtet worden ist. Diese Schillerwarte war für mich, als wir über den Seddinsee schipperten und ich als Kleinkind vorn im Faltboot meiner Eltern saß, etwas so Großartiges, dass ich sie heute noch deutlich vor Augen habe, wenn ich in Friedrich Schillers Die Kraniche des Ibykus lese: Schon winkt auf hohem Bergesrücken / Akrokorinth des Wandrers Blicken … Leider ist die Schillerwarte in den 1970er-Jahren verfallen und abgetragen worden, und Akrogosen ist heute nur noch eine chaotische Wildnis. Aber gleich nach der deutschen Wiedervereinigung haben sich meine Wanderfreunde und ich, nachdem wir mehrere verrostete Zäune überwunden hatten, noch unter der berühmten Wurzelkiefer gegenseitig fotografiert.
Der Blick ringsum ist, sofern man eine Sichtschneise gefunden hat, noch immer faszinierend, und es kommt einem das Heimatlied des Neu Zittauer Hauptlehrers Gause in den Sinn:
Stehst du am Rande jener Hügel,
da wo die Heide weit sich dehnt,
hättest dem Schauen weite Flügel
für diesen Anblick schnell entlehnt.
Vorn ducken sich die Häuser nieder,
dort hinten schlängelt sich der Fluss.
Wald, Wiese, Hügel grüßen wieder
– ein prächtig Bild, das ewig bleiben muss.
Gosen klingt nach Bibel. Der Pharao bot Joseph an, sich mit seinem Vater und seinen Brüdern in diesem besten Teil des Landes anzusiedeln: … du sollst im Lande Gosen wohnen und nahe bei mir sein … (2. Buch Mose, 45,10). Manche allerdings nehmen an, dass Gosen im Osten des alten Nildeltas lag.
Vielleicht hat diese Verbindung zwischen Brandenburg und Ägypten Ernst Lubitsch im Jahre 1922 bewogen, bei den Dreharbeiten für seinen Film Das Weib des Pharao in die Gosener Berge zu gehen und hier die Schlachtszenen zwischen den Ägyptern und den Nubiern spielen zu lassen (so jedenfalls der Tagesspiegel vom 25. Januar 2017, für den allerdings die Äthiopier die Gegner des Pharao sind).
Die Gosener Berge sind auch ein Stück deutscher, genauer ein Stück DDR-Geschichte: In ihren Tiefen verbargen sich die Bunkeranlagen der zentralen Diensteinheiten des Ministeriums für Staatssicherheit, und am Rande Gosens erstreckten sich die Gebäude der MfS-Hochschule zur Ausbildung von Auslandsagenten.
Einige Hundert Meter von der Stelle entfernt, auf der einst die Schillerwarte stand, gab es ein Hotel- und Kongresszentrum, in dessen großem Saal ich am 21. Juni 1991, organisiert von der Humboldt-Universität, am frühen Vormittag einen organisationssoziologischen Vortrag halten sollte. Anzureisen war schon einen Tag vorher, also am Donnerstag, dem 20. Juni 1991. An ebendiesem Tage wurde im Bonner Bundestag bis in den späten Abend darüber diskutiert, ob man nun nach erfolgter Wiedervereinigung den Parlaments- und Regierungssitz nach Berlin verlegen solle oder nicht. Die Debatte dauerte zehn Stunden und wurde in die Lobby des Hotels übertragen. Für mich als geborenen und bekennenden Berliner war das spannender als jedes Fußball-WM-Endspiel mit deutscher Beteiligung. Endlich nahm der Bundestag den Antrag zur »Vollendung der Einheit Deutschlands« mit 338 zu 320 Stimmen an. Hurra! Wolfgang Schäubles Rede hat wohl den Ausschlag für Berlin gegeben, und ihn liebe ich, obwohl seit 51 Jahren SPD-Genosse, noch heute dafür.
Nach Gosen, so sehe ich gerade auf meiner Karte, kann man mit dem Bus der Linie 369 von Müggelheim aus anreisen, aber auch von Erkner aus mit dem 424er-Bus, der bis zur Haltestelle Schillerhöhe fährt. Den habe ich wohl genommen, als ich vor etwa zwanzig Jahren zu einer Lesung in der Heimatstube Gosen, einem kleinen Museum, angereist bin.
Wer als Kenner der Gegend den Namen Gosen hört, denkt sofort an den Gosener Graben und den Gosener Kanal. Beide verbinden den Seddin- mit dem Dämeritzsee, aber der eine ist Natur pur, der andere eine schnurgerade künstliche Schifffahrtsstraße.
Wenn ich von Schmöckwitz her mit schon etwas müden Paddelschlägen an das Ende des Seddinsees gekommen war, ging es links in den Kanal und rechts, nicht leicht zu finden, in den Graben. Erst kam die Straßenbrücke, dann das Forsthaus Fahlenberg. Ein paar Hundert Meter weiter begann das Sumpf- und Wiesengebiet, das man auch als ein Delta der Spree bezeichnen kann oder als einen Spreewald en miniature. Rechts mündete ein schmaler Wasserlauf, kaum breiter, als ein Paddel lang ist, in den Gosener Graben. In den bin ich etwa 1956 mit meinem Vater an Bord eingebogen, aus reiner Neugier. Wir paddelten immer parallel zur Gosener Landstraße entlang und mussten uns im Boot lang ausstrecken, um unter einem niedrigen Holzsteg hindurchzukommen. Plötzlich ein Aufschrei. Oben auf der Straße stand ein schwarz-rot-goldenes Schilderhäuschen der DDR-Grenzpolizei, denn hier verlief die Grenze zwischen Ost-Berlin und der DDR – und in diese einzureisen, hätte uns als West-Berlinern eine saftige Strafe eingebracht. Was nun? Zu wenden war in dem engen Rinnsal unmöglich. Also paddelten wir im Rückwärtsgang wieder zum Gosener Graben.
Vom Gosener Graben zweigte auch der sogenannte Große Strom ab, und auf dem erreichte man in der Nähe von Schönschornstein die richtige Spree. Nebenbei: Aus Schönschornstein bei Erkner kommt auch Paul Quappe, der in den Romanen der Reihe Es geschah in Preußen als komischer Hausdiener eine dankbare Nebenrolle spielt.
Auf den nächsten Kilometern gab es dann seltene Tiere, Pflanzen und Bauern zu bestaunen. Letztere beim Heumachen. An einigen kleinen »Ablagen« – so wurden früher sandige Stücke am Ufer genannt – konnte man gut anlegen und Pause machen, jedenfalls so lange, bis eine offenbar nicht ganz ausgelastete untere Behörde der DDR beschlossen hatte, den Gosener Graben mittels einer Spundwand aus eingeschlagenen Pflöcken von seiner Urwüchsigkeit zu befreien. Das hinderte uns aber nicht daran, aus dem Boot zu steigen, um unser Margon-Tafelwasser aus dem Schmöckwitzer Konsum zu trinken. Belegte Brote hatten wir uns immer aus Schmöckwitz mitgebracht. Bei einer Fahrt mit dem Frohnauer Freund Dr. Jürgen Zingler aus West-Berlin hatte ich stattdessen einen Müsliriegel dabei. Als ich in den biss, schrie ich derart auf, dass mein Begleiter, der Internist war, befürchtete, ich hätte einen Herzinfarkt erlitten. Doch ich hatte nur eine teure Brücke aus ihrer Verankerung gelöst und sie um ein Haar verschluckt. »Das wäre ein schöner Bolustod für dich gewesen und hätte dir als Kriminalautor hohe PR-Werte gebracht«, sagte er gelassen. »Allerdings hätte ich dich mit dem Heimlich-Handgriff noch gerade gerettet.«
Bisweilen schlugen wir bei der Fahrt durch den Gosener Graben wild um uns. Die Bremsen hatten uns entdeckt und wollten ihre stilettartigen Saugrüssel in unsere Rücken versenken. Schafften sie es und delektierten sich an unserem Blut, dann hatte man es stundenlang mit irre juckenden »Flatschen« auf der Haut zu tun. Gosen war nichts für Mimosen.
Vom Gosener Graben kam man auf den Dämeritzsee. Durch ihn verlief die Grenze zwischen Ost-Berlin und der DDR, und auf einem Prahm saßen die Grenzposten, um die Papiere zu kontrollieren. Wir West-Berliner mussten nach links abbiegen, wo sich in Hessenwinkel an einem Arm der Müggelspree gut rasten ließ. Zurück nahmen wir dann, ausgebremst im Graben, lieber den Weg über den insektenfreien Kanal.
Oranienburg
Oranienburg ist für mich fast ein Jahrzehnt lang ein Ort der Sehnsucht gewesen, denn als ich 1982 nach Frohnau gezogen war, lag es zwar recht nahe, aber schier unerreichbar hinter Stacheldraht und Grenzsperren. Die S-Bahn fuhr nur bis Frohnau, und nördlich des Bahnhofs war der stillgelegte Bahndamm ein beliebter Spazierweg mit freiem Blick in die grünen Weiten der DDR. Meine Ost-Berliner Verwandten belehrten mich, dass der Ort O-Burg hieße, wie man auch KW für Königs Wusterhausen sage. Ich nenne Oranienburg manchmal Bötzow und werde dann angesehen, als hätte nun auch mich die Altersdemenz gepackt.
Der Ort, eine slawische Siedlung, wurde im Jahr 1216 als Bothzowe erstmals urkundlich erwähnt. Nachdem die Christen das Gebiet erobert hatten, bauten sie in Bötzow, so der »eingedeutschte« Name, eine Burg, die der brandenburgische Kurfürst Joachim II. später zu einem Jagdschloss umbauen ließ. Fünf Generationen später, im Jahre 1650, schenkte der berühmte Große Kurfürst die Domäne Bötzow seiner Gattin Louise Henriette, die dem Hause Oranien entstammte, und ließ an alter Stelle ein neues Schloss in holländischem Barock errichten: Oranienburg.
Nachdem während des 19. Jahrhunderts die Chemische Produkten-Fabrik das Gebäude genutzt hatte und später ein Lehrerseminar hier eingezogen war, musste das Schloss ab 1933 als SS-Kaserne herhalten. Die militärische Nutzung dauerte nach dem Ende der NS-Diktatur an: Nun machten sich die Rote Armee sowie in der DDR-Zeit die Kasernierte Volkspolizei und die Grenztruppen im Schloss breit. Heute ist der älteste Barockbau in Brandenburg Museum und Kulturstätte. In den 1990er-Jahren durfte ich hier einmal zu einer Lesung verweilen.
O-Burg liegt an einem See – aber nicht, wie man denken sollte, am Oranienburger See, sondern am Lehnitzsee. Der hat die Form eines Magens, erstreckt sich über 2,3 Kilometer in Nord-Süd-Richtung und ist mal 250, mal 400 Meter breit.
Am südlichen Ende des Sees fließt die Havel weiter Richtung Elbe, und S- und Regionalbahn überqueren den Fluss auf einer mächtigen Brücke. Unter der kann man auf einem schmalen Weg an der hier kanalartigen Havel entlanggehen. Ein schützendes Gitter gibt es nicht, und unter der Kaimauer scheint in der Dunkelheit der Hades zu lauern. Dorthin wurde ich einmal vom RBB beordert, damit mich Uwe Madel für seine Fernsehsendung Täter – Opfer – Polizei interviewen konnte. Mich packt heute noch die Angst, wenn ich daran zurückdenke.
Steigt man in Lehnitz aus der S-Bahn, kann man von seinem südlichen Zipfel aus fast ganz um den See herumwandern. An seinem nördlichen Ende mündet er in die Havel-Oder-Wasserstraße, und mit Blick auf die Lehnitzschleuse kann man den Kanal auf einer Brücke überqueren. Die L273 wird hier zur O-Burger Magistrale, der Bernauer Straße, zur DDR-Zeit Straße des Friedens. Auf ihr erreicht man nach wenigen Hundert Metern die Gedenkstätte und das Museum Sachsenhausen. Oranienburg kann sich glücklich schätzen, dass sein Name meist zuerst mit dem Schloss assoziiert wird – und erst dann mit dem Konzentrationslager. Unzählige Menschen sind hier gequält worden, wie etwa Jurek Becker, oder ermordet, wie der Hitler-Attentäter Georg Elser. Gott, was wäre der Welt an Schrecken und Elend erspart worden, hätte er am 8. November 1939 im Münchener Bürgerbräukeller sein Werk vollenden können!
Am Ufer des Lehnitzsees kann man im »Eiscafé Dietrich« einkehren und versuchen, die dunkelste Epoche deutscher Geschichte zu verdrängen. So ganz wird das aber nie gelingen, zumal in und um O-Burg regelmäßig nicht explodierte Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden werden, die aufwendig entschärft werden müssen. Weil hier viele Chemie- und Rüstungsbetriebe ansässig waren, war die Stadt ein vorrangiges Ziel der Luftangriffe der Alliierten. Es soll Berliner geben, die sich wegen der ständig gefundenen Blindgänger weigern, nach O-Burg zu fahren.
Wagt man den Ausflug dennoch und steigt an der Enthaltestelle Oranienburg aus der Berliner S-Bahn, sticht einem sofort der riesige Komplex des Gymnasiums F. F. Runge ins Auge. Gleich nach der Wiedervereinigung sind hier auch etliche sitzengebliebene Schüler aus den Nordberliner Ortsteilen Frohnau und Hermsdorf untergekommen. Weil es damals in Brandenburg nur 12 Schuljahre gab, in West- Berlin aber noch 13, konnten sie dann im selben Jahr ihr Abitur machen wie ihre ehemaligen Klassenkameraden.
Rechts vom Gymnasium beginnt die Willy-Brandt-Straße. Gehen wir die hinunter, können wir unter Umgehung der Hauptstraße über den Louise-Henriette-Steg den Schlossplatz erreichen. Ganz hier in der Nähe muss der Ort gelegen haben, an dem mein Ost-Berliner Freund und Kollege Jan Eik und ich gleich nach der friedlichen Revolution gemeinsam lesen sollten. Die Gastgeberin machte es sich leicht und bat uns, als wir vorn am Lesetisch nebeneinander Platz genommen hatten, uns doch bitte selbst vorzustellen. Auf mich zeigte sie zuerst. Und so sagte ich: »Mein Name ist Jan Eik, eigentlich Helmut Eikermann, geboren am 16. August 1940 in Berlin, und ick jloobe, det hört man ooch. Eigentlich bin ich Diplomingenieur für Informationstechnik, seit 1987 aber freiberuflicher Autor. Ich hoffe, Sie kennen meine beiden Kriminalromane hier.« Die lagen vor uns auf dem Tisch, und ich brauchte sie nur hochzuheben. »Das lange Wochenende, Verlag Neues Leben, Berlin 1975, und Poesie ist kein Beweis, 1986, erschienen in der DIE-Reihe.«
Danach stellte sich Jan Eik als Horst Bosetzky vor. Zu unserem Entsetzen durchschaute lange Zeit keiner, was da gespielt wurde.
Fällt das Wort Oranienburg, dann rufen viele sofort: »Ah, Eden!« Gemeint ist dabei aber nicht Rolf Eden mit seinem Berliner Nachtklub, sondern die Oranienburger »Gemeinnützige Obstbau-Siedlung Eden«, 1893 gegründet und ausgerichtet auf naturnahes und gesundes Leben.
Eine möglichst nachhaltige Genesung mit der Option auf ein gesundes Leben versuchte auch die Lungenheilstätte am Grabowsee zu gewährleisten, an welche ich als Lungenkranker sofort denken muss. An ihren Zäunen haben wir nach der Wiedervereinigung bei unseren Ausflügen von Frohnau aus oft gestanden. Bis 1995 war sie noch russisches Lazarett, dann begann sie langsam zu zerfallen. Heute wird die Anlage gern als Filmkulisse genutzt.
Auch Friedrichsthal sollte man besuchen und sich den Malzer Kanal mit seinen Schleusen ansehen. In der Friedrichsthaler Kirche wirkte der spätere evangelische Bischof und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland Kurt Scharf von 1933 bis 1945 als Pfarrer.
KW und O-Burg – diese DDR-Kürzel haben sich in meinem Gedächtnis derart festgesetzt, dass ich zu raten beginne, als mein Cousin Curt mir sagt, seine Tochter sei in SPO. »Sperenberg-Ost oder Spremberg-Ost?«
»Nein, Sankt Peter-Ording.«
Bad Belzig und Wiesenburg
»Treffpunkt Bad Belzig. Wir gehen am Sonnabend durch die Rummel«, verkündet unser Wanderführer.
»Über den Rummel!«, schreien da reflexartig die Kenner der deutschen Hochsprache, den Rummelplatz meinend.
Doch der Mann hat recht, obwohl das Wort nicht einmal im Duden zu finden ist. Die Rummel ist eine im Hohen Fläming gebräuchliche Bezeichnung für die hier anzutreffenden periglazialen Trockentäler wie beispielsweise die Rummel »Steile Kieten« zwischen Preußnitz und Bad Belzig und die »Brautrummel« bei Grubo.
Neben Freienwalde, Liebenwerder, Saarow und Wilsnack wurde im Bundesland Brandenburg auch Belzig mit dem Beinamen Bad geadelt. Das Städtchen liegt inmitten des Naturparks Hoher Fläming und verfügt mit dem Hagelberg über eine der höchsten Erhebungen im Norddeutschen Tiefland. Zudem findet man in seiner Nähe eines der letzten Refugien der Großtrappe in Deutschland. Interessant ist auch, dass der geografische Mittelpunkt der DDR zwischen Weitzgrund und Verlorenwasser – heute Teile des Stadtgebiets – gelegen hat. Verlorenwasser heißt aber nicht nur ein Ortsteil von Bad Belzig, sondern auch ein Flüsschen, das in Richtung Havel fließt.
Was ist an Bad Belzig besonders erwähnenswert? Erstens, dass Martin Luther hier 1530 in der Marienkirche gepredigt hat, zweitens, dass es 1547 im Schmalkaldischen Krieg von spanischen und 1636 im Dreißigjährigen Krieg von schwedischen Truppen zerstört worden ist, und drittens, dass sich hier die Burg Eisenhardt befindet. Die ist das Highlight der Stadt. Die slawischen Heveller hatten an ihrem Standort einen Burgwall errichtet, den Albrecht der Bär 1157 für die Askanier eroberte. Später ließ der Graf Siegfried von Belzig dann die massiv gebaute romanische Steinburg errichten. Den imposanten Bergfried, den »Butterturm«, im Innenhof der Burg kann man erklimmen, es sei denn, man leidet wie ich unter Höhenangst und hat nicht mehr genügend Kraft in den Oberschenkeln. Die Ringmauer und das Heimatmuseum sind einen Rundgang wert, ein wahres Erlebnis ist es aber, im Innenhof der Burg Eisenhardt zu sitzen, zu speisen und zu trinken und den Panoramablick zu genießen. Voller Glück können wir dann singen:
O Täler weit, o Höhen,
O schöner grüner Wald,
Du meiner Lust und Wehen
Andächtger Aufenthalt.
Nicht nur der Butterturm, auch der zweihundert Meter hohe Hagelberg will erklommen sein. Auf dem haben sich in den Befreiungskriegen im Vorfeld der Völkerschlacht bei Leipzig am 27. August 1813 die Preußen und die Franzosen in der sogenannten Kolbenschlacht bekriegt. Deren Name rührt daher, dass die Soldaten überwiegend mit Bajonetten und Gewehrkolben kämpfen mussten, weil wegen Dauerregens die Pulver und Gewehre feucht geworden waren. Als es schon so aussah, als würden die Preußen verlieren, erschienen die Russen auf dem Hagelberg und retteten ihnen den Sieg. Es gab Tausende von Toten und Verwundeten.
Auch ich erlitt eine Verwundung, nachdem ich den Hagelberg mit meiner Wandergruppe bestiegen hatte, jedoch nicht durch den Stich eines Bajonetts, sondern durch die Klinge meines Taschenmessers. Ich hatte mir einen Apfel mundgerecht zerteilen wollen, schrie auf wie ein preußischer Landsturmmann und wälzte mich filmreif im Grase. Zum Glück hatten wir einen Arzt in unserer Mitte, der meine Wunde kunstgerecht verbinden konnte.
Ist man schon einmal in Bad Belzig, lohnt es sich, auch das nahegelegene Wiesenburg zu besichtigen. Nach rund zweieinhalb Stunden Fußmarsch ist man vor Ort und kann das im Stil der Neorenaissance erbaute Schloss bewundern und im Schlosspark flanieren. Vom Bahnhof Wiesenburg ist man mit einem Zug der Linie RE7 in etwas mehr als einer Stunde wieder am Berliner Bahnhof Zoo.
Bad Freienwalde und Falkenberg / Mark
Der Name Bad Freienwalde (Oder) ist etwas irreführend, denn die Stadt liegt nicht, wie man annehmen könnte, an der bekannten großen Oder, sondern an der vergleichsweise kümmerlichen Alten Oder am Nordwestrand des Oderbruchs. Da hier das Barnimplateau beginnt, finden wir im Stadtgebiet Höhenunterschiede von bis zu 150 Metern.
Als wir Bad Freienwalde um das Jahr 2005 zum ersten Mal erwandern wollten, trafen wir uns auf dem Marktplatz mit der Stadtpfarrkirche St. Nicolai und dem Rathaus. Von dort gingen wir die leicht ansteigende Uchtenhagenstraße entlang. Die Uchtenhagens sind ein altes Adelsgeschlecht, und ihr Name ist ab 1250 in alten Urkunden zu finden. Beim Wegweiser Fontane-Wanderweg bogen wir nach rechts ab und stiegen zwischen mehreren Grundstücken einige Stufen hinauf. Wir erklommen einem Hang mit Buchen- und Eichenwäldern, und ich habe schnell die Orientierung verloren. Meistens versperrte dichtes Gebüsch den Blick auf die Stadt. Angesteuert haben wir vier Aussichtstürme, und wer mit einem Turm-Ticket alle bestieg, dem wurde ein Turm-Diplom verliehen. Darauf verzichtete ich mit der Begründung, schon ein Diplom zu haben, wenn auch nur das 1968 an der Freien Universität Berlin erworbene für Soziologen.
Den Aussichtsturm auf dem Galgenberg bestieg ich aber doch, und das hinterließ bei mir einen solchen Eindruck, dass ich einen der Protagonisten der Krimi-Reihe Es geschah in Berlin nach ihm benannt habe, nämlich den Assistenten des Kriminalkommissars Hermann Kappe: Gustav Galgenberg. Det is een richtija Berliner, der tut lupenrein berlinern und hat ooch alle Sprüche druff wie etwa: »Wer Jott vatraut und Bretta klaut, der hat ’ne billje Laube.«
Dann entdeckte ich etwas, das mir aus Bayern, Österreich und Holmenkollen gut bekannt ist, das ich aber nie und nimmer im Landkreis Märkisch-Oderland vermutet hätte: Skisprungschanzen. Drei davon gibt es hier im Papengrund, und auf der ältesten Schanze ist Birger Ruud, der Olympiasieger von 1936, den Rekord von sage und schreibe 40,5 Metern gesprungen.
Bad Freienwalde liegt mir auch deshalb am Herzen, weil mein Freund Volker Panecke dort aufgewachsen ist und er mich ins Redaktionskollegium des Jahrbuchs Viadrus geholt hat, das den Untertitel Heimatbuch für Bad Freienwalde (Oder) und Umgebung et Terra Transoderana trägt. Zum siebenhundertsten Stadtjubiläum (1316–2016) wurde das Sonderheft Freyenwaldia herausgegeben, in dem alles Wissenswerte über Bad Freienwalde nachzulesen ist. Spiritus Rector des Ganzen war der Ortschronist und Augenarzt Dr. Ernst-Otto Denk, und ein jeder Besuch in seiner Stadt ist damit ein denkwürdiger.
Zu Bad Freienwalde gehört auch die Ansiedlung Schiffmühle. Dort verweile ich gern, da mich dieser Ort ganz besonders an meinen Lieblingsdichter Theodor Fontane erinnert. Immer wieder lese ich Fontanes autobiografischen Roman Meine Kinderjahre und werde im Folgenden auch mehrfach aus dem 16. Kapitel (Vierzig Jahre später) zitieren. Aber recht eigentlich höre ich Fontane-Texte viel lieber – vorausgesetzt, sie werden so vollendet vorgetragen wie von Gert Westphal –, beispielsweise diese Sätze über Fontanes Vater:
Er wohnte damals, schon zehn oder zwölf Jahre lang, in Nähe von Freienwalde, und zwar in einer an der alten Oder gelegenen Schifferkolonie, die den Namen »Schiffmühle« führte und ein Anhängsel des Dorfes Neu-Tornow war. Vereinzelte Häuser lagen da, in großen Abständen voneinander, an dem träg vorüberschleichenden und von gelben und weißen Mummeln überwachsenen Flusse hin, während sich, unmittelbar hinter der Häuserreihe, ziemlich hohe, hoch oben mit einem Fichtenwalde besetzte Sandberge zogen. Genau da, wo eine prächtige alte Holzbrücke den von Freienwalde heranführenden Dammweg auf die Neu-Tornow’sche Flußseite fortsetzte, stand das Haus meines Vaters.
Und da steht es heute noch, an die 150 Jahre später.
Louis Henry Fontane wurde am 24. März 1796 in Berlin geboren und starb am 5. Oktober 1867 in Schiffmühle. Sein Vater, Theodor Fontanes Urgroßvater, ist unter anderem Kabinettssekretär der legendären Königin Luise von Preußen gewesen. Louis Henry Fontane hat in Berlin das Gymnasium zum Grauen Kloster besucht und in der Leipziger Straße eine Apothekerlehre absolviert, war aber zwischenzeitlich Soldat. Am 2. März 1813 hat er in der Schlacht bei Großgörschen trotz seiner französischen Wurzeln gegen Napoleons Truppen gekämpft hat und ist von einer Kugel getroffen worden, die jedoch in seiner Brieftasche stecken blieb. Später musste er aufgrund von hohen Spielschulden seine Apotheke in Neuruppin verkaufen. Eine Zeichnung von Hellmuth Raetzer zeigt ihn so, wie er im Erinnerungsbuch seines berühmten Sohnes beschrieben wird: Auf dem Kopfe saß ein Käpsel, grün mit einer schwarzen Ranke darum …
Sein Grabstein ist heute von Moosen und Flechten überwachsen. Die Inschrift lautet schlicht und einfach: Louis Hanri Fontane. Weder Daten noch Fakten sind darauf zu finden.
Schiffmühlen sind Wassermühlen. Da die träge dahinfließende Alte Oder alles andere als ein wild rauschender Bach ist, fragt man sich, wie mithilfe ihrer Wasserkraft bis 1770 Mehl gemahlen worden sein soll. Heute ist das kleine Fontanehaus in Schiffmühle ein Museum. Besucht man es, kann man sich das Ende der Kinderjahre bildlich vorstellen:
Als 5 Uhr heran war, mußt’ ich wieder fort. »Ich begleite Dich noch«, und so bracht er mich bis über die Brücke.
»Nun lebewohl und laß Dich noch mal sehen.« Er sagte das mit bewegter Stimme, denn er hatte die Vorahnung, daß dies der Abschied sei.
»Ich komme wieder, recht bald.«
Er nahm das grüne Käpsel ab und winkte.
Und ich kam auch bald wieder.
Es war in den ersten Oktobertagen und oben auf dem Bergrücken, da, wo wir von »Poseidon’s Fichtenhain« gescherzt hatten, ruht er nun aus von Lebens Lust und Müh.
Bad Freienwalde ist mit Falkenberg / Mark wie mit einem siamesischen Zwilling verwachsen. Und auch hier »fontanet« es sehr. Man findet in Falkenberg nicht nur die Villa Fontane, den Fontane-Wanderweg und einen Gedenkstein mit einem Kupferrelief eines Fontanekopfes, auch der Verleger und Sohn von Theodor Fontane, Friedrich, war in dem Ort oft zu Gast. Der Höhepunkt eines jeden Ausflugs nach Falkenberg ist aber das Speisen oder Kaffeetrinken im »Panoramarestaurant Carlsburg«, das schon seit 1838 bekannt und seit 1991 wiedereröffnet ist. Grandios ist der Blick hinunter ins Oderbruch, ein Hochland nach Norden hin bis zur sogenannten Neuenhagener Insel und den bläulich grünen Höhenrücken, die schon zu Polen gehören. Hier muss Joseph von Eichendorff gestanden haben, als er die folgenden Verse gedichtet hat:
Und ich wandre aus den Mauern
Bis hinaus in’s freie Feld,
Hehres Glänzen, heil’ges Schauern!
Wie so weit und still die Welt.
Schon allein das Wort Oderbruch löst bei mir hehre Gefühle aus, denn als Junge ist der Roman Die Heiden von Kummerow von Ehm Welk eines meiner Lieblingsbücher gewesen und das darin beschriebene vorpommersche Dorf Kummerow liegt im Bruch hinterm Berge. Selbstverständlich weiß ich, dass Welk eigentlich das Dorf Briesenbow bei Angermünde gemeint hat, das weit entfernt von der Oder liegt, an die sechzig Kilometer flussaufwärts an der Welse – aber was kümmert mich das?
Steht man auf der hölzernen Terrasse der »Carlsburg« und dreht den Kopf weit nach links, kann man das Schiffshebewerk Niederfinow erkennen. Schaut man nach links unten, blinken dort im Sonnenlicht die Schienen der RB60 (Eberswalde—Frankfurt / Oder), und die blau-weißen Züge der Niederbarnimer Eisenbahn erscheinen so klein wie die einer Modelleisenbahn.
Am westlichen Ufer der Oder
Der Titel Viadrus – Heimatbuch für Bad Freienwalde (Oder) und Umgebung verweist auf den Flussgott der Oder, einen kräftigen Mann mit Schilfblättern im Haar, der mit einem griechischen Manteltuch bekleidet ist, ein Ruder in der einen und eine Quellvase in der anderen Hand. 866 Kilometer lang ist die Oder. Das ist nicht viel im Vergleich zu den 2857 Kilometern der Donau, aber immerhin. Die Oder entspringt in Tschechien, wurde von den Polen Oddera genannt und hieß bei den deutschen Gelehrten des 16. Jahrhunderts nach ihrem Gott Viadrus fluvius. Diese Bezeichnung hat sich allerdings nicht durchgesetzt, nur die Europa-Universität Viadrina hat ihren Namen davon abgeleitet.
Warum die Oder der Schicksalsfluss meiner Familie ist, soll später erzählt werden, an dieser Stelle sei nur darauf hingewiesen, dass ich zwar nie auf der Oder gepaddelt bin, aber oft auf dem Oder-Spree-Kanal. Dabei habe ich immer davon geträumt, einmal den ganzen Kanal mit seinen insgesamt 65 Kilometern zu bewältigen und bei Eisenhüttenstadt jubelnd in die Oder einzubiegen.
Schreibt man über die Oder, wäre eigentlich über den Nationalpark Unteres Odertal und seine wunderschönen Flussauenlandschaften zu berichten, aber den habe ich nie erkundet – wir haben es auf dem Oderdeich nur bis zur Nationalparkstadt Schwedt geschafft. Wichtig für mich ist dagegen das märkische Oderland zwischen Bad Freienwalde (Oder) und Neuzelle.
Von Bad Freienwalde erreicht man mit dem Auto in kurzer Zeit Oderaue, in dessen Ortsteil Zollbrücke das »Theater am Rand« von Thomas Rühmann – bekannt durch die Rolle des Dr. Heilmann in der Fernsehserie In aller Freundschaft – und Tobias Morgenstern betrieben wird. Das Gebäude ist aus massivem Holz und sieht aus, als gehöre es in den Wilden Westen. Hinter der Bühne gibt es keine künstlichen Kulissen, allein die Natur mit ihren Feldern, Bäumen, Hecken, Koppeln, Wegen und Zäunen dient als Bühnenbild. Das ist einzigartig. Ich habe hier mit Freunden und Verwandten im Sommer 2015 das Stück Mitten in Amerika gesehen, eine bitterböse Geschichte um Wasser, Boden, Öl, Windräder und Schweinefarmen in Texas und Oklahoma. Zu Beginn der Vorstellung öffnete sich kein Vorhang – einen solchen gibt es hier gar nicht –, sondern die Schauspieler kamen durch ein Kornfeld von hinten auf die Bühne.
Nach der Vorstellung ging ich zur Oder hinunter, tauchte meine Hände mit einer rituellen Geste ins Wasser und dachte daran, wie mein Vater hier im Sommer 1937 entlanggepaddelt ist. Von Breslau nach Berlin hat er es geschafft. Meine Mutter war damals, weil sie schwanger war, nicht dabei – ich also auch nicht.
Wenn man Oderaue beziehungsweise Zollbrücke besucht, sollte man einen Abstecher nach Letschin machen. Dort befindet sich in der Fontanestraße 20 die Fontane-Apotheke, vormals allerdings nicht von Theodor, sondern von seinen Eltern betrieben. Nicht weit ist es auch zu den Seelower Höhen, wo die Rote Armee am 16. April 1945 die Schlacht um Berlin eröffnet hat. Auf einer unserer Wanderungen fanden wir dort noch immer leicht erodierte Schützengräben. Der herrliche Ausblick auf die Oderniederung lässt sich deshalb nicht so recht genießen.
Mit der Wandergruppe sind wir auch fast jedes Frühjahr zu den Adonisröschen an den Oderbergen in Lebus gepilgert. Lebus war einmal eine Größe in der europäischen Geschichte. Unter dem polnischen Herrscher Mieszko I. ist es zu einem wichtigen Teil des Piastenstaates geworden, und Bolesław III. Schiefmund hat 1125 das Bistum Lebus gegründet. Mitte des 13. Jahrhunderts eroberten dann die Askanier Lebus, und es wurde brandenburgisch. Bald aber wurde Lebus bedeutungslos, denn der Bischofssitz wurde nach Göritz (Oder) verlegt.
Als wir in Lebus am Oderufer in einem Restaurant sitzen und auf das Essen warten, wandern unsere Blicke nach Polen hinüber, wo auf einem Deich Fußgänger und Reiter zu sehen sind. Ich denke an O Cangaceiro – Die Gesetzlosen, den brasilianischen Abenteuerfilm von 1953, und versuche die Titelmelodie Mulher Rendeira