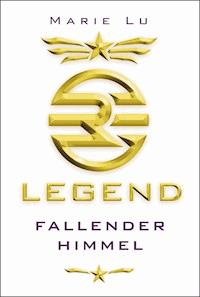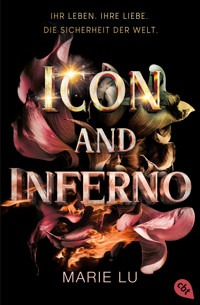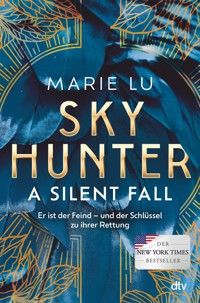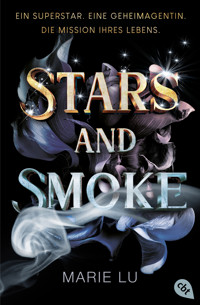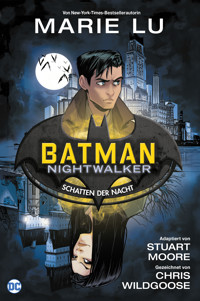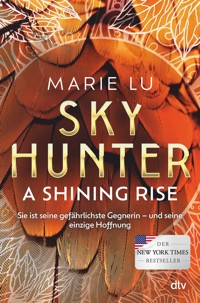
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die Skyhunter-Reihe
- Sprache: Deutsch
Wie viel bist du bereit, für deine Freiheit zu opfern? Mara, die letzte freie Nation des Kontinents, ist gefallen. Und hinter der feindlichen Linie steht Talin allein. Sie muss alles, woran sie geglaubt hat, verraten und als persönliche Skyhunterin für den Premier der Föderation kämpfen. Doch Red hat Talin noch nicht aufgegeben. Denn die Verbindung zwischen den beiden ist zwar schwach, aber dieser kleine Funke könnte genug sein. Genug, um zurück zueinander zu finden und um die Striker wieder zu vereinen. Während Red die verstreuten Streitkräfte von Mara um sich schart, macht Talin im Herzen der Föderation eine erschütternde Entdeckung. Für Red und Talin beginnt ein riskantes Spiel um das Schicksal des Kontinents – und um ihre gemeinsame Zukunft. - Das atemberaubende Finale der Skyhunter-Dilogie - Explosive Action, eine starke Heldin und ein faszinierendes Worldbuilding - Perfekt für Fans der Tropes Forbidden Love, Found Family und Morally Grey Alle Bände der Skyhunter-Reihe: Band 1: Skyhunter – A Silent Fall Band 2: Skyhunter – A Shining Rise Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Eine Kriegerin, gefangen im Land ihres Feindes.
Ein Verbündeter, der für sie alles riskieren würde.
Und ein letzter Kampf um die Zukunft einer ganzen Welt.
Allein hinter der feindlichen Linie muss Talin als Skyhunterin für den Premier der Föderation kämpfen. Doch Red hat Talin noch nicht aufgegeben. Denn die Verbindung zwischen den beiden ist zwar schwach, aber dieser kleine Funke könnte genug sein. Genug, um zurück zueinander zu finden und um die Striker wieder zu vereinen. Während Red die verstreuten Streitkräfte von Mara um sich schart, macht Talin eine erschütternde Entdeckung: Widerstand regt sich im Inneren der Föderation und die Wurzeln des Verrats reichen tief. Für Red und Talin beginnt ein riskantes Spiel um das Schicksal des Kontinents – und um ihre gemeinsame Zukunft.
Das atemberaubende Finale der Skyhunter-Dilogie
Von Marie Lu ist bei dtv außerdem lieferbar:
Skyhunter – A Silent Fall (Band 1)
Batman – Nightwalker
Marie Lu
Skyhunter
A Shining Rise
Band 2
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Petra Koob-Pawis
Für alle, die einen Verlust erlitten haben,
für alle, die schwere Zeiten überstanden haben,
und für alle, die es anderen ermöglichen zu überleben.
RED
DAS ERSTE, WAS DUALS Föderationssoldat lernst, ist Effizienz.
Dir wird beigebracht, wie du ohne großen Aufwand ein Stadtviertel niederbrennst.
Wie du innerhalb weniger Tage eine ganze Stadt räumst, um neue Bahngleise zu verlegen.
Wie du einen Gefangenen nach dem anderen exekutierst, bis du kaum noch weißt, in welcher Reihenfolge du sie hingerichtet hast.
Ich sehe die Soldaten, wie sie dort unten die Erde rund um die Stadt Newage aufreißen, bis die einst idyllische Landschaft einer Schrotthalde gleicht. Aber so ist das eben, wenn die Föderation etwas mit allen Mitteln in ihren Besitz bringen will. Wir marschieren vor eurer Grenze auf, vernichten euch und nehmen uns das, was wir wollen.
Wenn ich aufmerksam lausche, kann ich das Lachen der Soldaten hören, ihre Witze, ihre Geschichten von zu Hause.
Was sie tun, ist böse, ganz ohne Frage, auch wenn sie selbst nicht von Natur aus böse sind. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich, wer sie wirklich sind – jemandes Bruder, jemandes Tochter. Kinder, die gezwungen wurden, sich zwischen dem Schutz ihrer Familie und ihrer eigenen Seele zu entscheiden.
Woher ich das weiß? Weil ich einst selbst einer von ihnen war.
So ist das mit dem Bösen. Man muss nicht böse sein, um schlimme Dinge zu tun. Das Böse muss nicht den ganzen Menschen verschlingen. Es kann auch ganz klein sein. Du musst lediglich zulassen, dass es existiert.
Die Soldaten da unten lachen und scherzen, weil sie sich dann nicht allzu lange mit dem befassen müssen, was sie hier tun. Aber bald wird die Föderation sie wieder auf das Schlachtfeld schicken. Wenn ein Anführer seine Leute zu viel nachdenken lässt, ihnen Zeit gibt, sich an ihre Menschlichkeit zu erinnern, dann riskiert er, dass sie die Abscheulichkeit ihrer Taten erkennen. Und begreifen, dass das Blut Unschuldiger ihre Hände befleckt. Er riskiert, dass sie zurückblicken und sehen, was für ein Gemetzel sie angerichtet haben. Dass sie im Namen der Föderation auch einen Teil ihrer selbst zerstört haben. Und er riskiert, dass der Schmerz dieser Erkenntnis sie vor Grauen in die Knie gehen lässt.
Wenn du zu viel denkst, zu lange zögerst, dann sperrt er dich in einen Glaskäfig in einem seiner Labore. Er isoliert dich, sodass du mit niemandem außer dir selbst reden kannst. Dann redest du und redest, bis der Gedanke an ein Ich und ein Du jede Bedeutung verloren hat und du den Verstand verlierst.
Ich hatte zu viel Zeit zum Nachdenken. Ich saß in diesem Glaskäfig und dachte darüber nach, ob ich das Leben eines jungen Mädchens hätte verschonen sollen, ob ich für den Tod meiner Familie verantwortlich war und wie ich jemals den Mord an einem unschuldigen Menschen hätte rechtfertigen können, um das Leben eines anderen zu retten. Ich habe nachgedacht und nachgedacht, bis ich nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden konnte.
Jetzt bin ich frei, aber ich denke, ein Teil von mir wird immer in dieser Kammer gefangen sein. Ein Teil von mir wird immer an das Böse, und sei es noch so klein, verloren sein.
NewageMara
Die Karensa-Föderation
Sechs Monate nach dem Fall von Mara
1
TALIN
DER ORT, AN DEM EINST DAS HAUS meiner Mutter stand, ist jetzt nur noch ein verbranntes Feld. Ich erinnere mich an die Reihen grüner Pflanzen, an die Ranken mit den prallen Erbsenschoten, an die Wassertropfen auf den Blättern ihres Süßgrases, die nach Zitrone dufteten. Das alles ist verschwunden.
Auch der Rest ihrer alten Straße ist verschwunden – jede schiefe Hütte, jeder Kochtopf, der über einem Feuer dampfte. Die behelfsmäßig errichteten Verkaufsstände aus verblichenen Tüchern und rostigen Blechen entlang der Gassen, wo in Tüten abgewogene Gewürze und ausrangierte Werkzeuge vom Schrottplatz angeboten wurden. Der beißende Geruch nach frittiertem Fisch, ranzigem Fett und fauligem Abwasser. Nichts davon ist mehr da.
Die Armenviertel der Äußeren Stadt von Newage waren nie ein schöner Ort, aber jetzt bestehen sie nur noch aus Schlamm, Erde und Schutt. Die einzigen Fußabdrücke stammen von karensischen Stiefeln, von Föderationssoldaten auf Inspektionstour. In der Ferne hämmern Arbeiter neue Eisenbahnschienen fest, die direkt nach Newage führen sollen – einst die Hauptstadt von Mara, jetzt nur eine weitere von vielen Städten, die der Föderation anheimgefallen sind.
Der Nationalplatz ist vollgestellt mit Pritschen; Krankenschwestern versorgen verletzte Föderationssoldaten und maranische Kriegsgefangene. Die Wohnung, in der ich früher mit Red gelebt habe, ist in eine Kaserne umgewandelt worden, in der acht Föderationssoldaten gemeinsam untergebracht sind. Und die unterirdische Gefängnisgrube, in der Red einst festsaß und in der auch ich nach unserer Rückkehr nach Mara gefangen gehalten wurde, ist eine riesige Ausgrabungsstätte geworden. Ich sehe Bürgermeisterin Elland von Cardinia, die neben der ausgehobenen Erde steht und mit dem leitenden Ingenieur darüber spricht, wie die Funde am besten in die Hauptstadt transportiert werden können.
Die Föderation ist überzeugt, dass unter der Erde von Mara eine mächtige, uralte Energiequelle des Ersten Volks verborgen liegt, und Premier Konstantin glaubt, dass man sie genau an der Stelle finden wird, wo einst unser Gefängnis war. Karensische Ingenieure haben einen Zugang aufgesprengt und Bohrtrupps in das Silo geschickt. Die unterste Etage ist jetzt eine Grube, die in die Dunkelheit führt, mit Dutzenden von Seilen und Flaschenzügen.
Die Veränderungen machen vor nichts halt. Die Mauer, auf der ich als kleines Kind mit leuchtenden Augen und baumelnden Beinen hockte, wenn die Striker-Patrouillen an die Kriegsfront zogen, ist jetzt vollständig von Zetteln bedeckt, mit denen die Maraner nach verschollenen Angehörigen suchen. So sieht das seit dem Fall der Stadt vor sechs Monaten aus.
Gesucht: Damian Wen Danna, geliebter Vater.
Hat jemand Kira Min Calla, Tochter, zwölf, gesehen, die auf der Flucht in die Tunnel von ihrer Mutter getrennt wurde?
Errin An Perra sucht nach ihrem Baby, Seanine Min Perra, blaue Augen, braunes Haar, 19 Monate alt – Mutter und Kind wurden in der Nähe der Südmauer getrennt.
Torro Wen Marin sucht seine Eltern, Karin An Tamen und Parro Wen Marin, beide seit dem Tag der Invasion vermisst.
Und so weiter und so fort. Die Zettel mit den verzweifelten Aufrufen hängen dicht an dicht in mehreren Schichten übereinander, sodass es aussieht, als sei die Wand selbst aus Papier. Ich frage mich, ob die Mauern von Basea auch so ausgesehen haben, nachdem sich der Rauch verzogen hatte. Ich frage mich, ob es überhaupt noch jemanden gab, der nach uns hätte suchen können.
Jede Haustür ist mit einem Karensa-Siegel versehen. An jedem Schaufenster sind die Preise auf Karensisch notiert. An jeder Ecke stehen mindestens ein oder zwei karensische Soldaten, von denen die meisten die Hände in die Taschen ihrer scharlachroten Uniformen gesteckt haben und gelangweilt über die Kälte klagen.
Sechs Monate haben ausgereicht, um meine Erinnerungen an ein freies, unabhängiges Mara verblassen zu lassen. Ich hatte mir hier ein neues Leben aufgebaut, mich an die Routine des Alltags gewöhnt, in der Hoffnung, dass nun alles beim Alten bleiben würde, bis ich wieder einmal vor Augen geführt bekam, wie schnell alles zu Ende sein kann. Gerade noch gab es hier eine Stadtgemeinde, Stahlmauern und ein Zuhause. Im nächsten Moment ist da nur noch Asche.
Ich stehe neben Konstantin Tyrus, dem jungen Premier der Karensa-Föderation, am Rand der Arena, in der ich früher mit den Strikern trainiert habe. Auch dieser Ort hat sich verändert – an den Seitenwänden hängen jetzt die Banner des Feindes –, aber sein Zweck ist derselbe geblieben. Wir sind heute hier, um die Bestrafung der Gefangenen zu überwachen.
Konstantins Bruder, General Caitoman, hat den Platz auf der anderen Seite des Premiers eingenommen, die beiden sprechen leise miteinander. Um uns herum sind weitere Soldaten postiert. Ich werfe einen Blick in ihre Richtung. Einige bemerken es und senken erschrocken die Augen, verneigen sich ehrerbietig vor mir.
Ich spüre einen Anflug von Genugtuung angesichts ihrer Angst. Dann überkommt mich Abscheu. Sie haben Angst vor mir, weil sie ein Monster sehen, das von ihrem Premier geschaffen wurde.
Mein Blick huscht unwillkürlich zu meinem Unterarm, zu der weichen Haut zwischen Handgelenk und Ellbogen, unter der eine Panzerung verläuft. Meine Knochen sind jetzt mit blankem Stahl verstärkt, mein Haar hat den gleichen metallischen Glanz wie das von Red und auf meinen Handrücken prangen Tattoos in Form von Diamanten, dem Symbol für etwas Unzerstörbares.
Ich bin unzerstörbar. Ich bin stärker, als es ein Mensch sein sollte, und ich spüre diese Kraft bei jeder Bewegung. Wo ich früher nur Gras sah, erkenne ich jetzt ein Meer von Halmen. Ich sehe, wie der Wind die Luft kräuselt. Die Welt vibriert vor tausend neuen Bewegungen. Mein Rücken ist aufgeschnitten und neu zusammengesetzt worden, meine Glieder mit Stahlstreben verstärkt, und mein Gesicht ist teilweise hinter einem schwarzen Helm und einer Maske verborgen.
Lediglich meine Augen sind frei geblieben. Sie sind immer noch so groß und dunkel wie zuvor, obwohl auch sie in etwas Neues, Übermenschliches verwandelt wurden. Wenn ich jetzt an einem Spiegel vorbeigehe, sehe ich in meinen Augen etwas anderes – die Anwesenheit von jemand anderem, der in meinem Kopf herumspukt.
»Die Hälfte von ihnen sind Maraner«, sagt Caitoman zu Konstantin. In den vielen Monaten als Gefangene in den Labors habe ich genug Karensisch aufgeschnappt, dass ich die Sprache einigermaßen verstehen kann.
»Und die andere Hälfte?« Die Frage klingt desinteressiert, aber durch die besondere Verbindung mit dem Premier spüre ich, dass seine Aufmerksamkeit geweckt ist, so als hätte er bereits ungeduldig darauf gewartet, dass der General ihm mehr über die Gefangenen erzählt.
Caitomans Lippen verziehen sich zu einem dünnen Lächeln. Er hat all das, was Konstantin nicht hat: ausgeprägte Muskeln, Größe und Kraft, volles braunes Haar und einen boshaften Blick. Selbst Konstantins Augen haben nicht jene Leere wie die seines Bruders. Wenn ich dem General in die Augen schaue, sehe ich nur das nächtliche Meer. Erbarmungslos und aufgewühlt.
»Rebellen, die wir in den Grenzstaaten gefangen haben«, antwortet Caitoman. Ich habe Mühe, seinem schnellen Karensisch zu folgen. »Zwei von ihnen waren die Anführer bei den jüngsten Unruhen in Tanapeg. Eine von ihnen stammt aus Carreal. Sie stand an der Spitze der Aufständischen, die sich von der Föderation lossagen wollten.«
Rebellen aus den Grenzstaaten, Tanapeg im Westen und Carreal im Süden. Seit Monaten höre ich nun schon von ihnen – seit ich an der Seite des Premiers stehe und ihn beschütze. Ich spüre Konstantins tiefe Genugtuung über den Bericht seines Bruders.
»Ich nehme an, du hast sie gründlich befragt«, sagt er.
Caitoman sieht ihn mit hochgezogener Augenbraue an, zwischen den Brüdern herrscht ein unausgesprochenes Einvernehmen. »Das versteht sich von selbst«, erwidert er.
Meine Hände ballen sich zu Fäusten und lösen sich wieder, während ich mir sage, dass ich meine Gefühle unter Kontrolle halten muss. Ich habe hautnah miterlebt, wie General Caitoman seine Gefangenen verhört. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie viele Werkzeuge und Waffen er einsetzt, wie kreativ er sein kann und wie gut es ihm gelingt, seine Opfer möglichst lange am Leben zu erhalten. Wie sein schmallippiges Lächeln selbst dann nicht weicht, wenn alles vorbei ist.
Ich verdränge die Gedanken an den General und schaue mich stattdessen in der Arena um, halte Ausschau nach einer möglichen Bedrohung für den Premier.
Wenn Konstantin stirbt, stirbt auch meine Mutter. Einzig und allein aus diesem Grund sorge ich mich um das Leben und die Gesundheit des Premiers. Falls er getötet wird, wird sofort eine Nachricht an den geheimen Ort gesendet, an dem meine Mutter festgehalten wird – und ein Scharfschütze erschießt sie. In dem Moment, in dem Konstantins Herz aufhört zu schlagen, schlägt auch das meiner Mutter nicht mehr.
Also halte ich Ausschau nach potenziellen Attentätern und Spionen, die Konstantin schaden könnten, und nach Gefahren, die im Schatten lauern. Ich beobachte alles genau, auch wenn mir dabei schlecht wird.
Du bist wütend auf mich.
Konstantins Stimme in meinem Kopf reißt mich aus meiner Konzentration. Ich habe mich immer noch nicht an diese neue Verbindung zwischen uns gewöhnt. Die Skyhunterin und ihr Meister. In unseren geheimen Gesprächen klingt er ganz anders, als wenn er laut zu mir spricht. Seine Stimme ist weicher, weniger heiser und sehr viel eleganter, vielleicht so, wie er vor seiner Krankheit geklungen hat.
Ich bin immer wütend auf Euch, antworte ich ihm mental. Ich schaue zu ihm hinüber und sehe, wie er mich mit einem Ausdruck von der Seite ansieht, den ich hasse. Seine Augen verraten mir, dass er meine aufgepeitschten Emotionen spüren kann, meine Wut auf ihn, weil er mich dazu zwingt, hier zu stehen und das alles zu überwachen. Also dränge ich meine Gefühle erbarmungslos zurück, so als würde ich meinen Herzmuskel zusammendrücken, um ihn zu verkleinern.
Das ist eines der ersten Dinge, die ich nach meiner Verwandlung zur Skyhunterin gelernt habe: Meine Gedankenverbindung mit dem Premier bezieht einen Großteil ihrer Stärke aus meinen und seinen Gefühlen. Deshalb haben Red und ich die Gefühle des jeweils anderen immer so intensiv wahrgenommen, deshalb schienen sich unsere Emotionen gegenseitig anzufachen. Deshalb war Red immer dann der Stärkste auf dem Schlachtfeld, wenn er von seiner Wut befeuert war. Ich habe herausgefunden, dass das auch umgekehrt gilt: Je kälter ich selbst bin, desto mehr muss Konstantin sich anstrengen, um etwas durch unsere Verbindung zu spüren. Je mehr ich meine Emotionen zurückhalte, desto weniger kann er meine Gedanken lesen.
Und Red …
Je weniger ich mir erlaube zu fühlen, desto mehr entferne ich mich von Red.
Ich kann zwar immer noch das gleichmäßige, schwache Schlagen seines Herzens aus großer Entfernung wahrnehmen, aber das ist auch schon alles. Seit meiner Verwandlung habe ich keine einzige Gefühlsregung mehr von ihm gespürt. Seit ich angefangen habe, mich zurückzuziehen. Es ist fast eine Erleichterung. Je weniger ich fühle, desto weniger kann Red von mir erspüren. Und desto sicherer sind er und alle überlebenden Striker vor dem Monster, zu dem ich geworden bin.
Es scheint Konstantin zu amüsieren, wie sehr ich mich bemühe, ihn auf Abstand zu halten. Aber wenn er eine Reaktion von mir provozieren will, muss er sich schon etwas mehr anstrengen.
Die Hälfte der Gefangenen bedeutet dir nichts, fährt Konstantin fort. Die Leute kommen aus Ländern, in denen du nie warst. Und alle anderen haben dich nie anständig behandelt. Maranische Adlige. Striker, die dich nicht in ihren Reihen haben wollten. Sind sie dir so heilig?
Meine Lippen verziehen sich. Ausgerechnet Ihr sprecht über das, was heilig ist?
Warum denn nicht? Immerhin will ich Mara zu einem besseren Ort machen.
Er weiß genau, was er tut. Ich beiße die Zähne zusammen, kämpfe gegen meinen Zorn an. Mara gehört Euch nicht.
Er verschränkt die Arme vor der Brust und deutet mit einem Nicken auf das Erdloch. Der kunstvolle Kopfschmuck, den er heute auf seinem kahlen Schädel trägt, schwingt mit, die kostbaren Edelsteinketten klirren und klimpern. Die Energiequelle des Ersten Volks soll so mächtig sein, dass sie Wärme und Licht in jedes Haus im ganzen Land bringen kann, erklärt er mir. Da lohnt es sich, ein Gefängnis umzugraben, meinst du nicht auch? Und die Leute, die wir heute hinrichten werden, sind Kriegsverbrecher, Schurken, die Reichtümer gehortet haben, und Eiferer, die sich in den Dienst einer Nation stellen wollen, die es nicht mehr gibt. Es ist gerechtfertigt, sie hinzurichten, meinst du nicht auch? Er wirft mir einen wissenden Blick zu. Und jetzt sag mir, dass ich mich irre, Talin.
Ihr irrt Euch.
Sag mir, dass die Anführer von Mara an meiner Stelle anders handeln würden.
Warum? Es ist ja nicht so, als könnte ich damit etwas bewirken,erwidere ich bissig. Ich höre meine geknurrte Antwort in seinem Kopf widerhallen. Ihr tut, was Ihr wollt. Ihr fragt mich nur, um mich zu verspotten.
Er streicht mit den Fingern über den Saum seines Ärmels. Die Wahrheit klingt wie Spott, wenn man sie nicht hören will.
Ich stütze meine Hände auf die Brüstung vor mir und warte darauf, dass sich mein innerer Aufruhr legt.
Dann lasst mich Euch eine Wahrheit sagen, erwidere ich mit der größtmöglichen Ruhe, die ich aufbringen kann. Ihr habt Angst, als schwacher Herrscher angesehen zu werden.
Im selben Moment weiß ich, dass ich ins Schwarze getroffen habe. Er wendet seinen Blick von mir ab, aber durch unsere Verbindung spüre ich, wie seine Belustigung in Verärgerung umschlägt. Wir beide können dieses Spiel spielen und manchmal, nur manchmal, bin ich diejenige, die gewinnt.
Der Anflug von Ärger verflüchtigt sich und der Premier findet zu seiner kühlen Haltung zurück. Vorsicht, Talin, sagt er, bevor er erneut den Blick abwendet. Vergiss nicht, wer dich in Reichtum hüllt.
Ich blicke an mir hinab. Früher trug ich die schlichte und zugleich elegante saphirfarbene Uniform der Striker, jetzt kleide ich mich in üppigem ausländischem Luxus. Von Kopf bis Fuß bin ich eingehüllt in schwarze Wolle und Leder, darunter feines Leinen, der Saum mit Silberpelz besetzt, und über meinen kostbar verzierten Ärmeln trage ich zwei Armschützer aus dem stärksten und schönsten schwarzen Stahl, den ich je gesehen habe, geschmückt mit dem Siegel der Föderation.
Konstantin will, dass seine Kriegsmaschine gut aussieht.
Haben sie Red auch so auffallend gekleidet? Wurde er vor seiner Flucht ebenfalls wie eine Marionette vorgeführt? Meine Gedanken schweifen, wie so oft, in die Vergangenheit, als er noch an meiner Seite war. Ich sehe seine Gestalt, stark und scheinbar unbesiegbar, sehe, wie er schützend neben mir kauert. Sein Gesicht, umrahmt vom späten Nachmittagslicht in den Badehallen von Newage.
Ob Red irgendwo da draußen wohl auch an mich denkt?
Ich unterdrücke den Gedanken rigoros. Wenn ich mich zu sehr gehen lasse, merkt Konstantin, welche Wendung meine Gefühle genommen haben. Er wird wissen, dass ich wieder an Red denke. Ich habe das schon früh auf die harte Tour gelernt, als ich mich noch im Nationalen Forschungslabor erholte und eine ganze Nacht lang weinte, weil ich mich nach Red sehnte. Am nächsten Morgen tauchte Konstantin bei mir auf und fragte mich, ob ich den Aufenthaltsort von Red erspürt hätte. Er schickte Caitoman in den Wald, um die Stelle zu erkunden, wo ich Red vermutete. Zum Glück hatte ich mich geirrt – meine Verwandlung hatte mich in einen Zustand versetzt, in dem ich nur noch wirr denken konnte. Aber dieser Vorfall war mir Warnung genug.
Ich bin froh, dass der Premier mich noch nicht zwingen kann, ihm zu gehorchen. Die Chefingenieurin, die für meine Verwandlung verantwortlich ist, hat mir erklärt, dass man den Verstand eines Menschen nicht auslöschen kann, ohne ihn dabei zu zerstören. Bei einem wachen, intelligenten Menschen ist es schwer, jene Art von Gehorsam hervorzurufen, wie ihn die Geister der Föderation schon nach kurzer Zeit entgegenbringen. Die Ingenieurin hat noch keinen Weg gefunden, aber ihre Teams arbeiten daran.
Der Premier weiß jedoch, dass es mehr als einen Weg gibt, jemanden zu kontrollieren. Das hat er mir an dem Tag gezeigt, als er meine Mutter zu mir brachte, gefesselt und geknebelt und mit einem Messer an der Kehle. Ich befolge seine Befehle, nicht weil ich muss, sondern weil ich Angst habe, was passiert, wenn ich es nicht tue.
Meine Mutter wird Tag und Nacht bewacht. Konstantin lässt sie alle zwei Wochen an einen anderen Ort verlegen, je nachdem, wie ich mich verhalte. Wenn ich gehorsam bin und tue, was er sagt, darf sie die Zeit in einer luxuriösen Umgebung verbringen. Wenn ich ihn verägere, wird sie an einen viel schlimmeren Ort verbracht.
Ich darf sie alle zwei Wochen besuchen. Er tut so, als würde er mir das aus Wohlwollen gestatten, aber wir wissen beide, dass es nur dazu dient, mir vor Augen zu führen, wie sich mein Handeln unmittelbar auf das Leben meiner Mutter auswirkt. Damit ich sehe, wie gut oder schlecht sie lebt, und dass ich dafür verantwortlich bin.
Konstantin hat überall Augen, die mich beobachten und darauf achten, dass ich tue, was man mir sagt. Also tue ich es. Ich zwinge mich, seine Befehle zu befolgen, meiner Mutter zuliebe.
Aber mein Verstand hat nicht ausgesetzt. Noch nicht.
Die Chefingenieurin hat mich gewarnt, dass dies nicht so bleiben wird. Mit jedem Tag, der vergeht, wird die Bindung zwischen mir und dem Premier stärker. Und zugleich habe ich meine Gefühle mit jedem Tag weniger gut im Griff.
Wenn wir morgen in die Föderationshauptstadt Cardinia zurückkehren, wird die Ingenieurin im Nationalen Forschungslabor weiter an meiner Verwandlung arbeiten. Langsam, aber stetig wird meine Denkfähigkeit abnehmen, bis ich nicht mehr in der Lage bin, meine Gefühle von denen des Premiers zu unterscheiden.
In einem Jahr werde ich keine Kontrolle mehr über meinen eigenen Verstand haben.
Karensische Soldaten haben sich am Rand der Arena in Zweierreihen postiert. An dem einen Ende gleitet ein Tor auf und gibt den Blick auf eine Gruppe von Gefangenen frei, die nach vorn ins Licht gestoßen werden.
Ich erkenne, wer sie sind, anhand der Fetzen, die von ihrer Kleidung übrig geblieben sind. Die gefangenen Rebellenführer stechen hervor, sie haben die Köpfe immer noch hocherhoben. Insgeheim empfinde ich bei diesem Anblick ein Gefühl der Genugtuung. Einer von ihnen humpelt stark, ein anderer ist immer noch mit getrocknetem Blut bedeckt. Aber selbst Caitoman konnte ihren Willen nicht brechen.
Einige der anderen Gefangenen tragen noch Überreste ihrer maranischen Seidenmäntel und feinen Leinenhemden. Konstantin hat nicht gelogen, als er sagte, es seien Adlige unter ihnen. Sechs Monate lang haben sie im Gefängnis dahinvegetiert, haben geschuftet, um das Land nahe der Stadt zu roden und Vorräte von karensischen Zugwaggons in die Stadt zu schleppen. Sie wurden von karensischen Verhörbeamten befragt und von karensischen Richtern verurteilt und haben gewartet, gewartet, gewartet, bis endlich der Tag ihrer Hinrichtung kam.
Ich bin etwas überrascht, dass Konstantin sich die Mühe macht, zu einer Massenhinrichtung zu kommen. Als Premier der gesamten Föderation hat er doch sicher Besseres zu tun, als in Newage auszuharren und Todesurteile gegen Maraner zu verhängen. Und doch sind wir hier.
Vielleicht macht es ihm einfach Spaß zuzusehen, wie ein ganzes Land in die Knie geht. Vielleicht will er mit eigenen Augen sehen, wie die Rebellenführer hingerichtet werden.
General Caitoman lehnt an der Brüstung und lächelt, ohne zu lächeln. Ich starre ihn an, frage mich, was er wohl denkt, und bin zugleich dankbar, dass ich nie eine mentale Verbindung mit diesem Mann eingehen muss.
Als die Gefangenen näher kommen, erkenne ich einen von ihnen. Seine maranische Kleidung hängt in Fetzen an ihm, die Saphir- und Rottöne haben braune Flecken. Seine Schultern, einst stolz gestrafft, sind in der Niederlage gekrümmt. Gefängnis und harte Arbeit haben ihn in nur wenigen Monaten um Jahrzehnte altern lassen. Aber seine Gesichtszüge sind eine grausamere Version von Jeran.
Es ist sein Vater.
Bei seinem Anblick wird mir schwindlig und ich muss meine Gefühle fest im Griff halten, damit sie sich nicht verselbstständigen. Vor dem Untergang Maras habe ich seine Grausamkeit unzählige Male miterlebt, wenn er Jeran mit seinen Fäusten schlug oder seinen Sohn an den Haaren wegschleifte. Ich habe gesehen, wie Jerans Arme, sein Gesicht, sein Hals von den Misshandlungen dieses Mannes schwarz und violett verfärbt waren, ich habe gehört, wie Jeran immer wieder versucht hat, die Handlungsweise seines Vaters zu verteidigen, wie er es abgelehnt hat, sich gegen ihn zu wehren. Ich habe davon geträumt, ihm mein eigenes Schwert zwischen die Rippen zu stoßen, und Adena konnte mich nur mit Mühe daran hindern, mich auf diesen Mann zu stürzen.
Jetzt ist er hier und wartet auf seine Hinrichtung.
Er blickt zur Tribüne hoch und fixiert Konstantin. Das unerbittliche Glitzern in seinen Augen ist dem Eingeständnis seiner Niederlage gewichen und ich sehe die Angst, die jetzt beim Anblick des Premiers in ihm aufflackert. Dann huscht sein Blick zu mir und verharrt auf meinem Gesicht in einem Moment des Wiedererkennens.
Er öffnet den Mund, als wolle er mich rufen, aber es kommt kein Ton heraus. Kalt erwidere ich seinen Blick, aber irgendwo tief in mir brodelt ein grimmiges Vergnügen. Es ist dasselbe Gefühl, das ich habe, wenn karensische Soldaten bei meinem Anblick zusammenzucken. Talin, die baseanische Ratte, die nie richtig zu den Strikern gehörte. Jetzt stehe ich neben dem Premier der Föderation, gekleidet in das Schwarz einer Todbringerin, bereit, diesen schrecklichen Mann in der Arena sterben zu sehen.
Aber meine Freude wird augenblicklich von Abscheu verdrängt. Ich habe es zugelassen, einen Moment lang Konstantins Verbündete zu werden. Und damit bin ich selbst zu dem Monster geworden, das er aus mir gemacht hat. Ich bin eine Karensa geworden, die an seiner Seite steht.
Konstantin spürt meinen Stimmungsumschwung. Ein Freund von dir?, fragt er gespielt beiläufig.
Meine Hände ballen sich zu Fäusten und ich gebe ihm keine Antwort.
Unter den Gefangenen aus Mara befinden sich auch zwei Striker – ihre saphirblauen Mäntel sind selbst nach so langer Zeit im Gefängnis unverkennbar. Ich weiß, wer die beiden sind; sie waren zwar an einer anderen Stelle der Front im Einsatz, aber ich kann mich noch daran erinnern, wie ich früher mit ihnen in der Arena trainiert habe und am selben Tag wie sie befördert und für die Patrouille ausgewählt wurde. Das Mädchen heißt Sana, der Junge Eres. Sie sind immer sehr nett zu mir gewesen. Oder zumindest nicht schlimmer als die anderen.
Ich konzentriere mich auf den Kloß in meinem Hals. Einige dieser Menschen waren grausam, andere waren nett zu mir. Aber das spielt keine Rolle. Sie werden trotzdem alle sterben.
»Noch irgendwelche letzten Worte?«, ruft General Caitoman zu ihnen hinunter.
Eine lange Stille tritt ein. Die Rebellenführer erwidern trotzig seinen Blick, aber einer der Striker – Eres – bricht zusammen und sinkt schluchzend auf die Knie. Ich schaue ihn etwas genauer an und stelle fest, dass sämtliche Finger gebrochen und die Gelenke unnatürlich verdreht sind. Eres wiegt seine vom Wundbrand schwarz verfärbten Hände behutsam hin und her.
Ich erinnere mich vage daran, wie elegant seine Hände gewesen waren. Ich weiß noch, wie geschickt er während unserer Ausbildung mit seinen Waffen hantierte. Caitoman ist gut darin herauszufinden, wie man einem Menschen das Wichtigste wegnehmen kann.
Eres bittet um Gnade. Aber er sagt es auf Maranisch. Caitoman zuckt mit den Schultern und legt spöttisch die Hand an sein Ohr, um anzudeuten, dass er ihn nicht versteht.
Mein Herz zerbricht bei so viel Grausamkeit. Ich schaue weg, um nicht zu sehen, wie Eres sich mit flehendem Blick an mich wendet.
Auf welche Weise wird es geschehen?, frage ich Konstantin. Wann trifft Euer Henker ein?
Henker? Der Premier schüttelt den Kopf. Wer sagt, dass sie heute sterben?
Bei diesen Worten drehe ich mich zu ihm um. Ich schaue ihn an und in seinen Augen lese ich die Antwort.
Natürlich werden sie nicht sterben. Sie werden zu Geistern gemacht.
Gerade als mir dieser Gedanke durch den Kopf schießt, öffnen sich die Tore am anderen Ende der Arena.
Ich höre das vertraute Zahnknirschen, noch bevor sie hintereinander aus der Dunkelheit auftauchen und im gleißenden Nachmittagslicht blinzeln. Geister, etwa ein Dutzend.
Obwohl die Bestien keinerlei Anstalten machen anzugreifen, treten die in der Arena postierten karensischen Soldaten bei ihrem Anblick nervös von einem Bein aufs andere. Der größte Geist reckt seinen Kopf und schnüffelt, augenscheinlich verwirrt von seiner neu gewonnenen Freiheit. Seine langen, spitz zulaufenden Ohren zucken, versuchen, Geräusche einzufangen, an denen er sich orientieren kann.
Jerans Vater ist ein bösartiger Gewalttäter. Aber allein die Vorstellung, dass er sich in einen Geist verwandelt, den die Föderation dann zur Jagd auf andere einsetzt, macht mich krank.
Nein. Der Gedanke schießt mir durch den Kopf.
Nein?, wiederholt Konstantin beinahe amüsiert. Du stellst das infrage?
Unten hat die Strikerin Sana instinktiv eine Kampfstellung eingenommen und scharrt mit den Füßen. Eres bleibt, wo er ist, auf dem Boden kniend. Die Adligen neben ihnen ducken sich vor Angst, als die Monster auf der Suche nach Menschen heranschlurfen, und gehen hinter den Strikern in Deckung, als ob sie das retten könnte.
Nur die Rebellenführer bewegen sich nicht. Ich ertappe mich dabei, wie ich sie anstarre und aus ihren stoischen Mienen etwas Kraft schöpfe.
General Caitoman fest im Blick, ergreift eine von ihnen das Wort. Es ist die Rebellenführerin von Tanapeg.
»Ich habe eine letzte Botschaft für Euch«, ruft sie mit klarer und fester Stimme. »Und ich werde sie in Eurer Sprache verkünden, General Caitoman, damit Ihr sie versteht.« Ein Lächeln huscht über ihr Gesicht. »Ich bin nicht die Rebellenführerin, für die Ihr mich haltet.«
Auch Caitoman lächelt ungerührt, aber ich sehe, wie sich sein Kiefer leicht anspannt.
»Ich bin nur eine von vielen. Vergesst das nicht.« Ihr Blick richtet sich auf Konstantin. »Eure Föderation wird untergehen. Es ist nur eine Frage der Zeit.«
Konstantin schweigt, aber ich spüre seinen aufwallenden Zorn.
Plötzlich stößt Jerans Vater einen erstickten Schrei aus, weil ein Geist sich ihm auf allen vieren nähert. Die Kreatur dreht ruckartig den Kopf in seine Richtung. Die milchigen Augen weiten sich erwartungsvoll und der Geist reißt seine Kiefer auf, weil er Beute wittert.
Die anderen Adeligen verlieren die Nerven. Mit klirrenden Ketten fliehen sie zum Rand der Arena – und sehen sich den erhobenen Gewehren der karensischen Soldaten gegenüber. Sie sitzen in der Falle.
Der erste Geist schreit auf und mit ihm erheben auch die anderen ihre Köpfe. Meine Finger treten weiß hervor, als ich die Hände zu Fäusten balle. Verzweifelt versuche ich, meinen Herzschlag zu verlangsamen, bis allein schon die Anstrengung, meine Wut zurückzuhalten, mich fast in die Knie zwingt.
Es wird schnell gehen.
Der erste Geist stürzt sich auf die Gefangenen. Seine Geschwindigkeit überrascht angesichts seiner Größe – in wenigen Sekunden hat er einen der beiden Striker erreicht.
Sana weicht zur Seite aus. Ihre Hände fassen wie von selbst nach den Waffen, die normalerweise an dem Gurt an ihren Hüften stecken, aber sie greift nur Luft. Sie duckt sich, als der Geist nach ihr schnappt, rollt sich unter ihm hindurch und versucht, auf seinen Rücken zu springen.
Aber sie hat keine Waffen außer ihren Händen und die taugen nicht, um einem Geist den Hals umzudrehen, zumal die Gefangenschaft ihre Reflexe geschwächt hat. Bevor sie es auf den Rücken des Monsters schafft, wirbelt der Geist herum und schnappt erneut nach ihr. Diesmal bohren sich seine Zähne in ihr Bein.
Selbst jetzt, als er fest zubeißt, gibt Sana keinen Laut von sich. Auch was das angeht, war unser Training intensiv. Sie öffnet nur den Mund zu einer stummen Grimasse, als der Geist sie von sich wegschleudert.
Bei ihrem Anblick zucke ich zusammen, die scheinbar so ruhige Oberfläche meiner Gefühle kräuselt sich. Ich sehe wieder Corian in seinen letzten Momenten vor mir, sehe, wie seine Lippen sich blau färben und er mir das Zeichen gibt, sein Leben zu beenden.
Hört auf damit, fauche ich Konstantin in unserer Gedankensprache an.
Warum sollte ich?, erwidert der Premier kalt.
Das waren Striker. Macht sie Euch als nützliche Soldaten untertan.
Meine Geister sind meine Soldaten.
Als ich Konstantin anschaue, sehe ich seinen unerbittlichen Blick. Er beobachtet die Szene mit einer grimmigen Entschlossenheit, aber in seinem Herzen brodelt es und ich spüre fast so etwas wie Rachsucht darin.
Die unbändige Wut, die mich durchströmt, lässt sich kaum unterdrücken. In der Arena versucht einer der Adligen hilflos, seine Zähne in den Hals eines Geists zu schlagen, als dieser ihn packt und von den Füßen reißt. Doch da stürzt sich bereits ein zweiter Geist auf ihn und verstellt mir den Blick auf den Gefangenen. Ich sehe nur noch, wie er seine großen Kiefer in dessen Schulter bohrt. Eres rührt sich nicht vom Fleck, bis ihm ein Geist den Hals aufreißt. Die Anführerin der Rebellen, die zuvor ihre Unbeugsamkeit so deutlich zum Ausdruck gebracht hat, blickt unerschrocken in die Augen des Angreifers, bis dieser auch sie packt und in die Luft schleudert.
Meine Beherrschung ist endgültig dahin. Ich kann mich nicht länger zurückhalten. Ich spüre, wie die Wut aus meinem Herzen in meinen Brustkorb, meine Glieder, meinen Verstand strömt. Die Flügel auf meinem Rücken klicken, Metall schrammt über Metall, als sie sich entfalten. Ich muss mich nur in die Luft erheben, mich auf sie stürzen. Ich könnte sie in Fetzen reißen und niemand – nicht einmal der Premier – könnte mich aufhalten.
»Talin«, sagt Konstantin, diesmal laut und mit dunkler Stimme.
Aber ich achte nicht auf ihn. Ich presse die Zähne aufeinander, spüre die Kraft in meinen Adern. Unten in der Arena hat bei Sana bereits die Verwandlung eingesetzt, sie liegt unkontrolliert zitternd auf dem Boden, verrenkt sich vor Schmerzen und ihr Schweigen findet schließlich in einem qualvollen, unmenschlichen Stöhnen sein Ende.
Meine Flügel bewegen sich nach unten, nur einmal, dann hebe ich ab und schwinge mich in die Luft. Obwohl ich es nicht sehen kann, weiß ich, dass meine Augen angefangen haben zu glühen, so wie bei Red, damals auf dem Schlachtfeld, als gleißende Wut ihn überkam.
»Talin«, sagt Konstantin erneut und seine Stimme schneidet wie eine Klinge durch mich hindurch. Als ich zu ihm hinunterblicke, sieht er mich mit grauenerregender Geduld an.
Er weiß, dass seine Worte mir unter die Haut gegangen sind. Er hat mich gezwungen, meinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Das Band zwischen uns vibriert im Strom der Gefühle mit und ich spüre seinen Triumph über mich.
Denk an deine Mutter, mahnt er mich.
Denk an deine Mutter. Denk an deine Mutter.
Mehr ist nicht nötig, um mich in die Knie zu zwingen. Ich denke an meine Mutter, daran, wo sie sein könnte. Ich sehe ihre flinken Hände, wie sie eine Wunde an meinem Bein zusammenflickt, die ich mir beim Klettern auf einen Baum zugezogen habe. Ich sehe ihre Gestalt im Schein der Laterne, wie sie ihren eigenen Faden aus Süßgrasblättern herstellt und bis tief in die Nacht hinein näht, um meine Striker-Uniform zu reparieren. Die Erinnerungen schneiden durch meine Wut wie eine Säge durch einen Baumstamm.
Meine Füße berühren wieder den Boden und meine Flügel gleiten auf meinem Rücken in ihre Ausgangsposition zurück. Aber mein Zorn schießt weiter durch meine Adern, lässt Angst und Schrecken hochschwappen. All diese Wut, und keine Möglichkeit, sie loszuwerden.
Konstantin wirft mir einen zufriedenen Blick von der Seite zu. Braves Mädchen, lobt er mich.
Ich hasse ihn. Ich hasse ihn mit aller Kraft, auch wenn ich diesen Hass in eine Eisschicht umwandle, die mein Herz umschließt.
Inzwischen haben die Geister Jerans Vater erreicht. Er schluchzt jetzt laut, seine Schreie hallen durch die Arena. Einige Soldaten fangen an zu kichern.
»Es tut mir leid«, heult er und verliert im Angesicht der Geister völlig die Nerven. Er sieht nicht aus wie ein ehemaliger maranischer Senator, sondern wie ein kraftloser alter Mann. »Vergib mir. Vergib mir.«
Ich möchte bei seinem Anblick Genugtuung empfinden – als sich die Reißzähne eines Geists in seine Brust bohren, als er sich in Schmerzensschreie auflöst. Ich möchte das Ende von jemandem genießen, der einen meiner engsten Freunde gequält hat. Aber bei dem hier kann ich keine Freude empfinden.
Vergib mir. Vergib mir. Galt dieser verzweifelte Schrei dem Sohn, den er so misshandelt hat? Jeran? Ich werde es nie erfahren. Stattdessen schaue ich zu und bin zugleich froh, dass Jeran, falls er überhaupt noch lebt, nicht hier ist und das mitansehen muss. Er hat es nicht verdient, von einem solchen Bild auf ewig verfolgt zu werden.
Das muss der Grund sein, warum Konstantin sich überhaupt die Mühe gemacht hat, zu dieser Hinrichtung zu kommen, statt irgendwo anders in seinem Herrschaftsbereich seine unendlich vielen Aufgaben zu erfüllen. Er will, dass ich das mitansehe. Er will derjenige sein, der mit meinen Gefühlen spielt und zuschaut, wie ich zusammenbreche. Er hat mich hergeführt, um mitzuerleben, wie ich mich von Mara abwende.
Jede Faser in mir schreit geradezu danach, alles in Stücke zu reißen. Stattdessen sehe ich tatenlos zu. Ich denke an meine Mutter und erlaube mir nicht, zu fühlen.
Den Horror, Geistern ins Auge zu blicken, werde ich nie wieder auf die gleiche Weise empfinden wie früher. Ich muss nicht mehr fürchten, von ihnen in den Wäldern entlang der einstigen Kriegsfront gejagt zu werden. Das Knirschen ihrer Zähne und ihr schrilles Kreischen jagen mir keine Angst mehr ein. Jetzt quält mich eine andere Furcht: Zeugin zu sein, wie ihre Bösartigkeit sich gegen das Land richtet, für dessen Verteidigung ich so lange gekämpft habe.
Früher stand ich auf der Gegenseite und bot ihnen unerschrocken die Stirn. Jetzt sind sie meine Verbündeten und ich werde dabei zusehen, wie sie alles zerstören.
Als die Szene vor unseren Augen schließlich zu ihrem schrecklichen Ende kommt, dreht sich General Caitoman um und spricht leise zu Konstantin. Diesmal schwingt in seiner Stimme nicht mehr dieses kalte Vergnügen mit. Er ist verärgert.
»Ich werde die Behauptung dieser Frau überprüfen lassen«, murmelt er. Er meint offensichtlich die Rebellin, die es gewagt hatte, das Wort an ihn zu richten. »Es wird ihnen nicht gelingen, eine Armee aufzustellen.«
Armee. Ich spüre, wie Konstantins Emotionen überschießen, dann beherrscht er sich wieder, wenngleich eine gewisse Anspannung bleibt.
Und plötzlich erkenne ich den wahren Grund, warum Konstantin persönlich zu der Bestrafungsaktion erschienen ist. Nicht weil er sich gelangweilt hat. Oder weil er mich disziplinieren will – obwohl ich weiß, dass er daran Gefallen findet.
Nein, er will mit eigenen Augen sehen, wie das Leben dieser Rebellen beendet wird. Weil er sie als echte Bedrohung sieht. Weil er Angst hat. Und das bedeutet, dass er weiß, dass an den Worten der Frau etwas Wahres dran sein muss.
Ich bin nur eine von vielen, hat sie gesagt. Eure Föderation wird untergehen. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Da wird mir klar, dass die Gerüchte über Unruhen innerhalb der Föderation vielleicht, nur vielleicht, ernster sind als gedacht. Dass die Risse tief genug sein könnten, um die Föderation zu zerstören.
2
RED
ES GIBT EIN WORT IM MARANISCHEN, das mir gefällt. Rückerstattung.
Adena hat es mir gestern erklärt, als wir die Rinde von einem Baum abzogen, um behelfsmäßige Waffengurte herzustellen.
Rückerstattung, hat Adena gesagt. Es bedeutet die Rückgabe von etwas, das man verloren hat oder das einem gestohlen wurde. Eine Wiedergutmachung von Unrecht.
In Karensa gibt es kein entsprechendes Wort. Die Föderation ist der Ansicht, dass diejenigen, die es schaffen, etwas für sich zu beanspruchen, zugleich auch die vom Schicksal bestimmten Besitzer sind. Wenn man zu schwach ist, um das, was man liebt, zu behalten, so die Überlegung, hat man es vielleicht nicht verdient. Vielleicht gehört es in die Hände von jemand anderem.
Gut zu wissen, dass nicht alle dieser Meinung sind. Zugleich frage ich mich unwillkürlich: Was sonst weiß ich nicht?
Ich kauere zwischen Büschen am Rande eines Hügels und lasse den Blick über die doppelten Stahlmauern von Newage schweifen. Hier ist der sicherste Aussichtspunkt, ein hinter Gestrüpp und Bäumen verborgener Ort, von dem aus man die Bahnstation gut überblicken kann, die karensische Arbeiter errichtet haben.
Hinter uns ist das überfüllte Camp. Dabei sind es nicht viele, die die Belagerung überlebt haben: zwei Dutzend blieben unverletzt, dazu ein Dutzend Verwundete. Jeran, Aramin, Tomm und Pira sind unter den Strikern, die ich kenne. Für Adena sind wir – wie nannte sie uns? – ein heruntergekommener Haufen. Nicht zu Unrecht, schätze ich, denn wir sind heruntergekommen. Trotzdem hält jeder von uns Ordnung. Die Wäsche wird in einer ordentlichen Reihe zum Trocknen aufgehängt. Die Schuhe werden aufgereiht und, so gut es unter diesen Umständen geht, poliert. Man muss doch die Moral aufrechterhalten, oder? Einen gewissen Sinn für Ordnung beibehalten.
In anderen Teilen des Hügellands am Rande von Newage muss es weitere Überlebende geben, aber die Föderation hat ihre Truppen in den Wäldern postiert, sodass die einzelnen Grüppchen voneinander abgeschnitten sind. Dennoch empfindet der Premier uns wohl als bedrohlich genug, dass er weiter Jagd auf uns macht.
Genauer gesagt, auf mich. Seinen ersten Skyhunter. Seinen schlimmsten Fehler. Vielleicht sollte ich stolz auf mich sein.
Ich versuche, so ruhig wie möglich zu sitzen. Hinter mir ist Adena damit beschäftigt, behutsam meine verletzten Flügel zu verarzten. Einer wurde beim letzten Kampf verstümmelt, was zu einem tiefen Riss im Metall führte, sodass Drähte und Sehnen durchtrennt wurden. Ehrlich gesagt hätte ich nicht gedacht, dass diese Flügel überhaupt wehtun könnten. Aber das tun sie, die Wunde bereitet mir einen tiefen Schmerz, der bis ins Mark geht. Adena hat versucht, sie, so gut es geht, zu stabilisieren, aber ich kann sie nicht öffnen, ohne das Gefühl zu haben, dass ein gottverdammtes Messer durch meinen Rücken fährt.
»Ist der Zug abfahrbereit?«, fragt sie mich, während sie mich weiterbehandelt.
»Morgen, habe ich gehört.« Ich zeige auf die Gleise, die sich von den Stadtmauern Richtung Hügelkette schlängeln, die Mara vom Rest der Föderation trennt. »Sieht so aus, als hätten sie alles, was sie brauchen, auf den Wagen.«
»Wagen?«
»Waggons? Sie sind beladen«, wiederhole ich und versuche vergeblich, es auf Maranisch zu erklären. Hilfe suchend blicke ich mich im Lager nach Jeran um. Ich habe immer Schwierigkeiten, mich klar auszudrücken, wenn er nicht an meiner Seite ist und übersetzt.
Adena sieht mich von der Seite an. »Deine Aussprache hat sich verbessert.«
Ich zucke mit den Schultern. »Hauptsache, du verstehst, was ich sage.«
»Du klingst immer noch förmlicher als nötig. Du musst nicht jede einzelne Silbe betonen.«
»Wie wäre es denn richtig?«
Sie wiederholt denselben Satz und ich versuche, mich auf die Unterschiede zu konzentrieren.
»Siehst du? Ich betone nicht jedes einzelne Wort so wie du.«
Ich wiederhole den Satz, wenn auch etwas holprig. In den Monaten seit der entscheidenden Belagerung durch die Föderation habe ich genug Maranisch gelernt, um mich mit den anderen einigermaßen vernünftig zu verständigen. Aber Situationen wie diese verwirren mich immer noch.
Adena verdreht etwas auf meinem Rücken und ein heftiger Schmerz durchzuckt mich. »Bis morgen ist nicht mehr viel Zeit«, fahre ich fort. »Aber wir haben keine andere Wahl, oder?«
Sie seufzt. »Nein, haben wir nicht. Der Zug wird mehrere Dutzend maranische Kriegsgefangene in die Hauptstadt transportieren. Wenn wir die Soldaten befreien und die Gleise zerstören wollen, muss das bis morgen früh erledigt sein.«
Ich bin versucht zu sagen, dass es besser ist, die maranischen Soldaten ihrem Schicksal zu überlassen. Selbst wenn es uns gelingt, sie zu befreien, wohin sollen sie denn gehen? Wir würden das Unvermeidliche nur hinauszögern. General Caitoman schickt Tag für Tag Soldaten und Geister in die Wälder. Sie werden die Gefangenen irgendwann aufspüren, wenn diese sich weiter in der Nähe der Stadt verstecken. Und was dann?
Aber ich schweige. Jeder Einwand ist sinnlos. Wir sind die Einzigen, die gegen die Föderation kämpfen, die Einzigen, die sie aufhalten können – und wenn wir nicht handeln, tut es niemand. Also nicke ich. »Dann lass uns nicht länger warten«, murmle ich zustimmend.
»Verdammt, ich wünschte, Talin wäre jetzt bei uns«, seufzt Adena. »Sie kann sich besser anschleichen als wir alle.«
Meine Gedanken wenden sich sofort Talin zu, wie immer.
Nachdem wir getrennt worden waren, wartete ich noch sehr lange auf ein Zeichen von ihr, in der Hoffnung, dass sie über unsere Verbindung Kontakt mit mir aufnehmen würde. Hin und wieder spürte ich ihren Schmerz, ihren Kummer, ihre Qualen. Die ersten Nächte nach unserer Trennung verbrachte ich oft schlaflos, würgend, fiebrig. Ich fragte mich, was sie ihr antun würden. Die anderen im Camp konnten mich nur mit Mühe und Not davon abhalten loszustürmen, um nach ihr zu suchen.
Doch in den letzten Monaten habe ich kaum noch etwas von Talin gespürt. Wann immer ich meine Gedanken nach ihr aussende, spüre ich nur ihren Herzschlag, der im Rhythmus mit meinem pocht. Trotzdem habe ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Das darf man doch nicht, oder?
Was würde ich zu ihr sagen, wenn ich sie erreichen könnte?
Pass auf dich auf. Schütze dich.
Es tut mir leid.
Ich liebe dich.
Ich warte und warte. Aber da ist nichts.
Die verschiedenen Möglichkeiten, wie Konstantins Leute sie gequält haben könnten, suchen mich in jedem Albtraum heim. Nacht für Nacht wache ich schweißgebadet auf und flüstere ihren Namen. In meinem Kopf ist das Bild von ihr auf dem Schlachtfeld eingebrannt, als ich sie nicht retten konnte. Vielleicht bilde ich mir nur ein, ihren Herzschlag zu hören. Vielleicht ist sie bereits tot.
Und wenn sie es ist, ist es meine Schuld.
Ich spüre, wie sich eine vertraute Panik in mir ausbreitet. Es sind die Erinnerungen an meine Schwester und meinen Vater und daran, wie die beiden mich, zu Geistern mutiert, anknurrten. Wenn wir zu den Stadtmauern von Newage gehen, werde ich dann vielleicht einem Geist mit Talins Gesicht gegenüberstehen?
Diese Fragen schwirren mir noch im Kopf herum, als erneut ein scharfer Schmerz meinen Rücken durchzuckt. Instinktiv wirble ich herum und versetze Adena einen heftigen Stoß, dass sie ihr Gleichgewicht verliert und zurücktaumelt.
»Aua!«, beschwere ich mich knurrend.
Adena rappelt sich empört auf. »Sag mir vorher Bescheid, wenn du mir einen Schlag verpassen willst!«
»Sag mir Bescheid, wenn du mich mit einem Messer stechen willst.«
»Ich habe dich nicht mit einem Messer gestochen!«, blafft sie und breitet wie zum Beweis die Arme aus.
»Es hat sich aber so angefühlt.«
»Ich habe versucht, eine Federklinge gerade zu biegen, und du kreischt los, als hättest du gerade eine Eidechse aus meinem Mund krabbeln sehen.«
Ich blinzle verwirrt – was für ein seltsamer Vergleich. »Kann das wirklich passieren?«
»Kennst du die Redewendung nicht?« Sie steht auf und wischt sich die Hände ab. »Egal. Versuch mal, die Flügel zu bewegen. Du wirst zwar immer noch nicht gut fliegen können, aber ich denke, du kannst damit gleiten.«
Mit ausgebreiteten Flügeln richte ich mich auf. Beim Anblick meiner Schwingen weicht Adena unwillkürlich zurück, sogar jetzt ist sie immer noch auf der Hut vor mir. Ich selbst sehe mich zwar als Freund dieser Menschen, aber das bedeutet nicht, dass sie das auch von mir denken. Für die anderen in diesem Camp bin ich immer noch eine Kriegsmaschine der Föderation, jemand, der Karensa abtrünnig geworden ist und sich nun vorübergehend mit ihnen verbündet hat. Niemand verzeiht einem Feind so leicht. Irgendwann, so fürchten sie, wird der Tag kommen, an dem ich mich wieder gegen sie wende.
Ich trete einen Schritt zurück, versuche vorsichtig, meine Flügel zu bewegen – und zucke zusammen, allerdings angenehm überrascht. Was auch immer Adena gemacht hat, um den Schmerz zu betäuben, ich kann jetzt die Flügel zumindest so weit zusammenfalten, dass die schmalen Klingen sich auf beiden Seiten meines Rückens übereinanderlegen, auch wenn sie nicht vollständig in die dafür vorgesehenen Schlitze passen. Ich presse die Zähne zusammen und entfalte die Flügel wieder. Der Schmerz durchzuckt mich wie ein Hitzestoß. Meine Schwingen breiten sich aus, bis sie fast bis zur Hälfte geöffnet sind, und werfen Schatten auf den Waldboden.
Nicht gerade perfekt, nein, aber viel besser als vorher. Was soll ich sagen? Auch kleine Erfolge zählen.
Ich nicke Adena zu und lächle verhalten. »Pass auf, dass du nicht in die Hände der Föderation gerätst«, sage ich zu ihr. »Du wärst für sie eine wertvolle Wunderärztin.«
»Eine wertvolle was?«
Ich habe anscheinend das falsche maranische Wort benutzt. »Wunderärztin?«, versuche ich es erneut.
Adena lächelt verschmitzt. »Ich glaube, du meinst Wundärztin, die Worte klingen ziemlich ähnlich.« Sie hält einen kleinen Metallzylinder hoch und steckt ihn dann in ihren Gürtel zurück. »Du musst dich schnell genug bewegen können, um morgen für Ablenkung zu sorgen. Schaffst du das?«
»Ich wurde buchstäblich dafür geschaffen, eine Ablenkung zu sein«, antworte ich mit einem schiefen Lächeln.
Adena lacht kurz auf. »Vor deiner Verwandlung warst du bestimmt eine echte Nervensäge.«
Ich lache, aber als ich ihr zurück zum Lagerplatz folge, gehen mir ihre Worte nicht aus dem Kopf. Eine echte Nervensäge. Es fällt mir schwer, mich an irgendetwas zu erinnern, was ich war, bevor die Föderation mich holte, mein Leben in Einzelteile zerfiel und nur noch aus Jahren der Folter bestand. Bevor mein Verstand von der erdrückenden Qual der Isolation und der Experimente zermalmt wurde.
Wer warst du davor? Das frage ich mich ständig. Es ist eine Frage, mit der ich mich in der Glaskammer herumgeschlagen habe, eine Frage, zu deren Beantwortung ich mich immer dann gezwungen habe, wenn ich spürte, dass mein Verstand schwächer wurde. Ich habe mir diese Frage so lange gestellt, bis meine Stimme nicht mehr wie meine eigene klang, sondern wie ein zweites Wesen, das in meinem Kopf herumspukte und zu mir sprach, weil ich niemanden sonst hatte. Diese andere Stimme hallt jetzt in meinem Kopf wider.
Wer warst du davor?
Vielleicht hast du dieses andere Ich für immer verloren. Du hast vage Erinnerungen an einen Jungen, der seine Schwester durch einen Garten jagt und mit seinem Vater Verstecken spielt. Es gibt Gedankenfetzen deines Lebens als junger Soldat, der mit seinen Kameraden lacht und scherzt. Erinnerungen an Freunde, die du einmal hattest. An ein Mädchen, das Lei Rand hieß. Einen Jungen namens Danna Wendrove. Daran, wie ihr alle gewettet habt, wer von euch irgendein tollkühnes Manöver schafft, um als Preis den Wachdienst oder lange Nachtschichten zu tauschen. Danna kam oft zum Abendessen vorbei. Lei sagte dir einmal, dass du zu weichherzig seist.
Du lebst dein Leben in der Gewissheit, dass es immer so bleiben wird – bis plötzlich alles anders ist.
Du musst damals sehr glücklich gewesen sein, bevor die Föderation dir das alles genommen hat.
3
TALIN
NACHDEM DAS SCHLIMMSTE GETAN IST, werden die Gefangenen zurück in ihre Zellen geschleppt, um ihre Verwandlung in Geister zu vollenden. Als sie aus der Arena geführt werden, richtet Konstantin seinen stählernen Blick auf mich und deutet mit einem Nicken zum Himmel.
»Überwache die Gleise, Talin«, befiehlt er, »und erstatte mir in der Nationalhalle Bericht. Ich will sichergehen, dass der Zug freie Fahrt haben wird.«
Natürlich weiß ich, dass dies nicht der einzige Grund ist, warum er mich auf diese Mission schickt. Jedes Mal, wenn ich die Stadtmauern überfliege, folgen mir die Blicke aller und die Angst steht den Menschen ins Gesicht geschrieben. Die Bewohner von Mara sollen die Macht der Föderation über sich sehen, sollen daran erinnert werden, warum es sinnlos ist, sich gegen Karensa zu wehren. Ich bin Konstantins Champion – und sein persönliches Spektakel.
Obwohl ich heute zum Glück nicht diejenige war, die Konstantins Strafe vollziehen musste, bin ich trotzdem erschöpft. Ich habe nur dagestanden und zugesehen, aber wie überstrapazierte Muskeln zittert mein Verstand immer noch von der Anstrengung, mich zurückzuhalten. Weil ich keine andere Wahl habe, als zu gehorchen.
Jedes Mal, wenn Konstantin mir einen Befehl gibt, durchfährt mich die Angst. Wird es diesmal damit enden, dass er unzufrieden mit mir ist? Wird es diesmal damit enden, dass er meine Mutter tötet?
Also trete ich, ohne zu zögern, vor. Meine Ängste bleiben in meinem Herzen verschlossen, hinter den Mauern, die ich errichtet habe, um meine Gefühle unter Kontrolle zu halten. Schwarzer Stahl entfaltet sich auf meinem Rücken, klackend gleiten die Metallfedern aneinander, bis sich meine Flügel zu ihrer vollen Spannweite geöffnet haben. Ich verneige mich vor Konstantin, dann blicke ich hinauf in den Himmel und steige mit einem Flügelschwung in die Höhe.
Während ich davonfliege, fällt es mir schwer, mich nicht völlig dem einzig Guten an meinem Dasein als Skyhunterin hinzugeben, wo es mir doch zumindest ein kleines bisschen Freude bereitet. Die Welt rauscht unter mir hinweg und plötzlich wirkt Konstantin klein, seine schmale Gestalt verschwindet aus meinem Blickfeld, während ich die Mauern von Newage überquere, bis ich hoch über der Stadt bin und die Menschen unter mir zu Punkten schrumpfen. Für einen kurzen Moment vergesse ich das Band, das mich an den Premier fesselt, und gebe mich der Illusion von Freiheit hin.
Aber schon im nächsten Moment werde ich von Schuldgefühlen überwältigt. Als ich während meiner Verwandlung zitternd in der Überwachungsstation auf dem Bauch lag, damit mein Rücken – der in Vorbereitung auf die stählernen Flügel aufgeschnitten worden war – heilen konnte, prophezeite mir die Chefingenieurin, dass ich meine neue Macht genießen würde. Dass ich süchtig werden würde nach der Kraft einer Skyhunterin, dass es nichts Berauschenderes geben würde als die Erkenntnis, dass ich alles tun kann, was ich will.
Ich kann fliegen. Ich kann zerstören. Ich kann töten, wann immer ich will.
Damals versicherte ich ihr, dass ich es mit jeder Faser meines Seins hassen würde. Ich sagte es in Gebärdensprache, während mein Körper schweißgebadet war und mein Blick von den aufsteigenden Tränen getrübt wurde. Sie hatte mich sehr wohl verstanden – in den Monaten meiner Gefangenschaft hatte sie genug von meiner Mara-Gebärdensprache erlernt, um einiges von dem, was ich sagte, zu entziffern.
Warte nur ab, Skyhunterin, hatte sie mit einem wissenden Lächeln erwidert.
Und hier bin ich nun, keine sechs Monate später, und der Nervenkitzel des Fliegens lässt das Blut durch meine Adern pulsieren. Mein Magen revoltiert zwar, doch ich verdränge wieder einmal meine Gefühle.
Von hier oben ist der Kontrast zwischen der Architektur von Newage und den Ruinen, auf denen es erbaut wurde, leicht zu erkennen – uralter schwarzer Stahl neben reinem weißem Stein, ein Zusammenprall zweier Zivilisationen, der mir bisher trotzdem vertraut und beruhigend erschien. Doch jetzt markieren scharlachrote Banner die schwarz-weißen Straßenzüge der Stadt. Rauchschwaden steigen in die Luft, wo Soldaten Häuser ausräumen und deren Einrichtungsgegenstände ins Feuer werfen. Die Föderation verbrennt Überbleibsel von Maras Herrschaft: unsere Flaggen, Banner, Uniformen, Wappen. Schon seit einer Weile flammen hier und da diese Feuer auf, färben den Abendhimmel in ein mattes Aschbraun, während überall feiner Ruß herabregnet.
Geister haben sich zu Rudeln geschart, einige kauern in Käfigen, andere erkunden die Hügel am Rande der Stadt. Gleise winden sich wie Schlangen von Newage weg. Unser Waggon steht am Ende des Zuges bereit. Morgen wird dieser Zug nicht nur uns, sondern Dutzende von Waggons voller Beute aus Mara – Artefakte, Hinterlassenschaften des Ersten Volks, Kriegsgefangene – zurück ins Herz der Föderation bringen.
Das ist ein weiterer Grund, warum Konstantin will, dass ich mir die Stadt aus der Luft ansehe. Der Blick von hier oben führt mir eindringlich Maras Niederlage vor Augen, zeigt mir unmissverständlich die Lage einer eroberten Nation. Es ist der unausgesprochene Beweis seiner Entschlossenheit, mich weiter zu brechen. Seine Art, mir zuzuflüstern: Denk immer daran.
Mara existiert nicht mehr. Es ist nur ein weiteres Territorium der Föderation.
Das bisschen Freude, das ich beim Fliegen empfunden habe, erlischt, zurück bleibt nur die hohle Angst vor meiner neuen Identität.
Allein hier oben, in der Einsamkeit des Windes und des Himmels, wo niemand mich sieht und Konstantin weit entfernt ist, darf ich endlich die Mauer um mein Herz etwas öffnen. Ich kann mich nicht länger zurückhalten. Ich lasse locker und die Flut der Gefühle, die ich zurückgehalten habe, strömt durch mich hindurch, durchdringt jede Faser meines Körpers.
Aber es ist zu viel, diese plötzliche Erleichterung. Meine Augen füllen sich mit Tränen.
Ich weine lautlos, während ich in einem Bogen über die Stadt hinwegfliege und der Wind die Spuren meiner Trauer fortträgt. Hier oben kann ich weinen, ohne dass ein Tropfen auf meinen Wangen landet. Meine Gedanken wandern zu meiner Mutter, dann zu der immer wieder drohenden Frage, wohin Konstantin sie als Nächstes schicken wird.
Letzten Monat habe ich mich offen seinem Befehl verweigert, eine Gruppe von Maranern auszulöschen, die sich in einem Tal außerhalb von Newage versteckt hielt. Am nächsten Tag ließ der Premier meine Mutter in eine der Fabriken entlang des Flusses, der sich durch Cardinia schlängelt, verfrachten. Ich verbrachte unseren letzten Besuchstag damit, hilflos zu schluchzen; zu qualvoll war der Anblick ihrer hohlen Wangen und der blutenden Wunden an ihren angeketteten Händen, mit denen sie schwere Steinquader auf die Ladefläche eines Wagens hievte. Ich sagte ihr, dass es mir leidtäte, schrecklich leid. So etwas darf sich diesen Monat nicht wiederholen.
Wird er sie diesmal belohnen, weil ich heute in der Arena an seiner Seite stand? Oder wird er sie für meinen Wutausbruch bestrafen? Bei dem Gedanken daran entfährt mir ein Schluchzer – ein heiseres Röcheln, das sofort im Rauschen des Windes untergeht. Was wird mit ihr geschehen? Wie viel wird sie noch für mich ertragen müssen?
Ich weine, bis meine Lunge brennt, bis die eisige Luft in meinen Augen sticht, bis ich nicht mehr unterscheiden kann, ob meine Tränen von der Angst oder von der beißenden Luft in der Höhe stammen.
Endlich wird mein Atem langsamer. Meine Fäuste lockern sich, die Muskeln in meinem Rücken entspannen sich und mein Flug wird sanfter, während ich mich den Luftströmen überlasse. Als ich mit dem Fliegen begann, wurde ich sehr schnell müde, weil ich gegen den Wind ankämpfte. Im Lauf der Zeit lernte ich, meinen Körper im Einklang mit dem Wind zu bewegen und zu beobachten, wie die Vögel die Luft zu ihren Gunsten nutzen. So gewann ich an Ausdauer. Jetzt habe ich schon die halbe Stadt überflogen und mich so weit beruhigt, dass ich die Mauern um mein Herz wieder errichten kann, und weil ich mich etwas ausruhen konnte, sind sie jetzt noch etwas höher als zuvor. Nach und nach finde ich meine Fassung wieder, bis ich sicher sein kann, meine Gefühle gebändigt zu haben.
Unten kommt hinter den Wohntürmen die Arena in Sicht. Sie ist nun nicht mehr Hinrichtungsplatz, sondern eine behelfsmäßige Versorgungsstation, in der die Arbeiter der nahe gelegenen Ausgrabungsstätte Kisten verschieben, um mehr Platz für den ausgegrabenen Schutt zu schaffen.
Ein zweiter Blick veranlasst mich, mein Tempo zu drosseln. Ich ändere meinen Kurs und fliege einen engen Kreis über der Arena, während ich mir die riesige Grube ansehe, die einst das Gefängnis von Newage war.
Die Flaschenzüge und Seile, die seit Langem in der Grube hängen, ziehen jetzt etwas Großes aus der Tiefe herauf. Die Bürgermeisterin von Cardinia steht neben den Arbeitern und späht in das Loch.
Ich runzle die Stirn und für einen Moment gewinnt die Neugier die Oberhand über meinen Kummer. Haben sie endlich etwas gefunden?
Das geheimnisvolle Objekt ist zylinderförmig und etwa so groß wie ein Strebepfeiler der Nationalhalle, aber dem Ächzen der Flaschenzüge und der schieren Anzahl der Arbeiter nach zu urteilen, die sich abmühen, es hochzuziehen, wiegt es mindestens zehnmal so viel. Obwohl es über und über mit Erde bedeckt ist, sehe ich dunkles Metall im trüben Nachmittagslicht schimmern.
Langsam und vorsichtig ziehen die Arbeiter den riesigen Gegenstand nach oben, bis er mit einem letzten kräftigen Ruck über dem Boden schwebt. Ein Team versucht, ihn zur Seite zu schieben, während die Flaschenzüge ihn auf eine bewegliche Plattform absenken.
Stirnrunzelnd betrachte ich das Ungetüm. Ich habe bisher nichts Vergleichbares in Mara gesehen, auch nicht in den Ruinen des Ersten Volkes. Während ich noch staune, bemerke ich das schwache Leuchten, das von dem Zylinder ausgeht. Vielleicht bilde ich es mir nur ein oder es ist noch eine Nachwirkung meines Fieberwahns im Labor, wo ich nie sicher sein konnte, ob das, was ich im Spiegel sah, ich selbst oder eine Halluzination war … aber irgendetwas an dem Objekt scheint warm zu sein. Als hätte es ein Eigenleben. Ein kalter Schauder überläuft mich, als ich sehe, wie die Arbeiter den Zylinder umkreisen, auf verschiedene Teile davon zeigen und die Außenfläche abwischen. Die Energiequelle, von der Konstantin behauptet, sie liege unter Mara begraben – haben sie sie tatsächlich gefunden?
Das Leuchten, das aus dem Innern zu kommen scheint, weckt in mir die Erinnerung daran, wie ich Red zum ersten Mal auf dem Schlachtfeld gesehen habe, in jener fernen Nacht, als wir der Föderation an der Kriegsfront gegenüberstanden. Red hatte sich neben mir auf den Boden gekauert und ein leises, tiefes Knurren ausgestoßen, und als ich ihn anblickte, glühten seine Augen in einem ätherischen blauen Licht. In diesem Moment wusste ich, dass er mehr als nur ein Mensch war.
Red, rufe ich ihn erneut reflexartig, bevor ich meine Aufmerksamkeit wieder auf das richte, was unter mir passiert.
Seit Maras Eroberung rufe ich ihn jeden Tag. Wenn ich zu Bett gehe, sehnt sich mein Geist immer noch nach ihm, meine Gefühle brennen vor Trauer und Verzweiflung und in der Hoffnung auf eine Antwort, die niemals kommt. Während all dieser Zeit hat er mir nie geantwortet.
Bis jetzt.
In meinem Kopf spüre ich das leise Zupfen von etwas Vertrautem.